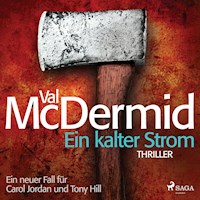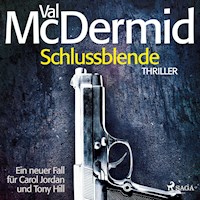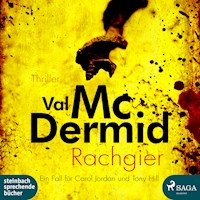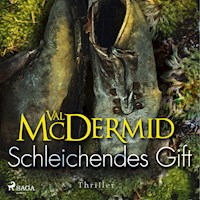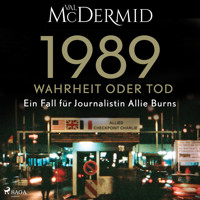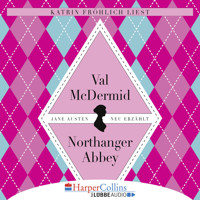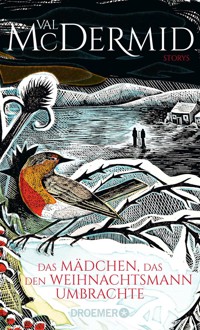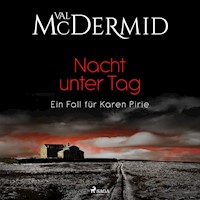
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Karen Pirie
- Sprache: Deutsch
Der zweite Cold Case für DCI Karen Pirie: ein psychologisch ausgefeilter und atmosphärisch dichter Krimi von der schottischen Bestseller-Queen Val McDermid Das Verschwinden von Mick Prentice gibt Detective Inspector Karen Pirie Rätsel auf: Micks Tochter meldet ihn nach über zwanzig Jahren vermisst – doch aus der Familie des Bergarbeiters ist nicht viel herauszukriegen. Und auch bei dem steinreichen Sir Brodie, dessen Tochter damals zur selben Zeit zusammen mit ihrem Neugeborenen entführt wurde, stößt Karen auf eine Mauer des Schweigens. Allmählich kommt ihr der Verdacht, dass dies kein Zufall ist ... Die schottische Bestseller-Autorin Val McDermid beweist auch mit »Nacht unter Tag«, dass sie »eine Meisterin ihres Fachs ist« (NDR). Wie in den anderen Bänden der Krimi-Reihe mit Karen Pirie wird ein Verbrechen in der Gegenwart mit einem Cold Case verknüpft, der weit in die Vergangenheit zurückweist. »Ein packendes und intelligentes Krimi-Drama rund um die Themen Freundschaft, Schuld und Moral.« – SPIEGEL SPEZIAL Die Krimi-Reihe mit DCI Karen Pirie ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Echo einer Winternacht - Nacht unter Tag - Der lange Atem der Vergangenheit - Der Sinn des Todes - Das Grab im Moor
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Val McDermid
Nacht unter Tag
Ein Fall für Karen Pirie
Aus dem Englischen von Doris Styron
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Das Verschwinden von Mick Prentice gibt Detective Inspector Karen Pirie Rätsel auf: Micks Tochter meldet ihn erst nach über zwanzig Jahren vermisst – doch aus der Familie des Bergarbeiters ist nicht viel herauszukriegen. Und auch bei dem steinreichen Sir Brodie, dessen Tochter damals zur selben Zeit zusammen mit ihrem Neugeborenen entführt wurde, stößt Karen auf eine Mauer des Schweigens. Allmählich kommt ihr der Verdacht, dass dies kein Zufall ist …
Inhaltsübersicht
[Widmung]
Mittwoch, 23. Januar 1985, Newton of Wemyss
Mittwoch, 27. Juni 2007, Glenrothes
Dienstag, 19. Juni 2007, Edinburgh
Mittwoch, 27. Juni 2007, Glenrothes
Donnerstag, 21. Juni 2007, Newton of Wemyss
Mittwoch, 27. Juni 2007, Glenrothes
Montag, 25. Juni 2007, Edinburgh
Mittwoch, 27. Juni 2007, Glenrothes
Donnerstag, 28. Juni 2007, Edinburgh
Montag, 18. Juni 2007, Campora, Toskana, Italien
Donnerstag, 28. Juni 2007, Edinburgh
Donnerstag, 28. Juni 2007, Newton of Wemyss
Freitag, 14. Dezember 1984, Newton of Wemyss
Donnerstag, 28. Juni 2007, Newton of Wemyss
Freitag, 14. Dezember 1984, Newton of Wemyss
Donnerstag, 28. Juni 2007, Newton of Wemyss
Samstag, 15. Dezember 1984, Newton of Wemyss
Donnerstag, 28. Juni 2007, Newton of Wemyss
Glenrothes
Rotheswell Castle
Mittwoch, 13. Dezember 1978, Rotheswell Castle
Donnerstag, 28. Juni 2007, Rotheswell Castle
Glenrothes
Kirkcaldy
Sonntag, 2. Dezember 1984, im Wald von Wemyss
Donnerstag, 28. Juni 2007, Kirkcaldy
Freitag, 29. Juni 2007, Nottingham
Freitag, 14. Dezember 1984
Freitag, 29. Juni 2007
Rotheswell Castle
Samstag, 19. Januar 1985
Dysart, Fife
Freitag, 29. Juni 2007, Rotheswell Castle
Nottingham
Donnerstag, 29. November 1984, Dysart
Freitag, 29. Juni 2007, Glenrothes
Samstag, 30. Juni 2007, East Wemyss
Newton of Wemyss
Kirkcaldy
Rotheswell Castle
Montag, 21. Januar 1985, Rotheswell Castle
Samstag, 30. Juni 2007, Newton of Wemyss
Freitag, 23. Januar 1987, Eilean Dearg
Samstag, 30. Juni 2007, Newton of Wemyss
Mittwoch, 23. Januar 1985, Rotheswell Castle
Samstag, 30. Juni 2007, Newton of Wemyss
Sonntag, 1. Juli 2007, East Wemyss
Montag, 2. Juli 2007, Glenrothes
Campora, Toskana
Peterhead, Schottland
Montag, 21. Januar 1985, Kirkcaldy
Montag, 2. Juli 2007, Peterhead
Mittwoch, 23. Januar 1985, Newton of Wemyss
Montag, 2. Juli 2007, Peterhead
Campora, Toskana
East Wemyss, Fife
Campora, Toskana
Kirkcaldy
Boscolata, Toskana
East Wemyss
Dienstag, 3. Juli 2007, Glenrothes
San Gimignano
Coaltown of Wemyss
San Gimignano
Edinburgh
Campora
Mittwoch, 4. Juli 2007, East Wemyss
Rotheswell Castle
Glenrothes
Hoxton, London
Dundee
Siena
Glenrothes
Vom Flughafen Edinburgh nach Rotheswell Castle
Donnerstag, 5. Juli 2007, Kirkcaldy
Sonntag, 14. August 1983, Newton of Wemyss
Donnerstag, 5. Juli 2007
Glenrothes
Rotheswell Castle
Kirkcaldy
Celadoria bei Greve im Chianti-Gebiet
Donnerstag, 26. April 2007, Villa Totti, Toskana
Donnerstag, 5. Juli 2007, Celadoria bei Greve im Chianti-Gebiet
Kirkcaldy
Boscolata, Toskana
Freitag, 6. Juli 2007, Kirkcaldy
A1, Firenze–Milano
Rotheswell Castle
Freitag, 13. Juli 2007, Glenrothes
Mittwoch, 18. Juli 2007
Donnerstag, 19. Juli 2007, Newton of Wemyss
Danksagung
Dieses Buch ist dem Andenken an Meg und Tom McCall gewidmet, meinen Großeltern mütterlicherseits. Sie schenkten mir Liebe, lehrten mich vieles über das Leben in einer Gemeinschaft und vergaßen nie, wie es war, vor einer Suppenküche anstehen zu müssen, um ihre Kinder ernähren zu können. Ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich mit der Liebe zum Meer, zum Wald und dem Werk von Agatha Christie aufwuchs. Keine kleine Dankesschuld.
Mittwoch, 23. Januar 1985, Newton of Wemyss
Die Stimme ist dumpf wie die Dunkelheit, die sie umfängt. »Bist du bereit?«
»So bereit, wie ich nur sein kann.«
»Du hast ihr gesagt, was sie tun soll?« Die Worte überschlagen sich, kommen hastend in einer einzigen Kette von Lauten.
»Mach dir keine Gedanken. Sie weiß genau Bescheid. Sie macht sich keine Illusionen darüber, wer die Konsequenzen tragen wird, wenn es schiefgeht.« Harte Worte in strengem Tonfall. »Ihretwegen mach ich mir keine Sorgen.«
»Was soll das heißen?«
»Nichts. Es bedeutet nichts, klar? Wir haben keine Wahl. Hier nicht. Jetzt nicht. Wir tun nur, was getan werden muss.« Die Worte klingen hohl und draufgängerisch. Man kann nur vermuten, was sich dahinter verbirgt. »Komm, bringen wir’s hinter uns.«
Und so fängt es an.
Mittwoch, 27. Juni 2007, Glenrothes
Die junge Frau schritt durch den Empfangsbereich, und das rhythmische Klacken ihrer niedrigen Absätze auf dem Kunststoffboden wurde vom Geräusch der vielen anderen vorbeieilenden Füße übertönt. Sie sah aus wie jemand, der eine wichtige Mission hat, dachte der Beamte in Zivil, als sie auf seinen Schreibtisch zukam. Aber eigentlich war das ja bei den meisten so. Die ganzen Poster an den Wänden, auf denen Hinweise zur Verbrechensverhütung und allerlei weitere Informationen standen, erreichten diese Leute nie, wenn sie in wilder Entschlossenheit auf ihn zuschritten.
Sie steuerte ihn mit fest aufeinandergepressten Lippen an. Sieht nicht schlecht aus, dachte er. Aber wie bei vielen der Frauen, die sich hier einfanden, war ihr Äußeres auch nicht gerade spitzenmäßig. Ein bisschen mehr Make-up wäre angebracht gewesen, um ihre leuchtend blauen Augen stärker zu betonen; und auch etwas Kleidsameres als Jeans und ein Kapuzenpullover. Dave Cruickshank setzte sein gewohntes professionelles Lächeln auf. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte er.
Die Frau schob den Kopf leicht zurück, als wolle sie sich verteidigen. »Ich möchte jemanden als vermisst melden.«
Dave versuchte, sich seine Müdigkeit und Gereiztheit nicht anmerken zu lassen. Wenn nicht bitterböse Nachbarn, dann waren es sogenannte Vermisste. Die Frau war für ein verschwundenes Kleinkind zu gelassen und für einen weggelaufenen Teenager zu jung. Bestimmt ging es um einen Streit mit ihrem Freund. Oder um einen senilen Opa, der ausgebrochen war. Also eine verflixte Zeitverschwendung – wie üblich. Er zog einen Block mit Formularen über den Schaltertisch zu sich heran, bis er akkurat und gerade vor ihm lag, und griff nach einem Füller. Aber er nahm dessen Kappe noch nicht ab. Es gab eine Schlüsselfrage, die beantwortet werden musste, bevor er Einzelheiten notieren würde. »Und wie lange ist diese Person schon verschwunden?«
»Zweiundzwanzig Jahre und sechs Monate. Genau genommen seit Freitag, dem vierzehnten Dezember 1984.« Sie streckte das Kinn vor, und Entrüstung verdüsterte ihre Gesichtszüge. »Ist das lang genug, um es ernst nehmen zu können?«
Detective Sergeant Phil Parhatka sah sich den Videobeitrag auf seinem Computermonitor zu Ende an, dann schloss er das Fenster. »Ich sag dir«, begann er, »wenn es überhaupt jemals eine günstige Zeit gegeben hat, um an ungelösten Fällen zu arbeiten, dann jetzt.«
Detective Inspector Karen Pirie hob den Blick kaum von der Akte, die sie gerade auf den neuesten Stand brachte. »Wieso?«
»Ist doch klar. Wir sind mitten im Krieg gegen den Terrorismus. Und ich habe mir gerade angesehen, wie mein Abgeordneter aus unserem Wahlkreis mit seiner Frau in die Downing Street 10 eingezogen ist.« Er sprang auf und ging zu dem kleinen Kühlschrank hinüber, der auf einem Aktenschrank stand. »Womit würdest du dich lieber beschäftigen? Alte ungelöste Fälle aufklären und dafür eine gute Presse bekommen oder Islamisten daran hindern, mitten in deinem Revier eine Bombe zu legen?«
»Du meinst, weil Gordon Brown jetzt Premierminister ist, wird Fife zur Zielscheibe werden?« Karen legte den Zeigefinger auf die Stelle in der Akte, wo sie stehengeblieben war, und hörte Phil nun aufmerksam zu. Es dämmerte ihr, dass sie sich zu lange mit der Vergangenheit beschäftigt hatte, um die gegenwärtigen Eventualitäten beurteilen zu können. »Als Tony Blair an der Macht war, haben sie sich doch auch nie um seinen Wahlkreis gekümmert.«
»Das stimmt allerdings.« Phil schaute in den Kühlschrank und schwankte zwischen einem Irn Bru und einem Vimto. Vierunddreißig Jahre war er alt und konnte sich immer noch nicht die Getränke abgewöhnen, die in seiner Kindheit das Größte gewesen waren. »Aber diese Typen nennen sich islamische Kämpfer, und Gordon ist ein Pfarrerssohn. Ich möchte ungern in den Schuhen des Polizeipräsidenten stecken, wenn sie sich vornehmen, ein Exempel zu statuieren, und die alte Kirche seines Vaters in die Luft sprengen.« Er entschied sich für das Vimto. Karen schüttelte sich.
»Ich verstehe nicht, wie du das Zeug trinken kannst«, sagte sie. »Hast du noch nie bemerkt, dass es praktisch ein Brechmittel ist?«
Phil nahm auf dem Weg zu seinem Schreibtisch einen großen Schluck. »Lässt Haare auf der Brust wachsen«, erwiderte er.
»Dann nimm doch gleich zwei Dosen.« Karen klang gereizt und etwas neidisch. Phil schien sich von zuckersüßen Getränken und gesättigten Fettsäuren zu ernähren, war aber trotzdem noch genauso schlank und drahtig wie damals, in ihrer gemeinsamen Zeit als Anfänger. Sie dagegen brauchte eine normale Cola nur anzusehen, um zu spüren, wie sie ein paar Zentimeter zulegte. Es war wirklich ungerecht.
Phil kniff seine dunklen Augen zusammen und verzog die Lippen zu einem spöttischen, aber gutmütigen Lächeln. »Wie auch immer. Der Silberstreif am Horizont ist, dass es dem Chef gelingen könnte, mehr Geld von der Regierung loszueisen, wenn er sie überzeugen kann, dass die Bedrohung sich verstärkt hat.«
Karen schüttelte den Kopf, jetzt hatte sie festen Boden unter den Füßen. »Meinst du etwa, dass Gordons berühmter moralischer Leitstern ihm erlauben würde, auf etwas zuzusteuern, das so sehr nach Eigennutz aussieht?«
Noch im Sprechen griff sie nach dem Telefon, das gerade zu läuten begann. Es gab in dem großen Büro des Teams für ungelöste Fälle durchaus Kollegen, die rangniedriger waren, aber Karen hielt auch nach ihrer Beförderung an ihren alten Gewohnheiten fest und ging weiterhin ran, sobald ein Telefon in ihrer Nähe klingelte. »Detective Inspector Pirie am Apparat«, meldete sie sich zerstreut, denn sie war in Gedanken noch bei dem, was Phil gesagt hatte, und fragte sich, ob er sich wohl insgeheim danach sehnte, mehr in die aufregendere praktische Polizeiarbeit eingebunden zu sein.
»Dave Cruickshank am Empfang, Inspector. Hier ist eine Frau, die, glaub ich, mit Ihnen sprechen müsste.« Cruickshank klang unsicher, was so ungewöhnlich war, dass Karen aufmerksam wurde.
»Worum geht es?«
»Eine vermisste Person«, sagte er.
»Einer von unseren Fällen?«
»Nein, sie möchte jemanden als vermisst melden.«
Karen unterdrückte einen gereizten Seufzer. Cruickshank sollte doch inzwischen wirklich Bescheid wissen. Er saß schon lange genug am Empfang. »Da muss sie mit der Kripo reden, Dave.«
»Ja, schon. Normalerweise wäre das meine erste Anlaufstelle. Aber wissen Sie, die Sache ist etwas ungewöhnlich. Und deshalb dachte ich, es wäre besser, zuerst mit Ihnen darüber zu sprechen.«
Komm zur Sache. »Wir haben es mit ungelösten Fällen zu tun. Wir leiern keine neuen Nachforschungen an.« Karen sah mit rollenden Augen zu Phil hinüber, der über ihren offensichtlichen Ärger grinste.
»Dies ist nicht gerade eine neue Sache, Inspector. Der Mann ist vor zweiundzwanzig Jahren verschwunden.«
Karen richtete sich auf ihrem Stuhl auf. »Vor zweiundzwanzig Jahren? Und man kommt jetzt endlich dazu, es zu melden?«
»Stimmt. Ist das nun ein alter ungelöster Fall oder was anderes?«
Karen wusste, dass Cruickshank die Frau genau genommen an die Kripo verweisen müsste. Aber sie hatte schon immer eine Schwäche für alles gehabt, was bei anderen nur ein belustigtes, ungläubiges Kopfschütteln hervorrief. Kühne Hypothesen brachten sie erst so richtig in Schwung. Diesem Impuls folgend, war sie in drei Jahren zweimal befördert worden, war an Kollegen im gleichen Dienstalter vorbeigezogen und hatte andere nervös gemacht. »Schicken Sie sie rauf, Dave. Ich spreche mal mit ihr.«
Sie legte auf und schob sich vom Schreibtisch zurück. »Warum man wohl mit einer Vermisstenmeldung zweiundzwanzig Jahre wartet?«, fragte sie mehr sich selbst als Phil, während sie auf ihrem Schreibtisch nach einem neuen Notizbuch und einem Stift suchte.
Phil schob die Lippen vor wie einer jener teuren Karpfen. »Vielleicht war sie im Ausland. Vielleicht ist sie gerade zurückgekommen und hat herausgefunden, dass diese Person nicht da ist, wo sie sie erwartet hatte.«
»Und vielleicht braucht sie uns, damit der Betroffene für tot erklärt werden kann. Geld, Phil. Darauf läuft es doch gewöhnlich hinaus.« Karen lächelte ironisch. Ihr Lächeln schien nachzuwirken, wie bei der Grinsekatze aus Alice im Wunderland. Geschäftig verließ sie das Büro und ging zu den Aufzügen hinüber.
Ihr geübtes Auge studierte und stufte die Frau ein, die ohne das geringste Anzeichen von Schüchternheit aus dem Aufzug stieg. Jeans und ein Kapuzenpullover von Gap, der sportlich wirken sollte. Schnitt und Farben ihres Outfits waren hochmodern. Die Lederschuhe waren sauber, ohne Kratzer und passten im Farbton zu ihrer Handtasche, die von der Schulter auf die Hüfte herabhing. Ihr mittelbraunes Haar war gut geschnitten, der lange Bob begann nur an den Rändern ein wenig herauszuwachsen. Also wohl keine Arbeitslose. Wahrscheinlich auch keine Frau aus einer Sozialsiedlung. Sondern eine nette Frau der Mittelklasse, die etwas auf dem Herzen hatte. Mitte bis Ende zwanzig, blaue Augen mit einem hellen, topasfarbenen Glanz. Kaum eine Spur Make-up. Entweder versuchte sie es gar nicht, oder sie war schon verheiratet. Die Haut um ihre Augen wirkte leicht angespannt, als sie Karens musternden Blick bemerkte.
»Ich bin Detective Inspector Pirie«, stellte diese sich vor und ließ es damit erst gar nicht zu einer Pattsituation zwischen zwei Frauen kommen, die einander abschätzten. »Karen Pirie.« Sie fragte sich, was die andere Frau wohl von ihr hielt – von einer kleinen, dicken Frau, die in einem zu engen Marks-und-Spencer-Kostüm steckte, mit mittelbraunem Haar, dem ein Besuch beim Friseur nicht geschadet hätte. Sie wäre vielleicht hübsch, wenn die Konturen ihrer Knochen unter der Fülle sichtbar wären. Wenn Karen sich gegenüber ihren Freundinnen so beschrieb, lachten die und sagten, sie sehe doch toll aus und leide nur unter mangelndem Selbstwertgefühl. Aber das glaubte sie nicht. Sie hatte eine recht gute Meinung von sich. Wenn sie jedoch in den Spiegel schaute, ließ sich das, was sie sah, nicht abstreiten. Aber schöne Augen hatte sie. Blau mit kleinen braunen Pünktchen. Ungewöhnlich.
Die Frau schien beruhigt – entweder durch das, was sie sah, oder das, was sie hörte. »Gott sei Dank«, meinte sie. Der Akzent von Fife war deutlich, obwohl er sich entweder durch Bildung oder längere Abwesenheit etwas abgeschliffen hatte.
»Wie bitte?«
Die Frau lächelte und zeigte ihre kleinen, regelmäßigen Zähne, wie das Milchgebiss eines Kindes. »Das heißt, dass Sie mich ernst nehmen. Mich nicht mit irgendeiner jungen Kollegin abspeisen, die sonst den Tee kocht.«
»Ich lasse meine jungen Kollegen ihre Zeit nicht damit verschwenden, Tee zu kochen«, erwiderte Karen trocken. »Ich war nur zufällig diejenige, die den Anruf angenommen hat.« Sie wandte sich halb zum Gehen, schaute dann zurück und sagte: »Kommen Sie bitte mit?«
Karen führte die Frau einen Seitenkorridor entlang zu einem kleinen Zimmer. Ein hohes Fenster ging auf den Parkplatz und auf den Golfplatz hinaus mit seinem gleichmäßig künstlichen Grün in der Ferne. Vier mit dem grauen Tweed der Ämter bezogene Polsterstühle standen um einen runden Tisch, dessen helles Kirschbaumholz zwar poliert war, aber nur stumpf glänzte. Der einzige Hinweis auf den Zweck dieses Raums ergab sich aus der Reihe gerahmter Fotos an der Wand, alles Bilder von Polizisten im Einsatz. Jedes Mal, wenn sie das Zimmer nutzte, fragte sich Karen, warum die oberen Etagen nur Bilder ausgewählt hatten, die in den Medien meistens dann veröffentlicht wurden, wenn etwas sehr Schlimmes passiert war.
Die Frau sah sich unsicher um, während Karen einen Stuhl herauszog und ihr ein Zeichen machte, Platz zu nehmen. »Im Fernsehen ist das anders«, sagte sie.
»Nicht vieles im Polizeibezirk von Fife ist wie im Fernsehen«, entgegnete Karen und setzte sich in einem Winkel von neunzig Grad, nicht der Frau direkt gegenüber. Eine weniger herausfordernde Position brachte bei einer Zeugenbefragung gewöhnlich mehr.
»Wo sind die Tonbandgeräte?« Die Frau ließ sich nieder, zog aber ihren Stuhl nicht näher an den Tisch heran und hielt ihre Tasche auf dem Schoß fest.
Karen lächelte. »Sie verwechseln eine Zeugenbefragung mit dem Verhör eines Verdächtigen. Sie sind ja hier, um eine Meldung zu machen, nicht um wegen eines Verbrechens befragt zu werden. Sie dürfen also auf einem bequemen Stuhl sitzen und aus dem Fenster schauen.« Sie schlug ihren Block auf. »Ich glaube, Sie wollten jemanden als vermisst melden?«
»Das stimmt. Sein Name ist …«
»Einen Moment. Ich muss ein bisschen weiter vorn anfangen. Zunächst mal, wie heißen Sie?«
»Michelle Gibson. So heiße ich, seit ich verheiratet bin. Mein Mädchenname ist Prentice. Aber alle nennen mich Misha.«
»Gut, Misha. Ich brauche auch Ihre Adresse und Telefonnummer.«
Misha ratterte alle Angaben herunter. »Das ist die Adresse meiner Mutter. Ich mache das sozusagen in ihrem Auftrag, wissen Sie?«
Karen kannte den Namen des Dorfes, aber nicht den der Straße. Es hatte sich aus einem der kleinen Weiler entwickelt, die der dortige Grundbesitzer für seine Bergleute zu einer Zeit gebaut hatte, als ihm die Arbeiter noch genauso gehörten wie die Gruben selbst. Und es wurde schließlich zu einer Schlafstadt für Fremde, die weder eine Verbindung zu dem Ort noch zu seiner Vergangenheit hatten. »Trotzdem brauche ich auch die Angaben zu Ihrer Person«, erklärte sie.
Misha runzelte leicht die Stirn, dann gab sie eine Adresse in Edinburgh an. Karen sagte die Anschrift nichts; obwohl sie nur dreißig Meilen von der Hauptstadt entfernt wohnte, waren ihre Kenntnisse der sozialen Gegebenheiten dort von provinzieller Unzulänglichkeit. »Und Sie möchten jemanden als vermisst melden«, fuhr sie fort.
Misha zog scharf die Luft ein und nickte. »Meinen Vater. Mick Prentice. Also eigentlich Michael, genau genommen.«
»Und wann ist Ihr Vater verschwunden?« Jetzt könnte es interessant werden, dachte Karen. Sollte es überhaupt jemals interessant werden.
»Wie ich dem Mann unten schon sagte, vor zweiundzwanzig Jahren und sechs Monaten. Am Freitag, dem vierzehnten Dezember 1984, haben wir ihn zum letzten Mal gesehen.« Misha Gibson zog die Augenbrauen zusammen und blickte störrisch und finster drein.
»Das ist eine ziemlich lange Zeit, um jemanden dann erst vermisst zu melden«, bemerkte Karen.
Misha seufzte und wandte den Kopf, um aus dem Fenster zu sehen. »Wir glaubten nicht, dass er verschwunden war. Nicht direkt.«
»Ich kann Ihnen nicht folgen. Was meinen Sie mit ›nicht direkt‹?«
Misha drehte sich um und hielt Karens beharrlichem Blick stand. »Hört sich so an, als seien Sie aus der Gegend hier.«
Karen fragte sich, worauf das hinauslaufen würde, und erwiderte: »Ich bin in Methil aufgewachsen.«
»Also, nichts für ungut, aber Sie sind alt genug, um sich zu erinnern, was 1984 los war.«
»Der Streik der Bergleute?«
Misha nickte. Ihr Kinn war weiterhin vorgeschoben, und sie starrte sie trotzig an. »Ich bin in Newton of Wemyss aufgewachsen. Mein Vater war Bergmann. Vor dem Streik arbeitete er unten in der Lady Charlotte. Sie werden sich erinnern, was die Leute in dieser Gegend damals sagten: Niemand sei streitbarer als die Kumpel von Lady Charlotte. Trotzdem verschwand in einer Nacht im Dezember nach neun Monaten Streik ein halbes Dutzend von ihnen. Na ja, ich sage, sie verschwanden, aber alle kannten die Wahrheit. Nämlich dass sie nach Nottingham zu den Streikbrechern gingen.« Ihr Gesicht verzog sich krampfhaft, als kämpfe sie gegen einen körperlichen Schmerz an. »Bei fünf von ihnen war niemand allzu überrascht, dass sie den Streik unterliefen. Aber meine Mum erzählt, alle seien fassungslos gewesen, dass mein Dad sich ihnen anschloss. Sie selbst auch.« Sie sah Karen flehentlich an. »Ich war zu klein, um mich erinnern zu können. Aber alle sagen, er war durch und durch Gewerkschaftsmann. Der Letzte, von dem man erwartet hätte, dass er zum Streikbrecher werden könnte.« Sie schüttelte den Kopf. »Trotzdem, was sollte sie sonst denken?«
Karen verstand nur zu gut, was ein solcher Treuebruch für Misha und ihre Mutter bedeutet haben musste. In dem radikalen Kohlegebiet Fife gab es nur Sympathie für diejenigen, die durchhielten. Mick Prentice’ Verhalten hatte seine Familie bestimmt sofort zu Parias gemacht. »Es war für Ihre Mutter bestimmt nicht leicht«, sagte sie.
»In einer Hinsicht war es total einfach«, entgegnete Misha bitter. »Was meine Mutter betraf, war’s das. Für sie war er tot. Sie wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben. Er schickte Geld, aber sie spendete es dem Unterstützungsfonds für Notfälle. Später, als der Streik vorbei war, gab sie es dem Wohlfahrtsverband für Bergarbeiter. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem der Name meines Vaters nie erwähnt wurde.«
Karen spürte einen Kloß im Hals, ein Gefühl zwischen Anteilnahme und Mitleid. »Er hat sich nie gemeldet?«
»Nur sein Geld kam. Immer in gebrauchten Scheinen. Immer mit einem Nottinghamer Poststempel.«
»Misha, ich hoffe, es klingt nicht herzlos, aber für mich hört es sich nicht so an, als sei Ihr Vater verschollen.« Karen bemühte sich, ihre Stimme so sanft wie möglich klingen zu lassen.
»Das dachte ich auch nicht. Bis ich ihn suchen ging. Glauben Sie mir, Inspector. Er ist nicht dort, wo er sein sollte. Er war nie dort. Und es ist absolut nötig, ihn ausfindig zu machen.«
Die schiere Verzweiflung in Mishas Stimme überraschte Karen. Sie erschien ihr interessanter als Mick Prentice’ Aufenthaltsort. »Wieso?«, fragte sie.
Dienstag, 19. Juni 2007, Edinburgh
Misha Gibson war nie auf die Idee gekommen, zu zählen, wie oft sie schon voller Empörung aus dem Kinderkrankenhaus getreten war, weil die Welt trotz des Geschehens in der Klinik einfach so weitermachte wie immer. Sie hatte nie daran gedacht, nachzuzählen, weil sie sich nie zu glauben erlaubte, es könnte das letzte Mal sein. Seit die Ärzte ihr den Grund für Lukes deformierte Daumen und die milchkaffeebraunen Flecken auf seinem schmalen Rücken erklärt hatten, verbiss sie sich in die Überzeugung, sie werde ihrem Sohn irgendwie helfen, dem Angriff auszuweichen, mit dem seine Gene sein Leben bedrohten. Jetzt aber sah es so aus, als werde diese Überzeugung einer vernichtenden Überprüfung unterzogen.
Misha stand einen Moment unentschlossen und ärgerlich über das sonnige Wetter da, denn sie wünschte sich einen Himmel, der so trüb war wie ihre Stimmung. Sie wollte noch nicht nach Haus. Am liebsten hätte sie geschrien und mit irgendetwas um sich geworfen, und eine leere Wohnung hätte sie nur in Versuchung gebracht, die Beherrschung völlig zu verlieren und genau das zu tun. John würde nicht da sein, um sie in den Arm zu nehmen oder zurückzuhalten. Er hatte gewusst, dass sie mit dem Arzt sprechen würde, und deshalb war natürlich bei der Arbeit eine unüberwindliche Schwierigkeit aufgetreten, die nur er lösen konnte.
Statt durch Marchmont zu ihrer Mietwohnung in dem Sandsteinbau zurückzukehren, überquerte Misha die belebte Straße zu den Meadows, der grünen Lunge der südlichen Stadtmitte, wo sie immer so gern mit Luke spazieren gegangen war. Als sie einmal mit Google Earth auf ihre Straße hinuntergeschaut hatte, hatte sie sich auch den Park angesehen. Aus dem Weltraum sah er wie ein mit Bäumen umsäumter Rugbyball aus, der von den Wegen wie mit Riemen zusammengehalten wurde. Sie hatte bei dem Gedanken, dass sie und Luke auf der Oberfläche wie krabbelnde Ameisen aussahen, gelächelt. Heute gab es kein Lächeln mehr, das Misha hätte trösten können. Heute musste sie sich der Tatsache stellen, dass sie vielleicht nie wieder mit Luke hier spazieren gehen würde.
Sie schüttelte den Kopf und versuchte, die wehleidigen Gedanken zu vertreiben. Sie brauchte einen Kaffee, um sich zu sammeln und die Dinge im richtigen Rahmen zu sehen. Sie würde einen raschen Spaziergang durch den Park und zur Georg-IV.-Brücke hinunter machen, wo heutzutage hinter jedem Fenster eine Bar, ein Café oder ein Restaurant war.
Zehn Minuten später saß Misha in einer Ecknische mit einem tröstlichen Caffè Latte vor sich. Es war noch nicht das Ende, konnte nicht das Ende sein. Sie würde nicht zulassen, dass es das Ende war. Auf irgendeine Weise musste es für Luke noch eine Chance geben.
Als sie ihn zum ersten Mal in den Armen gehalten hatte, wusste sie sofort, dass etwas nicht stimmte. Obwohl sie von Medikamenten benommen und von den Wehen noch geschwächt war, hatte sie es gewusst. John hatte es geleugnet und dem niedrigen Geburtsgewicht ihres Sohnes sowie den kleinen stumpfartigen Daumen keine Beachtung geschenkt. Aber die Angst hatte Mishas Herz mit kalter Gewissheit umklammert. Luke war anders. Die einzige Frage war für sie, wie anders er war.
Als einigermaßen glücklichen Umstand konnten sie allein die Tatsache betrachten, dass sie in Edinburgh nur zehn Minuten zu Fuß vom Royal Hospital for Sick Children entfernt wohnten, einer Einrichtung, die in der Boulevardpresse regelmäßig unter den so beliebten Geschichten über »Wunder« erschien. Es dauerte nicht lange, bis die Fachärzte des Kinderkrankenhauses das Problem erkannt, aber auch erklärt hatten, dass es für sie keine Wunder geben würde.
Fanconi-Anämie. Wenn man es schnell aussprach, klang es wie ein italienischer Tenor oder eine Stadt auf den Hügeln der Toskana. Aber hinter der reizvollen Musikalität der Worte verbarg sich eine tödliche Botschaft. In der DNA von Lukes beiden Elternteilen gab es versteckte rezessive Gene, die sich verbunden, eine seltene Erkrankung ausgelöst und ihren Sohn zu einem kurzen Leben voller Schmerzen verdammt hatten. Irgendwann im Alter zwischen drei und zwölf Jahren würde er mit größter Wahrscheinlichkeit eine aplastische Anämie entwickeln, eine Rückbildung des Knochenmarks, die sein Todesurteil bedeutete, wenn kein geeigneter Spender gefunden werden konnte. Das schonungslose Urteil lautete, dass Luke ohne eine erfolgreiche Knochenmarkstransplantation nur im glücklichsten Fall älter als zwanzig Jahre werden würde.
Diese Auskunft erfüllte sie mit einer Mission. Bald erfuhr sie, dass für Luke als Einzelkind die beste Chance einer erfolgreichen Therapie in einer Knochenmarkspende von einem anderen Familienmitglied bestand. Die Ärzte nannten das eine Mismatch-Transplantation von verwandtem Material. Zuerst hatte dies Misha verwirrt. Sie hatte von Datenbanken für Knochenmarkspender gelesen und angenommen, dass die größte Hoffnung darin liege, dort einen perfekt passenden Spender zu finden. Aber der Arzt erklärte ihnen, das Knochenmark von einem Familienmitglied, auch wenn es nicht perfekt passe, sondern nur einige mit Luke übereinstimmende Gene hätte, stelle ein niedrigeres Komplikationsrisiko dar als eine perfekt passende Spende von jemandem außerhalb der erweiterten Familie des Patienten.
Seitdem war Misha die Genzusammensetzungen auf beiden Seiten der Familie durchgegangen, hatte Überredungskunst, emotionale Erpressung und sogar das Versprechen von Belohnungen für entfernte Cousins und ältere Tanten eingesetzt. Es hatte einige Zeit in Anspruch genommen, da es eine Einzelmission war. Denn John hatte sich hinter der Mauer seines unrealistischen Optimismus verschanzt. Es würde bald einen Durchbruch in der Stammzellenforschung geben. Ein Arzt würde irgendwo eine Therapie entdecken, die nicht von der Voraussetzung übereinstimmender Gene abhing. Ein perfekt passender Spender würde irgendwo in einer Datenbank auftauchen. John sammelte gute Geschichten mit glücklichem Ausgang. Er durchforstete das Internet nach Fällen, die bewiesen, dass die Ärzte unrecht hatten. Jede Woche förderte er neue medizinische Wunder und anscheinend unerklärliche Heilmethoden zutage. Und daraus schöpfte er seine Hoffnung. Er sah keinen Sinn in Mishas ständigen Bemühungen und war sicher, dass alles schon irgendwie gut werden würde. Seine Fähigkeit, die Augen vor der Realität zu verschließen, war kolossal.
Dafür hätte sie ihn am liebsten umgebracht.
Aber stattdessen ging sie die Zweige ihrer jeweiligen Stammbäume auf der Suche nach dem perfekten Kandidaten weiter durch. Erst vor ungefähr einer Woche, wenige Tage vor dem schrecklichen Urteil, war sie in diese endgültige Sackgasse geraten. Es gab nur eine einzige Möglichkeit. Aber sie hatte gebetet, gerade diese nicht in Betracht ziehen zu müssen.
Bevor sie diesen Gedanken weiterverfolgen konnte, fiel ein Schatten auf sie. Sie blickte auf und machte sich darauf gefasst, jedem energisch entgegenzutreten, der sie stören wollte. »John«, begrüßte sie ihn müde.
»Ich dachte doch, dass ich dich hier irgendwo finden würde. Dies ist das dritte Lokal, in dem ich es probiert habe«, sagte er, schob sich auf die Bank in der Nische und rutschte unbeholfen weiter, bis er im rechten Winkel und nah genug neben ihr saß, dass sie sich berühren konnten, wenn einer von ihnen das wollte.
»Ich hätte jetzt nicht in eine leere Wohnung gehen können.«
»Das kann ich verstehen. Was haben sie gesagt?« Sein markantes Gesicht verzog sich vor Angst. Nicht wegen des ärztlichen Urteils, dachte sie, denn er hielt seinen kostbaren Sohn immer noch für unbesiegbar. Sondern es war ihre Reaktion, die John Sorge machte.
In dem Wunsch nach Kontakt als auch nach Trost ergriff sie seine Hand. »Es wird Zeit. Ohne Transplantation höchstens sechs Monate.« Sie fand sogar selbst, dass ihre Stimme kalt klang. Aber Wärme konnte sie sich nicht leisten. Wärme würde ihren starren Gemütszustand lösen, und hier war nicht der rechte Ort für den Ausbruch von Kummer oder Liebe.
John umklammerte ihre Finger fest mit seiner Hand. »Vielleicht ist es noch nicht zu spät«, widersprach er. »Vielleicht werden sie …«
»Bitte, John. Nicht jetzt.«
Seine Schultern im Jackett strafften sich, sein Körper spannte sich an, während er mit seiner abweichenden Meinung an sich hielt. »Also«, sagte er mit einem tiefen Atemzug, der mehr einem Seufzer glich. »Ich nehme an, du wirst nach dem Dreckskerl suchen?«
Mittwoch, 27. Juni 2007, Glenrothes
Karen kratzte sich mit ihrem Kuli am Kopf. Warum bekomme ich all die guten Fälle? »Warum haben Sie so lange nichts getan, um Ihren Vater zu finden?«
Sie bemerkte einen flüchtigen Ausdruck von Irritation um Mishas Mund und Augen. »Weil ich mit dem Gedanken aufgewachsen bin, dass mein Vater ein egoistischer, dreckiger Streikbrecher ist. Was er getan hat, hat meine Mutter aus ihrer eigenen Dorfgemeinschaft vertrieben. Deshalb wurde ich auf dem Spielplatz und später in der Schule angegriffen. Ich dachte, ein Mann, der seine Familie so im Stich ließ, würde sich kaum die Mühe machen, sich um seinen Enkel zu kümmern.«
»Er hat Geld geschickt«, stellte Karen fest.
»Hier und da ein paar Pfund. Blutgeld«, erwiderte Misha. »Wie gesagt, meine Mum hat es nicht angerührt. Sie hat es verschenkt. Ich hatte nie einen Nutzen davon.«
»Vielleicht hat er versucht, sich mit Ihrer Mum zu versöhnen. Eltern sprechen nicht immer mit uns über unbequeme Wahrheiten.«
Misha schüttelte den Kopf. »Sie kennen meine Mum nicht. Selbst jetzt, da Lukes Leben in Gefahr ist, ist es ihr nicht recht, dass ich versuche, meinen Dad zu finden.«
Karen dachte zwar, das sei ein ziemlich schwacher Grund dafür, einen Mann zu meiden, der vielleicht die Zukunft eines Jungen retten konnte. Aber sie wusste, welche tiefen Gefühle es in den alten Bergwerksgemeinden gab. So ließ sie es dabei bewenden. »Sie sagen, er war nicht dort, wo er sein sollte. Was ist passiert, als Sie nach ihm gesucht haben?«
Donnerstag, 21. Juni 2007, Newton of Wemyss
Jenny Prentice holte einen Beutel Kartoffeln aus dem Gemüsefach und begann sie zu schälen, den Oberkörper über die Spüle gebeugt, den Rücken ihrer Tochter zugewandt. Mishas Frage hing unbeantwortet zwischen ihnen und erinnerte sie beide an die Barriere, die die Abwesenheit des Vaters von Anfang an zwischen ihnen errichtet hatte. Misha versuchte es noch einmal. »Ich sagte …«
»Ich hab dich schon gehört. Meine Ohren sind in Ordnung«, unterbrach sie Jenny. »Und die Antwort ist, ich hab nicht die geringste Ahnung. Wie soll ich wissen, wo man nach dem egoistischen Drecksack von Streikbrecher suchen könnte? Wir sind die letzten zweiundzwanzig Jahre ohne ihn klargekommen. Es gab nie einen Grund, nach ihm zu suchen.«
»Aber jetzt gibt es einen.« Mischa starrte auf die runden Schultern ihrer Mutter. Das schwache Licht, das durch das kleine Küchenfenster hereinfiel, betonte die Silberfäden in ihrem ungefärbten Haar. Sie war kaum über fünfzig, schien aber das mittlere Alter übersprungen zu haben und direkt auf die gebeugte Haltung einer verletzlichen alten Frau zuzusteuern. Es war, als hätte sie vorausgesehen, dass dieser Angriff eines Tages kommen würde, und hätte beschlossen, ihr bedauernswertes Aussehen zu ihrer Verteidigung einzusetzen.
»Er wird uns nicht helfen«, erklärte Jenny verächtlich. »Er hat doch gezeigt, was er von uns hielt, als er wegging und uns die Suppe auslöffeln ließ. Er hat immer nur für sich selbst gesorgt.«
»Vielleicht. Aber wegen Luke müssen wir es trotzdem versuchen«, beharrte Misha. »War auf den Kuverts mit dem Geld nie ein Absender vermerkt?«
Jenny schnitt eine geschälte Kartoffel in der Mitte durch und warf sie in einen Topf mit Salzwasser. »Nein. Er machte sich nicht mal die Mühe, einen kurzen Brief in den Umschlag zu stecken. Nur ein Bündel dreckige Geldscheine, das war alles.«
»Und die Männer, mit denen er wegging?«
Jenny warf Misha kurz einen vernichtenden Blick zu. »Was mit denen war? Sie haben sich hier in der Gegend nie mehr sehen lassen.«
»Aber manche von ihnen haben doch hier oder in East Wemyss noch Familie. Brüder, Cousins. Vielleicht wissen die etwas über meinen Vater.«
Jenny schüttelte entschieden den Kopf. »Seit er gegangen ist, habe ich nie jemand von ihm sprechen hören. Kein Wort, weder gut noch böse. Die andern Männer, mit denen er ging, waren nicht seine Freunde. Der einzige Grund, mit ihnen zu fahren, war, dass er kein Geld hatte, auf eigene Faust in den Süden zu kommen. Er hat sie wahrscheinlich ausgenutzt, genau wie uns, und ist dann, kaum angekommen, einfach seinen eigenen Weg gegangen.« Sie warf noch eine Kartoffel in den Topf und erkundigte sich ohne große Begeisterung: »Willst du zum Abendessen bleiben?«
»Nein, ich hab noch zu tun«, antwortete Misha ungeduldig, weil ihre Mutter ihre Suche nicht ernst nahm. »Es muss doch jemanden geben, mit dem er Kontakt gehalten hat. Mit wem hätte er wohl gesprochen? Wem hätte er von seinen Plänen erzählt?«
Jenny richtete sich auf und stellte den Topf auf den altmodischen Gasherd. Jedes Mal wenn Misha und John zur Zeremonie des Sonntagsessens Platz nahmen, boten sie an, den angeschlagenen und abgenutzten Herd zu ersetzen. Aber wie jedes andere freundliche Angebot lehnte Jenny auch dies mit der gleichen irritierenden Opfermiene ab. »Da hast du ebenfalls kein Glück«. Sie ließ sich auf einem der zwei Stühle nieder, die in der engen Küche zu beiden Seiten des winzigen Tisches standen. »Er hatte nur einen richtigen Freund. Andy Kerr. Er war ein strammer Kommunist, der Andy. Ich sag dir, 1984 gab es nicht mehr viele, die noch die rote Fahne hochgehalten haben, aber Andy gehörte dazu. Er war schon lange vor dem Streik Gewerkschaftsfunktionär. Er und dein Vater waren schon seit der Schule beste Freunde.« Ihr Gesichtsausdruck wurde für einen Moment etwas weicher und ließ Misha fast die junge Frau erkennen, die sie einmal gewesen sein musste. »Die hatten immer was vor, die beiden.«
»Und wo kann ich diesen Andy Kerr finden?« Misha saß ihrer Mutter gegenüber und hatte ihr Vorhaben zu gehen vorübergehend aufgegeben.
Das Gesicht ihrer Mutter verzog sich zu einer bitteren Grimasse. »Der arme Kerl. Wenn du Andy findest, bist du wirklich ein guter Detektiv.« Sie beugte sich vor und tätschelte Mishas Hand. »Er gehört auch zu den Opfern deines Vaters.«
»Wie meinst du das?«
»Andy hat deinen Vater bewundert. Er hielt große Stücke auf ihn. Der arme Andy. Der Streik hat ihn furchtbar in die Klemme gebracht. Er glaubte an den Streik und an den Kampf. Aber es brach ihm das Herz, mit ansehen zu müssen, welche Not seine Männer zu ertragen hatten. Er war am Rande eines Nervenzusammenbruchs, und der leitende Funktionär hier am Ort zwang ihn, kurz bevor dein Vater sich aus dem Staub machte, sich krankzumelden. Danach hat ihn nie wieder jemand gesehen. Er hat irgendwo draußen in der Pampa gelebt, deshalb hat niemand bemerkt, dass er fort war.« Sie stieß einen langen müden Seufzer aus. »Er hat deinem Vater eine Postkarte von irgendwo oben im Norden geschickt. Aber der war natürlich schon als Streikbrecher unterwegs und hat sie nie bekommen. Als Andy später zurückkehrte, hinterließ er einen Brief für seine Schwester, in dem er schrieb, er könne es nicht mehr aushalten. Hat sich umgebracht, der arme Kerl.«
»Was hat das mit meinem Vater zu tun?«, fragte Misha.
»Ich hab immer gedacht, als dein Dad damals zum Streikbrecher wurde, das hat das Fass zum Überlaufen gebracht.« Jennys andächtiger Gesichtsausdruck grenzte an Selbstzufriedenheit. »Das hat Andy den Rest gegeben.«
»Das weißt du doch gar nicht genau.« Misha wich empört zurück.
»Ich bin nicht die Einzige hier, die das glaubt. Wenn dein Vater sich jemandem anvertraut hätte, dann wäre es Andy gewesen. Und das wäre eine zu schwere Last für seine arme zarte Seele gewesen. Er hat sich das Leben genommen und wusste, dass sein einziger wirklicher Freund alles verraten hatte, wofür er stand.« Mit dieser melodramatischen Feststellung stand Jenny auf und nahm einen Beutel Karotten aus dem Gemüsefach. Es war klar, dass sie zu dem Thema Mick Prentice alles gesagt hatte.
Mittwoch, 27. Juni 2007, Glenrothes
Karen sah verstohlen auf ihre Uhr. Welche guten Eigenschaften Misha Gibson auch haben mochte, sich kurz zu fassen gehörte nicht dazu. »Andy Kerr erwies sich also wortwörtlich als totes Ende?«
»Meine Mutter glaubt das. Aber anscheinend ist seine Leiche nie gefunden worden. Vielleicht hat er sich doch nicht umgebracht«, sagte Misha.
»Sie tauchen nicht immer wieder auf«, meinte Karen. »Manchmal holt sie das Meer. Oder die Wildnis. Es gibt noch viele unbewohnte Flächen in diesem Land.« Resignation verbreitete sich auf Mishas Gesicht. Karen hielt sie für eine Frau, die wohl fast alles glaubte, was man ihr erzählte. Wenn irgendjemand das wusste, dann war es ihre Mutter. Vielleicht waren die Dinge nicht ganz so klar, wie Jenny Prentice ihre Tochter glauben machen wollte.
»Das stimmt«, gab Misha zu. »Und meine Mutter hat gesagt, er hätte einen Brief hinterlassen. Hat die Polizei den wohl noch?«
Karen schüttelte den Kopf. »Das bezweifle ich. Wenn wir ihn überhaupt jemals hatten, ist er wahrscheinlich an seine Familie zurückgegeben worden.«
»Hätte es eine gerichtliche Untersuchung gegeben? Ob man ihn dazu vielleicht gebraucht hätte?«
»Sie meinen die Untersuchung eines tödlichen Unfalls«, stellte Karen klar. »Nicht ohne Leiche, nein. Wenn es überhaupt Unterlagen gibt, dann eine Vermisstenakte.«
»Aber er ist doch nicht vermisst. Seine Schwester hat ihn für tot erklären lassen. Ihre Eltern sind beide bei dem Fährunglück bei Zeebrügge umgekommen. Anscheinend hatte ihr Vater sich immer geweigert zu glauben, dass Andy tot sei, deshalb hatte er sein Testament nicht so geändert, dass die Schwester das Haus erhielt. Sie musste vor Gericht gehen und Andy für tot erklären lassen, damit sie das Erbe antreten konnte. Das hat jedenfalls meine Mutter erzählt.« Nicht einmal die Andeutung eines Zweifels war auf Mishas Gesicht zu sehen.
Karen machte sich eine Notiz Andy Kerrs Schwester und fügte ein kleines Sternchen hinzu. »Wenn sich also Andy umgebracht hat, sind wir wieder beim Streikbrechen als einziger vernünftiger Erklärung für das Verschwinden Ihres Vaters. Haben Sie versucht, mit den Männern Kontakt aufzunehmen, mit denen er weggegangen sein soll?«
Montag, 25. Juni 2007, Edinburgh
Es war zehn nach neun am Montagmorgen, und Misha war bereits erschöpft. Eigentlich sollte sie jetzt in der Kinderklinik sein und sich auf Luke konzentrieren. Mit ihm spielen, ihm vorlesen, die Mediziner überreden, ihre Therapie zu erweitern, die Behandlungspläne mit dem Pflegepersonal besprechen, all ihre Energie einsetzen, um sie mit ihrer eigenen Überzeugung anzustecken, dass ihr Sohn gerettet werden konnte. Und wenn er gerettet werden konnte, schuldeten ihm alle, dass man ihm jede nur mögliche therapeutische Maßnahme angedeihen ließ.
Aber stattdessen saß sie mit dem Rücken zur Wand und angezogenen Knien auf dem Boden, das Telefon auf dem Schoß und den Notizblock neben sich. Sie redete sich ein, sie sei dabei, allen Mut für den Anruf zusammenzukratzen, wusste aber irgendwo im Hinterkopf, dass der wahre Grund für ihre Untätigkeit Erschöpfung war.
Andere Familien nutzten das Wochenende, um sich zu entspannen und ihre Akkus wieder aufzuladen. Nicht so die Gibsons. Zunächst war in der Klinik weniger Personal im Dienst, und Misha und John fühlten sich verpflichtet, noch mehr Energie als sonst für Luke aufzubringen. Auch wenn sie nach Hause kamen, gab es keine Ruhe. Mishas fester Glaube, die letzte Hoffnung für ihren Sohn bestehe darin, ihren Vater zu finden, hatte den Konflikt zwischen ihrem missionarischen Eifer und Johns passivem Optimismus noch mehr angeheizt.
An diesem Wochenende war es schwieriger gewesen als sonst. Dass Lukes Leben eine Zeitgrenze gesetzt worden war, machte jeden gemeinsamen Augenblick noch kostbarer, aber auch schmerzlicher. Es war schwer, nicht in melodramatische Sentimentalität zu verfallen. Sobald sie am Samstag das Krankenhaus verlassen hatten, wiederholte Misha immer wieder den Satz, den sie vorbrachte, seit sie ihre Mutter gesehen hatte. »Ich muss nach Nottingham, John. Das weißt du doch.«
Er steckte die Hände in die Taschen seiner Regenjacke und schob den Kopf vor, als ginge er gegen einen starken Wind an. »Ruf den Typ einfach an«, erwiderte er. »Wenn er dir etwas zu sagen hat, kann er das auch am Telefon machen.«
»Vielleicht aber nicht.« Sie machte zwei schnelle Schritte, um mitzuhalten. »Die Leute sagen einem immer mehr, wenn man sie direkt vor sich hat. Er könnte mir vielleicht den Kontakt zu anderen verschaffen, die zusammen mit ihm runtergegangen sind. Vielleicht wissen die etwas.«
John schnaubte. »Und wieso kann sich deine Mutter nur an einen Namen erinnern? Wieso kann sie nicht die Verbindung zu anderen herstellen?«
»Ich hab es dir doch gesagt. Sie hat alles über die Zeit damals verdrängt. Ich musste sie wirklich bearbeiten, bis sie wenigstens mit Logan Laidlaws Namen herausrückte.«
»Und du findest es nicht erstaunlich, dass der einzige Mann, an dessen Namen sie sich erinnern kann, keine Familie in der hiesigen Gegend hat? Dass es keine klaren Anhaltspunkte gibt, um ihn aufzuspüren?«
Misha hakte sich bei ihm unter, teilweise um ihn zu bremsen. »Aber ich habe ihn doch aufgespürt, oder? Du bist zu misstrauisch.«
»Nein, das bin ich nicht. Deine Mutter begreift nicht, was im Internet alles möglich ist. Sie weiß nichts über Dinge wie Online-Wählerverzeichnisse oder Suchmaschinen wie 192.com. Sie glaubt, wenn es keinen Menschen gibt, den du fragen kannst, bist du aufgeschmissen. Sie meinte, sie hätte dir nichts gesagt, das dir nützen konnte. Sie will nicht, dass du in der Sache herumstocherst, und wird dir nicht helfen.«
»Das macht ja dann zwei, die mir nicht helfen wollen.« Misha ließ ihn los und ging vor ihm her.
John holte sie an der Ecke ihrer Straße ein. »Das ist unfair«, sagte er. »Ich will nur nicht, dass dir unnötig weh getan wird.«
»Und wenn ich zusehe, wie mein Kind stirbt, und nichts tue, um es zu retten, meinst du etwa, das würde mir nicht weh tun?« Misha spürte den Zorn heiß und rot in ihre Wangen aufsteigen, und brennende Tränen der Wut lauerten dicht unter der Oberfläche. Sie wandte sich von ihm ab und blinzelte verzweifelt, den Blick auf die hohen Sandsteinhäuser gerichtet.
»Wir werden einen Spender finden. Oder sie werden eine Therapie entwickeln. Diese ganze Stammzellenforschung kommt ja wirklich schnell voran.«
»Nicht schnell genug für Luke«, entgegnete Misha, und das vertraute Gefühl von Schwere in ihrem Magen ließ sie langsamer gehen. »John, bitte, ich muss nach Nottingham fahren. Du musst dir zwei Tage freinehmen und bei Luke für mich einspringen.«
»Du brauchst nicht zu fahren. Du kannst mit dem Typ telefonieren.«
»Es ist nicht das Gleiche. Das weißt du doch. Wenn du mit Kunden zu tun hast, machst du das auch nicht per Telefon. Nicht wenn es etwas Wichtiges ist. Du gehst hin und besuchst sie. Du willst ihnen in die Augen schauen. Ich bitte dich doch nur, dir zwei Tage freizunehmen und Zeit mit deinem Sohn zu verbringen.«
Seine Augen blitzten bedrohlich, und sie wusste, dass sie zu weit gegangen war. John schüttelte störrisch den Kopf. »Ruf ihn einfach an, Misha.«
Und das war’s. Die lange Erfahrung mit ihrem Mann hatte sie gelehrt, dass John im Recht zu sein glaubte, wenn er eine bestimmte Haltung eingenommen hatte. Wenn man weiter auf einer anderen Meinung beharrte, gab ihm das nur Gelegenheit, seine Position noch zu untermauern. Sie hatte keine neuen Argumente, die gegen seine Entscheidung ankommen konnten. Also saß sie hier auf dem Boden und formulierte Sätze in ihrem Kopf, die Logan Laidlaw dazu bringen sollten, ihr zu sagen, was mit ihrem Vater passiert war, seit er sie vor mehr als zweiundzwanzig Jahren verlassen hatte.
Ihre Mutter hatte ihr nicht viel erzählt, worauf sie ihre Strategie aufbauen konnte. Laidlaw war ein nichtsnutziger Frauenheld, ein Mann, der sich im Alter von dreißig Jahren noch wie ein Teenager benahm. Mit fünfundzwanzig war er verheiratet und bald wieder geschieden gewesen und erwarb sich den schlechten Ruf eines Mannes, dem im Umgang mit Frauen allzu schnell die Hand ausrutschte. Das Bild, das Misha von ihrem Vater hatte, war sehr lückenhaft und einseitig, aber selbst in ihrer durch die Voreingenommenheit ihrer Mutter geprägten Sicht klang Mick Prentice nicht wie jemand, der sich viel mit Logan Laidlaw hätte abgeben wollen. Andererseits aber gesellten sich in schweren Zeiten ungleiche Gefährten zueinander.
Endlich nahm Misha den Hörer und wählte die Nummer, die sie über Internetsuche und Telefonauskunft gefunden hatte. Er war wahrscheinlich arbeitslos, dachte sie beim vierten Klingeln. Oder er schlief.
Beim sechsten Klingeln wurde plötzlich abgenommen. Eine tiefe Stimme brummte ein undeutliches Hallo.
»Ist dort Logan Laidlaw?«, fragte Misha und bemühte sich, ruhig zu klingen.
»Ich hab schon ’ne Küche, und Versicherungen brauch ich auch keine.« Der Dialekt von Fife und die vertraute Wortmelodie klangen deutlich durch.
»Ich will Ihnen nichts verkaufen, Mr.Laidlaw. Ich möchte nur mit Ihnen reden.«
»Aha. Und ich bin der Premierminister.«
Sie hatte das Gefühl, er werde gleich auflegen. »Ich bin die Tochter von Mick Prentice«, platzte sie heraus und hatte damit ihre Strategie hoffnungslos vermasselt. Sogar aus der Entfernung konnte sie sein heiseres, pfeifendes Schnaufen hören. »Mick Prentice aus Newton of Wemyss«, versuchte sie es noch einmal.
»Ich weiß, woher Mick Prentice stammt. Aber ich weiß nicht, was Mick Prentice mit mir zu schaffen hat.«
»Hören Sie, mir ist klar, dass Sie sich dieser Tage nicht oft sehen, aber ich wäre Ihnen wirklich für alles dankbar, was Sie mir sagen könnten. Ich muss ihn unbedingt finden.« Mishas eigener Akzent passte sich jetzt seinem breiten Dialekt an.
Pause. Dann erwiderte er ratlos: »Warum reden Sie mit mir? Ich hab Mick Prentice nicht gesehen, seit ich 1984 aus Newton of Wemyss weggegangen bin.«
»Okay, aber selbst wenn Sie sich gleich getrennt haben, als Sie in Nottingham ankamen, müssen Sie doch eine Ahnung haben, wo er geblieben ist, wohin er gehen wollte?«
»Hören Sie mal, Schätzchen, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Was meinen Sie damit, dass wir uns gleich getrennt haben, als wir nach Nottingham kamen?« Er klang gereizt, ihre aufgeregten Fragen hatten seine nicht gerade ausgeprägte Geduld erschöpft.
Misha holte tief Luft und sagte dann ganz langsam: »Ich will nur wissen, was mit meinem Vater los war, nachdem Sie nach Nottingham kamen. Ich muss ihn finden.«
»Sind Sie noch richtig im Kopf, Mädchen? Ich hab keine Ahnung, was mit Ihrem Vater los war, nachdem ich nach Nottingham kam, und zwar deshalb: Ich war in Nottingham, und er war in Newton of Wemyss. Und auch wenn wir beide am gleichen Ort gewesen wären, wären wir nicht das gewesen, was man Freunde nennt.«
Die Worte trafen sie wie eine kalte Dusche. Stimmte irgendetwas mit Logan Laidlaws Erinnerung nicht? War er dabei, sein Gedächtnis zu verlieren? »Nein, das stimmt nicht«, widersprach sie. »Er ist mit Ihnen nach Nottingham gegangen.«
Es folgte ein schallendes Lachen, dann ein rauher Husten. »Jemand hat Sie veräppelt, Mädchen«, keuchte er. »Eher hätte Trotzki persönlich den Streik gebrochen als der Mick Prentice, den ich gekannt habe. Wieso glauben Sie denn, dass er nach Nottingham kam?«
»Das bin ja nicht nur ich. Alle glauben, dass er mit Ihnen und den anderen Männern nach Nottingham gegangen ist.«
»Das ist ja verrückt. Warum sollten das alle denken? Kennen Sie Ihre eigene Familiengeschichte nicht?«
»Was meinen Sie damit?«
»Herrgott noch mal, Mädchen, Ihr Urgroßvater. Der Großvater Ihres Vaters. Wissen Sie nichts über ihn?«
Misha hatte keine Ahnung, worauf er hinauswollte, aber zumindest hatte er nicht aufgelegt, wie sie befürchtet hatte. »Er ist gestorben, bevor ich zur Welt kam. Ich weiß überhaupt nichts über ihn, außer dass er auch Bergmann war.«
»Jackie Prentice«, begann Laidlaw vorwurfsvoll und beinahe etwas genüsslich. »Er war damals 1926 Streikbrecher. Nachdem alles vorbei war, musste man ihm eine Arbeit im Tagebau geben. Wenn dein Leben von den Männern in deiner Gruppe abhängt, willst du als Streikbrecher nicht da unten sein. Höchstens, wenn alle anderen im gleichen Boot sitzen, wie es bei uns der Fall war. Weiß Gott, warum Jackie im Dorf geblieben ist. Er musste den Bus nach Dysart nehmen, wenn er einen trinken gehen wollte. In den Dörfern von Wemyss gab es kein Lokal, in dem man ihn bedient hätte. Ihr Dad und Ihr Grandpa mussten also zweimal so hart arbeiten wie alle anderen, um unten in der Grube akzeptiert zu werden. Niemals hätte Mick Prentice diesen Respekt einfach aufgegeben. Eher hätte er gehungert. Und hätte auch in Kauf genommen, wie Sie mit ihm hungerten. Woher auch immer Sie Ihre Informationen haben, die haben keine verdammte Ahnung.«
»Meine Mutter hat es mir erzählt. Und alle in Newton sagen das auch.« Die Schockwirkung seiner Worte gab ihr das Gefühl, als bekäme sie plötzlich keine Luft mehr.
»Na, dann irren sie sich eben. Warum denken sie das bloß?«
»Weil er in der Nacht, als Sie nach Nottingham gingen, zum letzten Mal in Newton gesehen wurde oder man von ihm gehört hatte. Und weil meine Mutter manchmal per Post Geld mit dem Nottinghamer Poststempel geschickt bekommt.«
Laidlaw schnaufte schwer, was sich wie ein Schifferklavier an ihrem Ohr anhörte. »Meine Güte, das ist ja bescheuert. Mein liebes Kind, tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss. Wir sind damals in der Dezembernacht zu fünft aus Newton of Wemyss weggegangen. Aber Ihr Dad war nicht dabei.«
Mittwoch, 27. Juni 2007, Glenrothes
Karen ging auf dem Rückweg zu ihrem Schreibtisch in der Kantine vorbei und holte sich ein Sandwich mit Geflügelsalat. Von Kriminellen und Zeugen ließ sich Karen zwar selten täuschen, aber wenn es ums Essen ging, konnte sie sich selbst bereits vor dem Frühstück siebzehnmal etwas vormachen. Das Sandwich zum Beispiel. Vollkornbrot, ein Lappen welker Salat, zwei Tomatenscheiben und Gurke machten schon ein gesundes Essen. Butter und Mayonnaise spielten keine Rolle. In ihrem Kopf wurden die Kalorien durch die Vorteile aufgewogen. Sie klemmte ihr Notizbuch unter den Arm und riss im Gehen die Plastikverpackung auf.
Phil Parhatka sah auf, als sie sich auf ihren Stuhl plumpsen ließ. Nicht zum ersten Mal erinnerte sie die Art und Weise, wie er den Kopf hielt, an eine dunklere, dünnere Ausgabe von Matt Damon. Nase und Unterkiefer genauso vorspringend, die geraden Augenbrauen, der Haarschnitt wie im Film Die Bourne Identität, der Gesichtsausdruck, der in einer Sekunde von Offenheit zu Vorsicht wechseln konnte. Nur die Farbtöne waren anders. Phils polnische Herkunft war verantwortlich für sein dunkles Haar, die braunen Augen und die derbe blasse Haut. Seine eigene Note hatte er mit dem winzigen Loch im linken Ohrläppchen hinzugefügt, in dem normalerweise, wenn er nicht im Dienst war, ein Diamantstecker saß. »Wie war’s denn?«, erkundigte er sich.
»Interessanter, als ich erwartet hatte«, gab sie zu und stand noch einmal auf, um sich eine Cola light zu holen. Während sie aß, fasste sie Misha Gibsons Geschichte kurz zusammen.
»Und sie glaubt das, was dieser alte Knacker in Nottingham ihr erzählt hat?«, fragte er, lehnte sich zurück und verschränkte die Finger hinter dem Kopf.
»Ich vermute, sie ist die Art Frau, die im Allgemeinen das glaubt, was die Leute ihr sagen«, meinte Karen.
»Dann wäre sie also ’ne miserable Polizistin. Du wirst es zur Bearbeitung an die Zentralabteilung weitergeben, nehme ich an?«
Karen biss in ihr Sandwich und kaute kräftig, wobei sich an Kiefern und Schläfen ihre Muskeln wölbten und zusammenzogen wie ein Stressball in Aktion. Sie schluckte, bevor sie richtig zu Ende gekaut hatte, und spülte alles mit einem Schluck Cola light hinunter. »Weiß noch nicht«, antwortete sie. »Eigentlich ist es interessant.«
Phil warf ihr einen skeptischen Blick zu. »Karen, es ist kein ungelöster Fall. Wir sind nicht berechtigt, uns damit abzugeben.«
»Wenn ich es an die Zentralabteilung weitergebe, werden sie das einfach liegen- und verkümmern lassen. Niemand da drüben wird sich um einen Fall kümmern, dessen Spuren sich vor zwanzig Jahren verloren haben.« Sie weigerte sich, seinem kritischen Blick standzuhalten. »Das weißt du genauso gut wie ich. Und laut Misha Gibson hat ihr Kleiner nur noch diese letzte Chance.«
»Dadurch wird immer noch kein ungelöster Fall daraus.«
»Nur weil er 1984 nicht bearbeitet wurde, bedeutet dies nicht, dass er jetzt nicht als ungelöst gilt.« Karen deutete mit dem letzten Stück ihres Brotes zu den Akten auf ihrem Schreibtisch. »Und keiner von denen da läuft davon. Darren Anderson – da kann ich nichts machen, bis die Polizei auf den Kanaren sich dransetzt und herausfindet, in welcher Bar seine Exfreundin arbeitet. Ishbel Mackindoe – hier heißt es warten, bis das Labor mir mitteilt, ob sie den anonymen Briefen brauchbare DNA entnehmen können. Patsy Miller – damit kann ich nicht weitermachen, bis die Met den Garten in Haringey vollends umgegraben hat und die gerichtsmedizinische Untersuchung beendet ist.«
»Im Fall Patsy Miller gibt es Zeugen, mit denen wir noch einmal reden könnten.«
Karen zuckte mit der Schulter. Sie wusste, dass sie ihren höheren Dienstgrad gegen Phil ausspielen und ihn so zum Schweigen bringen konnte, aber der ungezwungene Umgang zwischen ihnen war ihr wichtiger. »Die laufen nicht weg. Oder du kannst einem von den Durchläufern ein praktisches Training ermöglichen.«
»Wenn du meinst, dass sie praktisches Training brauchen, solltest du ihnen diesen uralten Fall eines Vermissten zuteilen. Du bist jetzt Inspector, Karen, und solltest nicht wegen solcher Dinge herumrennen.« Er wies auf die zwei Durchläufer, die an ihren Computern saßen. »Das ist doch was für die. Hier geht es eher darum, dass du dich langweilst.« Karen versuchte ihm zu widersprechen, aber Phil redete einfach weiter. »Vor deiner Beförderung habe ich dir ja gesagt, dass du bei der Schreibtischarbeit durchdrehen würdest. Und jetzt guck dich doch mal an. Du klaust den Uniformierten in der Zentralabteilung die Fälle. Demnächst ziehst du los und führst selbst Befragungen durch.«
»Na und?« Karen zerknüllte die Sandwichverpackung mit mehr Kraft, als eigentlich nötig war, und warf sie in den Papierkorb. »Es ist gut, am Ball zu bleiben. Und ich werd dafür sorgen, dass alles regulär zugeht. Ich nehme DC Murray mit.«
»Den Minzdrops?« Phil klang ungläubig und schien beleidigt. »Du würdest lieber den Minzdrops mitnehmen als mich?« Murrays Kollegen nannten ihn »den Minzdrops«, weil sie sich von seinem Namen an die klassischen Murray-Mint-Bonbons erinnert fühlten.
Karen lächelte freundlich. »Du bist jetzt Sergeant, Phil. Ein Sergeant mit Ehrgeiz. Im Büro zu bleiben und meinen Stuhl warm zu halten wird dir helfen, deine Hoffnungen zu verwirklichen. Außerdem ist der Minzdrops nicht so schlecht, wie du vorgibst. Er tut immerhin, was man ihm sagt.«
»Das macht ein Collie auch. Aber ein Hund würde mehr Initiative zeigen.«
»Das Leben eines Kindes steht auf dem Spiel, Phil. Ich habe mehr als genug Initiative für uns beide. Es muss richtig gemacht werden, und dafür werde ich sorgen.« Sie drehte sich zu ihrem Computer um und machte damit deutlich, dass diese Unterhaltung beendet war.
Phil machte den Mund auf, um noch etwas zu sagen, aber als er Karens strengen Blick bemerkte, besann er sich eines Besseren. Sie waren einander vom Anfang ihrer beruflichen Laufbahn an zugetan, denn jeder akzeptierte die individualistischen Neigungen des anderen. Sie hatten zusammen die Karriereleiter erklommen, und ihre Freundschaft hatte die Herausforderung unterschiedlicher Dienstgrade überdauert. Aber er wusste, dass er bei Karen nur bis an gewisse Grenzen gehen durfte, und hatte das Gefühl, diese gerade erreicht zu haben. »Ich spring für dich ein«, bot er an.
»Das ist mir recht«, sagte Karen, während ihre Finger über die Tasten flogen. »Vermerk meine Abwesenheit morgen früh. Ich habe das Gefühl, dass Jenny Prentice gegenüber zwei Polizisten etwas mitteilsamer sein wird als gegenüber ihrer Tochter.«
Donnerstag, 28. Juni 2007, Edinburgh
Das Warten war eine der Lektionen, die Journalisten nicht in Kursen lernten. Als Bel Richmond noch einen Vollzeitjob bei einer Sonntagszeitung hatte, hatte sie immer behauptet, sie würde nicht für eine Vierzig-Stunden-Woche bezahlt, sondern für die fünf Minuten, die sie reden musste, um über eine Türschwelle zu gelangen, die für andere unüberwindlich blieb. Das hieß, viel Zeit mit Warten zu verbringen. Warten auf Rückrufe. Warten, bis der nächste Teil einer Geschichte herauskam. Warten, bis aus einem Kontakt eine Quelle wurde. Bel hatte viel gewartet, und obwohl sie immer erfahrener geworden war, hatte sie nie gelernt, gern zu warten.
Sie musste zugeben, dass sie schon Zeit in Umgebungen verbracht hatte, die weniger zuträglich waren. Hier hatte sie Annehmlichkeiten wie Kaffee, Kekse und Zeitungen. Und der Raum, in dem man sie warten ließ, bot die wunderbare Aussicht, die eine Million von Butterkeksdosen geziert hatte. An der Princes Street gab es eine ganze Reihe von typischen Touristenzielen, das Schloss, das Denkmal für Sir Walter Scott, die Nationalgalerie und die Princes Street Gardens. Bel bemerkte auch noch andere bedeutende architektonische Augenschmankerl, aber sie kannte die Stadt noch nicht gut genug, um genau sagen zu können, um welche es sich handelte. Sie hatte die schottische Hauptstadt nur ein paarmal besucht, und es war nicht ihre Entscheidung gewesen, dieses Treffen hier abzuhalten. Sie hatte sich London gewünscht, aber durch ihre Weigerung, sich im Voraus in die Karten schauen zu lassen, hatte sie ihre Führungsrolle eingebüßt und war zur Bittstellerin geworden.
Ganz ungewöhnlich für eine freie Journalistin, hatte sie vorübergehend einen Assistenten für Recherchen an ihrer Seite. Jonathan war Journalistikstudent an der City University und hatte seinen Tutor gebeten, ihn für sein Praktikum Bel zuzuteilen. Offenbar gefiel ihm ihr Stil gut. Sie war recht erfreut über das Kompliment, aber geradezu entzückt über die Aussicht, acht Wochen lang vom harten, langweiligen Teil der Arbeit befreit zu sein. Deshalb hatte Jonathan den ersten Kontakt mit Maclennan Grant Enterprises hergestellt. Die Nachricht, mit der er zurückkam, war eindeutig. Wenn Ms Richmond nicht bereit sei, den Grund für ihr Treffen mit Sir Broderick Maclennan Grant zu nennen, sei Sir Broderick nicht bereit, sie zu treffen. Sir Broderick gebe keine Interviews. Aber weitere Verhandlungen aus der Ferne hatten zu einem Kompromiss geführt.
Und jetzt wurde Bel, wie sie dachte, in ihre Schranken gewiesen. Sie war gezwungen, im Besprechungszimmer eines Hotels zu warten. Und man hatte ihr zu verstehen gegeben, dass jemand so Wichtiges wie die persönliche Assistentin des Vorsitzenden und Hauptaktionärs des Unternehmens, das mit seinem Wert im Land an zwölfter Stelle stand, Dringenderes zu tun hätte, als bei irgendeiner Londoner Journalistin anzutanzen.
Sie wäre gern aufgestanden und auf und ab gegangen, wollte sich aber ihre Gereiztheit nicht anmerken lassen. Auf ihre überlegene Position zu verzichten war ihr nie leichtgefallen. Stattdessen zog sie ihre Jacke zurecht, vergewisserte sich, dass ihre Bluse ordentlich im Rock steckte, und wischte ein Stäubchen von ihren smaragdgrünen Wildlederschuhen.
Endlich ging genau fünfzehn Minuten nach der vereinbarten Zeit die Tür auf. Die Frau, die mit dynamischem Schwung, in Tweed und Kaschmir gehüllt, hereinkam, sah aus wie eine Lehrerin unbestimmten Alters, die daran gewöhnt war, Disziplin von ihren Schülern zu fordern. Einen verrückten Moment lang wäre Bel aus einem pawlowschen Impuls heraus, der auf ihre eigenen Teenager-Erinnerungen an böse Nonnen zurückging, fast aufgesprungen. Aber es gelang ihr, sich zurückzuhalten und ganz gelassen aufzustehen.
»Susan Charleson«, stellte sich die Frau vor und streckte ihr die Hand hin. »Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Wie sagte doch Harold Macmillan einmal: ›Zwischenfälle, meine lieben Jungen. Zwischenfälle.‹«
Bel beschloss, sie nicht darauf aufmerksam zu machen, dass Harold Macmillan von der Tätigkeit eines Premierministers und nicht von der einer Amme eines Industriekapitäns gesprochen hatte. Sie ergriff die warmen trockenen Finger mit ihrer Hand. Ein kurzer fester Druck, dann war sie entlassen. »Annabel Richmond.«
Susan Charleson ging an dem Sessel gegenüber von Bel vorbei auf den Tisch am Fenster zu. Auf dem falschen Fuß erwischt, schnappte sich Bel ihre Tasche sowie die Ledermappe und folgte ihr. Die Frauen setzten sich einander gegenüber, und Susans Lächeln glich einem Strich kalkweißer Zahnpasta zwischen den dunkelrosa geschminkten Lippen. »Sie wollten Sir Broderick sprechen«, sagte sie. Keine Einleitung, kein Geplauder über die Aussicht. Einfach direkt zur Sache. Bel hatte diese Taktik selbst gelegentlich benutzt, aber das hieß nicht, dass es ihr gefiel, wenn der Spieß umgedreht wurde.
»Das stimmt.«
Susan schüttelte den Kopf. »Sir Broderick spricht nicht mit der Presse. Ich fürchte, Sie haben Ihre Reise umsonst gemacht. Ich habe Ihrem Assistenten das erklärt, aber er ließ sich nicht abweisen.«
Jetzt war Bel mit einem kühlen Lächeln an der Reihe. »Das hat er gut gemacht. Ich habe ihn offensichtlich richtig geschult. Aber hier scheint ein Missverständnis vorzuliegen. Ich bin nicht gekommen, weil ich um ein Interview bitten möchte. Sondern weil ich glaube, ich habe etwas, das Sir Broderick interessieren wird.« Sie hob die Mappe an und zog den Reißverschluss auf. Dann nahm sie ein einzelnes dickes Blatt im DIN-A3-Format mit der Rückseite nach oben heraus. Es war verschmutzt und verströmte den schwachen Geruch einer merkwürdigen Mischung aus Staub, Urin und Lavendel. Bel konnte nicht widerstehen und warf Susan Charleson einen schnellen, spöttischen Blick zu. »Möchten Sie es sehen?«, fragte sie und drehte das Blatt um.