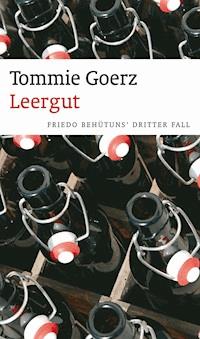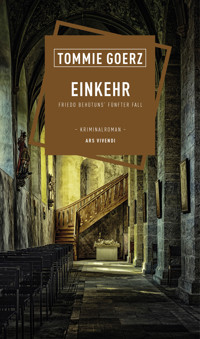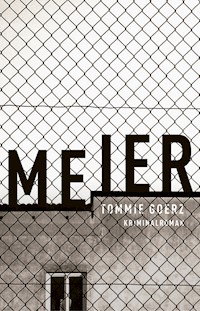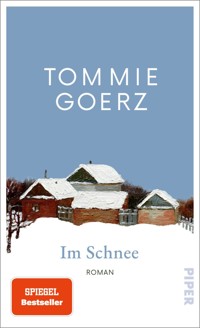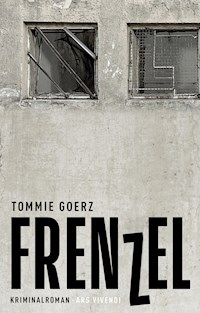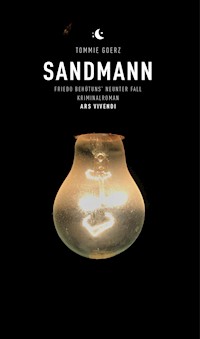Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In einer Nacht im Jahr 1982 brechen zwei junge Menschen aus Franken zu einer Reise mit unbekanntem Ziel auf – und sind seither wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt keine Spur, nicht eine einzige. Jahrzehnte gehen ins Land – da findet die Feuerwehr beim Testen eines Sonargerätes das Auto der beiden. Darin: die knöchernen Überreste der Verschollenen. Was ist in jener Nacht vor 36 Jahren passiert? Ein alter Freund der beiden und das Team um den Nürnberger Kommissar Friedo Behütuns machen sich unabhängig voneinander auf die Suche. Es kommt viel zutage, wenn man erst einmal den Schlamm aufwühlt – und vieles scheint plötzlich möglich: War es Selbstmord? Rache? Ein Unfall? Stecken Verbindungen zum Drogenmilieu dahinter, Kontakte zur RAF, eine Beziehung, Familiäres? Doch dann ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tommie Goerz
Nachtfahrt
Kriminalroman
ars vivendi
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Originalausgabe (Erste Auflage Mai 2018)
© 2018 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Lektorat: Dr. Felicitas Igel
Umschlaggestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © Jill Battaglia / Trevillion Images
Umschlagrückseite: © eelscha / photocase.de
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
ISBN 978-3-86913-910-4
Dieser Roman könnte, würde man die Örtlichkeiten sowie die Namen des einen oder anderen Protagonisten anders wählen, überall auf der Welt spielen. In Kalifornien, den schottischen Highlands, in Frankreich, Italien, dem Lake District, in Kasachstan oder sonst wo. Das Einzige, was man bräuchte, wäre ein See. In der vorliegenden Fassung spielt die Handlung in Franken. Weil es dort besonders schön ist. Ansonsten ist alles frei erfunden, nicht eine Person oder Begebenheit hat ein Pendant in der Wirklichkeit – und wenn, dann zufällig und ungewollt. Der gesamte Roman entstammt einzig und allein der Fantasie des Autors.
Inhalt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Allererster Dank
Der Autor
Als Gerardo Contreras noch tot gewesen war,
hatte es für mich keinen Grund gegeben,
mir eine Meinung über ihn zu bilden.
Tom Bouman, »Auf der Jagd«
And there ain’t no sunshine, when she’s gone,
and there ain’t no peace, when she’s at home
Dan Reeder, »Fireball«
1
Samstag, 2.9.2017
In dieser Nacht hatte der alte Medizinprofessor Burger schlecht geschlafen. Ereignisse, die schon viele, viele Jahre zurücklagen, waren urplötzlich wieder hochgekommen, hatten sich in seine Träume gedrängt und ihm den Schlaf geraubt. Dinge, von denen er geglaubt hatte, sie würden ihn bis an sein Lebensende nicht mehr einholen, waren plötzlich wieder da, einfach so. Warum? Es hatte doch überhaupt keinen Anlass gegeben. Er war aufgestanden, hatte sich im Dunkeln ein Glas Wasser geholt und durch den Vorhang hindurch zum Fenster hinausgesehen. Ein Auto war langsam die Straße heraufgekommen, tastend beinahe die Scheinwerfer, war wie suchend leise vorbeigerollt, dann war das Licht auf der anderen Seite hinter der Kurve verschwunden – und unvermittelt war es ihm, als sei alles erst gestern gewesen. Was war hier los? Er wusste es nicht – aber er war sich in diesem Moment sicher: Es war etwas geschehen. Oder es würde etwas geschehen. Langsam, beinahe lautlos, war das Auto kurz darauf wieder zurückgekommen, genauso wie damals. Diesmal aber hielt es nicht an, es fuhr weiter. Fand das denn nie ein Ende? Ohne sich zu bewegen, hatte er am Fenster gestanden und versucht, seinen Atem zu kontrollieren. Es würde etwas geschehen. Es war September, so wie damals.
•
Sonntag, 3.9.2017
Der Nürnberger Kommissar Friedemann »Friedo« Behütuns war ein anderer geworden nach dem Tod seiner Julie. Schweigsamer, einsamer, störrischer, oft auch unleidlicher, unfreundlicher, ungeduldiger. Und aufbrausender, zorniger, manchmal jähzornig, abrupt und eruptiv. Unberechenbarer. Und nicht immer gerecht, weiß Gott nicht. Das alles war ihm bewusst, aber er konnte nichts dagegen tun. Oder wollte nicht, ließ es geschehen, ließ sich gehen. Was war, war. Punkt. Und es war ihm egal. Es spielte einfach keine Rolle. Seit er seine Julie verloren hatte, waren zwar schon mehr als zwei Jahre vergangen, doch die Wunde wollte nicht richtig vernarben. Kaum war eine dünne Hautschicht darüber gewachsen, riss sie wieder auf. Manchmal genügte der Rücken einer Frau im Augenwinkel, eine ähnliche Silhouette, der Klang einer Stimme von irgendwoher, eine ähnliche Frisur oder Haarfarbe, ähnlich wippendes Haar, und die Wunde war wieder offen und blutete wie unter Marcumar. Das Leben war nicht mehr wie ein warmes Bad, in das er sich hineinlegen konnte, sich wohlfühlen, einfach so. Das Leben war zu einem Grat geworden, sehr schmal, sehr steil, und ständig lief er Gefahr auszurutschen und abzustürzen. Ins Bodenlose zu fallen.
Natürlich hatten sich die Kollegen um ihn bemüht, rührend sogar. Hatten ihn aufgefangen und unterstützt, wo immer sie konnten, aber Schwermut und Trauer sind zähe Begleiter und lassen sich nicht so einfach ausschalten. Sie stülpen sich über dich und halten dich gefangen wie klebriger Brei, durch den kein Lichtstrahl dringt. Und schafft es einmal einer hindurch, schließt sich die Masse sofort wieder über dir, und du stehst umso mehr im Dunkeln, weil du das Licht gesehen hast.
Ihm fehlten Motivation, Lust, Begeisterung. Und er war dünnhäutig geworden, war mit den Nerven oft am Anschlag. Manchmal kannte er sich selbst nicht wieder. Über Monate schien er völlig ausgetrocknet, hatte kaum eine Träne hervorgebracht nach Julies Tod, hatte nicht weinen können, wie auch schon in den dreißig, vierzig Jahren davor. Heulen war nichts für Männer – und jetzt heulte er manchmal los wie ein Schlosshund, völlig unvermittelt. An einem der vergangenen Abende erst, da hatte er in seiner Wohnung das Radio eingeschaltet. Und war sofort in Tränen ausgebrochen, beinahe ansatzlos. Hatte sich setzen müssen und Rotz und Wasser geflennt. Es hatte ihn geschüttelt, ihm die Brust eingeschnürt, war einfach so aus ihm herausgelaufen. Warum? Wegen einer Arie. Einer ARIE! Wegen einer gequetschten und unerträglich hohen Sopranstimme, Zahnarztbohrerstimme, die sich um eine Männerstimme schlang. Eine OPER! Bisher war er weggelaufen, wenn er so etwas gehört hatte. Oder hatte den Sender weitergedreht, sofort, hatte am Fernseher weitergezappt mit einem inneren Schütteln, ja beinahe mit Abscheu. Sopranstimmen hatten bei ihm schlagartig Schiefertafelkreidequietschgänsehaut erzeugt und regelrecht Ekel. Sie waren ihm widerwärtig. Die Fußnägel hatten sich ihm hochgeklappt, die Tapete hatte sich von den Wänden gerollt, die Milch im Kühlschrank war geronnen und das Bier sauer geworden. Und jetzt? Lief eine Arie, und es zog ihm die Beine weg. Bellini, Il Pirata, »Crudele! E Vuoi?« Er wusste überhaupt nicht, was das hieß, konnte kein Wort Italienisch, hatte keine Ahnung, worum es in der Oper, geschweige in dieser Arie ging und was die dort sangen. Und trotzdem schoss ihm das Wasser aus den Augen, und es sprengte ihm die Brust. Solch heftigen Schmerz kannte er nur aus seiner Kindheit. Vom Heimweh, dass einem die Luft wegblieb und Schluchzer einen beutelten.
Oder lag es am Italienischen? Aber warum? Er hatte dazu überhaupt keinen Bezug, keine Erinnerung, nichts. Aber ganz genauso erging es ihm, als sie eines Abends Gianmaria Testas Nuovo spielten. Schleusen auf – und Rotz und Wasser, marsch!
Nein, am Italienischen konnte es nicht liegen, er verstand davon ja kein Wort. Außerdem: Angefangen hatte es mit Süßes Leben von Udo Lindenberg. Da hatte es ihn zum ersten Mal zerlegt. »Warum kommt keiner mehr«, sang da der alte Rocker mit der weichen Stimme, »ich bin ja noch nicht tot. Die Abenddämmerung, der Himmel ist so rot. Die Stunden sind so kostbar, jede Sekunde ein Gewinn. Wenn du mich jetzt berührst, bin ich doch für dich schön. Süßes Leben, es war so gut …« Wenn du mich jetzt berührst … Behütuns schrie vor Schmerz. Und trank während der fünf Minuten dieses Liedes fast eine ganze Flasche Wein.
Anders erging es ihm, als sie eines Abends Dan Reeders Fireball spielten. Da trieben ihm die Harmonien zuerst ansatzlos die Tränen in die Augen, dass er sich am Tisch festhalten musste – und vermischten sich dann unversehens mit einem verzweifelten inneren Lachen, als der Refrain kam: »And there ain’t no sunshine, when she’s gone – and there ain’t no peace, when she’s at home.« Ja, Lachen und Weinen, tiefster Schmerz und ununterdrückbares Lachen zugleich, selbst wenn es das Lachen der Verzweiflung ist: das geht. Nach den nur zwei Minuten dieses kurzen Songs ging es ihm schlecht und gut zugleich, und er hätte den Nürnberger Dan Reeder auf der Stelle umarmen können. Er kannte ihn ja aus der Hersbrucker Bücherwerkstätte.
Behütuns atmete durch und holte sich zurück in die Welt und an seinen Schreibtisch. Das Telefon klingelte.
Einmal.
Zweimal.
Dreimal.
Friedemann Behütuns, Leiter des Sonderbüros Metropolregion, sah aufs Display. Rasts Nummer. Sein Chef.
Er schaute wieder zum Fenster hinaus, nahm nicht ab.
Das Telefon verstummte.
Minuten später klingelte es wieder.
Sein Chef.
Der Kommissar grunzte unwillig, nahm wieder nicht ab.
Das Telefon verstummte wie vorher.
Eine Fliege landete auf Behütuns’ Hand, krabbelte ein paar Zentimeter, putzte sich mit den Vorderbeinen über Augen und Kopf, noch mal, dann mit den Hinterbeinen über die Flügel, krabbelte wieder ein paar Schritte und flog davon. Prallte gegen die Fensterscheibe. Tock. Und noch mal. Tock. Und noch mal, mit Anlauf. Die Fliege war dumm. Von der Straße unten hörte man Autohupen, vom Gehsteig vor dem Präsidium Stimmen. Irgendjemand schimpfte dort mit vielen Üs, höchstwahrscheinlich ein Türke. Vor seinem geistigen Auge tauchte Rumpelstilz Erdogan auf, der mit heiserer Stimme … Behütuns ging das nichts an, er dachte über einen Fall nach.
Zumindest tat er so. Saß vor einem geöffneten Aktenordner und starrte vor sich hin. Dachte an Julie. Seine Julie. Die jetzt schon seit über zwei Jahren in der Bretagne unter der Erde … und dennoch war es manchmal so, als käme sie gleich zur Tür herein. Zweieinhalb Jahre, das waren locker achthundert Tage. Tage, an deren ersten zweihundertfünfzig er manchmal nicht gewusst hatte, wie er die nächsten fünf Minuten überstehen sollte. Und jetzt immer diese Heulanfälle. Ob das irgendwann einmal aufhörte?
Das Telefon klingelte erneut.
Schon wieder sein Chef.
Behütuns nahm nicht ab.
Die Fliege summte, blieb dumm und dotzte weiter gegen das Fensterglas, immer und immer wieder. Der Kommissar öffnete das Fenster und ließ sie hinaus. Als er sich umdrehte, stand sein Chef in der Tür und sah ihn fragend an. Trat ein, nahm Platz und legte eine Mappe auf den Tisch.
»Ich möchte, dass Sie sich das ansehen.«
Behütuns warf einen Blick auf die Mappe, fasste sie nicht an. »Älteres Semester, oder?«
Der Chef nickte. »Anfang 1980er-Jahre.«
Es war eine jener Mappen, die aus einem gefalteten, biegsamen Karton bestanden und an den Ecken von einem Gummi zusammengehalten wurden.
»Ein Vermisstenfall?« Das entnahm Behütuns der Beschriftung des Deckels, fast wie gemalt mit einer sauberen Handschrift, wie man sie heute nirgends mehr fand. Er nahm die Mappe nicht in die Hand.
»Von 1982.«
Der Kommissar legte den Kopf leicht schief und sah seinen Chef an. »1982?«
Der nickte.
»Was geht uns das an?« Er wusste, dass die Personenfahndung bei Vermisstenfällen nach 30 Jahren abgebrochen und die Vorgänge zu den Akten gelegt werden. Zu den Aktenvernichtern. »Der Fall ist über 35 Jahre her.«
Der Chef schüttelte den Kopf. »Die Fälle.«
»Wie, dieFälle?«
»Die Fälle. Es sind zwei.«
»Zwei Fälle?«
Er nickte. »Zwei Personen, also zwei Fälle.«
»Und?«
»Ich möchte, dass Sie sich darum kümmern.«
Behütuns machte eine abwehrende Geste und schüttelte den Kopf. »Keine Zeit. Mein Schreibtisch ist übervoll, und das wissen Sie.«
Der Chef wiederholte nur seinen letzten Satz, und Behütuns wusste, dass er keine Chance hatte. Ober sticht Unter, beim Schafkopf wie im richtigen Leben. »Ich möchte, dass Sie sich das ansehen.«
»Was soll das bringen, nach über 35 Jahren?«
»Die Personen sind aufgetaucht.«
»Wie …?«
»Wie ich gesagt habe: Die vermissten Personen sind wieder aufgetaucht. Im wahrsten Sinn des Wortes.«
»Lebendig?«
»Tot.«
»Wann?«
»Gestern Vormittag.«
»Wo?«
»Bei Erlangen. Steht alles in der Mappe.«
»Muss ich da jetzt hin?«
»Nein, das haben die Kollegen schon gemacht.«
»Können die dann nicht weiter…?«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Sie kümmern sich darum?« Sein Chef stand auf und ging zur Tür, nickte noch einmal fragend. Behütuns antwortete schnaufend mit einer hilflosen Geste. Dann war er wieder allein. Die Mappe lag auf dem Tisch, und er schaute zum Fenster hinaus. Das Ü-Geschrei unten war verstummt.
Auf dem Fenstersims landete eine dicke Stadttaube. Instinktiv griff sich der Kommissar ein zusammengeknülltes Blatt aus dem Papierkorb und warf es gegen die Scheibe. Flügelklatschend und mit einem empörten »Gurrr« schreckte der Vogel auf und flüchtete. Er würde wiederkommen, das war dem Kommissar klar, nicht sofort, aber irgendwann später. Tauben sind nicht dumm, aber penetrant.
»Aufgetaucht«, grunzte Behütuns, »und das auf meinem Schreibtisch. Und warum?«
Er sah sich im Büro um. Keiner da. Wie auch, es war Sonntag. Kein Dick, kein P. A., keine Frau Klaus. Er, ganz allein. Weil er es daheim nicht ausgehalten hatte.
»Nur weil ich Depp reingekommen bin.«
Warum eigentlich war der Chef am Sonntag da? Hatte der Ärger zu Hause oder war ihm das Wasser abgestellt worden oder der Strom? Der hat wohl nichts Besseres zu tun, dachte er sich. Die Taube landete wieder auf dem Fensterbrett. Behütuns schlug mit der flachen Hand gegen die Scheibe. Einen Moment schien es, als falle der dicke Vogel vor Schreck hinunter, dann gurrte das Vieh vorwurfsvoll und klatschte sich mit den Flügeln empört davon.
»Warum bin ich nicht gleich in die Fränkische gefahren?!«, murmelte er vor sich hin. Er verließ den Raum, ohne die Mappe auch nur angefasst zu haben. Das hatte Zeit bis Montag. Eine Akte von vor über 35 Jahren? Was konnte daran so wichtig sein?
Behütuns schlug die Tür hinter sich zu. Aufgetaucht? Er tauchte jetzt erst einmal ab. 13 Uhr, noch Zeit genug für eine Fahrt hinaus in die Fränkische Schweiz. Das Beste, das man an einem Sonntagnachmittag tun konnte.
Dabei waren die Tage voll böser Zeichen.
Christoph Ransmayr, »Cox oder der Lauf der Zeit«
2
Sonntag, 3.9.2017
Einen Teufel würde er tun, sich am Sonntagmittag in einen 35 Jahre alten Vermisstenfall einzuarbeiten. Nur weil sein Chef es sonntags daheim nicht aushielt. Warum kümmerten sich die Erlanger Kollegen eigentlich nicht darum? Egal, er würde es morgen erfahren. Die Sache hatte jetzt 35 Jahre lang Zeit gehabt, da käme es auf den einen Tag auch nicht mehr an. Kommissar Behütuns stieg hinunter in die Tiefgarage, startete seinen Wagen und fuhr hinaus. Ließ sich treiben. Fuhr aus der Stadt und einfach so herum, wohin es ihn gerade verschlug. Er brauchte das jetzt, so wie Hunderte andere anscheinend auch. Stoßstange an Stoßstange wälzte sich die Kolonne durchs Wiesenttal, irgendwo Kaffee und Kuchen entgegen. Oder bewegte sich, bereits schäuferlabeladen, verdauungsbedingt entsprechend träge. Motorradfahrer heulten in Horden vorbei, forderten das Schicksal heraus und schienen ihren Spaß dabei zu haben. Andere mussten sie ja dann von der Straße kratzen, nicht sie selbst. Die Sauerei mutete man immer den anderen zu.
Behütuns wich auf die kleineren, weniger befahrenen Straßen aus, bog ab in unbekannteres Terrain. Hielt nach einem Wirtshaus Ausschau. In die Fränkische fahren, ohne irgendwo ein Bier zu sich zu nehmen, war unvorstellbar. Und ohne irgendwo etwas zu essen, erst recht, ganz egal, ob man Hunger hatte, und ganz egal, wie es einem ging. In Engelhardsberg sah er schließlich ein paar Tische an der Straße stehen. Kein Wirtshaus, eher so etwas wie ein Kiosk. Aber: Dort saß noch niemand. Hier würde er seine Ruhe haben. Der Kommissar parkte seinen Wagen und nahm an einem der Tische Platz. Das Innere des Kiosks war mit ausgestopften Vögeln dekoriert, in einem Käfig krächzte ein Papagei. Der Kioskbetreiber saß vor einer Flasche Bier und kümmerte sich um nichts. Wahrscheinlich saß er schon seit seinem Frühschoppen und trank sich den Tag schön. Er musste dabei schon weiter fortgeschritten sein, denn er wirkte kaum unzufrieden. Lediglich ein schmales Nicken zur Begrüßung, kein Laut sonst, keine Frage, ob Behütuns etwas wolle und was. Man hatte viel Zeit und wenig Lust, sich diese mit Arbeit zu versauen. Der Papagei turnte mit Krallen und Schnabel rastlos an den Gitterstäben in seinem Käfig umher. Eine Frau schaute ums Eck, nickte Behütuns zu.
»Bier?«
»Ein Dunkles.«
Sie brachte es, stellte die Flasche samt Krug auf den Tisch und machte sie auf.
»So. Aufmachn derfis, ohber eischengn derfis ned.«
Behütuns sah sie fragend an. »Ach so?«
»Ja wissen S’, walli ka Schankerlaubnis hob.« Sie blieb noch einen Moment unschlüssig stehen, fragte, ob das dann alles sei, und trollte sich: »Wenn niggs mehr is, geh i eds nauf und ziehch mei dreggerde Woar aus.« Manchmal gestatten ganz einfache Sätze tiefe Einblicke in das Leben anderer Menschen.
Eine Zeit lang war es so, wie er es sich wünschte: ganz einfach ruhig. Niemand da, der quasselte. Niemand, der ihn mit einem 35 Jahre alten Fall belästigte. Kaum zehn Minuten später aber war es mit der Ruhe vorbei, ein Trupp Wanderer fiel ein und besetzte zwei Tische. Einer der Männer, der sich als besonders lebenslustig und humorbegabt hervortat, schaute sich im Kiosk um, besah sich die vielen ausgestopften Vögel und machte dazu überflüssige Piepgeräusche. Schließlich trat er an den Papageienkäfig, musterte den bunten Vogel und presste ihm dann mit gequetschter Stimme ein »Hallo« entgegen.
Der Papagei turnte unbeeindruckt weiter durch seine Gestängewelt.
»Ha–llo!«
Und noch einmal. Seine Mitwanderer und -wanderinnen lachten schon ob des gelungenen Spaßes. Der Papagei aber reagierte nur hektisch und flatterte in seinem Käfig umher.
»Ha–llo!«
»Ha–ll–lo!«
Der Wirt sah sich das von seinem Tisch aus eine Weile an und trank sein Bier. Irgendwann aber wurde es ihm wohl zu bunt, denn er sagte wie zu sich selbst, aber wohltemperiert so, dass es alle hören mussten: »Doh song di Leud immer ›Hallo‹ zu den Viehch und hörn ned auf. Is doch ka Wunder, dass der doh verrüggd werd.«
Ab da hörte man kein »Hallo« mehr, lästig lustig aber blieb die Truppe trotzdem. Behütuns zahlte und fuhr weiter. Sah bei der Kuchenmühle vorbei, aber hier war es ihm zu voll. Also wendete er und drehte weiter seine Schleifen übers Land und durch die Täler. In Muggendorf am Bahnhof der Museumsbahn schließlich stellte er gegen fünf seinen Wagen ab. Er hatte Hunger. Auf seinem Fußweg hinüber ins Dorf musste er nicht lange suchen, um ein Wirtshaus zu finden, das ihm behagte: die Sonne mit ausgeblichenen, alten Sonnenschirmen, von denen nicht ein einziger ausgeklappt war. Kein Mensch auf der Terrasse. Er stieg die Handvoll Stufen zur Eingangstür empor und trat ein. Das Wirtshaus – vorne ein Vorraum mit drei Tischen, Tresen und Eingang zur Küche, dahinter die große Stube – ebenfalls komplett leer, kein einziger Gast, aber so, wie es Behütuns unmittelbar ansprach: alter Rauch- und ein wenig Muffelgeruch, in die Jahre gekommene Farben, dunkles Holz, zerschlissene Kissen, spärlich verteilt auf die Holzstühle, vertrocknete Blumen auf Fenstersimsen und vereinzelt auf den massiven Ahorntischen sowie vergilbte Vorhänge. Es war alles in bester Ordnung.
Nachdem er erst hinten in den großen Gastraum gesehen hatte, steuerte er auf einen der beiden Tische im Vorraum zu und wollte sich setzen, doch insistierte umgehend der Wirt: »Wollnsersi ned nach hindn seddsn?«, deutete er hinüber in die große Stube.
»Nein, ich tät’ schon lieber hier vorn sitzen«, entschied Behütuns und zeigte auf einen der Tische im Vorraum. »Oder ist das der Stammtisch?« Er konnte aber nirgendwo ein entsprechendes Schild entdecken.
»Nah.«
Also sprach doch erst einmal nichts dagegen, dass er dort Platz nahm. Doch da insistierte der Wirt erneut: »Nah, villeichd ned grohd an den Disch, sondern ehrer an denn.«
Behütuns sah den Wirt fragend an.
»Wall, wissen S’, da kommt nocherd ahner, der hoggd immer doh.«
»Der kann sich ja dann zu mir setzen«, schlug Behütuns vor.
Der Wirt lachte. »Nah-nah, des machd der ned. Wissen S’, des is so ahner, der kummd immer bloß auf a Seidla, alle Ohmd.« Damit war das Thema umfassend geklärt. Behütuns bestellte Bratwürste und bekam sein Bier, trank und schwieg. Auch der Wirt sagte nichts. Aus der Küche drangen Brutzelgeräusche. Als er sein Bier halb getrunken hatte, öffnete sich die Tür, und vier Touristen kamen herein. Grüßten und setzten sich sofort an den Ecktisch, den Tabutisch. Der Wirt zuckte in Richtung Behütuns nur hilflos mit den Schultern und nahm die Bestellung auf.
Als Behütuns’ Bratwürste kamen, fragte einer der vier Neuen, warum so wenig los sei. Sonntagabend müsse doch eigentlich mehr Betrieb sein.
»Des is so, die Leid kummer nemmer, und die Junger sowieso ned.«
Und warum nicht?
»Des is der Schdrugdurwandl, des is überall so, doh kammer niggs machn.«
Behütuns aß und achtete nicht weiter auf die Gespräche. Er dachte an die Mappe auf seinem Schreibtisch und fragte sich, was es wohl auf sich hatte mit den Vermissten. 35 Jahre fort, und jetzt »aufgetaucht«? Inzwischen verspürte er doch ein wenig Neugier. Die Türe öffnete sich, nur einen schmalen Spalt breit, ein scheues Gesicht sah kurz herein und zog sich sofort wieder zurück, schloss die Türe von außen.
»Sehng S’?«, nickte der Wirt ihm zu. »Ihch habs ja gsachd.« Das war wohl der scheue tägliche Stammgast gewesen. Behütuns schnitt seine dritte Bratwurst an, Fett lief heraus und vermischte sich mit dem Sauerkraut, und lauschte dem Gespräch der anderen mit dem Wirt. Inzwischen waren sie bei den Immobilien angelangt und was die Häuser hier draußen wohl kosteten. Ja, Häuser könne man kaufen hier draußen, informierte der Wirt, von 60.000 bis 600.000 Euro sei alles dabei. Aber hier wolle ja keiner mehr her. »Irngdwann brenner die alle amoll.«
»Warum sollten die Häuser brennen? Wie meinen Sie das?«
»Na ja, ihch mahn bloß. Haaß saniern, wie mer so sachd.« Er lachte. »Des wor doch scho immer so. Erschd guhd versichern, undann wech. Und wassd: Des Feier fängd doch nie am Dach zum brenner oh, des kummd doch immer ausm Keller, su is des scho immer gwehn.«
Wirklich? Die vier vom Nebentisch sahen sich belustigt an. Das wollten sie nun doch nicht glauben.
»Ihr seid doch über die Riesenburch gloffm heid, oder? Dann seider ah in der Kuchnmühl drühm gwesn.«
Ja, waren sie.
»Doh is des ah so gwehsn. Di Kinner worn ned derhamm, di Frah ah ned, undi Aldn worn es erschde Moll ühberhaubds fodd. Des wor scho a Zufall. Und dann, wie’s der Deufl gwolld had, hodds im Keller es brenner ohgfangd.«
Sie lauschten der Geschichte des Wirtes.
»Der Schnee wor so hoch glehng«, zeigte der Wirt auf Bauchhöhe, »doh had die Feierwehr, die hamm ja ah erschd nu vo Ebermannschdadd nieberfohrn müssen, zerschd nu die Keddn ohleng müssen, die senn ja anderschd gorned durchkummer.«
Die vier lauschten gebannt. Auch Behütuns hörte neugierig zu, wiewohl auch innerlich schmunzelnd.
»Und, konnsder dengn, bis die dann endli dohgwesn senn, hodd des Feier vill Dseid ghabbd. Doh hamms in der Kuchnmühl drühm nemmer vill löschn müssn.«
Ob das denn stimme und wann das gewesen sei?
»No frahli schdimmd des, wos glabdn ihr? In die Aachdsgerjoahr is des gwehsn. Danohch hadders dann verkaffd, die Mühl, sei Geld hodder ja ghabd. Die wor ned schlechd versicherd.«
In den Achtzigerjahren, dachte Behütuns. Dahin muss ich morgen auch zurück mit der Mappe auf meinem Schreibtisch.
Er bezahlte, ging. Im Uferbereich der Wiesent besangen die Amseln den Abend, der sich anschickte, sich über das Land zu legen. Über den Baumspitzen drüben hing wie ein Fingernagel schräg die dünne Sichel des Mondes.
Behütuns fuhr durch den dämmernden Abend zurück in die Stadt. Seine Stimmung hatte sich ein wenig gebessert.
Für einen Augenblick schien die Zeit den Atem anzuhalten.
Dann wurde es heftig.
Franzobel, »Das Floß der Medusa«
3
Montag, 4.9.2017
»Moin, Klaus.« Behütuns ließ die Bürotür ins Schloss fallen und setzte sich an seinen Schreibtisch. Und sah die Mappe liegen. Hatte er nicht gestern einen Moment lang Lust auf diesen Fall verspürt? Sie war schon wieder verflogen. Frau Klaus, immer der Erste im Büro, richtete gerade Blumen. Die Septembersonne schien zum Fenster herein und kündete von einem herrlichen Tag. Noch hatte der Himmel aber diese spezielle Frische eines Spätsommermorgens, die einfach Lust machte aufs Leben.
»Ist jemand gestorben?«
»Friedo!«, wies ihn Klaus zurecht.
»Na gut, dann – hat jemand Geburtstag?«
»Nein«, erwiderte Frau Klaus leicht schnippisch, »die sind für uns.«
»Wie ›für uns‹?« Was sollten sie hier mit Blumen?
Frau Klaus arrangierte weiter unbeirrt den Strauß. Nahm eine nach der anderen vom Papier auf, besah sie sich, hielt sie prüfend in die eine und in die andere Richtung, schnitt schließlich einmal ein längeres, ein andermal ein kürzeres Stück des Stiels ab oder ein Blatt, hielt sie erneut prüfend zu den anderen und steckte sie dann in einem ganz bestimmten Winkel in die Vase. Zupfte noch ein wenig daran herum oder drehte sie, und wenn sie zufrieden war, kam die nächste dran. Behütuns verstand das alles nicht. So etwas machen nur Frauen, dachte er sich.
»Kein Geburtstag?« Er schüttelte den Kopf. »Namenstag vielleicht?« Irgendetwas musste doch sein.
Klaus lächelte ihn an. »Nein, nichts, einfach nur schön. Und nur für uns.«
»Nur für uns – für uns zwei?« Behütuns nahm die Vorlage auf und wollte Klaus damit necken.
Der aber nickte. »Nur für uns zwei, denn sonst kommt ja heute keiner. Deshalb.«
Der Kommissar stutzte. »Es kommt keiner? Wieso?«
Klaus sah ihn an. »Na, Dick hat Urlaub, und Peter Abend ist auf seinem Lehrgang.«
»Lehrgang? Was für ein Lehrgang?«
»Zeitmanagement, weißt du das nicht mehr?«
»Zeitmanagement, was soll das denn sein?«
»Schätze, da lernt man, mit seiner Zeit umzugehen.«
»Mit seiner Zeit umzugehen? Der soll seine Sachen machen, dann braucht er kein Zeitmanagement.« Neumodischer Scheiß, dachte er sich. »Und wie lange dauert das?«
»Drei Tage, wenn ich recht informiert bin.«
»Drei Tage? Wenn er die arbeiten täte, bräuchte er hinterher kein Zeitmanagement.«
Klaus richtete weiter die Blumen. Griff mit beiden Händen unter den Strauß, lupfte ihn leicht an, lockerte ihn, ließ ihn wieder auseinanderfallen, trat einen Schritt zurück, legte den Kopf schief und kniff die Augen zusammen. Prüfte das Werk. Zupfte erneut an ihm herum. Behütuns sah ihm fasziniert zu. Was man mit Blumen alles machen konnte.
»Drei Tage.« Es ließ ihm keine Ruhe. »Und dann hat er Stress, wenn er zurückkommt, weil ihm die drei Tage fehlen. Was für ein Unsinn!«
»Aber ab da kann er wahrscheinlich besser mit seiner Zeit umgehen. Also sie sich einteilen und so.«
»Womit wir wieder beim Anfang sind«, konstatierte Behütuns. »Würde er seine Arbeit gleich machen, hätte er kein Zeitproblem, und die Arbeit wäre getan.« Natürlich war ihm klar, dass er gerade haltlosen Quatsch von sich gab, denn irgendeinen Sinn würde das Seminar schon haben, sonst hätte es die Behörde erst gar nicht in das Schulungsangebot mit aufgenommen, aber ein wenig Gemotze musste sein. Bälfern reinigt die Seele und hebt die Laune. Und die drohte gerade umzuschlagen. Weil die Mappe dort lag und er sich selber drum kümmern musste – und den Job nicht delegieren konnte, wie er insgeheim gehofft hatte. Liegen lassen konnte er ihn nicht die drei Tage, bis P. A. von seinem Lehrgang zurück wäre, das wusste er. So wie der Alte den Ordner hier abgelegt hatte. Ein 35 Jahre alter Vermisstenfall, der schon über fünf Jahre abgelaufen war. Nur weil die im Archiv ihre Arbeit nicht taten. Würden die etwas gewissenhafter arbeiten, wäre der Fall längst im Schredder gelandet, wie es die Vorschriften vorsahen. Jetzt aber lag das Ding bei ihm auf dem Tisch, und alles war im Urlaub oder auf Fortbildung. Was hieß: Keiner arbeitete hier etwas – die im Archiv nicht, und die Kollegen auch nicht. Ein Saustall war das vielleicht! Nur er musste natürlich ran, wie immer. Dabei war er hier der Chef, oder täuschte er sich? Nein. Schade, dass die gute alte Haut Jaczek nicht mehr im Team war. Dem hätte er die Mappe aufs Auge drücken können. Der hätte sich zwar geärgert, aber er hätte sich dann der Angelegenheit unnachgiebig angenommen. Jaczek wäre jetzt, also um diese Uhrzeit, zwar noch nicht im Büro, weil er immer zu spät kam, der konnte nicht pünktlich sein, aber dann hätte er sich reingebissen mit seiner Pedanterie. War ja auch für was gut. Behütuns brach seinen Gedankenschwall ab.
»Und Dick hat Urlaub, hast du gesagt?«
»Yep.«
»Wie lange?«
»Heute den ersten Tag – und bis einschließlich nächsten Montag.«
Behütuns fiel aus allen Wolken. »Die ganze Woche!? Wer hat denn das genehmigt?«
Klaus stellte die Blumen Behütuns gegenüber auf den leeren Schreibtisch von Peter Abend. »Schau, das sieht doch schön aus, oder? Ein bisschen was für die Seele.«
»Wer das genehmigt hat, habe ich gefragt.« Behütuns ignorierte die Blumen.
»Du selbst. Du hast den Dienstplan gemacht und sowohl Urlaub wie auch den Lehrgang genehmigt. Da ist überall deine Unterschrift drunter.«
Behütuns grummelte. »Ja, Scheiße. Weil ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, und ihr das einfach ausnutzt.«
Klaus stemmte die Arme in die Seiten und sah Behütuns scharf an. »Nein. Weil Ferien sind, seine Frau keinen Urlaub kriegt und die Krippen zu sind, deshalb muss Dick Urlaub nehmen. Und P. A. musste den Lehrgang schon zweimal verschieben, weil immer zu viel zu tun war. So. Und jetzt kommst du!«
»Ist ja recht. Ist schon ein Kaffee fertig?« Es war besser, das Thema zu wechseln.
»Und ich soll ihn dir wohl bringen?«
»Nein, lass mal, alles ist gut.« Behütuns wuchtete sich hoch und ging hinüber zur Anrichte, wo die Kaffeemaschine stand. Mit einem dampfenden Pott kam er zurück. »Dann schau ich mir das halt mal an.« Er griff sich die Mappe und schlug sie auf.
»Chef?«
»Ja?«
»Ist das die Sache mit denen, die man in Oberndorf aus dem See gefischt hat?«
»Keine Ahnung. Hat man das?« Behütuns hatte bislang nichts davon gehört.
»Ja, einen Käfer mit Knochen zweier Personen. Am Samstag.«
»Wenn die vor 35 Jahren verschwunden sind, kann das gut sein, ja.« Der Kommissar sah Frau Klaus fragend an. »Woher weißt du das?«
»Steht doch heute riesengroß in der Zeitung.«
Behütuns brummte irgendetwas und wandte sich wieder der Mappe zu. Gleich obenauf lag gleich ein Zettel seines Chefs: »Bitte unbedingt BKA kontaktieren!« Und dazu eine Nummer und der Name Grüneis. Behütuns legte den Zettel beiseite und sah sich den Vorgang durch.
»Vermisstenfall Burger Marcus/Leone Luigi.« Und danach alle möglichen Angaben zu den Personen, ihren Familien, ihrem Umfeld. Also: Marcus Burger, geb. 28.2.1957, es folgte die Adresse, Vater Prof. Dr. Herwig Thelonius Burger, geb. 6.4.1924, Mutter Friederike Dorothea Burger, geb. Frenzel, geb. 18.2.1928, Hausfrau, verstorben Dezember 1980, Krebs. Luigi Leone, geb. 2.9.1958, Vater Antonio Leone, Ing. mit Prokura, geb. 16.4.1920, Bozen, Mutter Ilsa Leone, geb. Lübbeke, 25.12.1926 in Fürth, Hausfrau.
Er entnahm den Unterlagen auch, dass Marcus Burger und Luigi Leone am 26. September 1982 von einer Feier mit Freunden gegen 23 oder 23.30 Uhr (»divergierende Angaben der Zeugen«) mit ihrem VW Käfer 1200 mit unbekanntem Ziel aufgebrochen waren und sich für den nächsten Tag mit einem Gerold Reinwand verabredet hatten. Zu dieser Verabredung aber nicht gekommen waren.
»Ja, das scheint der Fall zu sein, Klaus.« Er blätterte weiter in den Unterlagen.
Vermisstenmeldung Eingang: 30. September 1982. Aufgegeben von Prof. Dr. H. Th. Burger und Ing. Antonio Leone, erneut Vermisstenmeldung aufgegeben 4. Oktober 1982.
Wahrscheinlich hatte man die Eltern beim ersten Mal beruhigt und wieder weggeschickt, dachte Behütuns. Normal eigentlich, wenn erwachsene Personen sich ein paar Tage nicht meldeten, sie nicht schwer krank waren und es keinerlei Hinweise auf einen Unfall oder ein Verbrachen gab. Er rechnete nach: Die beiden Burschen waren längst volljährig, und wenn Erwachsene mit einem Auto fortfuhren und nicht gleich jedem erzählten, wohin, dann war das noch lange kein Grund für eine Vermisstenmeldung – und schon gar kein Grund für die Polizei, irgendwie tätig zu werden. Hinweise auf ein Verbrechen lagen offenbar bis heute nicht vor.
Behütuns blätterte weiter. Hatte es eine Befragung der Freunde gegeben, die bei der Feier anwesend waren?
Anscheinend nicht, zumindest stand davon nichts in den Akten. Die waren fortgefahren nachts, mehr nicht, und seitdem spurlos verschwunden.
Irgendwelche Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum? Nichts zu finden.
»Na ja, aber in dem Alter und zu dieser Zeit …«, sagte Behütuns wie zu sich selbst.
»Hast du etwas gesagt?«, fragte Frau Klaus aus dem Nebenzimmer.
»Nein. Nichts.«
Und dann fand er noch zwei offenbar zu späteren Zeitpunkten hinzugefügte Notizblätter, beide handschriftlich verfasst. Der eine dieser Bögen war versehen mit einer mehrfach unterstrichenen Randbemerkung »Kein Bezug zum Fall – nur der Vollständigkeit halber!«, die Notiz selbst lautete: »M. Burger/L. Leone Feb. ’81 unschuldig Beteiligte an Verkehrsunfall mit drei Todesopfern« sowie einer unleserlichen Unterschrift. Die Notiz auf dem zweiten Blatt lautete: »16.6.1994, Ehepaar Leone mit Pkw am Stilfser Joch tödlich verunglückt. Keine direkten Nachkommen ermittelbar.« Irgendjemand hatte also die Akte damals halbwegs auf dem neuesten Stand gehalten.
Na gut, dachte er sich, legte die Papiere wieder zusammen und klappte die Mappe zu, und was soll ich jetzt damit?
»Hast du die Zeitung da, Klaus?«
Frau Klaus legte sie ihm hin. Behütuns flog über den Artikel und sah sich das Bild an. Ein schlammiger Käfer, drei Personen daneben. Er nickte. »Ja, der Käfer, 35 Jahre, Überreste von zwei Personen – das sind schon die zwei.«
Okay, das waren also die Fakten: Zwei junge Männer, der eine war damals schon 25, der andere 24, fahren mit ihrem Auto in einen See und ersaufen. Zumindest stellt sich das jetzt so dar, nach 35 Jahren. Bisher hatte man das nicht gewusst, und die beiden galten als vermisst. Jetzt wusste man es besser.
Aber man wusste nicht, wie es dazu kam, dass sie in diesen Weiher gefahren sind. Auch nicht, warum sie überhaupt zu dem Weiher gefahren waren. Aber konnte man das heute noch herauskriegen? Nach 35 Jahren? Quatsch.
Behütuns schob die Mappe beiseite. Das würde wohl ein Geheimnis bleiben, warum die in dem Weiher abgetaucht waren. Wo befanden sich jetzt eigentlich die Überreste, die man gefunden hatte, also die Knochen? Sicherlich in der Gerichtsmedizin. Oder bereits beim Bestatter, damit die Angehörigen das Begräbnis ausrichten konnten?
Hm, welche Angehörigen eigentlich? Nach Stand der Akten lebte nur noch der Vater des einen, Prof. Dr. Herwig Thelonius Burger. Herwig Thelonius, was für ein geschwollener Name! Na gut, Friedemann war auch nicht viel besser, und der Professor hatte wenigstens einen normalen Nachnamen dazu. Er jedoch, Behütuns … Zurück zum Professor. Der war 1924 geboren, also heute 93 Jahre alt. Wenn er tatsächlich noch lebte. Vielleicht waren die Akten aber auch nicht auf dem allerneuesten Stand, und der Mann war schon unter der Erde? Und wenn nicht, dachte Behütuns, was kann ich von einem 93-Jährigen noch erwarten? Das wird wahrscheinlich ein alter, vergesslicher, gebrechlicher Tattergreis sein, den ich überhaupt nicht mehr zu irgendwas zu befragen brauche.
Behütuns nahm einen Schluck Kaffee und sah zum Fenster hinaus.
»Klaus?«
»Ja?«
»Kannst du bitte versuchen herauszubekommen, ob es diesen Professor Burger noch gibt? Prof. Dr. Herwig Thelonius Burger, er war früher mal an der Uniklinik Erlangen.«
»The… was?«
»Siehste, genauso ging’s mir auch. Thelonius. The-lo-ni-us.«
»Ah, wie Thelonious Monk, nur die deutsche Fassung des Namens.«
»Thelonius wer?«
»Thelonious Monk, einer der größten Jazzmusiker aller Zeiten. Pianist und Komponist. Nur dass man den noch mit o schreibt. The-lo-ni-o-us.«
»Thelonious Monk? Nie gehört.«
»Solltest du aber. Vielleicht bring ich dir mal ein paar Scheiben mit.«
»Platten?«
»Yep, Schallplatten. Du hast doch noch einen Plattenspieler, oder?«
Natürlich hatte Behütuns noch einen Plattenspieler. Allerdings war der Antriebsgummi ausgeleiert, also eierten die Platten. Er hatte sich vor Jahren zwar schon in weiser Voraussicht mit Ersatzriemen versorgt, hatte aber keine Ahnung, wo er die hingepackt hatte. Die lagen wahrscheinlich irgendwo ganz hinten in einer Schublade, wo sie keiner vermutete.
Das Telefon klingelte. Behütuns nahm ab.
»Ja?«
Schweigen am anderen Ende.
»JA?«
Pause am anderen Ende. Dann, in einem belehrend-vorwurfsvollen Ton: »Können Sie sich nicht melden?«
Behütuns nahm den Hörer kurz vom Ohr und sah ihn sich, den Erstaunten spielend, von allen Seiten an. »Ich mich melden? Habe ich doch. Außerdem: Sie haben meine Nummer gewählt, richtig? Und da das eine interne Nummer ist, haben Sie gezielt meinen Apparat angewählt, oder Sie sind durchgestellt worden und wollen mich sprechen. Dann können Sie auch davon ausgehen, dass ich am Apparat bin, wenn ich abhebe. Allerdings – mal andersherum gefragt: Wer sind Sie denn?«
»Grüneis, Horst Grüneis, BKA Köln.«
Das BKA, uiuiui, das war der vom Zettel des Alten. Und die vom BKA waren immer die ganz Gescheiten. Behütuns sagte nichts, wartete nur ab.
Schweigen am Telefon, nur Schnaufen am anderen Ende.
»Eigentlich habe ich ja erwartet, dass Sie mich anrufen.«
Behütuns sagte nichts.
»Gestern schon.«
»Gestern war Sonntag, da arbeiten wir nicht. Oh – ich glaube, wir werden gerade unterbrochen …« Er legte auf, grinste kurz, grunzte »so blöd muss mir keiner kommen« und sah auf die Uhr. Kurz vor zehn. Das konnte ja ein lustiger Tag werden. BKA. Grüneis. Das hatte ganz sicher mit dem Auffinden des Autos zu tun, schlussfolgerte er, weshalb sonst legt mir der Chef da einen Zettel rein, dass ich dort anrufen soll, dreimal unterstrichen. Aber warum, bitte, interessiert sich das BKA für ein Auto, das 35 Jahre auf dem Grund eines Sees vor sich hin gegammelt hat?
Das Telefon klingelte.
»Klaus?«
Das Telefon klingelte weiter.
»Ja?«
»Ich bin nicht da.«
»Wo bist du denn?«
»Unterwegs.«
»Herr Behütuns!« Der Chef stand in der Tür, und das Telefon klingelte. »Sie sind unterwegs?«
Das Telefon klingelte weiter.
»Bin grad im Begriff zu gehen.«
»Aber das Telefon klingelt.«
»Ja, das macht Klaus.«
Der Chef schüttelte den Kopf und deutete unmissverständlich auf den klingelnden Apparat. Behütuns schüttelte genervt den Kopf und nahm ab.
»Kriminalkommissar Behütuns, Polizeipräsidium Nürnberg, Sonderbüro Metropolregion Nürnberg SoBüMeNü, Servus, Kollege Grüneis, wir sind scheint’s unterbrochen worden, tut mir leid.« Sein Chef sollte ruhig einmal mitkriegen, wie beschissen und entwürdigend das klang, wenn sie sich hier ordnungsgemäß meldeten. Eine Zumutung war das!
Klaus nebenan unterdrückte ein Prusten. Behütuns hörte eine Zeit lang zu, nickte zwischendurch mal mit dem Kopf, verabschiedete sich schließlich mit »okay, dann bis morgen« und legte wieder auf.
Klaus und Rast sahen ihn neugierig an.
»Terroristen.«
»Wer – die vom BKA?«
»Nein, die Reste.«
»Reste?«
»Ja, die Überreste der beiden Typen aus dem Weiher. Die aus dem Vorgang da.« Dazu deutete er auf die Mappe auf dem Tisch.
»Ich hatte doch eine Notiz ganz obenauf gelegt, dass Sie die vom BKA anrufen sollen.«
»Na ja, jetzt kommt der ja morgen, der Grüneis.«
•
»Rechtsmedizin Uni Erlangen, Forensik, Hummelt«, meldete sich die Stimme einer jungen Dame.
»Behütuns hier, Kripo Nürnberg, Grüß Sie, Frau Doktor.« Der Kommissar kannte die junge Ärztin, die dort im Keller die Leichen zerschnippelte. Die wurden aus ganz Nordbayern nach Erlangen gebracht , im Durchschnitt drei pro Tag. Die Nürnberger Gerichtsmedizin war dazu viel zu klein und viel zu schwach besetzt.
»Hallo, Herr Behütuns, Sie rufen sicherlich an wegen …«
»Richtig geraten, wegen der beiden Leichen aus dem Auto, das aus dem See gefischt wurde.«
Die Ärztin am anderen Ende lachte leicht. »›Leichen‹ ist vielleicht ein wenig übertrieben.«
»Wieso?«
»Wir haben nur Knochen, alles andere ist längst verwest.«
»Aber die Überreste sind noch bei Ihnen?«
»Die sind noch hier, ja.«
»Und Sie? Sind Sie später da?«
»Im Institut? Ja.«
»Dann schau ich einmal vorbei.« Das kam ihm gerade recht. Raus aus dem Präsidium, raus aus dem Büro, weg von irgendwelchen unerwünschten Anrufen.
»Klaus?«
»Was ist?«
»Ich fahr mal rüber in die Rechtsmedizin.«
•
Als er die Edelstahltüre im Keller der Rechtsmedizin aufschob, beugte sich Frau Dr. Hummelt gerade über einen massigen Frauenleib, der rücklings auf einem der beiden museal anmutenden Marmortische lag. Ihr Bauch war mit einem riesigen Schnitt geöffnet worden und die Ärztin zog, als sie Behütuns sah, die Hände aus der Bauchhöhle zurück, streifte sich die Handschuhe ab, warf sie in den am Tisch angebrachten blauen Müllsack, wusch sich die Hände und reichte ihm die noch nasse Hand. »Hallo, Herr Behütuns.«
Er zögerte, die Hand zu nehmen.
»Ach, das ist bloß Wasser.«
Der zweite Marmortisch war leer. Jeder dieser beiden uralten Tische mit seinem Überlaufrand, seinem Abflussloch und dem integrierten Spülbecken war wohl schon vor über einem Jahrhundert aus einem einzigen Stück geschlagen worden. Die Stahlfüße, ein Wasserhahn mit einem Stück rotem Schlauch daran, das Gestell seitlich für den Müllsack, das alles auf kaltgrauen, uralten Bodenfliesen mit in den Boden eingelassenem Gully und umgeben von weiß gefliesten Wänden zum Abspritzen, mutete Behütuns immer wieder an wie die Kulisse aus einem Josef-Hader-Film. Aufschneider oder Knochenmann. Die große Tafel an der Wand mit den Begriffen »Gewicht«, »Größe«, »Kopf«, »Leber«, »Herz«, »Magen« etc. untereinander, auf die noch mit Kreide geschrieben wurde, vervollständigte das Bild. Tageslicht gelangte in diesen Raum ausschließlich durch die knapp unter die Decke gequetschten, länglichen Milchglasscheibenfenster, die nach Norden zeigten. Von außen ebenerdig und verborgen hinter einer Hecke. Also so gut wie keines. Neonlicht machte den Raum zusätzlich kalt.
»Kommen Sie.«
Am entlang der Wand angebrachten langen Tisch saß gebeugt ein Kollege mit Mundschutz und Schutzbrille und zerschnitt irgendwelche Fleischteile, die sicherlich von dem Fleischberg auf dem Marmortisch stammten, und besah sie sich unterm Mikroskop. Danach wanderten die Brocken in kleine, verschraubbare Plastikbehälter mit Formaldehyd, wahrscheinlich bis zum Sanktnimmerleinstag. Am Kollegen vorbei, der keine Notiz von ihnen nahm, führte Dr. Hummelt ihn in den Nebenraum, öffnete eine der quadratischen Edelstahlklappen dort an der Wand und zog eine Wanne heraus.
»Hier sind unsere zwei.«
In der Wanne lag nicht sehr viel. Behütuns erkannte zwei Becken, Teile zweier Wirbelsäulen mit Rippen daran und mehrere verschiedene Knochen, auch Fußknochen.
»Das ist alles?«
Dr. Hummelt sah ihn an und sagte lapidar: »Mehr haben uns Hecht und Waller leider nicht übrig gelassen. Auch von Karpfen weiß man, dass sie Fleisch fressen, und Forellen, die mit Vorliebe übrigens Leber, zumindest nehmen die manche Angler als Köder …«
»… Aale …«
Dr. Hummelt schüttelte den Kopf. »Das basiert auf einer typischen Fehlinformation, die aber sehr weit verbreitet ist. Dass Aale Aas fressen, kennen die Leute aus der Blechtrommel, in der Verfilmung haben sie das gesehen. Ist aber falsch. Aale fressen kein Fleisch, auch kein Aas, zumindest konnte man das bisher nicht nachweisen. Das hat Günter Grass erfunden, aber seither hat jeder das Bild mit den Pferdeköpfen im Kopf.«
»Ist das wahr?«
»Absolut. Aber Krebse zum Beispiel fressen Fleisch und Aas. Die gibt’s aber ganz sicher nicht in dem Weiher, genauso wenig wie Forellen. Hechte, Waller und Karpfen dagegen schon.«
»Und ich dachte immer, Leichen werden im Wasser so wachsartig, quellen zuerst auf und kriegen dann diese monströse Schildkrötenhaut?«
»Nur, wenn kein Sauerstoff da ist. Davon gab es in dem Weiher wohl genug.«
Behütuns sah sich die Reste in der Edelstahlwanne an. »Aber sagen Sie mal, die fehlenden Knochen, die Köpfe, Arme, Hände – das sollen alles die Fische gefressen haben? Oder hat das vielleicht schon vorher gefehlt?«
»Sie meinen, dass Teile abgetrennt wurden?« Sie schüttelte den Kopf. »Dann müsste man an den Trennstellen noch Spuren finden, selbst nach so langer Zeit.«
»Und … nichts?«
»Nein, definitiv nicht. Keinerlei Kratzer oder Einkerbungen, etwa von Messern, Sägen oder Ähnlichem, das habe ich alles untersucht.«
»Aber so einen Kopf … Schleppen Fische wirklich so ein großes Ding weg? So ein Kopf wiegt ja auch ein paar Kilo.« Behütuns schüttelte ungläubig den seinen.
»Na ja, laut Bericht lag das Auto auf der Seite, die Seitenfenster waren offen, auch das Schiebedach wohl 30 bis 40 Zentimeter. Und wissen Sie, wie groß so ein Hecht werden kann?«
»Einen Meter?«
»Ja, das wird der durchaus. Und ein Waller oder Wels?«
»Auch so?«
Die Ärztin lachte. Ihr machte der Job offenbar Spaß. »Ich habe schon welche gesehen, die waren zwei Meter lang. Und hatten so einen Umfang.« Sie deutete mit den Armen einen großen Kreis an. »Solche Fische reißen von einer aufgeweichten Leiche leicht einmal eine ganze Hand auf einmal ab und schleppen sie irgendwohin oder schlucken sie. Da bleibt dann nichts davon übrig.«
»Spezialität des Hauses: Wallerfilet, Hechtfilet«, zitierte Behütuns die Speisekarte des Restaurants am Fundort, dem Oberndorfer Weiher.
»Und so einen Schädel«, sinnierte die Ärztin weiter, »den reißt so ein Waller auch ab, schleppt ihn nach draußen, dann kullert der vielleicht über den Seegrund, andere Fische kommen, schubsen und nagen weiter daran herum. Der liegt dann irgendwann tief im Schlamm, beziehungsweise das, was davon übrig ist. Da finden Sie nichts mehr.«
»Und es sind die Knochen zweier junger Männer?«
»Das kann ich mit Sicherheit sagen, ja. Das lässt sich aus der Beckenform ableiten und aus dem Abnutzungsgrad der Gelenke. Wir haben es hier mit den Resten zweier männlicher Personen zu tun, geschätztes Alter zwischen 25 und 35 Jahren.«
Behütuns nickte. »Das kommt hin. Es sind also unsere zwei.« Er dachte einen Moment lang nach. »Die DNA können Sie noch bestimmen, oder?«
»Aus den Fersenknochen recht gut, ja.«
»Und machen Sie das noch?«
»Wenn Sie das brauchen und der Staatsanwalt es anordnet, ja.«
»Sonst nicht?«
»Nein, weil sonst zahlt es ja keiner. Wir arbeiten hier ja nicht umsonst.«
»Verstehe. Meinen Sie, dass das hier nötig ist?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Wie gesagt, das entscheiden Sie und der Staatsanwalt. Wenn Sie den Verdacht haben, dass man hier zwei Vietnamesen, Bulgaren, Chinesen oder sonst wen reingesteckt und versenkt hat …«
»Und Sie? Was meinen Sie?«
»Ich?«, antwortete Frau Dr. Hummelt. »Ich habe dazu keine Meinung. Ich mache hier meinen Job. Anzeichen eines Verbrechens habe ich keine entdecken können, Einwirkungen von Drogen oder Alkohol kann ich an dem, was hier gefunden wurde, nicht mehr feststellen, und damit bin ich raus. It’s your turn.«
Am frühen Nachmittag fuhr Behütuns wieder zurück ins Büro. An seiner Windschutzscheibe fand er ein Knöllchen. Das musste er wohl oder übel bezahlen. Privat. Intern ließ sich da schon lange nichts mehr machen.
Er übernimmt auch Besorgungen, Reparaturen und Umzüge.
Leïla Slimani, »Dann schlaf auch du«
4
Montag, 4.9.2017
Nichts deutete darauf hin, dass in genau dieser Ausgabe der Montagszeitung eine Meldung von Bedeutung für ihn stehen könnte. Die Welt drehte sich vor sich hin, die Weltenläufte waren durch nichts zu beeinflussen und bewegten sich ohnehin weitgehend im Kreis, zumindest konnte man diesen Eindruck gewinnen. Was einen aktuell in seinen Bann zog, war, aus der Distanz betrachtet, eher banal. Der Beweis: Hatte man sich einmal zwei oder drei Wochen den Aktualitäten entzogen, während eines Urlaubs zum Beispiel, waren die Themen danach immer noch dieselben. Als ob man nie fort gewesen wäre. Wie oft hatte Dr. Hanns-Jochim Baumann, von Freunden nur Hajo genannt, diese Erfahrung schon gemacht. Warum also sollte ausgerechnet in dieser Ausgabe der Süddeutschen Zeitung etwas für ihn persönlich Bedeutsames stehen? Er wäre nie auch nur auf den Gedanken gekommen. Fakt war für ihn: Er hatte eine Zeitung, hatte eine lange Fahrt vor sich und würde sie, sollte ihm langweilig werden, eher zerstreut als mit Interesse durchblättern. Und zu Hause, darauf freute er sich, wartete sein Motorrad auf ihn, seine gute alte 1000er BMW Paris-Dakar, die ihn seit über 20 Jahren zuverlässig begleitete und mit der er sich in den nächsten Tagen, so das Wetter mitspielte, aufmachen würde auf eine Tour in aller Gemütlich- und Genüsslichkeit quer durch den Spätsommer in Frankreich. Ein paar Dinge hatte er dafür noch zu erledigen, aber er hatte keine Eile. Über Land auf kleinen Straßen wollte er möglichst direkt Richtung Westen fahren und würde, so zeigte es die Karte an, in Fécamp herauskommen, der kleinen Hafenstadt in der Normandie. Ungefähr bei Trier würde er die Grenze überqueren nach Luxemburg, danach einen Zipfel Belgien mitnehmen, in der Nähe von Sedan endlich Frankreich erreichen und dann über so verlockend klingende Städtchen wie Signy-l’Abbaye, la Fère, Breteuil oder St. Saëns schließlich in Fécamp ankommen. Wohltönende Namen von Orten, die er noch nicht kannte. Mit Marktplätzen, Cafés und Kirchen, so stellte er es sich vor. Es hatte ihn gewundert, dass er, wenn er direkt nach Westen fuhr, doch so weit im Norden das Meer erreichen würde, aber es war nur gefühlt so weit nördlich, in seiner inneren Topografie. Denn Nürnberg lag tatsächlich auf einer Linie mit Fécamp – im Kopf aber befand sich die Normandie viel weiter im Norden, nicht geradewegs westlich. Aber auf die Topografie im Kopf ist wenig Verlass, genauso wie oft auf den Kopf selbst.
Golden leuchtend schien die schon tief stehende Abendsonne zum Abteilfenster herein, raste scheinbar über die Landschaft. Verschwand kurz hinter Baumwipfeln, dem Bahndamm oder Hügelkuppen und tauchte jenseits davon wieder auf. Blendete noch. Und wanderte auch wegen der Kurven.
Es war Spätsommer, der erste Montag im September, die Tage schon wieder spürbar kürzer, und in der Frühe des Morgens stand bereits oft Nebel über den Wiesen. Dr. Baumann war Kommunikationsfachmann und weit jenseits der fünfzig. Und er war eitel. Trieb regelmäßig Sport, war trotz seines Alters noch schlank und trug, nicht wie die meisten in der Branche, Schwarz, sondern immer und überall blütenweiße Hemden, am liebsten frisch gebügelt. Weil er schon früh festgestellt hatte, dass man es mit weißen Hemden leichter hatte. Man musste sich beim Kunden nicht so anstrengen, es öffneten sich einem schneller Türen, es wurde einem mehr geglaubt. Tatsache. Er hatte bis heute nicht ergründen können, woran das lag, aber es war so, und er hielt eisern an seinen weißen Hemden fest. Weiße Hemden und sein Doktortitel, das waren seine Door-Opener, da konnte er sich auch den in der Zwischenzeit grau gewordenen Pferdeschwanz leisten, von dem er sich seit seiner Jugendzeit nicht getrennt hatte. Er war sein Markenzeichen, genauso wie die meist auf die Stirn geschobene Brille. Dr. Baumann war Quereinsteiger, hatte in Germanistik promoviert, weil er nach dem Studium nicht gewusst hatte, was er tun sollte, und in der Branche hatte sich der Titel als Pfund herausgestellt. Aber auch sonst. Einmal hatte ihn nachts die Polizei angehalten, weil sein Rücklicht defekt war. »Führerschein! Fahrzeugpapiere!«, hatte ihn der Polizist durchs heruntergekurbelte Seitenfenster unfreundlich angeblafft. Baumann hatte ihm die Papiere wortlos hinausgereicht, hoffend, dass der Beamte ihn nicht noch »Haben Sie etwas getrunken?« fragen oder ihn gar blasen lassen würde, denn drei Biere hatte er mindestens intus gehabt. Doch oh Wunder: Nachdem der Polizist einen Blick auf die Papiere geworfen hatte, war er schlagartig zuvorkommend und freundlich geworden. »Es könnte sein«, hatte er vorsichtig angemerkt, während er ihm die Papiere durchs Fenster zurückgereicht hatte, »dass Ihr rechtes Rücklicht defekt ist, Herr Doktor Baumann.« Er hatte sich nämlich, sein Professor hatte ihm dringend dazu geraten, seinen damals neu erworbenen Titel sofort in die Dokumente eintragen lassen. Gut dreißig Jahre war das jetzt schon her, aber von dem Titel hatte er immer wieder profitiert, wie auch von seinen weißen Hemden. Heute betätigte sich Baumann, wie viele Kollegen seines Alters auch, als Dozent, Berater und Besserwisser. Gerade befand er sich auf der Rückfahrt von Berlin. Vor geraumer Zeit hatte der Zug den Bahnhof Jena Paradies verlassen und rollte nun, tatam-tatammmm, tatam-tatammmm, beinahe gemütlich auf seiner alten, kurvigen Trasse durch den Thüringer Wald. Richtung Abend und Nacht. Lange würde es diese schöne, langsame Strecke nicht mehr geben, noch in den nächsten Monaten sollte die neue für den ICE in Betrieb genommen werden und die Fahrtzeit um fast zwei Stunden verkürzen. Verschlafen wirkende Weiler huschten im beginnenden Dämmerlicht vorm Fenster vorbei, hineingekauert in enge, wie auf ewig schattige Täler, und die Häuser dort schienen in ihrem farblosen Grau und mit den schwarzen Schieferschindeln noch immer typisch nach DDR zu riechen, auch noch nach so vielen Jahren. Als ob dort unverändert der Geschmack von Braunkohle hinge, schwefelgelb und schwer, der früher die gesamte »Demokratische« Republik unverwehbar überzogen hatte. Irgendwann, nahm er sich zum wiederholten Male vor, würde er hierher einmal zum Wandern fahren, die Landschaft lud geradezu dazu ein. Baumann hatte sich vom Schaffner – in modernem Bahnsprech heute »Zugbegleiter« oder »Mitglied des Bordpersonals« genannt, dafür hatten sie keine Chance mehr auf Verbeamtung – in Berlin die Süddeutsche Zeitung geben lassen, blätterte zerstreut und ohne Interesse an etwas Bestimmtem immer wieder einmal darin herum, doch meist sah er aus dem Zugfenster hinaus, ließ die Landschaft an sich vorübertatammen und seinen Gedanken freien Lauf. Er hatte seine Debonair-Jacke von Ted Baker sorgsam an den Haken gehängt, den obersten Knopf seines blütenweißen van-Laack-Hemdes, Modell Stenströms, geöffnet und die Ärmel lässig bis unterhalb des Ellbogens aufgekrempelt. Jetzt prüfte er den Sitz des Gummibandes, das sein Haar zum Pferdeschwanz bündelte, ließ dann die Hand lässig über die Individualität zeigende Haarpracht gleiten, um sich zu vergewissern, dass sich die Haare nicht verknotet hatten, und strich sich schließlich über die Oberschenkel seiner eigenwillig leger geschnittenen Y-3-Jeans, vom Japaner Yohji Yamamoto für adidas designed. Selbstzufrieden betrachtete er seine dank »Distressed-Optik« gepflegt verkommen wirkenden Schuhe von Marsèll. Er liebte es, ausgesuchte Markenklamotten zu tragen. Er hatte irgendwann einmal damit begonnen, und wer das je getan hat, kann nicht mehr zurück. Nur Armut, also Not, konnte einem diese unsinnige Eigenheit abgewöhnen. Oder vernünftiges Denken. Wenn das aber Auswirkungen auf das Handeln haben sollte, musste wiederum Not herrschen. Er würde es also ohne Not nicht lassen. Die Lässigkeit und Beiläufigkeit, mit der er diese Sprache sprach, in der seine sehr dezente Armbanduhr von Glashütte Original schon beinahe protzig wirkte, war elitär, und nur die wenigsten konnten sie dechiffrieren. Die Berliner, bei denen er gewesen war, hatten diese Sprache sicher verstanden, ihn aber eher nicht. Baumann hatte in Berlin einen Vortrag gehalten, ganz allgemein zum Thema Werbung, »Kommunikation«, wie man das – und er nahm sich da nicht aus – in der Branche nannte, weil es dann klüger klang. Wichtiger. An einer privaten Hochschule für Kommunikation und Design, wohin er als Gastredner eingeladen gewesen war. Sondervorlesung zum Semesterbeginn.
Das Auditorium hatte überwiegend aus Studenten, aber auch erfahrenen Werbern bestanden. Aus Kollegen und Kolleginnen also. Gestandene Männer und Frauen, genauso wie er vom Leben wie von stilsicherem Markenbewusstsein gezeichnet. Von Unwiderstehlichkeit. Sie hatten sich die ersten Reihen reserviert. Diese Lehrkörper hatten ihr gesamtes Leben nichts anderes produziert als Werbung, und zwar sehr erfolgreich, wie man ihm nicht ohne Stolz – und dafür selbstverständlich die angemessene Ehrfurcht erwartend – gleich zur Begrüßung deutlich gemacht hatte. Unter seinesgleichen steckte man sofort seine Claims ab, denn jeder andere war ein potenzieller Konkurrent. Außerdem war man etwas, man stellte etwas dar und zelebrierte sich entsprechend. Seine Gastgeber nannten sich »Professoren« und waren alle noch aktiv im Metier unterwegs, als kreative Köpfe und Leader in Agenturen, meistens den eigenen. Sie hatten vor Jahren die Hochschule selbst gegründet und sich so zu Hochschullehrern gemacht. Auf diese Weise versorgte man sich in der Branche gern mit Titeln, mit denen man dann für das, was man in seiner Agentur für seine Kunden tat, noch mehr verlangen konnte. Weil man ja mehr war: Professor. Und über die Hochschule versorgte man sich auch mit willigem und billigem Nachwuchs, der gerne bereit war, ohne auch nur das geringste Murren fünfzig Stunden und mehr in der Agentur »ihres« Professors, den sie natürlich duzen durften, zu dienen. Und da die Akademie eine private war, verlangte sie von ihren Studenten monatlich eine Gebühr. Keine geringe. Damit ist der Mechanismus solcher Schulen weitgehend erklärt: Es war ein Reputations-, Titel- und Geldgenerierungsinstitut.
Baumann also hatte vor den Studenten und der versammelten Professoren- und Kreativführerschaft gestanden und zu Beginn seines Vortrags gefragt: »Kann mir jemand von Ihnen sagen, was Werbung ist?«
Das war keineswegs als rhetorische Frage gedacht, sondern durchaus sehr ernst gemeint. Und kalkuliert. Er wollte provozieren – und seinerseits seinen Claim abstecken. Sich absetzen. Denn die gesamte Professorenriege strotzte ihm zu sehr vor Selbstgefälligkeit und Blasiertheit, und das stieß ihm auf. Deshalb wählte er eine ganz spezielle Eröffnung seines Vortrages.
Auf seine Frage erntete er, wie erwartet, zunächst nur Schweigen. Erst leises, als ob man sich verhört hätte. Dann anschwellendes und immer lauter werdendes. Es hatte funktioniert. Das Schweigen durchlief relativ schnell verschiedene, sehr gut zu beobachtende, fließend ineinander übergehende Phasen. Kurze Verblüffung, ein Lidschlag Irritation, gefolgt von einem Atemzug Erstaunen, einem kaum merklichen Moment der Verunsicherung, den man aber noch im Augenblick des Entstehens kontrollierte, denn Werbung und ihre Macher sind nie unsicher, sie sind reflektiert und souverän, und kulminierte schließlich in Entrüstung, gefolgt von offener Ablehnung und letztendlich Feindseligkeit. Professoren- und Professorinnenaugen pfeilten ihn an. Was für eine Unverschämtheit!, schrie es ihm schweigend entgegen. Welche Dreistigkeit! Studentenaugen beobachteten nur verschüchtert und warteten ab. Was erlaubt sich dieser Niemand?!, brüllten ihn die Blicke an. Wie kann er es wagen, uns, die wir hier in Ehren und Ansehen in der Hauptstadt Deutschlands, einer Weltmetropole immerhin, unser gesamtes Leben lang – und das sehr erfolgreich, davon zeugen all unsere Trophäen! – bisher nichts als Werbung betrieben haben, zu fragen, was Werbung ist?! Abzufragen. Will der uns für dumm verkaufen? Gar verhöhnen? Wir, ja, wir! sind nachweislich die führenden Kreativen, die großen Strategen und Konzeptioner!
Empörtes Grummeln machte sich leise bemerkbar.
Bösartiges Grummeln.
Beantwortet aber hatte die Frage niemand.
Dr. Hajo Baumann, das war sein Kalkül, ließ die Frage eine Zeit lang wirken und nahm ihr dann wie nebenbei die Spitze: »Kann mir denn niemand sagen, wo ›Werbung‹ herkommt … also das Wörtchen ›Werbung‹?«
Doch er erhielt keine Antwort, nicht eine einzige, nicht einmal den Versuch. Die sich selbst zelebrierende, ehrenwerte Gesellschaft reagierte instinktiv wie ein waidwundes Tier, nicht die leiseste Spur von Offenheit oder Humor war zu sehen, kein bisschen, und nicht einmal ein Restfunke von dem, was sie immer nach außen propagierte und im Interesse ihrer Auftraggeber ständig von den Menschen einforderte: Neugier, Lust auf Neues, Lust auf Abenteuer, am Entdecken – penetrant wiederholt im allgegenwärtigen »Entdecke!«, »Entdecken Sie!«, »Entdecken Sie jetzt!« Entdecke, entdecke, entdecke! Doch selber? Keine Spur.
Aber Baumann war nicht erstaunt, eher im Gegenteil. Dies alles bereitete ihm insgeheim Freude, denn seine Strategie ging auf. Er konnte denen etwas erzählen – und sie mussten es sich gefallen lassen, belehrt zu werden.
Werbung, referierte er dann endlich und löste die Frage auf, leite sich ab von dem althochdeutschen werban, was wiederum dem russischen Sprachraum entstamme und dort mit dem Bedeutungsfeld von »Handwurzel« zusammenhänge. Völlig egal, ob das stimmte, es konnte ohnehin niemand nachprüfen. Also: Handwurzel.
Ach so! Man spielte jetzt, sich tunlichst entspannt gebend und die soeben noch spürbare Unsicherheit übertünchend, scheinbar gelangweilt Gelassenheit und Interesselosigkeit.
Der Ursprung von Werbung, so referierte Baumann – für die Berliner Dr. Baumann – leite sich folglich aus dem Kontext des Tanzens ab, des Sich-Drehens, beispielsweise im Reigen unter dem erhobenen Arm, also der Handwurzel, des anderen. Des Tanzpartners.
Demonstrative Langeweile: Was quält der uns mit Banalitäten?
Werbung habe etwas zu tun mit »Sich-schön-Machen« für den anderen, mit »Sich-von-der-besten-Seite-Zeigen«, mit »Den-anderen-für-sich-gewinnen-Wollen«.
Der Leithammel vorne zeigte sich leicht unruhig, die Nebensitzenden schlossen sich ihm an. Man wollte nicht zu erkennen geben, dass man von so etwas für das eigene Metier Zentralem nichts gewusst hatte.
Die Klaviatur der Werbung müsse, schloss Baumann unbeirrt aus dem Gesagten, Charme und Intelligenz sein, Witz und Überraschung, Schönheit und Anmut, die Süße des Lebens, der Zauber der Anziehungskraft. Die Vorliebe für das Süße sei schließlich, kommentierte er noch hochplausibel, eine anthropologische Konstante, beobachtbar quer durch alle Zeiten, Kontinente und Kulturen.
Der Leithammel vorne räusperte sich in seinem BOSS-Hemd.
Und er könne nicht verstehen, legte Baumann nach, warum, auch und gerade vor diesem Hintergrund – und das wundere ihn eigentlich schon seit Langem und zeuge wohl auch von einer gewissen Ahnungslosigkeit, wenn nicht sogar Arroganz, vielleicht aber auch nur naiver Unbedarftheit – warum also eine der namhaftesten und erfolgreichsten Agenturen des Landes sich als Wappentier das Trojanische Pferd auserkoren habe, selbstbewusst und voller Stolz, wohl anspielend auf die humanistische Bildung ihrer Gründer, so was mache ja immer was her. Doch sei dieses Pferd in Wahrheit ein reines Kriegsgerät voller Hinterlist und Heimtücke, das historisch unwiderlegbar nur darauf angelegt gewesen war, hinterrücks Tod und Verderben zu bringen. Wo doch der Kern der Werbung im, wie ja das Wort schon sage, Werben um die Gunst des anderen, um dessen Zuneigung zu suchen sei. Er sehe da nicht nur keinen Zusammenhang, sondern sogar eine gewisse Ahnungslosigkeit. Ein peinliches Versehen. Jetzt hatte er sich endgültig sehr weit aus dem Fenster gelehnt, und es gab für ihn kein Zurück mehr. Aber er stand vorn und hatte nicht nur den Wissensvorsprung, sondern auch die Macht. Und er genoss es.
Der Leithammel im Publikum gehörte jener Agentur mit dem Pferd an. Das Plenum grummelte.