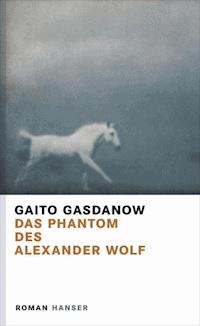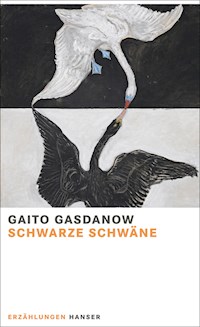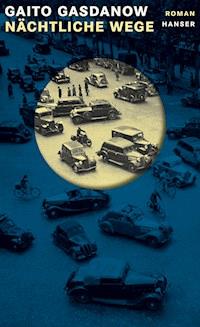
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tagsüber studiert er, nachts arbeitet der Erzähler als Taxichauffeur. Er verkehrt mit Dieben und Zuhältern, Selbstmördern und Clochards, Verrückten und Alkoholikern. Drei Halbweltdamen haben ihn zu ihrem Vertrauten gemacht: Raldy, die ehemalige Luxusprostituierte, Alice, ihre untreue Schülerin, und Suzanne mit dem Goldzahn. Sie hat den Sprung ins bürgerliche Leben geschafft und hätte mit Fedortschenko fast ihr Glück gefunden. Gasdanow, der im Exil sein Geld als Taxifahrer verdiente, erzählt vom Leben der Emigranten im Paris der dreißiger Jahre, zwischen brennender Nostalgie und einer heillosen Gegenwart. "Nächtliche Wege" ist ein Meisterwerk der literarischen Moderne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tagsüber studiert er und liest, nachts arbeitet er als Taxichauffeur. Er verkehrt mit Dieben und Zuhältern, Selbstmördern und Clochards, Verrückten und Alkoholikern. Drei Halbweltdamen haben ihn zu ihrem Vertrauten gemacht: Raldy, die ehemalige Luxusprostituierte, Alice, ihre untreue Schülerin, und Suzanne mit dem Goldzahn. Sie hat den Sprung ins bürgerliche Leben geschafft und hätte mit Fedortschenko fast ihr Glück gefunden. Wären da nicht seine bohrenden Fragen nach dem Sinn des Lebens. Gasdanow erzählt vom Leben der Emigranten in Paris, zwischen brennender Nostalgie und einer heillosen Gegenwart. Er beschreibt die Nachtseiten einer Gesellschaft, die ihre soziale und moralische Orientierung verloren hat. Ein Meisterwerk der literarischen Moderne.
Hanser E-Book
Gaito Gasdanow
Nächtliche Wege
Roman
Deutsch und mit einem Nachwort von Christiane Körner
Carl Hanser Verlag
Meiner Frau gewidmet
Vor einigen Tagen erblickte ich während der Arbeit, tief in der Nacht, auf der zu dieser Stunde völlig menschenleeren Place Saint-Augustin einen kleinen Karren von dem Typ, wie ihn gewöhnlich Invaliden benutzen. Es war ein dreirädriger Karren, konstruiert wie ein beweglicher Stuhl; vorne ragte eine Art Lenkstange empor, die vor und zurück bewegt werden musste, um eine mit den Hinterrädern verbundene Kette anzutreiben. Der Karren bewegte sich unglaublich langsam, wie im Traum, umfuhr den Kreis vieleckiger Leuchten und begann, den Boulevard Haussmann hinaufzurollen. Ich näherte mich, um ihn mir genauer anzusehen; eine vermummte, winzig kleine Greisin saß darin; man sah nur ihr verschrumpeltes dunkles Gesicht, fast nicht mehr menschlich, und eine magere Hand von derselben Farbe, die mühsam die Stange bewegte. Ich hatte schon mehrmals Leute wie sie gesehen, doch nur tagsüber. Wohin mochte diese Greisin nachts fahren, wie war sie hierher geraten, was konnte der Grund für ihre nächtliche Fahrt sein, wer mochte sie an welchem Ort erwarten?
Ich schaute ihr nach, geradezu nach Atem ringend vor Mitgefühl, dem Bewusstsein absoluter Unwiderruflichkeit und einer brennenden Neugier, die physischem Durst ähnelte. Natürlich erfuhr ich nicht das Geringste von ihr. Doch der Anblick des sich entfernenden Invalidenkarrens und sein langsames Knarren, deutlich hörbar in der unbeweglichen und kalten Luft dieser Nacht, fachte in mir jäh einen unersättlichen Wunsch an, der mich in den letzten Jahren kaum je verlassen hatte – viele fremde Leben kennenzulernen und zu versuchen, sie zu verstehen. Er war stets fruchtlos, denn ich hatte keine Zeit, mich ihm zu widmen. Doch das Bedauern, das ich im Bewusstsein dieser Unmöglichkeit verspürte, zog sich durch mein ganzes Leben. Wenn ich später darüber nachdachte, schien mir diese Neugier im Grunde unbegreiflich, weil sie auf fast unüberwindliche Hindernisse stieß, die gleichermaßen von meiner materiellen Lage wie von den natürlichen Unzulänglichkeiten meines Verstandes herrührten und außerdem daher, dass jede irgendwie abstrakte Erkenntnis meinerseits wiederum von meinem eigenen sinnlichen und ungestümen Daseinsgefühl behindert wurde. Außerdem war ich notorisch unfähig, Leidenschaften oder Interessen zu verstehen, die mir persönlich fremd waren; zum Beispiel musste ich mir jedes Mal regelrecht Zwang antun, um einen Menschen, der in hilfloser und blinder Leidenschaft sein ganzes Geld verspielte oder vertrank, nicht für einen Idioten zu halten, der weder Mitgefühl noch Mitleid verdiente – weil ich zufälligerweise keinen Alkohol vertrug und mich beim Kartenspiel tödlich langweilte. Ebenso wenig verstand ich Schürzenjäger, die ihr Leben lang von einer Umarmung zur nächsten eilten – doch hier lag ein anderer Grund vor, von dem ich lange nichts ahnte, bis ich den Mut hatte, das Ganze zu Ende zu denken, und begriff, dass es Neid war, eine umso erstaunlichere Einsicht, als ich in allem Übrigen völlig frei von diesem Gefühl war. Womöglich hätte auch in anderen Fällen eine kaum merkliche Veränderung bewirken können, dass die Leidenschaften, die ich nicht verstand, mich dann doch angezogen hätten, dass ich ihrer zerstörerischen Wirkung anheimgefallen wäre wie andere auch und mich Leute, denen diese Leidenschaften fremd waren, ihrerseits mitleidig betrachtet hätten. Und dass ich sie nicht verspürte, war vielleicht bloß ein Anzeichen dafür, dass mein Selbsterhaltungstrieb stärker ausgeprägt war als der meiner Bekannten, die ihren mageren Verdienst auf der Rennbahn verspielten oder in unzähligen Cafés vertranken.
Doch meine unparteiische Neugier auf alles, was mich umgab und was ich mit barbarischer Beharrlichkeit ganz und gar verstehen wollte, wurde darüber hinaus von Zeitmangel behindert, der wiederum daher rührte, dass ich ständig in bitterer Armut lebte und die Sorge um meinen Lebensunterhalt meine ganze Geistesgegenwart beanspruchte. Freilich schenkte mir derselbe Umstand einen gewissen Reichtum oberflächlicher Eindrücke, die ich nicht gewonnen hätte, wenn mein Leben in anderen Bahnen verlaufen wäre. Ich hatte keine vorgefasste Meinung über das, was ich sah, ich bemühte mich, Verallgemeinerungen und Folgerungen zu vermeiden: Doch gegen meinen Wunsch war es so, dass mich vor allem zwei Gefühle überkamen, wenn ich darüber nachdachte – Verachtung und Mitleid. Wenn ich mich heute dieser traurigen Erfahrung entsinne, glaube ich, dass ich mich vielleicht getäuscht habe und diese Gefühle unbegründet waren. Gegen ihr Aufkommen ließ sich jedoch jahrelang auf keine Weise angehen, und jetzt waren sie ebenso unwiderruflich, wie der Tod unwiderruflich ist, und ich wäre nicht imstande, sie aufzugeben; das wäre dieselbe seelische Feigheit, wie wenn ich die Erkenntnis aufgäbe, tief in mir lebe ein unstrittiger und unerklärlicher Drang zu töten, die restlose Verachtung fremden Eigentums und die Bereitschaft zu Betrug und Laster. Und die Gewohnheit, mit fiktiven, offenbar nur dank einer Vielzahl von Zufällen nie geschehenen Dingen umzugehen, machte diese Erfindungen für mich realer, als wenn sie tatsächlich geschehen wären; und sie alle hatten etwas besonders Verlockendes an sich, das anderen Dingen nicht eigen war. Nicht selten malte ich mir, wenn ich von der Nachtarbeit durch die toten Pariser Straßen nach Hause zurückkehrte, in allen Einzelheiten einen Mord aus, alles, was ihm vorausging, alle Gespräche, die Zwischentöne der Repliken, den Ausdruck der Augen – und als handelnde Personen dieser erfundenen Dialoge konnten Zufallsbekanntschaften auftreten oder Passanten, die mir aus irgendeinem Grund im Gedächtnis geblieben waren, oder schließlich ich selbst in der Rolle des Mörders. Am Ende eines solchen Gedankenspiels kam ich meistens zu demselben Fazit, das zur Hälfte ein Gefühl war – eine Mischung aus Ärger und Bedauern darüber, dass mir eine solch unerfreuliche und unnötige Erfahrung zufiel; und dass ich dank eines absurden Zufalls Taxichauffeur hatte werden müssen. Alles oder fast alles, was es an Schönem auf der Welt gab, war mir gleichsam fest verschlossen – und ich blieb allein, mit dem hartnäckigen Wunsch, trotz allem nicht von der endlosen und trostlosen menschlichen Abscheulichkeit überflutet zu werden, mit der meine Arbeit mich täglich in Berührung brachte. Sie war fast flächendeckend, selten gab es darin Platz für etwas Positives, und kein Bürgerkrieg ließ sich bezüglich Widerwärtigkeit und Fehlen von irgendetwas Gutem mit diesem schlussendlich doch friedlichen Dasein vergleichen. Natürlich lag das auch daran, dass die Pariser Bevölkerung bei Nacht sich stark von derjenigen bei Tag unterschied und aus ein paar Kategorien von Leuten bestand, die meistens ihrer Natur und ihrem Beruf nach schon im Voraus dem Untergang geweiht waren. Doch außerdem fühlten sich diese Leute generell nicht veranlasst, ihr Verhalten einem Chauffeur gegenüber zu mäßigen: ›Ist es nicht egal, was ein Mensch von mir denkt, den ich nie wiedersehe und der keinem meiner Bekannten etwas erzählen kann?‹ Auf diese Weise sah ich meine zufälligen Kunden so, wie sie tatsächlich waren, und nicht, wie sie nach außen wirken wollten – und diese Art Kontakt zeigte sie fast jedes Mal in einem schlechten Licht. Auch wenn ich noch so unvoreingenommen war, ich konnte nicht umhin zu bemerken, dass sie im Prinzip nur wenig voneinander trennte, und nach dieser kränkenden Gleichsetzung unterschied sich die Dame in Balltoilette, die auf der Avenue Henri-Martin wohnte, nicht wesentlich von ihrer weniger glücklichen Schwester, die wie ein Wachtposten, von einer Ecke zur anderen, das Trottoir ablief; und respektabel wirkende Leute, dem Aussehen nach aus Passy oder Auteuil, feilschten genauso erniedrigend mit dem Chauffeur wie der betrunkene Arbeiter von der Rue de Belleville; und trauen konnte man keinem von ihnen, davon musste ich mich mehr als einmal überzeugen.
Ich erinnere mich, wie ich am Anfang meiner Chauffeurstätigkeit einmal am Trottoir bremste, aufmerksam geworden durch das Stöhnen einer recht anständigen Dame von vielleicht fünfunddreißig Jahren mit geschwollenem Gesicht, sie lehnte an einem Prellpfosten, stöhnte und machte mir Zeichen; als ich herangefahren war, bat sie mich stockend, sie ins Hospital zu bringen; sie habe das Bein gebrochen. Ich hob sie hoch und legte sie ins Automobil; doch als wir angekommen waren, weigerte sie sich zu zahlen und erklärte dem Mann im weißen Kittel, der herausgekommen war, ich hätte sie mit dem Auto angefahren, und sie habe sich das Bein gebrochen, als sie daraufhin gestürzt sei. Und ich büßte nicht nur mein Geld ein, sondern riskierte auch noch, der so genannten unvollendeten fahrlässigen Tötung beschuldigt zu werden. Zum Glück begegnete der Mann im weißen Kittel ihren Worten mit Skepsis, und ich machte mich aus dem Staub. Und wenn mir späterhin Leute Zeichen machten, die neben einem auf dem Trottoir ausgetreckten Körper standen, trat ich nur stärker aufs Gas, fuhr weiter und dachte nicht daran anzuhalten. Der Herr im hocheleganten Anzug, der aus dem Hotel Claridge kam und den ich zur Gare de Lyon fuhr, gab mir hundert Franc, ich hatte kein Wechselgeld; er sagte, er werde den Schein drinnen wechseln, ging fort – und kam nicht wieder; es war ein respektabler, grauhaariger Herr mit einer guten Zigarre, der an einen Bankdirektor erinnerte; durchaus möglich, dass er wirklich einer war.
Einmal, ich hatte gerade eine Kundin gefahren, es war zwei Uhr nachts, machte ich das Licht im Automobil an und sah auf dem Rücksitz einen Damenkamm mit eingefassten Brillanten liegen, vermutlich künstliche, aber er sah jedenfalls wertvoll aus; ich war zu faul, auszusteigen, und beschloss, den Kamm später in Verwahrung zu nehmen. Unterdessen hielt mich eine Dame an – auf einer Avenue in der Nähe des Champ de Mars –, die eine sortie de bal aus Zobel trug, sie ließ sich zur Avenue Foch fahren; als sie ausgestiegen war, fiel mir der Kamm wieder ein, und ich sah über die Schulter. Der Kamm war fort, die Dame in der sortie de bal hatte ihn gestohlen, wie das ein Hausmädchen oder eine Prostituierte getan hätte.
Darüber und über viele andere Dinge dachte ich fast immer in denselben Morgenstunden nach. Im Winter war es noch dunkel, im Sommer wurde es um diese Zeit hell, und es war niemand mehr auf der Straße; sehr selten begegnete man Arbeitern – stummen Gestalten, die vorübergingen und verschwanden. Ich sah sie fast gar nicht an, weil ich ihre äußere Erscheinung auswendig kannte, wie ich die Viertel kannte, in denen sie wohnten, und die anderen, in denen sie nie waren. Paris ist in mehrere feste Zonen aufgeteilt; ich weiß noch, wie ein alter Arbeiter – ich war mit ihm zusammen in der Papierfabrik in der Nähe vom Boulevard de la Gare – mir sagte, er sei in den vierzig Jahren seines Pariser Lebens noch nie auf den Champs-Élysées gewesen, weil er, wie er erklärte, nie dort gearbeitet habe. In dieser Stadt – in den Armenvierteln – war noch eine Psychologie aus ferner Vergangenheit lebendig, geradezu aus dem 14. Jahrhundert, die neben der Gegenwart existierte, sich aber nicht mit ihr vermischte und kaum einmal mit ihr zusammentraf. Und ich dachte bisweilen, wenn ich beim Umherfahren an derartige Orte geriet, von deren Existenz ich früher nichts geahnt hatte, dass sich dort bis heute ein langsames Absterben des Mittelalters beobachten lasse. Es gelang mir aber selten, mich mehr oder weniger fortlaufend auf einen Gedanken zu konzentrieren, und mit der nächsten Drehung am Steuerrad war die schmale Straße wieder verschwunden, und vor mir erstreckte sich eine breite Avenue, gesäumt von Häusern mit Glastüren und Lift. Diese Flüchtigkeit der Eindrücke ermüdete die Aufmerksamkeit, und ich verschloss lieber die Augen vor allem und dachte an nichts. Bei dieser Arbeit konnte kein Eindruck, kein Reiz von Dauer sein – und so versuchte ich erst im Nachhinein, Details in meinem Gedächtnis aufzurufen und zu ergründen, die ich während meiner letzten Nachtfahrt gesehen hatte und die typisch für die spezifische Welt des nächtlichen Paris waren. Immer, jede Nacht traf ich mehrere Verrückte – meistens Leute kurz vor der Einlieferung in die Irrenanstalt oder das Krankenhaus, Alkoholiker und Clochards. In Paris gibt es Tausende solcher Leute. Ich wusste im Voraus, dass ein bestimmter Verrückter durch eine bestimmte Straße laufen würde und ein anderer durch ein anderes Viertel. Es war extrem schwierig, etwas über sie in Erfahrung zu bringen, denn was sie sagten, war meist völlig zusammenhanglos. Manchmal gelang es allerdings.
Ich erinnere mich, wie eine Zeitlang ein kleiner, unscheinbarer Mann mit schütterem Schnurrbart mein Interesse weckte, er war recht sauber gekleidet, vermutlich ein Arbeiter; ich sah ihn etwa einmal in der Woche oder alle zwei Wochen gegen zwei Uhr nachts immer an derselben Stelle auf der Avenue de Versailles, an der Ecke gegenüber vom Pont de Grenelle. Er stand meistens auf dem Fahrdamm, dicht am Trottoir, drohte mit der Faust und murmelte kaum hörbar Beschimpfungen. Verstehen konnte ich nur, wie er raunte: Bastard! … Bastard! Er war jahrelang ein vertrauter Anblick für mich – immer zur selben Stunde, immer am selben Fleck. Schließlich sprach ich ihn an, und nach langen Befragungen bekam ich seine Geschichte heraus. Er war Zimmermann, wohnte in der Nähe von Versailles, zwölf Kilometer von Paris entfernt, und konnte deshalb nur einmal in der Woche herkommen, am Samstag. Vor sechs Jahren war er eines Abends mit dem Besitzer des Cafés, das auf der anderen Straßenseite lag, aneinandergeraten, und der hatte ihm ins Gesicht geschlagen. Er war fortgegangen und hegte seitdem einen tödlichen Hass. Jeden Samstagabend fuhr er nach Paris; und weil er sich sehr vor dem Mann fürchtete, der ihn geschlagen hatte, wartete er, bis das Café zumachte, trank, um sich Mut zu machen, in den Bistros der Nachbarschaft ein Glas nach dem anderen, und wenn sein Feind schließlich das Lokal schloss, ging er dorthin, drohte dem unsichtbaren Besitzer mit der Faust und murmelte flüsternd Beschimpfungen; er war so verängstigt, dass er es niemals wagte, mit erhobener Stimme zu sprechen. Die ganze Woche über, wenn er in Versailles arbeitete, wartete er ungeduldig auf den Samstag, dann zog er seine Feiertagskleidung an und fuhr nach Paris, um nachts, auf der menschenleeren Straße, seine kaum hörbaren Beleidigungen auszustoßen und zum Café hin zu drohen. Er blieb stets bis zum Morgengrauen in der Avenue de Versailles – und dann lief er in Richtung Porte de Saint-Cloud, hielt von Zeit zu Zeit inne, wandte sich um und schüttelte seine kleine, dürre Faust. Ich suchte später das Café seines Beleidigers auf und traf hinter der Theke eine üppige Rothaarige an, die über das Geschäft klagte, wie es alle taten. Ich fragte, ob sie das Café schon lange führe, wie sich herausstellte, waren es drei Jahre, sie hatte es nach dem Tod des früheren Eigentümers übernommen, der an einem Schlaganfall gestorben war.
Gegen vier Uhr morgens fuhr ich, um ein Glas Milch zu trinken, gewöhnlich zu einem großen Café gegenüber von einem der Bahnhöfe, wo ich wirklich jeden kannte, angefangen von der Besitzerin, einer alten Dame, die mit ihrem künstlichen Gebiss mühsam Sandwichs kaute, bis zu einer kleinen älteren Frau in Schwarz, die sich nie von ihrer großen Einkaufstasche aus Wachstuch trennte, sie schleppte sie immer mit sich herum; ich schätzte sie auf etwa fünfzig. Meistens saß sie still in der Ecke, und ich konnte mir keinen Reim darauf machen, was sie um diese Zeit hier tat: Sie war immer allein. Ich fragte die Besitzerin; die Besitzerin antwortete, die Frau arbeite wie die anderen auch. Anfangs wunderten mich solche Dinge, doch dann erfuhr ich, dass auch ältere und ungepflegte Frauen ihre Kundschaft hatten und häufig nicht schlechter verdienten als die anderen. Um dieselbe Uhrzeit tauchte regelmäßig eine sturzbetrunkene magere Alte mit zahnlosem Mund auf, die beim Betreten des Cafés schrie: »Kein Stück!«, und wenn sie später das Glas Weißwein bezahlen sollte, das sie getrunken hatte, wunderte sie sich jedes Mal und sagte zum Garçon: »Also wirklich, du übertreibst.« Ich bekam den Eindruck, dass sie gar keine anderen Wörter kannte, jedenfalls sprach sie keine anderen aus. Wenn sie auf das Café zukam, sagte irgendjemand nach einem Blick über die Schulter unweigerlich: »Da kommt Keinstück.« Doch eines Tages traf ich sie im Gespräch mit einem stockbetrunkenen zerlumpten Mann an, der sich mit beiden Händen an der Theke festhielt und hin und her schwankte. Sie richtete folgende – aus ihrem Munde sehr überraschende – Worte an ihn: »Ich schwöre dir, Roger, das ist die Wahrheit. Ich habe dich geliebt. Aber wenn du in so einem Zustand bist …« Und dann unterbrach sie ihren Monolog und schrie von neuem: »Kein Stück!« Schließlich verschwand sie eines schönen Tages, nachdem sie ein letztes Mal »Kein Stück!« geschrien hatte, und tauchte nicht mehr auf; als ich mich ein paar Monate später nach ihr erkundigte, erfuhr ich, das sie gestorben war.
Zwei Mal in der Woche erschien ein Mann mit Baskenmütze und Pfeife in dem Café, der M. Martini genannt wurde, weil er stets Martini bestellte, er kam meistens zwischen zehn und elf Uhr abends. Schon um zwei Uhr nachts war er völlig betrunken, gab jedem, der wollte, ein Getränk aus, und um drei Uhr, wenn er sein Geld verbraucht hatte – in der Regel etwa zweihundert Franc –, bettelte er die Besitzerin an, ihm noch einen Martini auf Pump zu geben. Dann führte man ihn meist aus dem Café. Er kam zurück, man führte ihn wieder heraus, und dann ließen ihn die Garçons einfach nicht mehr herein. Er empörte sich, zuckte die abfallenden Schultern und sagte:
»Ich finde, das ist ein Witz. Ein Witz. Ein Witz. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.«
Er war Lehrer für Griechisch, Latein, Deutsch, Spanisch und Englisch, lebte draußen vor der Stadt, hatte eine Frau und nicht weniger als sechs Kinder. Um zwei Uhr nachts trug er seinen Zuhörern, gewöhnlich Zuhälter oder Clochards, philosophische Theorien vor und stritt erbittert mit ihnen; sie lachten ihn aus, ich weiß noch, wie sie grölten, als er ihnen Schillers Handschuh auf Deutsch rezitierte, sie amüsierten sich natürlich nicht über den Inhalt, von dem sie keine Ahnung hatten, sondern darüber, wie lächerlich die deutsche Sprache klang. Ich nahm ihn einige Male beiseite und riet ihm, heimzufahren, aber er weigerte sich stets, und alle meine Argumente bewirkten nichts; er war im Grunde zufrieden mit sich und zu meiner Überraschung sehr stolz darauf, ganze sechs Kinder zu haben. Einmal unterhielten wir uns, als er noch halbwegs nüchtern war; er warf mir vor, eine bürgerliche Moral zu haben, und ich wurde wütend und schrie ihn an:
»Hol’s der Teufel, begreifen Sie denn nicht, dass Sie im Hospital und im Delirium enden und nichts Sie davor retten kann?«
»Sie haben das Wesen der gallischen Philosophie nicht erfasst«, antwortete er.
»Was?«, fragte ich irritiert.
»Ja«, bekräftigte er, während er die Pfeife stopfte, »das Leben wird uns zum Vergnügen geschenkt.«
Erst da bemerkte ich, dass er betrunkener war, als ich anfangs angenommen hatte; wie sich herausstellte, war er an dem Tag eine Stunde früher erschienen als sonst, womit ich nicht gerechnet hatte.
Mit den Jahren schwand seine Widerstandskraft gegen den Alkohol ebenso wie seine Mittel, man ließ ihn überhaupt nicht mehr ins Café; und als ich ihn das letzte Mal sah, hetzten Garçons und Zuhälter ihn und einen Clochard aufeinander und versuchten, sie zu einem Kampf anzustacheln, dann stieß man sie beide zu Boden, und M. Martini rollte übers Trottoir und von dort auf den Fahrdamm, wo er eine Zeitlang liegenblieb – im Winterregen, im eiskalten nassen Schlamm.
»Das nennen Sie also, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, gallische Philosophie«, sagte ich, während ich ihm aufhalf.
»Ein Witz. Ein Witz. Ein guter Witz – das ist alles, was ich dazu sagen kann«, plapperte er wie ein Papagei.
Ich setzte ihn an einen Tisch.
»Er hat kein Geld«, sagte ein Garçon zu mir.
»Wenn’s nur das wäre!«, antwortete ich.
M. Martini wurde plötzlich nüchtern.
»Jeder Fall von Alkoholismus hat seinen Hintergrund«, sagte er unerwartet.
»Das mag ja sein«, antwortete ich zerstreut. »Aber Sie zum Beispiel, warum trinken Sie?«
»Vor Kummer«, sagte er. »Meine Frau verachtet mich, sie hat meinen Kindern beigebracht, mich zu verachten, und der einzige Zweck meines Daseins besteht für sie darin, dass ich ihnen Geld gebe. Ich ertrage das nicht und gehe deshalb abends aus dem Haus. Ich weiß, dass alles vor die Hunde geht.«
Ich betrachtete seinen schmutzstarrenden Anzug, die Abschürfungen im Gesicht, die kleinen Waisenaugen unter der Baskenmütze.
»Ich glaube, da ist nichts mehr zu machen«, sagte ich.
Die Frauen im Café kannte ich alle, denn sie hielten sich dort stundenlang auf. Es waren ganz unterschiedliche Typen darunter, doch ihre Individualität behielten sie nur am Anfang ihrer Laufbahn, später, nach einigen Monaten, wenn sie den Beruf erlernt hatten, glichen sie den anderen aufs Haar. Die meisten waren Hausmädchen gewesen, doch es gab Ausnahmen – Verkäuferinnen, Stenographistinnen, ziemlich selten Köchinnen, und sogar die ehemalige Besitzerin eines kleinen Delikatessengeschäfts, deren Geschichte alle kannten: Sie hatte es mit einer hohen Summe versichert und dann in Brand gesteckt, und zwar so ungeschickt, dass die Versicherungsgesellschaft sich weigerte zu zahlen; am Ende lag das Geschäft in Schutt und Asche, aber Geld bekam sie nicht. Und da beschlossen sie und ihr Mann, sie solle zunächst einmal auf diese Weise arbeiten, und zu einem späteren Zeitpunkt würden sie wieder ein Geschäft eröffnen. Sie war eine recht attraktive Frau um die dreißig; doch das Gewerbe nahm sie so gefangen, dass bereits nach einem Jahr nicht mehr die Rede davon war, wieder ein Geschäft zu eröffnen, umso weniger, als sie einen ständigen Freier fand, einen respektablen und wohlhabenden Mann, der ihr Geschenke machte und sie als seine zweite Ehefrau ansah; er ging samstags und mittwochs abends mit ihr aus, zweimal pro Woche, und an diesen Tagen arbeitete sie also nicht. Meine ständige Nachbarin an der Theke war Suzanne, eine kleine, stark geschminkte Blondine mit einer großen Vorliebe für besonders prächtige Kleider, Armbänder und Ringe; einen Schneidezahn im Oberkiefer hatte sie vergolden lassen, und das gefiel ihr so, dass sie sich alle paar Minuten in ihrem kleinen Spiegelchen betrachtete, nach Hundeart die Oberlippe hochgezogen.
»Ist doch wirklich schön«, sagte sie eines Tages an mich gewandt, »oder?«
»Ich kann mir nichts Alberneres vorstellen«, sagte ich.
Seitdem hegte sie mir gegenüber eine gewisse Feindseligkeit, und gelegentlich wurde sie ausfallend. Besonders verächtlich reagierte sie darauf, dass ich immer Milch trank.
»Immer bloß Milch«, sagte sie drei Tage später zu mir, »willst du vielleicht meine?«
Sie war sehr für Veränderungen, manchmal verschwand sie für ein paar Nächte – das bedeutete, dass sie in einem anderen Viertel arbeitete, dann wieder tauchte sie einen ganzen Monat nicht auf, und als ich den Garçon fragte, ob er nicht wisse, was mit ihr sei, antwortete er, sie habe eine feste Stelle angenommen. Er sagte es anders, nämlich, sie habe jetzt eine feste Adresse – und es stellte sich heraus, dass sie im größten Bordell von Montparnasse arbeitete. Doch auch dort hielt es sie nicht, sie blieb nie lange an einem Ort. Sie war noch sehr jung, zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahre alt.
Jede Nacht, von acht Uhr abends bis sechs Uhr morgens, saß die Besitzerin des Cafés, das mehrere Millionen wert war, in eigener Person an der Kasse. Dreißig Jahre lang schlief sie tagsüber und arbeitete nachts; tagsüber vertrat sie ihr Mann, ein ehrbarer Alter in gutem Anzug. Sie hatten keine Kinder, anscheinend nicht einmal nahe Verwandte, und widmeten ihr ganzes Leben dem Café, wie andere ihr Leben der Wohltätigkeit, dem Dienst an Gott oder einer Beamtenlaufbahn widmen; sie fuhren nie weg, machten nie Urlaub. Einmal kam die Besitzerin allerdings zwei Monate lang nicht zur Arbeit – sie litt an einem Magengeschwür und lag die ganze Zeit im Bett. Sie besaß schon längst ein riesiges Vermögen, konnte jedoch das Arbeiten nicht lassen. Äußerlich glich sie einer liebenswerten Hexe. Ich unterhielt mich mehrere Male mit ihr, und einmal wurde sie zornig auf mich, weil ich sagte, ihr Leben sei im Grunde ebenso vergeudet wie das von M. Martini. »Wie können Sie mich mit diesem Alkoholiker vergleichen?«, und mir fiel mit einiger Verspätung ein, dass nur die allerwenigsten Menschen – vielleicht einer von hundert – imstande sind, ein halbwegs unparteiisches Werturteil anzuerkennen, vor allem, wenn es sie persönlich betrifft. Madame Duval selbst betrachtete ihr Leben als abgeschlossen und von einem bestimmten Sinn erfüllt – und in gewisser Hinsicht hatte sie recht, es war wirklich abgeschlossen und in seiner kompletten Zwecklosigkeit sogar vollendet. Was immer man hätte unternehmen können, jetzt war es zu spät. Doch das hätte sie nie eingesehen. »Wenn Sie sterben, Madame …«, wollte ich sagen, hielt mich aber zurück, weil die im Grunde abstrakte Frage es in meinen Augen nicht wert war, unser gutes Verhältnis aufs Spiel zu setzen. Und ich sagte, vielleicht sei ich im Irrtum und mein Eindruck komme daher, dass ich mich zu einer solchen Leistung über dreißig Jahre hinweg nicht fähig fühlte. Das besänftigte sie, und sie antwortete, natürlich könne das bei weitem nicht jeder schaffen, aber dafür sei sie heute einer Sache sicher: Ihren Lebensabend würde sie einmal in Ruhe verbringen – als stünde sie in ihrem jetzigen Alter, mit ihren dreiundsechzig Jahren nicht am Ende ihres Lebens, sondern am Anfang. Auch darauf hätte ich viel erwidern können, doch ich schwieg.
Später wurde mir klar, dass sie keineswegs eine Ausnahme war, ihr Fall war ausgesprochen typisch; ich kannte Millionäre mit schmutzigen Händen, die sechzehn Stunden am Tag arbeiteten, alte Chauffeure, die rentable Häuser und Grundstücke besaßen und trotz Kurzatmigkeit, Sodbrennen, Hämorrhoiden und eines insgesamt katastrophalen Gesundheitszustands für dreißig Franc am Tag weiterarbeiteten; bekämen sie unterm Strich nur noch zwei Franc am Tag heraus, würden sie trotzdem arbeiten, bis sie eines schönen Tages nicht mehr aus dem Bett hochkämen, und das wäre dann ihr kurz bemessener Urlaub vor dem Tod. Denkwürdig war auch ein Garçon in diesem Café: Er war ein glücklicher Mensch. Das erfuhr ich eines Tages während einer kurzen philosophischen Unterhaltung, die ein älterer Mann unbestimmten Aussehens begonnen hatte, vermutlich ein ehemaliger Chauffeur. Er redete über die Lotterie und sagte, sie ähnele der Sonne; wie sich die Sonne um die Erde drehe, so rotiere auch das Lotterierad.
»Die Sonne dreht sich nicht um die Erde«, sagte ich zu ihm, »das ist falsch; und die Lotterie ähnelt der Sonne nicht.«
»Die Sonne dreht sich nicht um die Erde?«, fragte er ironisch. »Wer hat dir das gesagt?«
Er sprach völlig im Ernst; da fragte ich ihn, ob er überhaupt lesen könne, er war gekränkt und beharrte darauf zu erfahren, wie ich denn über die Himmelsmechanik besser informiert sein könne als er. Die Autorität von Wissenschaftlern erkannte er nicht an, er versicherte, sie wüssten nicht mehr als wir. Hier mischte sich der Garçon ins Gespräch und sagte, das spiele alles keine Rolle, eine Rolle spiele nur, ob der Mensch glücklich sei.
»So einen habe ich noch nie gesehen«, sagte ich.
Und da antwortete er mit einer gewissen Feierlichkeit, dass sich mir endlich die Gelegenheit biete, denn in diesem Augenblick sähe ich einen glücklichen Menschen.
»Was?«, fragte ich verblüfft. »Sie halten sich für einen vollkommen glücklichen Menschen?«
Er erklärte mir, das sei so. Offenbar hatte er immer einen Traum gehabt – zu arbeiten und seinen Lebensunterhalt zu verdienen –, und dieser Traum hatte sich erfüllt: Er war vollkommen glücklich. Ich betrachtete ihn aufmerksam: Er stand mit seiner blauen Schürze, die Ärmel hochgekrempelt, hinter der feuchten Zinktheke; seitwärts erklang Martinis Stimme: »Ein Witz, ein Witz, ein Witz«, rechts wiederholte jemand heiser: »Ich sag dir, das ist mein Bruder, kapiert?« Neben meinem Gesprächspartner, der überzeugt davon war, dass die Sonne sich um die Erde drehte, erklärte eine dicke Frau – das Weiß ihrer Augen überzogen von einem dichten roten Adernetz – ihrem Beschützer, in diesem Viertel könne sie nicht arbeiten: »Was ich auch anstelle, ich finde keinen.« Mitten drin stand der Garçon Michel; und sein gelbes Gesicht war tatsächlich glücklich. »Na, ich gratuliere, mein Lieber«, sagte ich zu ihm.
Und auch als ich wieder im Auto saß, gingen mir unablässig seine Worte durch den Kopf: »Ich hatte nur einen Traum, immer nur einen: meinen Lebensunterhalt zu verdienen.« Das war am Ende noch trauriger als Martini oder Madame Duval oder die dicke Marcelle, die in Montparnasse keine Freier fand; und ihre Geschäfte gingen tatsächlich schlecht, bis ein gescheiter Mensch ihr sagte, ohne Zweifel werde in einem anderen Viertel, nämlich im Quartier des Halles, eine weniger raffinierte Kundschaft ihre Schönheit zu schätzen wissen; und sie begann tatsächlich dort zu arbeiten; ein halbes Jahr später traf ich sie in einem Café am Boulevard de Sébastopol, sie hatte noch mehr Fett angesetzt und war viel besser gekleidet. Von dem glücklichen Garçon erzählte ich einem meiner ständig alkoholisierten Gesprächspartner, der Platon genannt wurde – wegen seiner Neigung zur Philosophie; der Mann, noch nicht alt, verbrachte jede Nacht in dem Café, an seinem Platz an der Theke, stets mit einem Glas Weißwein vor sich. Er hatte wie Martini an der Universität studiert, eine Zeitlang in England gelebt, war mit einer bildhübschen Frau verheiratet, Vater eines prächtigen Jungen und materiell gut gestellt; ich weiß nicht, wie und warum das alles sehr rasch zur Vergangenheit wurde, doch er verließ seine Familie, seine Verwandten brachen den Kontakt ab, und er war allein. Er hatte eine freundliche und höfliche Art, war ziemlich gebildet, beherrschte zwei Fremdsprachen, hatte viel gelesen und seinerzeit sogar eine philosophische Dissertation verfasst, ich weiß nicht mehr, worüber, womöglich gar über Böhme; und erst in letzter Zeit ließ sein Gedächtnis nach, und man merkte ihm die verheerenden Folgen des Alkohols deutlich an – anders als in den ersten Jahren unserer Bekanntschaft. Er lebte von einer winzigen Summe, die seine Mutter ihm heimlich gab – sie reichte nur für ein Sandwich pro Tag und den Weißwein.
»Und Ihre Wohnung?«, fragte ich einmal.
Er zuckte die Achseln und antwortete, dass er dafür überhaupt nichts zahle, und als der Hausbesitzer ihm mit Repressalien gedroht habe, habe er, Platon, geantwortet, er werde, wenn der andere etwas gegen ihn unternehme, die Zündschnur einer Dynamitpatrone anstecken und das Haus in die Luft sprengen und damit in gewisser Weise den Forderungen des Hausbesitzers – der ebenfalls dort lebte – entgegenkommen, denn der müsse sich dann über keinerlei Zahlungen von keinerlei Mietern je wieder den Kopf zerbrechen. Platon redete leise, absolut ruhig, doch mit solch unbeirrbarer Aufrichtigkeit und Überzeugung, dass ich keinen Moment an seiner Entschlossenheit zweifelte, das Gesagte in die Tat umzusetzen. Am merkwürdigsten fand ich indessen, dass Platon antiquierte, aber felsenfeste Ansichten vom Aufbau des Staates hatte, der sich nach seinen Worten auf drei Prinzipien stützen sollte: Religion, Familie, König. »Und der Alkohol?«, rutschte es mir heraus. Er antwortete völlig ruhig, das sei ein zweitrangiger, ja nicht einmal notwendiger Faktor. »Sie zum Beispiel trinken nicht«, sagte er, »doch das hindert mich nicht daran, Sie als normalen Menschen zu betrachten; schade natürlich, dass Sie kein Franzose sind, aber das ist nicht Ihre Schuld.« Dem glücklichen Garçon begegnete er mit Skepsis und sagte, auf derart primitive Wesen seien unsere Vorstellungen von Glück nicht übertragbar; er räumte aber ein, der Garçon könne auf seine Art glücklich sein, »wie ein Hund, ein Vogel, ein Affe oder ein Nashorn«; gegen Morgen fing Platon an, ungereimtes Zeug zu reden – ein sonderbares Delirium, überraschend ruhig, aber die Begriffe gerieten ihm durcheinander, er verglich Hamlet mit Poincaré und Werther mit dem Finanzminister, einem alten Fettwanst, der, in welcher Hinsicht auch immer, das ideale Gegenbild zu Werther war. Ich wusste, wie der Minister aussah, weil ich einmal mit meinem Auto in der Schlange vorm Senat gewartet hatte, wo eine Nachtsitzung stattfand; alle meine Kollegen hofften, die Senatoren chauffieren zu können, es war schon kurz nach vier Uhr morgens. Doch im letzten Moment fuhren ein paar Autobusse auf den Hof, die die Senatoren heimbrachten. Der letzte Bus mit der Aufschrift »Fahrpreis 3 Franc« entfernte sich gerade, da trat der Finanzminister auf die Straße und rannte dem davonfahrenden Bus aus Leibeskräften hinterher; ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen, aber meine Kollegen überschütteten ihn wegen seines Geizes mit einer Flut von Schimpfwörtern. Seit jener Nacht – ich sah ihn ganz aus der Nähe – habe ich deutlich seine Gestalt vor Augen, den Bauch, das Keuchen, den aufgeknöpften Pelz, den er trug, und die besorgte, stumpfsinnige Miene.
Über den glücklichen Garçon sprach ich mit Platon in einer Nacht von Samstag auf Sonntag. Das war die unruhigste Nacht in der Woche; im Café tauchten lauter zufällige Besucher auf, die meisten betrunken. Ein schwermütiger Alter mit grauem Schnauzbart sang im Falsett bretonische Lieder; zwei Clochards stritten sich über einen Vorfall, der, soweit ich verstand, ein Jahr zurücklag; eine Stammkundin des Cafés, eine außergewöhnlich hässliche Frau mit flachem Froschgesicht, die aber als gute Arbeiterin galt, rückte ganz dicht an einen etwa Fünfzigjährigen mit dem Band der Ehrenlegion heran und murmelte – jemand hatte sie in dieser Nacht betrunken gemacht – immer wieder: »Versteh mich doch, versteh mich doch«, und ein ganz unbeteiligter Mann vom Typ des energiegeladenen Trinkers, der ihr zuhörte, hielt es schließlich nicht mehr aus und sagte: »Da gibt’s nichts zu verstehen, du bist einfach ein Stück Dreck und weiter nichts.« Ein hagerer älterer Mann drängte sich mit einem Ausdruck echter Besorgnis in den Augen durch die Menge und bat Madame Duval, ihm zu erlauben, eine der Säulen im Café hochzuklettern – nur bis zur Decke und zurück, »Sie sehen, Madame, ich bin absolut korrekt. Nur ein Mal, Madame, nur ein Mal …«, und der kräftige Oberkellner führte ihn hinaus und schlug ihm auf der Straße vor, es doch mit dem Laternenpfahl zu versuchen. Draußen, jenseits des beschlagenen Fensters, gingen von Zeit zu Zeit zwei Polizisten vorüber, »wie der Schatten von Hamlets Vater«, sagte ich zu Platon. Dann verschwanden die samstäglichen Cafégäste allmählich in der nebligen und kalten Morgendämmerung; trübe brannten die Laternen über den Trottoirs, in den Kurven des rutschigen Fahrdamms zischten die Reifen der seltenen Automobile.
»Jeden Morgen danke ich dem Herrgott dafür«, sagte Platon, als wir zusammen das Café verließen, »dass Er die Welt geschaffen hat, in der wir leben.«
»Sind Sie sicher, dass Er wirklich gut daran getan hat?«
»Davon bin ich völlig überzeugt, wie elend und betrunken ich auch sein mag«, sagte er mit seiner üblichen Gelassenheit.
Ich begleitete ihn bis zur Avenue du Maine, unterwegs sprach er von Toulouse-Lautrec und Gérard de Nerval, und gleich stellte ich mir Nervals entsetzlichen Tod vor, die stille kleine Straße in der Nähe der Place du Châtelet, seinen baumelnden Körper, den gleichsam von einer monströsen Phantasie erdachten schwarzen Hut auf dem Kopf des Erhängten.
Ich hatte hin und wieder die Gelegenheit, ein paar Stunden in dem Café zu verbringen, wenn ich mein Auto in Erwartung des Morgenzugs um halb sechs am Bahnhof parkte; und in der Zeit von zwei Uhr nachts bis zur Ankunft des Zuges, wenn die anderen Chauffeure Karten spielten oder in ihren Autos schliefen, ging ich lieber in das Café oder machte, wenn das Wetter gut war, einen Spaziergang; nur dieses erzwungene Nichtstun gab mir die Möglichkeit, die Kundschaft des Cafés richtig kennenzulernen. Es trug fast immer Früchte; jede Nacht ging ich etwas stärker verseucht von dort weg, und trotzdem brauchte ich mehrere Jahre, bis ich die Nachtbewohner zum ersten Mal in Gedanken als lebendes menschliches Aas bezeichnete – ich dachte früher besser von den Menschen und hätte mir sicher viele rosige Vorstellungen bewahrt, die mir jetzt nie mehr zur Verfügung stehen werden, ganz als hätte ein stinkendes Gift denjenigen Teil meiner Seele weggeätzt, der für sie vorgesehen war. Und die düstere Dichtung vom menschlichen Verfall, in der ich früher einen speziellen und tragischen Zauber sah, hörte für mich auf zu existieren, und ich glaube jetzt, dass sie ursprünglich auf Unwissen und auf eben jenem Irrtum beruhte, der für Gérard Nerval, den Platon in unserem Morgengespräch erwähnt hatte, so unwiderruflich gewesen war. Und die Menschen, die sie schufen und die es dorthin zog, wie es sie in den Tod zog, konnten sich nicht einmal sterbend damit trösten, dass sie die Dinge so gesehen hatten, wie sie tatsächlich waren und wie sie sie beschrieben hatten; sie waren so fraglos in ihrer Täuschung befangen, wie der respektable Herr fraglos unrecht hatte, wenn er die ehemalige Besitzerin des Delikatessengeschäfts, in die er verliebt war und mit der er mittwochs und samstags ausging, als seine zweite Ehefrau ansah.
Und vielleicht sollte man zwei Freier von Suzanne beneiden, die ich eines Tages sah; beide waren gut gekleidet und offenbar wohlhabend, und beide betraten das Café mit dem gleichen Lächeln und stützten sich auf die gleichen weißen Stöcke; sie waren blind. Suzanne setzte sich zu ihnen, und ich betrachtete die drei aus der Ferne und stellte mir vor, wie Suzannes Reden und Lachen aus der Dunkelheit zu ihnen drang. Dann gingen sie zu dritt ins Hotel gegenüber, und Suzanne führte sie behutsam – immerhin waren es Kunden – über den Platz. Nach einer Stunde kamen sie zurück; die Blinden blieben noch an einem Tisch sitzen, Suzanne trat an die Theke und stellte sich neben mich.
»Immer noch Milch?«, fragte sie.
»Sie konnten deine Schönheit gar nicht schätzen«, sagte ich, ohne zu antworten, »man denke nur, selbst deinen Goldzahn haben sie nicht gesehen.«
»Stimmt«, antwortete sie, und plötzlich sagte sie mit überraschender und kindlicher Neugierde im Blick, natürlich könnten sie sie nicht sehen, aber sie hätten sie stattdessen überall betastet, und das habe sie gekitzelt. Als ich an ihnen vorbeiging, blieb ich einen Moment stehen; auf ihren rosigen Gesichtern lag jenes besondere schutzlose Lächeln, das nur Blinden eigen ist.
Wie in früheren Phasen meines Lebens gelang es mir auch in Paris nur selten und für kurze Zeit, die Realität, in der ich leben musste, von außen zu betrachten, als würde ich an dem Geschehen gar nicht teilhaben. Das war stets, wie die Erinnerung an manche Landschaften, das Resultat einer visuellen Erkenntnis, die danach für immer in meinem Gedächtnis haftenblieb; und wie die Erinnerung an einen Geruch war sie von einer ganzen Welt anderer Dinge umgeben, die ihre Entstehung begleiteten. Meistens ging sie nicht aus einer langen Kette von Erscheinungen hervor, sondern gesellte sich ihnen nur hinzu, und das bot die Möglichkeit, die unterschiedlichen Leben zu vergleichen, die ich nacheinander zu führen gezwungen war und die mir fern und traurig vorkamen, unabhängig davon, ob etwas jetzt oder vor vielen Jahren geschah. Und dann stand mir die tragische Absurdität meiner Existenz so plastisch vor Augen, dass ich, nur in diesen Momenten, klar und deutlich Dinge begriff, über die man nie nachdenken sollte, weil sie Verzweiflung, Irrenhaus oder Tod nach sich ziehen. Doch merkwürdigerweise kam mir nach solchen Überlegungen nie der Gedanke an Selbstmord, der mir absolut fremd war, immer, auch in den schrecklichsten Augenblicken meines Lebens; und ich wusste, dass er nicht mit dem ständigen und brennenden Wunsch zu verwechseln war, der jedes Mal aufkam, wenn der Metrozug aus dem Tunnel in die Station einfuhr – sich blitzschnell von der festen steinernen Bahnsteigkante abzustoßen und vor den Zug zu werfen, mit derselben Bewegung, mit der ich mich in der Badeanstalt vom Sprungbrett ins Wasser warf. Aber Tausende von Zügen passierten die Station, und jedes Mal, wenn ich zum Bahnsteig hinunterstieg, verspürte ich den absurden Wunsch, zu lächeln und zu mir selbst »Da wären wir!« zu sagen, in einem Ton, der Spott und gleichzeitig die Zuversicht ausdrückte, dass alle künftigen Metrozüge mich ebenso passieren würden wie bisher. Dieses Gefühl – den Drang, die eine und dieses Mal wirklich letzte Bewegung zu machen – kannte ich schon lange; es erfasste mich auch, wenn ich im Auto an den wenig stabilen Geländern einer Seine-Brücke vorbeifuhr und dachte: jetzt ein bisschen Gas geben, das Steuer herumreißen – und alles ist vorbei. Und ich bewegte das Steuer ein paar Zoll und korrigierte es gleich wieder, und das Auto, nach einem Ruck zum Geländer hin, verfolgte den alten Kurs und setzte seine bisherige ungefährliche Fahrt fort. Jenes Mal dagegen – in der glutheißen und schwarzen Nacht Konstantinopels –, als mir real die Gefahr drohte, vom fünften Stock in die Tiefe zu stürzen, hatte ich dieses Gefühl nicht, stattdessen hatte ich das unwiderstehliche Verlangen, mich zu retten, koste es, was es wolle. Ich war damals in eine verzweifelte Lage geraten. Im asiatischen Teil der Stadt gab es einen riesigen Brand, und aus meinem Fenster im dritten Stock sah ich nur einen dichten roten Schein; das Haus, in dem ich wohnte, lag in Pera, mitten im europäischen Viertel. Ich beschloss, aufs Dach zu steigen, erreichte es auch ziemlich leicht, und zwar von einer steinernen Plattform aus, die auf allen vier Seiten in Augenhöhe von Mauern umgeben war. Ich schwang mich auf das annähernd flache Ziegeldach und schritt in die Richtung, wo meiner Berechnung nach der Brand gut zu sehen sein müsste. Der Schein war wirklich ein wenig heller, und etwas zeichnete sich schwarz darin ab, aber trotzdem waren nicht einmal die Flammen zu erkennen. Nach etwa zehn Minuten machte ich kehrt. Die Nacht war sehr dunkel, es gab weder Sterne noch Mond, ich ging aufs Geratewohl und kam nicht auf die Idee, dass ich mich irren könnte. Schließlich gelangte ich zu der Plattform und ließ mich, den Rücken nach außen, hinab. Als die Dachkante auf der Höhe meiner Augen war, streckte ich die Fußspitzen aus; aber da war kein Boden unter mir. Das wunderte mich, ich ließ mich weiter hinab, bis ich schließlich an den ausgestreckten Armen hing, mit den Fingern an die Ziegel geklammert, erreichte aber den Boden wieder nicht. Da drehte ich mühsam den Kopf zur Seite und schaute nach unten: Ganz weit weg, in, wie mir schien, entsetzlicher Tiefe brannte matt eine Laterne überm Straßenpflaster; ich hing an der hinteren, fensterlosen und absolut glatten Hauswand, über einem fünfstöckigen Abgrund. Mein Hemd war unglaublich schnell klatschnass. Ich hielt mich nur mit den Fingern an den Ziegeln fest – sofort kamen sie mir rutschig und wackelig vor – und konnte auf niemandes Hilfe zählen. Im ersten Moment verspürte ich ein maßloses Grauen. Dann begann ich, mich hochzuarbeiten. Zuvor hatte ich in Griechenland mit einem Kameraden trainiert, um als Akrobat im Zirkus aufzutreten, und was für die meisten Leute unmöglich gewesen wäre, fiel mir vergleichsweise leicht. Gesicht und Brust an die Mauer gedrückt, zog ich meinen Körper empor, fasste bereits mit der ganzen Hand, erst rechts, dann links, die Ziegel, dann hob ich langsam, ohne jenes rhythmische Abstoßen, das bei gymnastischen Übungen fast unabdingbar ist, das ich aber jetzt nicht riskieren konnte, weil mir, verlöre ich auch nur für eine Sekunde das Gleichgewicht, der Absturz drohte, den rechten Ellbogen und zog mich gleich um mehrere Zentimeter hoch – der Rest war leicht; aber ich kroch erst noch eine ganze Strecke übers Dach, um von der Kante wegzukommen. Dann fand ich problemlos die Plattform und ging in mein Zimmer hinunter: Aus dem Spiegel sah mich mein Gesicht an, verzerrt, kalkbeschmiert, die Augen vollkommen fremd. Das alles liegt viele Jahre zurück, doch ich erinnere mich an den Blick von oben auf das matte Laternenlicht über den unregelmäßigen Pflastersteinen – eine jener ewigen, in tiefer Nacht versunkenen Stadtlandschaften, die ich später so oft in Paris sah. Und in seltenen und jäh aufflammenden lichten Momenten schien es mir völlig unerklärlich, dass ich nachts im Auto diese riesenhafte fremde Stadt durchquerte, die vorbeifliegen und verschwinden müsste wie ein Zug, sich aber nie zur Gänze von mir durchqueren ließ – als würde man schlafen, dagegen ankämpfen, aber nicht aufwachen können. Diese Empfindung war fast ebenso quälend wie die vergeblichen Versuche, die Last der Erinnerungen abzuwerfen; anders als die meisten meiner Bekannten vergaß ich fast nichts von dem, was ich gesehen und empfunden hatte; und die Vielzahl der Dinge wie der Menschen, von denen einige schon längst nicht mehr am Leben waren, verschüttete meine Vorstellungen. Ein einmal erblicktes Frauengesicht merkte ich mir für immer, nahezu alle Gefühle und Gedanken, die ich im Verlaufe vieler Jahre Tag für Tag gehabt hatte, wusste ich noch, und das einzige, was ich mit Leichtigkeit vergaß, waren mathematische Formeln und der Inhalt einiger vor langer Zeit gelesener Bücher und Lehrwerke. An Menschen aber erinnerte ich mich immer, an alle, obwohl die überwältigende Mehrheit von ihnen in meinem Leben keine besondere Rolle spielte.