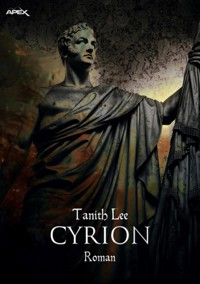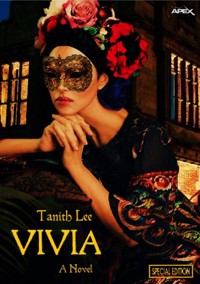7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In jener Zeit, da die Erde eine Scheibe und noch keine Kugel war und Dämonen die Welt beherrschten, entführte Chuz, der Herr der Illusionen, seine schöne Geliebte Azhriaz aus dem Kerker, wo sie nach dem Willen ihres Vaters, des Herrn der Nacht, den Rest ihres Lebens verbringen sollte. Auf der Flucht vor den Häschern suchten die Liebenden Schutz bei den Sterblichen der Erde...
Wann immer Dämonen sich unter die Menschen mischen, bricht Magie mit Macht in das Alltagsleben ein: So schließen Jünglinge Freundschaft mit wilden Bestien; so dreht die Liebe einer jungen Frau das Rad der Zeit um Jahrhunderte zurück; und so erfüllt sich auch jene alte Weissagung, nach der Sonne und Mond sich in Menschenhand begeben werden...
Der fünfbändige Zyklus von der Flachen Erde gilt als Tanith Lees populärste Fantasy-Serie und überdies als Klassiker der Fantasy-Literatur.
Der vorliegende abschließende fünfte Band vereint sieben meisterhaft-poetische Erzählungen von der Flachen Erde und wurde im Jahr 1988 für den World Fantasy Award nominiert (in der Kategorie Beste Anthologie/Collection).
»Tanith Lee ist eine der stärksten und intelligentesten Erzählerinnen auf dem Gebiet der Heroic Fantasy.«
(Publisher's Weekly)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
TANITH LEE
Nächtliche Zauber
Fünfter Band von der Flachen Erde
Tanith Lee-Werkausgabe, Band 11
Erzählungen
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Die Autorin
Das Buch
NÄCHTLICHE ZAUBER
Tochter der Nacht, Wunschtraum des Tages
Der missratene Sohn
Dooniveh, der Mond
Schwarz wie eine Rose
Die Spieler
Die Tochter des Magiers
Die Autorin
Tanith Lee.
(* 19. September 1947, + 24. Mai 2015).
Tanith Lee war eine britische Horror-, Science Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin und Verfasserin von Drehbüchern. Sie wurde viermal mit dem World Fantasy-Award ausgezeichnet (2013 für ihr Lebenswerk) und darüber hinaus mehrfach für den Nebula- und British Fantasy-Award nominiert.
Im Laufe ihrer Karriere schrieb sie über 90 Romane und etwa 300 Kurzgeschichten. Sie debütierte 1971 mit dem Kinderbuch The Dragonhoard; 1975 folgte mit The Birthgrave (dt. Im Herzen des Vulkans) ihr erster Roman für Erwachsene, der zugleich auch ihren literarischen Durchbruch markierte.
Tanith Lees Oevre ist gekennzeichnet von unangepassten Interpretationen von Märchen, Vampir-Geschichten und Mythen sowie den Themen Feminismus, Psychosen, Isolation und Sexualität; als wichtigsten literarischen Einfluss nannte sie Virginia Woolf und C.S. Lewis.
Zu ihren herausragendsten Werken zählen die Romane Trinkt den Saphirwein (1978), Sabella oder: Der letzte Vampir (1980), Die Kinder der Wölfe (1981), Die Herrin des Deliriums (1986), Romeo und Julia in der Anderswelt (1986), die Scarabae-Trilogie (1992 bis 1994), Eva Fairdeath (1994), Vivia (1995), Faces Under Water (1998) und White As Snow (2000).
1988 gelang ihr mit Eine Madonna aus der Maschine (OT: A Madonna Of The Machine) ein herausragender Beitrag zum literarischen Cyberpunk; eine Neu-Übersetzung der Erzählung wird in der von Christian Dörge zusammengestellten Anthologie Cortexx Avenue enthalten sein.
Ihre wichtigsten Sammlungen von Kurzgeschichten und Erzählungen sind: Red As Blood/Tales From The Sisters Grimme (1983), The Gorgon And Other Beastly Tales (1985) und Nightshades: Thirteen Journeys Into Shadow.
Tanith Lee war seit 1992 mit dem Künstler John Kaiine verheiratet und lebte und arbeitete in Brighton/England.
Sie verstarb im Jahre 2015 im Alter von 67 Jahren.
Der Apex-Verlag widmet Tanith Lee eine umfangreiche Werkausgabe.
Das Buch
In jener Zeit, da die Erde eine Scheibe und noch keine Kugel war und Dämonen die Welt beherrschten, entführte Chuz, der Herr der Illusionen, seine schöne Geliebte Azhriaz aus dem Kerker, wo sie nach dem Willen ihres Vaters, des Herrn der Nacht, den Rest ihres Lebens verbringen sollte. Auf der Flucht vor den Häschern suchten die Liebenden Schutz bei den Sterblichen der Erde...
Wann immer Dämonen sich unter die Menschen mischen, bricht Magie mit Macht in das Alltagsleben ein: So schließen Jünglinge Freundschaft mit wilden Bestien; so dreht die Liebe einer jungen Frau das Rad der Zeit um Jahrhunderte zurück; und so erfüllt sich auch jene alte Weissagung, nach der Sonne und Mond sich in Menschenhand begeben werden...
Der fünfbändige Zyklus von der Flachen Erde gilt als Tanith Lees populärste Fantasy-Serie und überdies als Klassiker der Fantasy-Literatur.
Der vorliegende abschließende fünfte Band vereint sieben meisterhaft-poetische Erzählungen von der Flachen Erde und wurde im Jahr 1988 für den World Fantasy Award nominiert (in der Kategorie Beste Anthologie/Collection).
»Tanith Lee ist eine der stärksten und intelligentesten Erzählerinnen auf dem Gebiet der Heroic Fantasy.«
(Publisher's Weekly)
NÄCHTLICHE ZAUBER
Was geht uns dies alles an?
Die Zeit ist endlos, und sie gehört uns.
Liebe und Tod sind nur die Spiele, die wir darin spielen.
- Die Herrin des Deliriums
Tochter der Nacht, Wunschtraum des Tages
Als die Tochter Azhrarns, des Dämons, zum erstenmal in der Welt lebte, wurde sie Sovaz genannt und war die Geliebte von Chuz, dem Fürsten Wahnsinn.
Um ihretwillen nahm Chuz eine eindeutige Gestalt von großer Schönheit an, was nicht immer seine Art gewesen war. Doch wie ihr Vater war auch er ein Gebieter der Finsternis.
Ziemlich lange, so sagt man, hausten die beiden Liebenden in den Tiefen eines großen Waldes, der durch ihre Gegenwart verzaubert und zu einem seltsamen, gefährlichen Ort wurde.
Am Waldessaum lag ein Dorf. Eine alte Straße führte daran vorbei zu den Städten im Süden, und in der Vergangenheit hatte diese Straße dem Dorf Bedeutung verliehen und Wohlstand gebracht. Seither waren andere Verkehrswege gebaut worden, und die Reisenden, die durch den tiefen Wald zogen, wurden weniger. Eine Karawane war in dieser Gegend seit sieben Jahren nicht mehr gesehen worden. Der rosa Stein, aus dem das Dorf gebaut war, war weicher und die Herzen waren härter geworden. Auf einem Hügel über dem Dorf stand zwischen Bäumen ein Tempel. Die Goldstreifen um die Säulen waren verblasst und die Türkisziegel auf den Dächern abgesplittert. Trotzdem lebten die Priester nicht schlecht, denn die Dorfbewohner hatten sich ihre Frömmigkeit bewahrt. Jede Nacht wurde auf dem höchsten Punkt des Tempels ein Leuchtfeuer entzündet, damit die Götter nicht vergaßen, wo das Dorf lag.
Manchmal musste eine ehrbare Familie in dieser Gegend feststellen, dass sie zu viele hungrige Mäuler zu füttern hatte, und dann wurde einer der jüngeren Söhne - Frauen waren nicht zugelassen - dem Tempel als Diener angeboten. Solch ein jüngerer Sohn war Käfer.
Als er sieben Jahre alt war, setzte ihn seine Amme im schattenhaften Geisterlicht vor Tagesanbruch im äußeren Hof des Tempels aus. Um den Hals trug er einen kleinen, minderwertigen Rubin an einem Stück Seide. Das war die Mitgift des Jungen, ohne die er nicht erwarten konnte, im Tempel aufgenommen zu werden. Der arme Käfer (der zu diesem Zeitpunkt noch einen anderen Namen trug) stand in der morgendlichen Kälte und weinte, bis schließlich ein Priester herausgewatschelt kam und ihn ohne allzu große Begeisterung entdeckte. »Schon wieder so ein Balg. Nun, Tradition ist Tradition. Mal sehen - ach, was für ein kümmerlicher
Stein. Hör auf zu flennen, Junge. Von jetzt an wärmt dich die Güte des Tempels.« Damit packte der Priester Käfer-der-noch-nicht-Käfer-hieß am Kragen und zog ihn mit sich.
Hier wuchs Käfer (denn so hieß er jetzt), ernährt von gottesfürchtiger Mildtätigkeit, die sich in verwässerter Milch, Fleischknorpeln, Krusten und Schwarten äußerte, im Lauf der Jahre heran. Daneben unterrichtete ihn der Tempel in den geistigen und geistlichen Künsten des Fegens, Scheuerns, Polierens und Ordnungmachens. Sein neuer Name, den man ihm in den ersten Tagen gab, sollte ihn durch sympathetische Magie zu selbstlosem Fleiß ermuntern. Die anderen Tempeldiener hatten ähnliche Namen, bis auf einen hübschen Jungen, der die Altarkerzen schnauzen und das Weihrauchfass schwenken durfte und der manchmal den Priestern beim Auskleiden und beim heiligen Bad behilflich war. Dieser Diener namens Schatz schlief stets in einer eigenen Zelle und aß am Tisch der Priester mit. Aber schließlich hatte der Tempel diesen Schatz der letzten Karawane abgekauft.
Hin und wieder einmal fragten bedürftige Reisende im Tempel um ein Nachtlager an. Sie mussten dafür zwar ein Entgelt entrichten, aber es war doch etwas geringer als der Preis, den man in der Dorfschenke verlangte.
Eines Tages, als Käfer, dünn, schmächtig und schwachsichtig wie alle anderen - außer Schatz - siebzehn Jahre alt war, machte ein Hausierer Gebrauch von der Gastfreundschaft der Priester. Gleich am nächsten Abend rief der Oberpriester Käfer zu einem Gespräch zu sich.
»Lieber Käfer«, sagte der Oberpriester, der auf einer Liege thronte, neben sich einen Tisch mit Süßigkeiten, Pfirsichen und Wein - Käfer wäre vielleicht das Wasser im Mund zusammengelaufen, wenn sein Gaumen nicht so trocken gewesen wäre, »mein Sohn, mir ist zu Ohren gekommen, dass du wieder in deinen alten Fehler verfallen bist.«
»Vater«, rief Käfer aus und warf sich zu Boden, »vergebt mir, dass ich drei Kerzen aufgegessen habe - aber mich quält ein so schrecklicher Hunger...«
»Leider!«, sagte der Oberpriester und spielte traurig mit einer Zuckermandel. »Du musst dich um die Tugend der Enthaltsamkeit bemühen. Haben wir dir denn in all der Zeit, die du bei uns verbracht hast, gar nichts beibringen können? Oh, weh! Drei Kerzen.« (Käfer klapperte vor Angst mit den Zähnen, denn er spürte schon den Riemen auf seinen Rücken niedersausen.) »Das ist jedoch nicht der Grund, warum ich dich habe rufen lassen. Ja, da du deine Sünde so offen eingestanden hast, können wir sie ausnahmsweise vielleicht sogar einmal übersehen.«
Käfer traute kaum seinen Ohren. Wenn ihm eine Strafe erlassen werden sollte, so sagte ihm seine Erfahrung, dann musste er sich sicher gleich auf noch etwas Schlimmeres gefasst machen. Käfer zitterte, vermochte sich aber nicht vorzustellen, was das sein könnte.
»Der Fehler, den ich meinte, mein Sohn, war deine betrübliche gewohnheitsmäßige Faulheit. Ein träger Mensch kann den Göttern nicht dienen. Aber du hast dich auf deinen Besen gestützt und geträumt und bist bis Tagesanbruch im Bett gelegen. Du bist niemals unbeobachtet, mein Sohn, auch wenn kein Mensch in deiner Nähe ist. Die Götter halten ständig Wache. Ich hatte eigentlich vor, dich zu züchtigen, aber ich glaube allmählich, dass deine Faulheit weniger auf Verderbtheit zurückzuführen ist als auf eine Schwerfälligkeit, die dir im Blute liegt. Aus diesem Grund gedenke ich dich auf einen Botengang zu schicken, der dich beleben soll und von dem du hoffentlich erfrischt und von größerem Eifer erfüllt zu uns zurückkehren wirst.«
Käfer starrte ihn mit offenem Munde an.
Der Oberpriester knabberte mit einem gewissen Widerwillen an ein paar kandierten Früchten, als wolle er sie nicht kränken, indem er sie unbeachtet ließ.
Schließlich fuhr er fort.
»Ich habe erfahren, dass sich vor kurzem ein reicher Herr und seine Dame im Wald niedergelassen haben. Sie leben zurückgezogen und verborgen vor den Augen der Welt, was zweifellos sehr für ihre Bescheidenheit spricht. Aber mir scheint, man sollte sie daran erinnern, welch unermessliches Glück die Götter spenden und dass wir hier ihnen den Weg zu diesem Glück zeigen können. Es besteht Grund zu der Annahme, dass sie, nachdem sie ja ein so ruhiges Leben führen, gar nichts von diesem heiligen Tempel wissen, der nur ein paar Tagereisen von ihrem Palast entfernt ist. Daher möchte ich ihnen einen Boten senden, der ihnen davon berichtet. Und für diese Aufgabe habe ich dich erwählt, mein lieber Käfer. Denn«, der Priester lächelte ihm zu, »trotz deiner Saumseligkeit glaube ich, dass du reinen Herzens bist.«
Käfer rutschte auf dem Bauch herum. Rein oder nicht, sein Herz hämmerte in höchster Aufregung. Er wagte weder Fragen zu stellen, noch irgendwelche Einwände zu erheben.
»Man wird dich ein wenig herausputzen«, fügte der Oberpriester hinzu und schloss seine in Fett eingebetteten Augen halb, so dass die Pupillen den Jungen wie funkelnde Lanzenspitzen anblickten. »Du wirst die Macht und die Frömmigkeit des Tempels vertreten. Natürlich wirst du nicht auf die Idee kommen, dich heimlich aus dem Staub zu machen, aber wenn die bösen Geister des Waldes dich doch in Versuchung führen und von deinem Wege abbringen wollen, so sollte dir klar sein, dass dich in diesem Fall mein Fluch treffen würde. Kannst du dich noch an das Schicksal von Ameise erinnern, der der Versuchung erlag, weglief und dabei eine kleine, silberne Votivgabe mitnahm?«
»Ja, Vater. Man hat ihn nie wiedergesehen.«
»Und weißt du auch warum, mein Sohn?«
»Weil - wie Ihr uns gesagt habt - Euer Fluch über ihn gekommen war.«
»Genauso ist es. Wisse also, dass du auf der Hut sein musst und nicht vom Wege abweichen darfst. Denn dieser Fluch ist schrecklich, und niemand kann ihm entrinnen, sobald er einmal wirksam wird. Die Knochen von Ameise liegen in den Wäldern. Aber du wirst deinen Auftrag ausführen und in unsere liebevolle Obhut zurückkehren.«
»Oh, ja, ja, Vater.«
»Sehr schön. Nun geh. Du wirst noch weitere Anweisungen erhalten. Morgen bei Sonnenaufgang machst du dich auf den Weg.«
Käfer kroch auf allen vieren aus dem Raum. Draußen im dämmrigen Säulengang stand er auf und schlang, keineswegs entzückt, die Arme um sich.
Offensichtlich hatte der Hausierer (der ganz außer sich zu sein schien, als er im Tempel eintraf) dem Oberpriester von den reichen, neuen Nachbarn im Wald berichtet. Ein paar merkwürdige Geschichten hatten das Dorf jedoch schon vorher erreicht, Kohlenbrenner, wandernde Bettler und dergleichen hatten sie mitgebracht. Einige behaupteten, ein Prinz und eine Prinzessin hätten sich im Wald angesiedelt. Andere sagten, es handle sich um zwei Zauberer. Ständig gab es zwischen den Bäumen Überraschungen. Lichter schwebten durch die Luft, Glocken ertönten, Teppiche oder Wolken flogen hoch oben zwischen den Ästen dahin.
Käfer, den man zwar für einen Narren hielt und der sich hütete, diesen Eindruck zu berichtigen, hatte jedoch schon erraten, warum man gerade ihn dazu erkoren hatte, die Grüße des Tempels zu überbringen. Da er überflüssig war, konnte man ihn unbesorgt aufs Spiel setzen. Wenn die Zauberer ihn töteten und verspeisten, hatte der Tempel nichts verloren. Traf allerdings der angenehme Teil der Gerüchte zu, dann konnte man das wohlhabende Pärchen vielleicht in den Schoß des Tempels führen. Möglicherweise schickten die beiden auch, in der Hoffnung, dass man sie dann in Ruhe lassen würde, nach Käfers Besuch ein prächtiges Geschenk an den Tempel. In diesem Fall hätte sich das Risiko durchaus bezahlt gemacht.
Was Ameise anging, so streifte der inzwischen vermutlich irgendwo auf der anderen Seite des Waldes umher und verprasste die Votivgabe. Nicht, dass Käfer den Fluch des Oberpriesters gefürchtet hätte, er war nur zu der Überzeugung gelangt, dass er ein Pechvogel war und dass es keine Rolle spielte, an welchem Ort der Erde er sich aufhielt, er würde niemals Glück haben. Halb verhungert und entmutigt, wie er war, brachte er nicht genügend Energie auf, um von einem Elend in ein anderes zu flüchten.
So wartete er in aller Demut, und irgendwann kam ein Priester und erklärte ihm, was er sagen sollte und wo er den Zauberpalast des reichen Herrn finden konnte - jedenfalls, wo er ihn vermutlich finden konnte (das schien sich manchmal zu ändern). In dieser Nacht fand Käfer auf seinem kratzigen Strohsack keinen Schlaf. Eine Stunde vor Tagesanbruch holte man ihn, überschüttete ihn mit kaltem Wasser, parfümierte ihn mit einer Essenz aus der am wenigsten wohlriechenden Duftphiole, zog ihm ein einigermaßen annehmbares Gewand an und gab ihm ein altes Maultier, einen Amtsstab und eine vom Oberpriester persönlich verfasste Schriftrolle. Zuletzt reichte man ihm einen Ranzen mit dürftiger Wegzehrung und entließ ihn durch die Tempelpforte.
Nur Schatz machte sich die Mühe, von einem hochgelegenen Fenster aus Käfers Aufbruch zu beobachten - aus Gründen, die nur Schatz selbst bekannt waren. Die rundliche Gestalt, wie immer von Kopf bis Fuß sittsam verhüllt, war leicht zu erkennen. Aber Käfer sah sie nicht.
Er ritt in den Morgen hinein und schaute nicht zurück und schon gar nicht nach vorne.
Mehrere Tage lang ritt Käfer durch den Wald. Anfangs fand er die Abwechslung recht angenehm, aber die Größe, die Höhe und die Tiefe des Waldes schüchterten ihn auch gewaltig ein, ebenso die merkwürdigen Geräusche und Gerüche, die ihn umgaben, und die Tiere, die mit vollem Recht hier lebten. Bis dahin war er fast sein ganzes Leben lang in den engen Mauern des Tempels eingesperrt gewesen. Dass er unter den Bäumen schlafen sollte, erfüllte ihn mit tausend Ängsten. Sogar bei Tag musste er an Dämonen denken - von denen er so gut wie nichts wusste, aber was er gehört hatte, war nichts Gutes -, sobald er einen Dachs grunzen hörte, der sich im Schlaf umdrehte.
Außerdem war die knapp bemessene Wegzehrung, die man ihm mitgegeben hatte, bald zu Ende, und das dahinschlurfende Maultier fing häufig mitten in der Bewegung zu dösen an. Von menschlichen Wesen - seien sie irdischer, wohlhabender oder magischer Natur - sah und hörte er nichts.
Was die Straße anging, so war sie ab dem fünften Tag so überwuchert, der Belag so löcherig und bucklig, dass Käfer gezwungen war, sie zu verlassen. Und bald darauf hatte er sich auch schon verirrt.
Als dies geschehen war und zudem die Nacht herankam, begann sich Käfer Gedanken über die Macht der Flüche des Oberpriesters zu machen. Vielleicht waren sie doch wirksam. Inzwischen stimmten die wilden Tiere des Waldes ihr irres Heulen und Kreischen an. Abseits der Straße würde sicherlich ein Löwe daherkommen und Käfer und das Maultier verschlingen, oder ein Teufelswesen konnte sie in aller Ruhe in Stücke reißen. Käfer wurde von einem matten Zorn erfasst. Er führte das Maultier in ein schützendes Dickicht und machte hastig ein Feuer. Zum Abendessen kaute er an seinen Fingernägeln, danach saß er da und grübelte. Endlich glaubte er einzuschlafen.
Aber nicht viel später hörte er ganz in der Nähe ein unheimliches Geräusch und erwachte wieder.
Zwischen den Farnwedeln schlich etwas herum. Das Geräusch war zu unbedeutend, um der Vorbote eines grausigen Todes zu sein, aber vielleicht stammte es ja auch von einer giftigen Schlange. Käfer sprang hastig auf, und in diesem Augenblick stahl sich ein großer Hase in den Feuerschein. Sein Fell war wie aus schwarzem Samt, um den Hals trug er ein goldenes Halsband, und in jedem seiner langen Ohren steckte eine winzige, silberne Mondsichel.
Während Käfer den Hasen noch anstarrte, machte dieser eine höfliche Verneigung und streifte dabei mit den Ohren den Boden. Dann drehte er sich um und entfernte sich leise.
Käfer war hin- und hergerissen zwischen Furcht und Neugier, ein wenig glaubte er auch, er schlafe noch, aber etwas drängte ihn doch, dem Tier nachzueilen.
Den Hasen schien das keineswegs zu erschrecken. Er ging in gemächlichem Tempo weiter, und bald erreichte er über eine ansteigende Lichtung ein Wäldchen aus Nussbäumen, wo das Mondlicht durch die Blätter sickerte und die reifenden Früchte wie Perlen schimmern ließ.
Irgendwo zwischen den Bäumen verschwand der Hase. Aber mittlerweile hatte Käfer einen schwachen Lichtschein entdeckt. Er ging weiter, und bald darauf lichtete sich das Wäldchen, und er blickte auf eine bescheidene, alte Hütte, aus deren Tür und Fenstern der weiche Schimmer drang. Hier befand sich ein Garten, der in der Nacht süß nach Jasmin duftete. Zwischen den Pflanzen floss wie eine Silberkette ein kleines Bächlein. Daneben standen auf einem grob gezimmerten Tisch ein einfacher Krug und ein Holzteller mit Brotkuchen, Äpfeln und Käse. Bei diesem Anblick erwachte in Käfer ein wütender Hunger. Aber plötzlich sah er auch, dass die Bewohner der Hütte dort unter der Mauer saßen. Da Käfer seit seinem siebenten Lebensjahr niemand mehr mit erkennbarer Freundlichkeit begegnet war, misstraute er allen Menschen. Er zog sich enttäuscht hinter eine Gruppe von Nussbäumen zurück.
In diesem Augenblick trat der Mond, weniger vorsichtig als er, auf die Lichtung, sein Schein mischte sich mit dem Lampenlicht aus der alten Hütte, und sein Perlenweiß verfärbte sich zu Zitronengelb.
Nun konnte Käfer die beiden Bewohner der Hütte deutlicher erkennen, und Neid durchzuckte ihn. Denn obwohl sie sichtlich zu den Armen gehörten, selbstgewebte Kleider trugen und nur mit Weinblättern geschmückt waren, waren sie beide jung und von außergewöhnlicher Schönheit.
Das lange Haar des Mädchens war pechschwarz und glänzte wie Wasser. Ihre Augen waren selbst im Schatten so blau wie Vergissmeinnicht und strahlten so, dass Käfer blinzeln musste. Neben ihr lag ein junger Mann, und seine Augen und sein Haar leuchteten heller als die Lampe. In den Händen hielt er eine Leier von verrückter Bauart; sie sah aus, als könne man sie unmöglich spielen, aber er entlockte ihr klangvolle Improvisationen, und während das Mädchen in seinem Arm lag, murmelte er ihr plötzlich dieses Lied ins Ohr, und Käfer hörte es:
Inmitten der Wildnis siehst du hier
Brot und Wein, und du bist bei mir.
Durch unser Lied wird die Wildnis ganz schnell
Zum Himmel auf Erden, rein und hell.
Danach blickte der goldene Jüngling zu Käfer hin, und es hatte fast den Anschein, als zwinkere er ihm zu. Käfer erschrak und fühlte sich gleichzeitig verletzt, denn er war sicher, gut versteckt zu sein. Niemand konnte ihn entdecken. Doch in bezug auf das Zwinkern hatte er sich bestimmt getäuscht, denn jetzt sagte der junge Mann zu der jungen Frau: »Lass uns hineingehen, die Nacht mag draußen bleiben und tun, was sie mag.« Und bei diesen Worten schien auch sie Käfer anzusehen, der mitten unter den Nussbäumen stand. Sie konnte ihn doch unmöglich entdeckt haben! Die beiden erhoben sich, gingen in die Hütte, und die Tür wurde fest geschlossen. Kurz darauf wurde auch die Lampe gelöscht.
Käfer wartete lange, hundert von nagendem Hunger erfüllte Jahre, ehe er sich auf Zehenspitzen in den Garten schlich und sich etwas von dem Essen auf dem Tisch und den irdenen Krug holte, der mit dunklem Wein gefüllt schien. Wirklich satt geworden war er bisher nur, wenn er die Priester bestohlen hatte; er hatte nicht anders handeln können, und auch dieser Diebstahl belastete sein Gewissen nicht, denn diese beiden waren zwar arm, aber sie hatten doch genug, dazu waren sie noch schön und liebten sich. Nachdem er jedoch einen bis zehn Schluck getrunken hatte, stellte er den Krug zwischen die Wurzeln der Nussbäume und lief davon.
Vielleicht lag es am Wein, denn Glück hatte er noch nie gehabt, jedenfalls fand Käfer sein fast erloschenes Feuer und das uralte Maultier wieder, das schnarchend daneben lag. Sobald er dort angelangt war, schlang er die Äpfel und den Käse fast in einem Stück hinunter; es konnte ja sein, dass die Bewohner der Hütte hinter ihm her waren. Doch das war nicht der Fall. Am Morgen würden sie sicher annehmen, dass irgendein wildes Tier sich das Essen geholt und den Krug heruntergestoßen hatte - vielleicht sogar jener schwarze Hase, bei dem sich Käfer in seinen Hungerphantasien eingebildet hatte, er trage kostbaren Schmuck...
Käfer träumte, die Sonne ginge über dem Wald auf und der Gesang der Vögel käme wie die Musik von vielen Leiern. Vor ihm stand nicht das gebrechliche Maultier, sondern ein silbrig schimmerndes Pferd mit safranfarbenem und goldenem Zaumzeug, mit Schellen an den quastenbesetzten Zügeln und prall gefüllten Satteltaschen auf beiden Seiten der kräftigen Flanken. In seinem Traum war Käfer begreiflicherweise wie verzaubert. Und als er sich, von Wohlbehagen und Zuversicht durchdrungen, erhob, wurde ihm bewusst, dass er ein über und über besticktes Gewand aus dicker Seide trug, und seine Füße steckten in so bequemen Schuhen, dass er sie, wären sie nicht so bunt gewesen, gar nicht bemerkt hätte. Auch die Ringe an seinen Fingern hätten ihn geblendet, hätte er im Traum nicht so unnatürlich scharfe und klare Augen gehabt -
»Nun«, sagte Käfer zum Morgen, »das ist ein schöner Traum, aber jetzt sollte ich lieber aufwachen und meine aussichtslose Suche nach dem Palast fortsetzen.«
In diesem Augenblick merkte Käfer, dass er völlig wach war.
Als er dies entdeckte, warf er sich wieder zu Boden, verbarg sein Gesicht und wartete darauf, dass entweder die Trugbilder verschwanden oder das Teufelswesen erschien, das sie geschaffen hatte, um ihn in Stücke zu zerreißen.
Nach einer Weile trat stattdessen das edle Pferd an ihn heran und stupste ihn sanft.
»Bist du das Maultier?« fragte Käfer.
Das Tier antwortete nicht, sondern begann, Gras zu rupfen. Käfer stand wieder auf. Dabei schüttelte ihn eine zweite Welle von körperlichem Wohlbefinden und Kraft, und dieses Gefühl war so ungewohnt, dass ihm fast die Sinne schwanden.
In diesem Zustand fiel es Käfer jedoch schwer, sich noch länger mit Angst und Beklommenheit herumzuschlagen.
»Ich will nur so viel sagen«, erklärte er dem Wald. »Wenn diese Gaben Bestand haben, bin ich vom reichsten Mann in meinem Dorf nicht zu unterscheiden.« Bei diesen Worten schoss ihm unvermittelt ein Gedanke durch den Kopf und veranlasste ihn, die Satteltaschen zu untersuchen. Tatsächlich, darin befanden sich - neben einigen sehr verlockenden Leckerbissen - einige große, lupenreine Rubine. »Ich glaube«, sagte Käfer zu sich, »damit kann ich zum Tempel zurückkehren und behaupten, ich hätte dem Palast tatsächlich einen Besuch abgestattet. Die Rubine kann ich als Geschenk des Herrn und der Dame bezeichnen und übergeben.«
Mit diesem frohgemuten Entschluss bestieg er das Pferd.
»Wenn mein Pech wirklich vorüber sein sollte, werde ich nun sofort und mit untrüglichem Instinkt die Straße finden.«
Käfer ritt auf gut Glück dahin und fand tatsächlich bald darauf die Straße. Sie war nicht mehr überwuchert.
Er trieb das Pferd auf das Pflaster und trabte in Richtung auf das Dorf weiter.
»Inmitten der Wildnis, ganz allein!«, sang Käfer zwischen Essen und Trinken, »mit Käse und Feigen, Brot und Wein, will ich mich nun des Lebens freu'n!«
So zog er einen oder zwei Tage lang dahin, füllte seinen Magen, wann immer er Lust dazu verspürte, sprach und scherzte mit dem Wald und sang. Wenn die Nacht kam und die Lichter löschte, legte er sich auf den Boden und freute sich von ganzem Herzen an den Geräuschen der Tiere. »Mein Pech ist vorüber«, sagte er. In Wirklichkeit fühlte er sich jetzt freilich nur so wohlgenährt und kräftig, dass kein pessimistischer Gedanke sich in seinem Kopf halten konnte. Und jedes Mal, wenn sich einer einschleichen wollte, fegte ihn eine neue Welle von Lebenskraft wieder hinaus.
So kehrte Käfer auf der Straße zurück. Und da das Pferd flott ausschritt, brauchte er für den Heimweg weniger Zeit, als für den Hinweg nötig gewesen war.
Doch als die rosa Mauern des Dorfes von ferne in Sicht kamen, reifte in Käfer ein neuer Entschluss. »Ich werde dem Tempel nichts abliefern, denn diese Kostbarkeiten, wie etwa das Gewand und das Reittier, waren für mich bestimmt. Es wäre undankbar, etwas davon wegzugeben. Und wer immer die Wesen auch sein mögen, die diesen wunderbaren Zauber für mich erwirkten, sie könnten zu Recht erzürnt sein und mich nun vielleicht sogar bestrafen wollen - so unwahrscheinlich mir das auch vorkommt. Nein, ich werde jedes dieser schönen Dinge behalten und den Priestern nur erzählen, dass der Herr und die Dame mir Geschenke gemacht haben. Und warum sollte ich«, fügte Käfer, von seiner eigenen Schlauheit angespornt, »nicht so tun, als wären die beiden schlichten Hüttenbewohner jener Herr und jene Dame gewesen?«
Nachdem Käfer sich endgültig so entschieden hatte, ritt er wie ein vornehmer Herr die Straße entlang und ins Dorf hinein.
Man darf gewiss sein, dass er auf den Straßen weidlich angestarrt wurde.
»Wer ist dieser fürstliche Jüngling?«, riefen die Leute.
Und die vornehmen, aber verarmten Familien holten ihre ältesten Töchter von den Regalen und staubten sie ab.
Doch der Jüngling, hochgewachsen und kräftig, mit dem Glanz der Gesundheit auf Haar und Haut und mit Fröhlichkeit in den großen, glänzenden Augen, ritt weiter die Straße hinauf auf den Tempel zu.
»Hoho! Fromm ist er auch«, sagten die Dorfbewohner und wussten nicht so recht, was sie davon halten sollten.
Inzwischen hatte man im Tempel, wo man den Jüngling schon bemerkt hatte, die Tore weit aufgerissen.
Als Käfer in den äußeren Hof einritt (wo man ihn zehn Jahre zuvor als schluchzendes Kind ausgesetzt hatte), eilte der Oberpriester persönlich geschäftig heran.
»Mein vornehmer Sohn«, rief der Priester, »du bist willkommen!«
Käfer blieb auf seinem Pferd sitzen und blickte sich um. Seine schönen Augen blitzten vor Freude, und das erfüllte den Oberpriester mit großen Hoffnungen, bis der junge Mann das Wort ergriff.
»Ist es möglich, dass Ihr mich nicht erkennt, Vater?«
»D-dich er-kennen, mein unvergleichlicher Knabe?«
»Nun, ich bin doch Euer Käfer, der in Eure liebevolle Obhut zurückgekehrt ist.«
Nun hatte sich Käfer zwar innerlich und äußerlich erstaunlich verändert, ein Wandel, wie ihn nur ein mächtiger Zauber bewirken kann, aber er war doch immer noch Käfer. Und nach einem langen, stummen Blick gab es im ganzen Hof keinen Priester, der das nicht allmählich erkannt hätte, nicht zuletzt der Oberste von ihnen, dessen Pupillen zwischen den Fettwülsten wie Lanzenspitzen funkelten.
»Mein Sohn«, sagte er schließlich, »ich sehe, du hast das Ziel erreicht, zu dem ich dich in meiner Güte und Weisheit ausgeschickt habe. Und wenn du auch, wie ich glaube, damals Zweifel gehegt haben magst, ob mir wirklich dein Glück am Herzen lag, wirst du nun wissen, dass es sich so verhielt.«
Käfer grinste.
Der Oberpriester raffte seine Röcke zusammen.
»Du wirst mir nun folgen, mein Sohn Käfer, denn ich will dir eine Privataudienz geben.«
»Sicher«, sagte Käfer. »Ich muss jedoch alle Anwesenden warnen; niemand darf sich an meinem Pferd, an seinem Zaumzeug oder an den Taschen zu schaffen machen. Jene, die mich für meinen Besuch solchermaßen belohnen, sind Magier und Meister des Fluchs - ich möchte sogar so weit gehen zu behaupten, dass ihre Flüche noch wirkungsvoller sind als die unseres heiligen Vaters hier. Sie haben ihre Geschenke an mich mit einem solch schrecklichen Fluch geschützt, dass ich nicht einmal wage, die Einzelheiten zu wiederholen. Ich sage nur noch einmal - hütet euch!«
Mit diesen Worten saß Käfer ab und stolzierte hinter dem Oberpriester her in dessen Aller heiligstes.
Dort befahl jener: »Sprich!«
Und Käfer erzählte seine Geschichte wie folgt:
Nach einer mühsamen Reise, bedroht von Waldlöwen, tödlichen Schlangen und dem Hungertod, hatte er einen verzauberten Palast erreicht, der offensichtlich von Magiern bewohnt wurde. Seine Pracht spottete jeder Beschreibung; daher wollte er gar nicht erst den Versuch machen, davon zu berichten. Während er jedoch noch staunend am Tor stand, war ein unheimlicher Mittelsmann erschienen - wieder sollte auf eine ohnehin unzulängliche Beschreibung verzichtet werden - und hatte Käfer in einen herrlichen Garten geführt, wo sich ein junger Prinz und eine Prinzessin von unvergleichlicher Schönheit aufhielten.
»Bitte, wie sahen sie aus?«, fragte der Oberpriester, ziemlich ratlos, weil er bisher nur einen Knochen mit so wenig Fleisch bekommen hatte.
Käfer holte tief Atem. Dann machte er mit der Sicherheit eines beliebten Schauspielers eine Handbewegung.
»Vater, obwohl alle Worte von der Wahrheit zu Bettlern gemacht werden, möchte ich Euch meine Eindrücke nicht vorenthalten: Er war golden wie die Sonne, auch seine Augen waren golden - er war wie der Tag am hellen Mittag. Aber sie - ach, sie - sie war die fleischgewordene Tochter der Nacht. Ihre Haut war hell wie der Mond, ihre Augen glichen zwei blauen Sternen, ihr Haar war die Dunkelheit selbst. Ja, sie war das Kind der Nacht, aber der Tag liebte sie, so wie man sagt, dass die Sonne den Mond liebt. Denn er war der Tag, er saß neben ihr, und seine Blicke ließen keinen Zweifel daran, dass sie das Ziel aller seiner Wünsche war. Doch ihn hätte ebenfalls kein Weib gleichgültig ansehen können. Und sie tat es auch nicht.«
Nach diesen Erläuterungen erzählte Käfer dem Oberpriester weiter, wie freundlich das junge Paar ihn empfangen und wie es ihn so üppig bewirtet habe, dass es seine Fähigkeiten übersteige, es zu beschreiben. Als der Besuch sich dem Ende näherte, beschenkten sie Käfer mit neuen Kleidern, mit dem Pferd, auf dem er zurückgekehrt war, und mit anderen, geheimen Schätzen, die er nicht enthüllen dürfe, das habe er geschworen, und die jedem, der sie ohne seine Erlaubnis berührte, den Tod bringen würden.
Der Oberpriester saß einige Minuten lang nachdenklich da, während sich Käfer aus einer Schale mit Orangen und anderen Leckereien bediente.
Endlich sagte der Oberpriester mit sanftem Tadel: »Aber, mein Sohn, nachdem du von diesen... frommen, gütigen Leuten so freundlich aufgenommen wurdest, hast du ihnen da nicht die heilige Schriftrolle überreicht und ihnen die Vorzüge dieses Tempels gepriesen, der dir doch seit so vielen Jahren Heimat und Familie ist?«
Als der Oberpriester dies sagte, spürte Käfer einen scharfen Stich der Gehässigkeit in seinem Herzen. Ohne sich dagegen zu wehren, sagte er: »Aber Vater, wozu habt Ihr mich denn sonst ausgesandt? Ich habe in allem Eurem Willen gehorcht. Aber es hat den Anschein, als verließen der Herr und die Dame niemals ihr Haus. Sie haben Euch jedoch eingeladen, ihnen einen Besuch abzustatten, wenn Ihr wollt.«
Als der Oberpriester das hörte, quollen ihm fast die Augen aus den verfetteten Höhlen, und Käfer musste so tun, als habe er sich an einer Nuss verschluckt, um sein Lachen zu vertuschen, denn er malte sich aus, wie sich der Priester, genau wie er selbst, im Wald verirrte und nichts finden konnte, was einem Palast ähnlich sah. Und dann sagte Käfer zu sich selbst: Schließlich ist aus der Art meiner Rückkehr klar ersichtlich, dass ich Erfolg hatte. Aber jeder kann sich im Wald verirren. Ich kann ihm nur den Weg beschreiben, wie er ihn mir beschrieben hat, und daran mag er seine Freude haben. Was das Zauberwesen angeht, das sich meiner erbarmte, vielleicht erbarmt es sich auch seiner.
Aber ich bezweifle es. Und dann musste er noch einmal Zuflucht zu einem kleinen Hustenanfall nehmen, und der Oberpriester trat besorgt heran und klopfte ihm auf den Rücken.
Am nächsten Morgen, eine Stunde nach Tagesanbruch, ritt der Oberpriester, begleitet von zweien seiner vertrautesten Unterpriester, in den Wald, zu ihrer Bedienung hatten sie, eine besondere Vergünstigung, nur den Knaben Schatz mitgenommen.
Zu keiner Zeit hatten die Angehörigen des Tempels irgendwelche Zweifel in bezug auf diese Mission geäußert. Vielleicht erinnerten sie sich, als sie Käfer in seiner neuen Pracht erblickten, an die in der Gegend verbreitete Redensart: Gibt eine Wespe Honig? Es war nicht schlecht, großzügigen Exzentrikern einen Besuch abzustatten, wenn man dazu aufgefordert wurde. Denn wenn sie einen schwachsinnigen Niemand mit solchen Geschenken bedachten, womit mochten sie dann einen gebildeten, heiligmäßigen Priester überhäufen?
Käfer war mehrere Tage lang geritten und hatte nur einen Ranzen voll Wegzehrung dabeigehabt. Die drei Priester hatten ein zusätzliches Maultier mitgebracht, bepackt mit Säcken und Taschen mit allen möglichen Dingen, die sie zu ihrer Bequemlichkeit nötig zu haben glaubten. Schatz führte dieses Maultier.
Den ganzen ersten Tag lang zog die Prozession auf der Straße dahin. Alle wurden arg von Fliegen geplagt, die vielleicht von den prall gefüllten Taschen mit Essen oder von Schatz' Parfüm angelockt wurden, sonst geschah jedoch weiter nichts.
Dann sank die Sonne nach Westen und schickte sich zum Untergehen an; ein tiefes, bronzefarbenes Glühen vertiefte die Farben des Waldes.
»Wir werden hier lagern, auf dieser Lichtung neben der Straße«, verkündete der Oberpriester. »Stellt das Zelt auf.«
Kaum hatten sie jedoch die Lichtung betreten und begonnen, von ihren Maultieren abzusteigen, als eine merkwürdig zittrige Musik aus dem Wald zu ihnen drang.
Man darf sicher sein, dass alle drei Priester die Ohren spitzten, während sich Schatz (der, das soll nicht verschwiegen werden, im Stillen so manche Vorbehalte gegenüber diesem Unternehmen hegte) hinter einen Baum schlich.
Im nächsten Moment hatten die fünf Maultiere einen merkwürdigen Anfall.
Zuerst schnaubten sie, dann bockten sie, so dass ihnen die Sättel und die Säcke vom Rücken fielen und der dritte Priester, der noch nicht abgestiegen war, auf eine für ihn recht unangenehme Weise hinunterbefördert wurde.
Von ihrer Last befreit, stürmten die Maultiere über die Lichtung, dann stellten sie sich auf die Hinterbeine, tanzten einen Reigen und schlugen sich dabei gegenseitig die Vorderhufe aneinander.
Die Priester starrten dieses alberne Bild erschrocken an.
Endlich bemerkte der Oberpriester, der von sich gewohnt war, dass er zu jedem Anlass eine scharfsinnige Bemerkung parat hatte: »Es ist wohlbekannt, dass die Nähe magischer Kräfte Störungen im Verhalten der niederen Tiere hervorrufen kann.«
Kaum waren die Worte über seine Lippen gekommen, da hörten die Maultiere zu tanzen auf und begannen stattdessen zerstreut zu grasen.
Das Licht strömte nun schnell durch das Sieb der Zweige und Blätter davon. Dann spritzte eine Reihe von hellen Strahlen über den Boden, und in ihrer Mitte hüpfte ein schwarzer Schatten.
Die Priester schlugen fromme Zeichen über sich, und der dritte wollte schon davonlaufen - aber einen Augenblick später hatten sie erkannt, dass sie nichts Furchterregendes vor sich hatten als einen großen schwarzen Hasen, offensichtlich ein Haustier, denn die Lichtblitze im Gras stammten von seinem goldenen Halsband und seinen silbernen Ohrringen.
Jetzt blieb der Hase stehen und verneigte sich dreimal so tief vor den Priestern, dass er mit seinen herrlichen Ohren die Erde streifte.
Dann drehte er sich um, hoppelte über die Lichtung, blieb wieder stehen und sah zu ihnen zurück.
»Das ist sehr erfreulich«, sagte der Oberpriester. »Es scheint, als hätten unsere künftigen Gastgeber nun doch ihr Haus verlassen, um uns entgegenzukommen. Der dumme Käfer hat, was nicht verwunderlich ist, ihre Wünsche entweder falsch verstanden oder nicht richtig weitergegeben. Der Hase ist ihr Bote, und wir müssen ihm folgen.«
Und dies taten sie denn. Auch Schatz kam in einiger Entfernung hinterher, denn allein im Wald zurückgelassen zu werden, war ihm ebenso unheimlich.
Nachdem sie ein paar Minuten lang durch die immer dunkler werdenden Alleen des Waldes gegangen waren, sahen sie einen starken Lichtschein, und schließlich öffnete sich eine zweite Lichtung vor ihnen, verschwenderisch erleuchtet von Lampen aus farbigem Glas, die an goldenen Ketten von den Bäumen oder, wo keine Bäume standen, an geschnitzten Elfenbeinstangen hingen. So wunderbar hell war dieser Platz, dass alle Vögel im Umkreis, die sich eben für die Nacht hatten zurückziehen wollen, wieder munter geworden waren, weil sie glaubten, die Sonne sei früher aufgestanden, um ihnen zuvorzukommen. Nun begannen sie hastig und wild hundert verschiedene Lieder zu zwitschern. Auch andere Klänge ertönten auf der Lichtung, doch sie schienen von nirgendwo zu kommen.
Mitten auf der Lichtung wuchs ein einzelner Nussbaum, aber seine Blätter waren aus Silber, und die grünen Schalen der Nüsse schienen doch tatsächlich Smaragde zu sein. Um diesen Nussbaum herum standen unter goldenen Baldachinen purpurrote Seidendiwane, auf denen purpurrote Atlaskissen aufgehäuft waren.
Von einem dieser Diwane erhoben sich nun ein junger Mann und eine junge Frau; der Beschreibung Käfers nach waren dies sicher jener Herr und seine Dame, die beiden Zauberer.
Der junge Mann konnte nur ein Prinz sein, so schön war er, und so kostbar war seine goldene Kleidung, die zu seinem goldenen Äußeren passte. An seiner Seite stand bescheiden ein Mädchen von etwa siebzehn Jahren in silbernem Gewand, mit Saphiren im wallenden, mitternachtsschwarzen Haar und mit Saphiren auch in den Augen.
»Ihr seid uns sehr willkommen«, rief der junge Prinz aus. »Ja, seit wir Euren Abgesandten bewirteten, erwarten wir Euch mit höchster Ungeduld.«
Und das bescheidene Mädchen blieb sittsam im Hintergrund, lächelte die Priester an und schlug dann die entzückenden Wimpern nieder.
Schon bald hatten es sich die Vertreter des Tempels auf den Diwanen bequem gemacht. Doch als Schatz näher treten wollte, schlug der Prinz unvermittelt einen strengen Ton an. »Euer Diener kann nicht bei Euch sitzen, ehrwürdiger Vater. Er muss sich da drüben außerhalb des Lichts einen Platz suchen.«
Der Oberpriester erhob keine Einwände. Er scheuchte Schatz mit herablassender Geste weg, und das verschmähte Geschöpf setzte sich wie befohlen in den Schatten, weitab von Wärme und Behaglichkeit.
Der schwarze Hase war verschwunden, doch jetzt erschienen aus irgendeinem geheimnisvollen Teil des Waldes ein paar gestreifte Krallenaffen, die sehr gesittet einhergingen. Sie traten zu den Priestern, einige wuschen ihnen Hände und Füße in parfümiertem Wasser, andere stellten goldene Krüge auf, aus denen es berauschend nach Wein mit darauf gestreuten Rosenblättern duftete, und wieder andere brachten sehr würdevoll so kostbare, mit Edelsteinen besetzte Schüsseln herbei, dass alle drei Priester ganz große, glitzernde Augen bekamen.
Ein üppiges Mahl wurde aufgetragen, und der junge Prinz und seine Prinzessin bedienten persönlich ihre Gäste, umkränzten ihnen die Stirn mit Myrtengrün, füllten ihnen die goldenen Becher und häuften ihnen die Teller voll; und dies alles schien ihnen großes Vergnügen zu bereiten, obwohl sie selbst nichts zu sich nahmen. (Schatz ließen sie jedoch von den Krallenaffen nur eine Tonschale mit Wasser und einen Holzteller mit Kräutern bringen.)
Das Festmahl war nun in vollem Gange, der Magierprinz und seine Prinzessin setzten sich und blickten die Priester respektvoll an, und der Prinz bat den Oberpriester inständig, er möge sie doch über das Wesen der Götter belehren, während das Mädchen in ihrer Bescheidenheit sich gar nicht anmaßte, das Wort zu ergreifen.
So verging ein großer Teil der Nacht mit Schmausen und Zechen, begleitet von hoch- und schöngeistigen Monologen des Oberpriesters, der, nachdem er endlich ein Publikum gefunden hatte, das seiner würdig war, mehrere Stunden fast ohne Pause redete und sich nur hin und wieder die Kehle mit Wein befeuchten musste. Während er sprach, überkamen ihn so gewaltige Erkenntnisse, solche Edelsteine der Erleuchtung, dass er von demütigem Stolz und einer Freude erfüllt wurde, wie er sie vielleicht seit seiner Kindheit nicht mehr empfunden hatte. Was die Gastgeber anging, so hingen sie ebenso reglos an seinen Lippen wie die Lampen ringsum an den Bäumen.
Schließlich hatte jedoch sogar der Oberpriester seinen Vorrat an Weisheiten erschöpft und beendete seine Litanei. Auf den anderen Lagern räkelten sich die beiden anderen Priester, sie waren von seinem Vortrag so überwältigt, dass sie die Augen geschlossen hatten, um ihn noch besser genießen zu können. Als seine Stimme verstummte, fuhren sie beide hoch, als erwachten sie aus einem wunderbaren Traum oder aus einer Vision, ja, als seien sie aus tiefem Schlaf auf geschreckt worden.
Dann traten die Krallenaffen wieder heran, Leckereien wurden aufgetragen und ein Wein, der die Priester noch mehr in Verzückung geraten ließ als die vorherigen. (Sogar Schatz bekam eine zweite Schale mit Wasser.)
»Ehrwürdiger Vater«, sagte nun der Prinz, »wir sehen uns außerstande, Euch für das zu danken, womit Ihr uns in dieser Nacht beglückt habt. Da Worte nicht aus- drücken können, was wir empfinden, hoffen wir, uns mit ein paar Geschenken, die wir Euch anbieten möchten, erkenntlich zu zeigen. Denn ein Verstand, ein Herz, ein Geist wie der Eure verlangen eine besondere Belohnung. Wir selbst haben eine lange Reise vor uns und müssen nun leider aufbrechen. Aber wir bitten Euch, Euch aller Annehmlichkeiten zu bedienen, die Euch umgeben. Morgen früh werden die Geschenke auf Euch warten. Inzwischen behaltet doch bitte alles, was Euch gefällt, zum Beispiel die Schüsseln und die Pokale. Und auch Euer Diener«, fügte der Prinz hinzu, »mag seine Schale und seinen Becher behalten.«
»Mein Sohn«, rief der Oberpriester, und aus seinen vorstehenden Augen quollen Tränen. »Ich bin überwältigt. Mein einziger Kummer ist, dass ich dich vielleicht nicht Wiedersehen werde.«
»Vielleicht kommt der Tag, an dem ich Euch in Eurem Tempel besuche.«
»Ach mein Sohn, das wäre ein wahrer Freudentag.«
»Gütiger Vater, schmeichelt mir nicht. Ich kann das nicht glauben.«
»Oh, wahrlich, wahrlich, es ist so!«
Und so nahm der Mittagsprinz unter allseitigen Freundschaftsbekundungen Abschied von den Priestern, und das Mädchen, das Käfer Tochter der Nacht getauft hatte, tat es ihm, wenn auch stumm, nach.
Doch auch nachdem die beiden aufgebrochen waren, blieben die Krüge mit Wein gefüllt, das Essen war weiterhin heiß und duftete köstlich und verlockte die Priester, sich noch einmal die Bäuche vollzuschlagen.
Bald darauf hörten sie ein metallisches seidenweiches Klingen, und als sie aufschauten, sahen sie drei stramme junge Frauen, nur mit Glöckchen bekleidet, aus dem Wald treten und auf sich zukommen.
Die Priester blickten sich an, aber nicht lange.
Dann begannen die schellenbehängten Mägdelein mit schmachtenden, die Aufmerksamkeit fesselnden Bewegungen zu den Klängen der unsichtbaren Musik zu tanzen. Die Priester sahen ihnen sehr interessiert zu und ließen sich sogar von ihren Tellern ablenken.
Als der Tanz zu Ende ging, trennten sich die Tänzerinnen, traten an die Liegen der Priester und zeigten sich durchaus nicht abgeneigt, sich zu ihnen zu legen.
Nun wurde im Tempel zwar Keuschheit verlangt, aber diese Regel wurde nicht immer streng eingehalten. Als die Tänzerinnen nun den Männern zulächelten, sie streichelten und zupften und ihnen, allem Anschein nach nur, um ihnen Erleichterung zu verschaffen und Freude zu bereiten, die Kleider lösten, tat der Oberpriester für diesen Abend seine letzte Entscheidung kund: »Es wäre ein schwerer Fehler und eine grobe Unhöflichkeit,«, sagte er, »das reizende Angebot unserer Gastgeber zurückzuweisen. Außerdem sind sie Magier, sie zu kränken wäre gefährlich für uns, ganz zu schweigen von der Unfreundlichkeit einer solchen Handlungsweise, wenn man bedenkt, wieviel Mühe sie sich gegeben haben.« Danach war er zu beschäftigt, um sich in dieser Angelegenheit noch weiter zu äußern. Nach einer Weile ertönten so laute Grunz-, Ächz- und Quiekgeräusche, dass einige der Smaragde von dem Nussbaum geschüttelt wurden.
Bei Sonnenaufgang erwachten die Priester aus einem erfrischenden Schlummer - und fanden alles zur Hand, um ihr Fasten (das ohnehin nur sehr kurz gewesen war) zu brechen, was sie auch mit großem Genuß taten.
Obwohl die schwellenden Liegen und Kissen noch vorhanden waren und auch das Frühstück bereitstand, war von den Gastgebern oder ihren Bediensteten nichts mehr zu sehen. Auch der Nussbaum war verschwunden, und die Lampen waren fort; nur das Sonnenlicht erhellte die Lichtung. Es ließ jedoch die Priester selbst wie Lampen aufleuchten, denn sie trugen jetzt priesterliche Gewänder von großer Pracht, um ihren Hals und an ihren Fingern funkelten erstaunliche Juwelen, und die bestickten Beutel an ihren goldgegürteten Bäuchen enthielten große Mengen von Smaragden.
Und was kam nun durch die Bäume getrottet? Drei silbergraue Rösser, aufgezäumt wie für Könige, und das für den Oberpriester bestimmte war mit einer purpurnen Schabracke und mit so vielen klirrenden Goldquasten und Perlenschnüren geschmückt, dass man sich wunderte, wie es einen Schritt tun konnte, ohne zusammenzubrechen. Ein viertes Pferd war mit Kästen mit Intarsien aus Gold und Onyx beladen. Als die Priester diese Behälter genauer untersuchten, stellten sie fest, dass man ihnen aufmerksamer Weise die edelsteinbesetzten Teller und Pokale des Festmahls eingepackt hatte, außerdem Kleidung mit allem, was dazugehörte, Schmuck und andere Gegenstände, und darüber brachen sie noch einmal in laute Begeisterungsrufe aus.
Als letztes kam schließlich das mit Flöhen verseuchte Maultier von Schatz auf die Lichtung geschlendert und sah sich beleidigt um. Schatz lag, ebenso gekleidet wie immer, schlafend unter einem Baum, erhob sich jedoch auf ein mahnendes Wort des Oberpriesters hin, sah ihn einen Augenblick lang an, keuchte dann erschrocken auf und wandte den Kopf ab.
»Nimm den Tonbecher und die Holzschale mit, die dir der Herr und die Dame geschenkt haben. Verschmähe sie nicht...« Mürrisch verstaute Schatz die Gegenstände auf dem Maultier. »Mir scheint, sie haben an dir einen Makel entdeckt, der mir bisher entgangen war, aus diesem Grund wurdest du nicht so reich bewirtet und beschenkt.« Schatz zog eine Grimasse. »Du brauchst gar nicht zu schmollen«, sagte der Oberpriester. »Eine Nacht, wie wir sie erlebt haben, kann deinen Wert nur verringern. Sei daher vorsichtig. Ich will kein Wort hören. Steige auf dein Maultier.«
Und so bestieg Schatz das Maultier.
Die Priester kletterten auf die prächtigen Pferde, und der dritte Priester nahm eifrig das mit den Schätzen beladene Packtier am Zügel.
So machten sie sich auf den Weg zum Dorf und malten sich unterwegs aus, wie man sie auf den Straßen anstarren würde.
Und es sollte so geschehen, wie sie es vorhergesehen hatten.
Die Sonne ging gerade unter, wie es ihre Gewohnheit war, als Käfer im Dorf unterhalb des Tempels lautes Geschrei vernahm. Er hatte sich während der Abwesenheit des Oberpriesters im Allerheiligsten dieses Herrn eingerichtet, und der Rest des Tempels hatte keinen Anlass gesehen, ihm das zu verweigern, da Käfer schließlich der Günstling von Magiern war. Abgesehen von den Besuchen am Tisch der Priester, um dort zu speisen, und bei seinem neuen Pferd, hatte Käfer die Zeit damit verbracht, seine Rubine zu zählen und Pläne für eine Zukunft außerhalb des Waldes zu schmieden. Vielleicht hatte er damit gerechnet, dass der Oberpriester überhaupt nicht zurückkehren würde, auf jeden Fall erwartete er ihn erst in mehreren Tagen. Doch als er nun die aufgeregten Stimmen hörte, sank ihm sofort der Mut. Ist es möglich, dachte er, dass auch diese Schurken beschenkt wurden? Wo bleibt da die Gerechtigkeit? Er stieg hinauf auf das hohe Dach, wo bei Nacht das Leuchtfeuer entzündet wurde, um dem Gedächtnis der Götter auf die Sprünge zu helfen, und als er hinunterschaute, bot sich ihm, da seine Augen jetzt kräftig waren und weit in die Ferne sehen konnten, ein wirklich erstaunlicher Anblick.
Als die Gruppe gerade ins Dorf einbiegen wollte, hatte der dritte Priester, der das Packpferd mit den Schätzen führte, einen scharfen Stich in seinem Schenkel gespürt und gedacht, einer der Flöhe seines Maultiers habe ihn gebissen. Aber dann fiel ihm ein, dass das nicht möglich war, da er schließlich nicht auf dem Maultier ritt, sondern auf einem prächtigen Pferd. Die untergehende Sonne schien ihm in die Augen, und als er sich geblendet zu seinem Gefährten umdrehte, sah er etwas äußerst Merkwürdiges. Es kam dem Priester doch tatsächlich so vor, als sei sein Bruder nicht wie der Höfling eines Königs gekleidet, sondern sitze, abgesehen von ein paar Baumranken und einer Schicht Schmutz, splitternackt auf seinem Reittier. Der dritte Priester äußerte sich nicht zu dieser Vision, sondern rieb sich nur die Augen und warf einen schnellen Blick auf den Vorsteher seines Ordens. »Hm. Es muss an der Sonne liegen, denn auch unser Vater sitzt nackt, nur an mehreren Stellen mit Vogelkot bespritzt, im Sattel, und an seinem Gürtel (der wie ein toter Wurm aussieht), hängt eine Kürbisflasche, in der - nein, nein. Ich bin von der Sonne geblendet.« Endlich fasste sich der Priester ein Herz und schaute an sich selbst hinunter. Und da bemerkte er, dass auch sein eigener, wohlgenährter Bauch sich ganz nackt und rund der lächelnden Glut des Sonnenuntergangs darbot. In diesem Augenblick biss ihn wieder ein Floh, denn er ritt nichts anderes als sein altes Maultier, an dessen Zügeln Schneckenhäuser und Eulenkot klebten, und unter seiner wunden Kehrseite war der Sattel voller Brennnesseln.
So kam es, dass das Dorf mit den rosa Steinhäusern eines Abends seinen Oberpriester und zwei seiner heiligen Vertrauten unbekleidet, bis auf ein paar spärliche Ranken und einige Kügelchen und Flecken pflanzlichen Ursprungs, und reichlich gesalbt mit den Exkrementen geflügelter Wesen, auf ihren Maultieren durch die Dorfstraße zum Tempel reiten sah. Bei sich und auf einem der Maultiere hatten sie Kürbisflaschen, die von Kaninchenkot, vertrockneten Rindenstücken und den Hinterlassenschaften von Füchsen und Wildkatzen überquollen. Dass sich bei diesem Anblick ein großes Geschrei erhob, ist nicht verwunderlich, und als Käfer sah, was los war, eilte er - was ebenfalls nicht verwunderlich ist - schleunigst hinab.
Auf der Straße vor dem Tempel trafen alle in höchster Verwirrung im letzten gnadenlosen Licht der Sonne zusammen. »Oh, frommer Vater«, heulte Käfer, »was ist Euch zugestoßen?«
Dann wurde eine Weile geschrien und aufgetrumpft, der Oberpriester wollte durch das Tor in den Tempel stürmen, doch Käfer und sein eigenes Maultier ließen es nicht zu. Und danach schwiegen alle wie benommen, und Schatz trabte heran, unverändert, voll bekleidet, auf einem Maultier sitzend, das keinerlei irgendwie gearteten Schmuck trug.
»Lasst mich sprechen!«, schrie Schatz.
Und das Dorf, das vor der Nacktheit des Oberpriesters den Blick abgewandt hatte, forderte ihn dazu auf.
»Ich prangere diese Priester öffentlich an«, kreischte Schatz schrill. »Ich wurde verschont, aber sie sind Bösewichter, und sie wurden für ihre Sünden bestraft - der tugendhafte Käfer hingegen wurde mit Segen überhäuft.«
Und dann berichtete Schatz folgendes: Die Priester hatten, von Habgier erfüllt, den Wald betreten und waren den beiden Zauberern begegnet. Dank der Sündhaftigkeit der Priester war es diesen möglich gewesen, sie vollkommen zu betören. Doch Schatz, der den Zauber durchschaute, ließen sie in Ruhe.
»Dann«, sagte Schatz, »legten sich diese Männer im Schein der Millionen von Glühwürmchen, die sich dort versammelt hatten, auf den schlammigen Boden und ließen sich Kränze aus stinkendem Unkraut und dürren Farnwedeln aufsetzen. Als man ihnen Sumpfwasser reichte, tranken sie es und wuschen sich damit, als man ihnen verfaulte Eier, alte Vogelnester und andere ekelerregende Dinge anbot, verschlangen sie alles mit Genuß. (Mir hingegen gab man reines Wasser und bekömmliche Kräuter.) Dann forderten die Zauberer den Oberpriester auf, einen Vortrag über das Wesen der Götter zu halten, und er redete fünf oder sechs Stunden lang und verkündete dabei solche Lästerungen, wie ich sie noch nie gehört habe, nicht einmal, wenn ich an der Schenke vorüberging. Er sagte, die Götter hätten Stimme wie Gänse und Schwänze wie Hunde, sie faselten dummes Zeug und hätten die Welt aus Dung geschaffen, außerdem - welch absurde Vorstellung - sei die Erde rund und wirble in einer großen Leere umher. Hin und wieder ließ einer der anderen Priester zum Zeichen, dass er dem in allen Punkten zustimmte, ein lautes Schnarchen hören. Als die abscheuliche Rede schließlich zu Ende war, verabschiedeten sich die beiden Zauberer. Doch dann stiegen drei Affen von den Bäumen und begannen zu tanzen, und schon bald zerrten diese verderbten Priester die Affen zu sich herab, wälzten sich mit ihnen im Schlamm und taten Dinge mit ihnen, die ich nicht mit ansehen mochte. Bei Sonnenaufgang erwachten die drei Priester so gekleidet, wie ihr sie hier seht, was sie für sehr vorteilhaft hielten. Sie stiegen auf ihre Maultiere und kehrten, die ganze Zeit mit ihrem Erfolg prahlend, hierher zurück. Nur ich war nicht besudelt und kam mit, um Zeugnis gegen sie abzulegen. Denn alles, was sie in ihrer Verblendung taten, wurde nur möglich, weil sie besessen sind von einer eines Priesters unwürdigen Gier nach Essen und berauschenden Getränken und von abscheulichen, verbotenen Gelüsten nach sinnlichen Freuden und nach Gold.«
Nach diesen Worten verbarg Schatz das Gesicht in den Händen, und mehrere Dorfbewohner wollten Trost spenden. Andere schrien jedoch, man sei mit einem schrecklichen Zauber geschlagen worden, die rechtschaffenen Priester seien frei von aller Schuld, und besonders im Falle der Affen sei auch Schatz einer Täuschung erlegen.
»Glaubt ihr, sie sind über solche Dinge erhaben?« kreischte Schatz, legte plötzlich Hand an seine Kleidung, an der die Zauberer nichts verändert hatten, und an gewisse Bandagen darunter, und riss alles vom Hals bis zum Knie entzwei. Schließlich stand Schatz entblößt da, und alle konnten sehen, dass sie eine rundliche, ansehnliche, junge Frau war. Vor Scham und Zorn errötend sagte sie: »Als sie mich kauften, war ich fast noch ein Kind, und sie erzogen mich insgeheim zur Kurtisane für jenen heiligen Vater dort und für seine Günstlinge. Um die Wahrheit zu verbergen, hüllten sie mich in lange Gewänder, ich musste meine Brüste zurückbinden, und sie drohten mir, wenn ich etwas verriete, würden sie mich mit einem solch schrecklichen Fluch belegen, dass ich unter Qualen sterben müsse. Ich hätte weglaufen können, aber wo sollte ich hin? Außerdem hatte ich persönliche Gründe zu bleiben, einer davon war die Hoffnung, die Götter würden diese Bestien eines Tages so nackt und bloß dastehen lassen, wie ihr sie jetzt seht.«
Dann raffte Schatz ihre Kleider um sich und lief davon.
Der Oberpriester und seine Vertrauten blieben zurück, ganz eingeschrumpft in all ihrem Fett, und in diesem Augenblick hörte man einen unheimlichen Schrei. Als die Dorfbewohner sich danach umwandten, sahen sie drei sehr gepflegte Affen die Straße heraufeilen. Als die Menge ihnen Platz machte, warfen sie sich den widerstrebenden Priestern, sogar dem widerstrebenden Oberpriester in die Arme, überschütteten jeden von ihnen mit Affenküssen und erwiesen ihnen all die groben Zärtlichkeiten, wie sie junge Bräute der weniger feinen Art ihren Gatten angedeihen lassen.
Käfer ritt ein zweites Mal aus dem Dorf, diesmal in eine andere Richtung, nach Süden, und er war guten Mutes, denn sein Pech war vorüber.
Er war jedoch noch nicht weit gekommen, als eine Gestalt zwischen den Bäumen hervorhuschte. Es war niemand anders als Schatz, die einen selbstgewebten Kittel trug, aber ihr Haar mit Blumen geschmückt hatte. Käfer hatte Schatz immer gehasst, als er noch ein verhätschelter, kriecherischer Knabe gewesen war. Jetzt, als hübsches betrogenes Mädchen, sah er sie mit ganz anderen Augen.
Hinter ihnen im Dorf hatten die Priester eine Menge zu erdulden, aber Schatz war nicht geblieben, um sich das anzusehen. Stattdessen schaute sie zu Käfer auf und erklärte ihm: »Ich liebte dich schon, ehe du ein so stattlicher Mann wurdest. Ich habe dir Kerzen hingelegt, damit du sie finden, stehlen und essen konntest, und ich habe sie vorher in Hammelfett getaucht. Als man dich in den Wald schickte, habe ich zu den Göttern gebetet und ihnen Opfer gebracht, damit sie dich beschützten. Ich habe geschworen, dass ich eines Tages zu dir kommen und dir dies alles erzählen würde. Aber sieh her, jetzt habe ich eine Mitgift mitgebracht.«
Und sie zeigte ihm einen mit erlesenen Steinen besetzten Silberteller und einen Pokal aus reinstem Gold.
Da hob Käfer sie zu sich auf das edle Pferd und küsste sie. Und dies war der süßeste Kuss, den sie beide jemals bekommen hatten.
Der Tempel im Dorf zündete sein Leuchtfeuer nicht mehr an. Er hoffte, dass sowohl die Götter als auch die Zauberer ihn vergessen würden. Käfer und Schatz lebten inzwischen meilenweit entfernt in einem anderen Land. Und in einem anderen Jahr errichteten sie gemeinsam einen Altar für einen Herrn, der golden war wie ein Sommertag, und für eine dunkle Dame, die sie die Tochter der Nacht nannten. Schatz verehrte auch andere Götter, aber Käfer nur diese beiden. Doch wenn Käfer - niemand nannte ihn mehr so, er hatte wieder seinen früheren Namen angenommen - vor ihr, der Tochter der Nacht, Opfergaben und Weihrauch darbrachte, sagte ihm das Schicksal nie, dass er seiner Zeit voraus war.
Kinder der Nacht
Sovaz-Azhriaz war jedoch uneins mit ihrem Vater Azhrarn, dem Dämonenfürsten, und Azhrarn selbst hatte außerdem einen heftigen Streit mit Chuz, Sovaz' Geliebten, dem Fürsten Wahnsinn.
Daher verfolgte der Dämonenfürst die beiden Liebenden, und nun ging es in den wilden Wäldern noch wilder zu. Die Eshva, die träumerischen Abgesandten der Dämonen, streiften dort umher und tanzten, und die Vazdru, die Angehörigen der obersten Dämonenkaste, ritten auf ihren Mitternachtspferden über die Wege und durch die Lichtungen. So kam es bei Mondschein und im Schatten der Nacht zu vielen merkwürdigen, unglückseligen Begegnungen.
1. Ein Traum
Marsinehs Haar hatte die Farbe roten Bernsteins, ihre Haut war wie Sahne, und manchmal sangen liebeskranke junge Dichter unter ihrem Fenster. Dazu war ihr Vater auch noch reich; sie kleidete sich in bunte Seide und legte sich goldenen Schmuck um Hals, Handgelenke und Knöchel. Alle dachten, sie würde eine gute Partie machen. Eines Tages kam ein Fremder in die Stadt. Er war gekleidet wie der Diener eines Königs und wurde von einem eigenen Gefolge begleitet. Er ritt zum Haus von Marsinehs Vater und überbrachte dort eine Botschaft. Der mächtige Lord Kolchash hatte von der Maid erzählen hören und sie auch in einem magischen Spiegel gesehen. Sie gefiel ihm, und er wollte sie freien. Die Hochzeit war schon festgesetzt, sie sollte in drei Monaten, am Vorabend einer Neumondnacht stattfinden. Das war alles.
»Aber«, sagte Marsinehs Vater.
»Es gibt kein Aber«, antwortete der prächtige Bote. »Meinem Herrn, Lord Kolchash, widerspricht man nicht. Habt Ihr noch nicht von ihm gehört?«
»Ich glaube«, murmelte Marsinehs Vater, »ich habe von ihm gehört... Aber Gerüchte sind oft irreführend.«
»Da Ihr keine andere Wahl habt, als dem Handel zuzustimmen«, sagte der Bote, ohne auf den Sinn dieser Bemerkung einzugehen, »werde ich Euch nun unverzüglich die Geschenke überreichen, die Euch mein Herr zum Zeichen des Verlöbnisses senden lässt.«