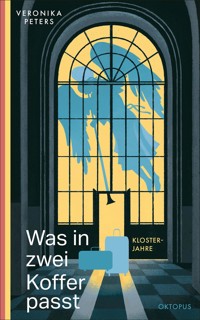19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem berührenden Roman voll skurrilem Humor kehrt eine Frau in das Dorf ihrer Kindheit zurück, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen und den Tod ihrer Mutter zu verarbeiten. Dabei entwickelt sich eine unerwartete Freundschaft. «Veronika Peters' so unwahrscheinliches wie einleuchtendes Figurengespann ist eine helle Freude!» Mariana Leky In Veronika Peters neuem Roman Nackt war ich am schönsten kehrt Antonia Bachmann, genannt Toni, aus der Bretagne in ihr oberhessisches Heimatdorf zurück, nachdem sie das alte Haus ihrer Mutter am Waldrand geerbt hat. Das Verhältnis zur Mutter war angespannt, Toni taucht erst zwei Wochen nach der Beerdigung in Lindbach auf, mit dem Ziel, das Haus schnellstmöglich loszuwerden. Doch wer ist diese extravagant gekleidete alte Frau, die sich im Gartenatelier eingerichtet und offensichtlich auf Toni gewartet hat? Sie stellt sich als Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven vor, eine exzentrische Dada-Künstlerin, die einst heftige Debatten über weibliche Selbstermächtigung auslöste. Klug und mit hinreißendem Witz erzählt dieser Roman von einer in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Freundschaft und von Frauen aus drei Generationen, die sich, ob tot oder lebendig, viel zu sagen haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Veronika Peters
Nackt war ich am schönsten
Roman
Über dieses Buch
EIN OBERHESSISCHES DORF, IN DEM EINE MYSTERIÖSE GREISIN FÜR AUFSEHEN SORGT. UND FÜR GERECHTIGKEIT.
Antonia Bachmann, genannt Toni, kehrt nach zwanzig Jahren in ihr Heimatdorf zurück, um das von ihrer Mutter geerbte Haus am Waldrand so schnell wie möglich wieder loszuwerden. Doch wer ist diese extravagant gekleidete alte Frau, die sich im Gartenatelier eingenistet und offensichtlich auf Toni gewartet hat? Sie stellt sich als Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven vor, 1874 in Swinemünde geboren, 1927 in Paris gestorben. Was nicht sein kann, ist trotzdem so, denn warum sollte eine Dada-Künstlerin der ersten Stunde, deren «Art of Madness» einst heftige Debatten über weibliche Sexualität und männliche Kontrolle auslöste, sich nicht auf ihre Weise einen Weg ins 21. Jahrhundert bahnen? Es gibt schließlich noch viel zu tun, nicht nur für Toni und die Menschen in Lindbach.
Warmherzig, klug und mit hinreißendem Witz erzählt Veronika Peters von Freiheit und Selbstermächtigung weiblicher Kunst – und von Frauen aus drei Generationen, die sich, ob tot oder lebendig, viel zu sagen haben.
Vita
Veronika Peters, 1966 in Gießen geboren, verbrachte ihre Kindheit in Deutschland und Afrika. Nach einer heilpädagogischen Ausbildung arbeitete sie als Erzieherin in einem psychiatrischen Jugendheim. Mit Anfang zwanzig stieg sie für einige Jahre aus dem sogenannten bürgerlichen Leben aus und trat in eine Kommunität von Benediktinerinnen ein, wo sie unter anderem als Gärtnereigehilfin, Restauratorin und Buchhändlerin tätig war. Seit dem Jahr 2000 lebt sie als freiberufliche Autorin in Berlin. Veronika Peters ist verheiratet mit dem Schriftsteller Christoph Peters und hat eine Tochter. Im März 2022 ist ihr siebtes Buch erschienen, «Das Herz von Paris», ein Roman über die Frauen der literarischen Avantgarde im Paris der Zwischenkriegsjahre.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung Julie-Anne Lebon
ISBN 978-3-644-01760-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Sie sagt: Die, die ich bin, wurde am 12. Juli 1874 in einer preußischen Hafenstadt geboren, beheimatet war ich nirgends und nie.
Die, die ich bin, ist am 14. Dezember 1927 in Paris, im 13. Arrondissement, an einer Gasvergiftung gestorben. Mit mir gemeinsam verendete ein kleiner Hund, er hieß Pinky.
Es ist also unmöglich, dass die, die ich bin, an einem sonnigen Freitagmorgen im Juli 2013 durch ein oberhessisches Dorf spaziert, gemeinsam mit einem kleinen Hund, er heißt Pinky.
Und doch.
1Toni
Am ersten Morgen nach meiner Rückkehr wurde ich von Loups tiefem Knurren geweckt. Nach der viel zu kurzen, in muffigen alten Laken verbrachten Nacht wollte ich nichts als weiterschlafen, deshalb knurrte ich zurück und vergrub mein Gesicht in den angemoderten Federkissen. Ich hatte keine Lust auf diesen Tag, keine Lust auf das Dorf, und am allerwenigsten Lust hatte ich, mich um dieses marode, von allen guten Geistern verlassene Haus zu kümmern.
«Keine Lust ist ein Argument für gar nichts», hörte ich meine tote Großmutter schimpfen.
Ich öffnete die Augen.
Loup stand am Fenster, schaute zu mir, dann wieder nach draußen, trat aufgeregt von einer Pfote auf die andere, winselte, knurrte erneut.
Als er sah, dass ich die Beine aus dem Bett schwang, stieg Loup mit den Vorderläufen auf die Fensterbank, wo eingestaubte Trockenblumen vor sich hin bröselten. Ein Bund Craspedia, deren ursprüngliches Sonnengelb sich kaum noch erahnen ließ, zerfiel unter den Pranken des alten Wolfshunds, ergrauter Lavendel rieselte zu Boden. Ich hob einen der Stängel auf, hielt ihn mir an die Nase, da war ein schwacher Hauch von angegammeltem Heu und sonst nichts.
So war das jetzt also.
Früher hatte das komplette Waldhaus wie ein provenzalisches Stück Seife gerochen, ebenso unsere Hemden und Pullis, die Handtücher, das Bettzeug, selbst die Unterhosen und die Socken, sogar die Sofakissen und die Küchenvorhänge, einfach alles. Man hätte, da bin ich mir sicher, mit verbundenen Augen jede von uns dreien im samstäglich überfüllten Spar-Markt als Waldhausbewohnerin identifizieren können, allein am Duft, der uns anhaftete. Meine Großmutter hatte mit der ihr eigenen Hartnäckigkeit ein kleines Lavendelfeld bewirtschaftet, gleich neben der Streuobstwiese auf dem nach Süden hin abfallenden Hang hinter dem inneren Gartengelände, der einzigen Stelle, an der die Sonne sich den ganzen Sommer über gegen den Schatten des Waldes durchsetzte. Selbst der alte Blumen-Weidner, der es ja schließlich wissen musste, war nach anfänglicher Skepsis überrascht gewesen, wie gut das Kraut unter den hiesigen Witterungsbedingungen gedieh. «Respekt, Emma!», hatte er gesagt, und danach war Oma nicht mehr zu bremsen gewesen. Meine gesamte Kindheit hindurch hatten im Spätsommer die Bündel zum Trocknen an quer durch die Zimmer gespannten Schnüren gehangen, so niedrig, dass wir uns die Köpfe daran stießen, und auf dem Herd hatte das frisch aufgesetzte Öl stundenlang im Wasserbad vor sich hin gesimmert. In seinen unterschiedlichen Verarbeitungszuständen war das Zeug dann an jeder denkbaren und undenkbaren Stelle im Haus verteilt oder versprüht worden: in den Kleiderschränken und Sockenschubladen, in Einkaufsbeuteln und Jackentaschen, auf den Fensterbänken und Türrahmen. Sogar die Nachbarn und selbstverständlich auch der Blumen-Weidner waren mit getrockneten Blüten, duftenden Stoffsäckchen oder handbeschrifteten Ölfläschchen beschenkt worden. «Das vertreibt Kummer und Skorpione!», hatte meine Großmutter immer behauptet. Als hätte sich jemals ein Skorpion nach Lindbach verirrt! Und ich kämpfte auch zwanzig Jahre nach Omas Tod noch mit den Tränen, wenn ich irgendwo Lavendel roch. Das immerhin ersparte mir das Waldhaus an diesem Morgen. Es stank nach alter Kanalisation und abgestandener Leere, damit konnte ich umgehen.
Loup bellte. Ich trat neben ihn und strich ihm über den Kopf.
Er beruhigte sich umgehend, blieb aber hoch aufgerichtet am Fenster stehen, die Ohren wachsam gespitzt, den Blick starr in den Vorgarten gerichtet. Seite an Seite schauten wir durch die Scheiben meines ehemaligen Kinderzimmers nach draußen. Und dann sah ich, was Loup alarmiert hatte: Da war eine Frau mit ihrem Hund unterwegs. Aber was für eine! Selbst in mit Exzentrikerinnen gesegneten Großstädten, sagen wir Berlin, Paris, London oder San Francisco, wäre die alte Dame, die eben das Grundstück in Richtung Wald verließ, eine spektakuläre Erscheinung gewesen, in Lindbach allerdings, diesem «oberhessischen Ende der Welt», wie meine Mutter es genannt hatte, war sie schlicht eine Sensation. Um die schmächtigen Schultern wehte ein violetter langer Umhang, auf dem Kopf thronte eine fuchsienfarbene Fliegerkappe, geziert von einem Gebilde, das auf die Entfernung aussah wie fächerartig arrangierte Silberlöffel. Neben der Alten trippelte, den Kopf hoch erhoben, ein lackschwarzes italienisches Windspiel. Sie hinkten beide, die Frau links, das Hündchen hinten rechts, was allerdings mehr nach minimalistischer Tanzchoreografie als nach Gehbehinderung aussah und ihrer beider Eleganz keinerlei Abbruch tat. Im Gegenteil. Ich war hingerissen! Und als wäre sich die Frau dessen bewusst, dass sie bestaunt wurde, blieb sie für einen Moment stehen, drehte sich ins Profil, schlug dabei mit theatralischem Schwung den Umhang zurück. Ein lila glitzerndes Pailletten-Oberteil kam zum Vorschein, über dem ein halbes Dutzend Perlenketten mit auf die Entfernung undefinierbaren silbernen Anhängern hing, dazu trug sie eine tannengrüne, mit bunten Fäden bestickte Pluderhose und schwarz-golden funkelnde Schnabelschuhe, deren Spitzen sich schneckenartig aufrollten. Auch das Windspiel schimmerte in der Morgensonne, von seinem perlenbesetzten Halsband baumelten Seidenquasten, farblich auf die Herrin abgestimmt. Man hätte meinen können, die beiden seien auf dem Weg zu einem mondänen Kostümball anstatt zur Gassirunde in den Lindbacher Forst.
«Heilige Scheiße!», murmelte ich.
«Wie soll Scheiße bitte schön heilig sein? Wenn du schon fluchen musst, dann bleib wenigstens logisch, mein Mädchen!»
Verschwindet aus meinem Kopf, alle beide!, dachte ich. In Anbetracht meiner gegenwärtigen Situation ein extrem dämlicher Gedanke.
Die Stimmen meiner Mutter und Großmutter hatten quasi identisch geklungen. Selbst die Dorfleute, die uns gut kannten, der Blumen-Weidner zum Beispiel, Doktor Arnold oder Pfarrer Martinek, hatten sie am Telefon nicht auseinanderhalten können. «Wen hab ich dran?», hatten sie immer gefragt. «Emma eins oder Emma zwei?» Der Einfachheit halber waren die Bachmann-Emmas im Dorf nummeriert worden. Dass man es mir durch abweichende Namensgebung verweigert hatte, die Nummer drei zu werden, habe ich meine gesamte Grundschulzeit hindurch als höchst unfair empfunden. «Hier ist keine Emma!», hatte ich als Zehnjährige einmal in den Hörer gebrüllt, was Pfarrer Martinek dazu veranlasst hatte, mich im Religionsunterricht fortan mit «Keine-Emma» anzureden. In der Regel war bei uns aber immer Emma eins, meine Oma, ans Telefon gegangen. Die Anrufer hätten das wissen können, denn Emma zwei, meine Mutter, war meistens anderswo, allein im Wald unterwegs, zum Malen, Trinken und Schlafen im ehemaligen Pferdeschuppen eingeschlossen oder gleich für mehrere Wochen ganz verschwunden. Auch ich hatte ihre Stimmen mehr als einmal verwechselt, obwohl es immer und ausschließlich Oma gewesen war, die mich zum Abendessen ins Haus gerufen hatte.
«Ach, mein Mädchen!»
Meine Mutter hätte mich nicht «mein Mädchen» genannt.
Eine Sache war im Waldhaus demnach wie früher: Oma sprach mit mir, während Mama schwieg. Vielleicht wurde ich aber auch einfach wahnsinnig.
Ich verließ mein Zimmer und betrat die Küche, um vom dortigen Erkerfenster aus den Waldweg besser einsehen zu können.
Was die beiden Emmas wohl zum Auftauchen der exzentrisch aussehenden Fremden in unserem Vorgarten gesagt hätten? Meine Mutter hätte wahrscheinlich stumm eine Skizze auf irgendeinen herumliegenden Zettel geworfen und wäre anschließend kommentarlos im Atelier verschwunden. Meine Großmutter hörte ich «nu brat mir einer ’nen Storch!» murmeln. Im gleichen Atemzug hätte sie das Fenster aufgerissen und nach der rätselhaften Unbekannten gerufen, sie hereingebeten, auf einen Tee eingeladen, Melisse oder Minze, denn «zum Kennenlernen gibt es bekanntlich nichts Besseres als einen leckeren und gesunden Aufguss aus frischen Gartenkräutern!». Auch das Hündchen hätte einen Butterkeks oder eine Scheibe Fleischwurst bekommen, dazu eine Schale Wasser und vermutlich sogar eine Decke, damit es weich lag.
«Zu meiner Zeit hat es in diesem Haus noch so etwas wie Gastfreundschaft gegeben!»
«Oma, sei still!»
«So weit kommt’s noch!»
«Du bist gar nicht hier, schon seit einer halben Ewigkeit nicht mehr.»
«Deswegen muss ich mir noch lange nicht den Mund verbieten lassen, schon gar nicht von einer, die genauso lange nicht mehr hier war und keine todsichere Ausrede für ihre Abwesenheit hat.»
Dieses helle Oma-Kichern, wenn sie sich selbst umwerfend witzig gefunden hatte.
Der Küchenschrank hinten an der Wand stand offen. Auf den blau-weiß gemusterten Tellern hatte meine Großmutter mir Blaubeerpfannkuchen und Eierbrot angerichtet, in Gabelhappen geschnitten, auch dann noch, als ich längst erwachsen gewesen war. In den geblümten Keramiktassen hatte ich von ihr Kamillentee oder warme Milch mit Honig serviert bekommen. Gelegentlich hatten wir uns auch etwas Rotwein in diesen Tassen genehmigt, heimlich eingegossen, um meine Mutter nicht zum Mittrinken zu animieren.
«Ach, mein Mädchen!»
Schluss damit!, dachte ich. Ein Zimmer im Gasthof hätte ich nehmen sollen, wo es frisch bezogene Betten, eine funktionierende Elektrik sowie ein ordentliches Frühstücksangebot gab und niemand aus den Geschirrschränken zu mir sprach.
Ich ließ meinen Blick durch den Raum wandern. Erst in diesem Moment wurde mir bewusst, dass es nicht nur drüben in meinem alten Zimmer, sondern auch in dieser Küche so aussah, als sei seit Jahren keiner mehr hier gewesen. Was, soweit ich informiert war, nicht sein konnte. In der Nacht hatte ich mich, völlig übermüdet von der langen Reise, durch den lediglich vom Schein meines Feuerzeugs beleuchteten Flur zu meinem Bett vorgetastet, hatte mich kurz gewundert, dass es noch an derselben Stelle stand, ansonsten aber kaum etwas vom Zustand des stockfinsteren Hauses bemerkt, außer eben dass es keinen Strom gab. Bei Tageslicht sah ich jetzt überall Schmutz, Staubfäden und Spinnweben, entdeckte in jedem Winkel seit Langem verwaiste Dinge. Auf der Eckbank lagen alte Zeitschriften, Mein schöner Garten, Apotheken Umschau und Das Goldene Blatt, über den Esstisch war noch immer dieselbe Plastiktischdecke mit Rosendekor gebreitet, vergilbt und am rechten Rand mit einem Muster aus kleinen Brandflecken versehen, die von meiner Zeit als pubertierend renitente Jungraucherin und wilden Partys mit den Arnoldjungs zeugten. Auf der Ablage neben der Tür zur Diele waren dreckige alte Gartenhandschuhe um eine angerostete Blumenschere gewickelt, auf dem Telefontischchen lagen ein halbes Dutzend Lottoscheine und Omas abgegriffenes Portemonnaie. An der Wand zwischen den Fenstern hing der Kalender vom Landfrauenverein, das Blatt vom November 1993 zeigte eine Blondine mit Strohhut, die vergeblich versuchte, ihre Arme um einen gigantischen Kürbis zu schlingen. Ich erinnerte mich daran, wie Oma und ich uns über dieses absurde Motiv amüsiert hatten, und schaute rasch zu dem von der Lampe baumelnden Fliegenfänger, den meine Mutter angewidert als «neolithische Riesenfroschzunge» bezeichnet hatte. Vom ursprünglichen Gelb war vor lauter schwarz verklebten Fliegenleichen nichts mehr zu sehen. Auf den Fensterbänken fanden sich noch mehr zerfallende Trockenblumen und verendete Insekten, Fliegen, Wespen, Holzbienen. Die Scheiben waren stumpf vor Schmutz, bei einem der Oberlichter war das Glas zersprungen, aus den Rahmen bröckelte der Kitt.
«Alles habt ihr verkommen lassen!», hörte ich Oma schimpfen.
Alles hatten wir verkommen lassen.
Ich war nicht hier gewesen. Ich war fortgegangen und fortgeblieben. Aber wo hatte meine Mutter in den vergangenen Jahren gekocht, gegessen, getrunken, gewohnt?
«Ihr habt eine Geisterbude aus unserem schönen Zuhause gemacht!»
Ich ging zurück zum Küchenschrank, warf die Tür zu, dass die Teller schepperten. Sie hatte kein Recht, so mit mir zu reden, schließlich war sie als Erste gegangen. Neben dem Schrank hing die alte Uhr, auf zwanzig nach zwölf stehen geblieben, ebenfalls mit einer dicken Staubschicht bedeckt. Ich nahm die Uhr von der Wand, drehte die Flügelschraube auf der Rückseite so lange, bis sie am Anschlag war. Als die Uhr zu ticken begann, dieses laute enervierende Ticken, das so unerträglich vertraut klang, hätte ich beinahe angefangen zu heulen.
«Wie konnte ich nur so bescheuert sein und herkommen?», murmelte ich.
«Aber wirklich! Was für ein Desaster!», antwortete meine Großmutter. Ich überlegte, ob ich mir tatsächlich ein Zimmer suchen oder gleich den nächsten Zug nehmen sollte. Morgen um diese Zeit könnte ich schon wieder in Paimpol sein und in Gesellschaft schlaftrunkener Bootsbauer den ersten petit café bestellen, bevor ich zur Arbeit ging. Es war ohnehin zu spät für alles. Sollte der Wald sich das Haus holen, den Garten, das blöde Lavendelfeld und den verdammten Atelier-Saustall sowieso.
«Fluchst du schon wieder?»
«Lass mich in Frieden, Omi!»
«Dafür bist du nicht hergekommen, mein Mädchen.»
«Ich gehe stark auf die fünfzig zu und bin weiß Gott kein Mädchen mehr.»
«In diesem Haus wirst du immer …»
«Ruhe jetzt!»
Loup kam angetrabt, sprang an mir hoch und blies mir seinen stinkenden alten Hundeatem ins Gesicht.
«Arrête! Lass das!»
Er ließ von mir ab und lief wieder zu dem Fenster, von dem aus man den Waldweg einsehen konnte. Diesmal knurrte er nicht.
Die alte Frau und der kleine Hund verschwanden gerade mit perfekt synchronen Hinkeschrittchen hinter der großen Eiche, an die die Arnoldjungs mich als Zwölfjährige einmal für Stunden gefesselt und geknebelt hatten, bis meine Großmutter kam und mich rettete.
Sie sagt: Die, die ich bin, fürchtet weder den Stich des Skorpions
noch den Duft von Lavendel,
weder den Schlaf der Geister
noch die Leitartikel der Apotheken Umschau.
Die, die ich bin, hat gelernt zu brüllen,
damit sie nicht sprachlos erstickt.
2Eine von hier
Es war nicht meine Schuld, dass ich die Beerdigung meiner Mutter verpasst hatte. Aber ich konnte sehr wohl etwas dafür, dass ich seit Omas Tod kein einziges Mal mehr in Lindbach gewesen war. Ich hatte all die Jahre meine schwermütige Mutter wissentlich sich selbst überlassen, nachdem meine Großmutter hatte sterben müssen, weil Emma zwei schlicht zu betrunken gewesen war, um rechtzeitig den Notarzt zu rufen. Sie waren nebeneinanderliegend im Garten gefunden worden, und man musste die Arme meiner Mutter mit Gewalt von der bereits erkalteten Leiche lösen. Als Doktor Arnold mich endlich erreichte, waren beide bereits abtransportiert worden: Oma im Leichenwagen zum Bestatter und Mama mit dem Krankenwagen in die Landesklinik. Angeblich wäre für meine Großmutter sowieso jede Hilfe zu spät gekommen, aber hundertprozentig sicher sein konnte man sich bei solchen Sachen nie. Ich hatte mich zwei Wochen lang um die Erledigung der Formalitäten gekümmert und den einzigen Menschen beerdigt, der mir unentbehrlich gewesen war. Am Tag danach hatte ich es im Waldhaus nicht mehr ausgehalten, war spontan abgereist, ohne meine Mutter auch nur ein Mal in der Klinik zu besuchen, geschweige denn ihre Entlassung abzuwarten. Zunächst ging ich wieder zurück ans Museum nach Frankfurt, später nach Köln und Berlin. Dort erreichte mich das Angebot für einen größeren Auftrag am Musée d’art et d’histoire in Saint-Brieuc, und so siedelte ich schließlich ganz nach Frankreich über. Als freiberufliche Restauratorin konnte ich überall Arbeit finden. Ich verliebte mich in die windumtoste bretonische Felsküstenlandschaft, die das Gegenteil der sanften Lindbacher Idylle war, und in Xavier, einen angenehm wortkargen französischen Kollegen, mit dem ich zuerst nur eine Werkstatt und seit nunmehr fast fünfzehn Jahren zudem noch das Ehebett teilte. Der Gedanke, zwischenzeitlich nach Deutschland zu reisen, Wochenenden oder Urlaub im Waldhaus zu verbringen, wie ich es vor Omas Tod gerne getan hatte, kam mir gar nicht. Was sollte ich da? Meine Mutter anbrüllen, ihr die Wodkaflasche aus den Händen schlagen, schweigend neben ihrem Elend sitzen, irgendeine Botschaft aus ihren verstörenden Werken herauslesen? Sie schien das genauso zu sehen, jedenfalls hat sie kein einziges Mal versucht, Kontakt mit mir aufzunehmen. Wir waren einander fremd, ich ihr und sie mir, waren es immer gewesen. Wahrscheinlich hätte ich mich trotzdem bei ihr melden sollen. Irgendwann, nach zwei, drei Jahren, eine Postkarte schicken oder am Geburtstag anrufen und fragen, wie es so geht. Die Frau war hilflos, krank, schuldunfähig allemal – sofern überhaupt von Schuld zu sprechen war. Als Tochter hatte ich wahrscheinlich genauso versagt wie sie als Mutter – aber auch das war ein Gedanke, der zu nichts führte. Man glaubt ja immer, man hat noch Zeit. Aber dann ist eines Tages die Zeit abgelaufen, und man weiß nicht, was man machen soll.
Als ich das Schreiben vom Amtsgericht gelesen sowie die beigelegten Papiere gesichtet hatte, die über einige Umwege schließlich doch noch in meinem Briefkasten gelandet waren, hatte ich, ohne weiter darüber nachzudenken, meinen Rucksack gepackt und war keine halbe Stunde später bereits auf dem Weg gewesen. Als hätte es noch einen Grund zur Eile gegeben! Loup war mir beim Packen nicht von der Seite gewichen, und weil Xavier noch bis mindestens Ende der Woche mitsamt unserem Auto in Saint-Pierre-sur-Dives war, um ein von Wurmfraß befallenes Chorgestühl zu behandeln, tippte ich eine Nachricht für ihn in mein Telefon und nahm den alten Wolfshund mit auf die Reise.
Ich habe etwas in Deutschland zu erledigen.
Loup und ich sind bald wieder da. Bisou. T.
Elf Stunden Zugfahrt von Paimpol über Guingamp bis Paris Montparnasse, dann von der Gare de l’Est bis Frankfurt, schließlich mit der Regionalbahn bis Großeichen, wo ich nachts um Viertel vor zehn angekommen war und mir, weil mein Telefon schlappgemacht hatte, kein Taxi hatte rufen können. Den letzten Bus hatte ich eben noch von hinten gesehen, der nächste würde erst wieder früh um halb sechs kommen. Also waren Loup und ich eine weitere Stunde über Feld- und Waldwege gewandert, bis wir völlig erschöpft nachts um elf angekommen waren. Mein Schlüssel hatte noch ins Schloss gepasst.
Und jetzt stand ich, fassungslos angesichts meiner strunzdummen Planlosigkeit, in dieser eingestaubten Geisterküche, in der ich nicht sein wollte, und hörte meine Oma «es ist, wie es ist, Kind» sagen.
Ich war nicht einmal in der Lage, mein Telefon aufzuladen, um einen Termin mit der Maklerin zu vereinbaren, eine Anwaltskanzlei zu kontaktieren, beim Notariat anzurufen oder was auch immer man machen musste, um ein Erbe schnellstmöglich abzuwickeln. So etwas wie ein Frühstück ließ sich ebenfalls nicht zubereiten, und Loup, der am allerwenigsten für die Situation konnte, in die ich uns hineinmanövriert hatte, hatte definitiv Besseres verdient, als mit einem weiteren der trockenen Müsliriegel aus meinem Rucksack abgespeist zu werden, von denen wir uns, abgesehen von zwei Croissants in der Bahnhofshalle der Gare de l’Est, während der vergangenen vierundzwanzig Stunden ernährt hatten. Zigaretten gab es auch keine mehr. Ich kam nicht drum herum, ins Dorf zu laufen und etwas einzukaufen – und damit zwangsläufig den Lindbachern meine Rückkehr kundzutun.
«Vorläufige Rückkehr», sagte ich in Richtung des Küchenschranks. «Stippvisite! Tem-po-rär! Ich haue wieder ab, das kannst du aber wissen!»
Aus dem Küchenschrank drang nichts als Stille. Zum Glück.
«Hier herrscht Leinenpflicht! Und wenn ich mir den so anschaue, gehört da außerdem ein Maulkorb drauf!»
Der Wagen war neben mir stehen geblieben, der Fahrer hatte mit einem leisen Surren das Fenster heruntergelassen, um mich besser anpöbeln zu können.
«So weit kommt’s noch!», schimpfte ich zurück, und im selben Moment wurde mir bewusst, dass ich gerade meine Oma zitiert hatte, dann erkannte ich den Fahrer.
«Guten Morgen, Taxi-Herbert! Hast du vielleicht eine Zigarette für mich?»
«Ich werd verrückt! Toni Bachmann? Bist das wirklich du?»
Ich nickte.
Taxi-Herbert hielt mir kopfschüttelnd eine zerbeulte Packung American Spirit und ein rosa Feuerzeug mit Hello-Kitty-Motiv hin. «Wir sind beide verdammt alt geworden, es ist unfassbar!»
Ich pfriemelte eine Zigarette aus der Packung, zündete sie an, sog gierig den Rauch ein. «Zum Glück bist zumindest du noch immer so ein ausgemachter Charmeur, Herbert.»
Er hob salutierend die Hand an die Stirn. «Das hilft enorm in meinem Job.»
«Kann ich mir vorstellen.»
«Entschuldige übrigens, dass ich wegen dem Maulkorb gemeckert habe, Toni, ich dachte, du wärst keine von hier.»
So war Lindbach: Man ließ sich zwanzig Jahre lang nicht blicken und blieb dennoch, ob man wollte oder nicht, «eine von hier». Selbst dann, wenn man im von bösen Zungen «Bastardbude» genannten Waldhaus aufgewachsen war, in dem man sich herzlich wenig um Dorfgebräuche und Anstandsregeln geschert hatte. Aber Herbert war nie einer von denen gewesen, die die Nase darüber gerümpft hatten, wie es bei uns zugegangen war oder dass es bei den Bachmann-Emmas keine Väter für ihre unehelichen Töchter gab. Daran hatten ohnehin die wenigsten Anstoß genommen. Was das anging, konnte man im Großen und Ganzen stolz auf die Lindbacher sein, die «reimten sich ihren eigenen Reim», wie Pfarrer Martinek oft gesagt hatte, und zogen es vor, «den lieben Gott einen guten Mann sein» zu lassen, bevor sie sich unnötig aufregten.
Herbert steckte sich ebenfalls eine Zigarette an. «Ich hab gedacht, dich gibt’s gar nicht mehr.»
«Doch», sagte ich. «Mich gibt’s noch.»
Er hatte anscheinend nicht vor, mich auf die Beerdigung anzusprechen, die vorletzten Samstag ohne mich stattgefunden hatte.
«Und du? Hast offenkundig doch deinem Alten nachgeeifert, statt Tierfilmer zu werden, wie sich das gehört hätte?»
Er kratzte sich am Hinterkopf. «Ich fotografiere gelegentlich immer noch, draußen bei den Rehen oder wenn Rinderkirmes ist. Und dann hab ich ja auch …» Er stockte. «Ach, egal. Selbstständiger Fuhrunternehmer ist ein prima Beruf. Man trifft viele Leute, kommt gut rum und ist sein eigener Chef.»
«Wie weit kommst du denn für gewöhnlich?»
«An Feiertagen manchmal sogar bis Frankfurt.»
«Quasi Weltreise.»
«Mach dich nur lustig, Toni, juckt mich nicht. Ich tue das wirklich gerne. Und den Namen wäre ich sowieso nie losgeworden. Selbst wenn ich den Oscar für meine Filme bekommen hätte, wäre ich in Lindbach der Taxi-Herbert geblieben. Da hab ich lieber gleich das Steuer übernommen, mir den Titel mit Taten verdient. Hat gepasst. Passt immer noch.»
Er wurde bereits in der Grundschule von allen «Taxi-Herbert» genannt, weil seine Familie das einzige Transportunternehmen des Ortes betrieb, bestehend aus Herberts Vater und einem gewaltigen Benz, aus dessen nur geringfügig modernerem Nachfolger mich Herbert jetzt angrinste. Früher fand ich ihn nett, aber merkwürdig, wie er samstags und sonntags in aller Frühe mit seiner Super 8 auf dem Hochsitz am Waldrand hockte, manchmal stundenlang. Man konnte ihn von unserem hinteren Garten aus gut sehen, er war als Jugendlicher bereits ein Koloss. «Taxi-Günthers Junge hat eine schöne Passion», hatte meine Oma immer voller Hochachtung gesagt und ihm manchmal Marmeladenbrote und Tee gebracht.
«Wie geht’s Günther?», fragte ich.
«Gut, hoffentlich. Er ist seit acht Jahren tot.»
«Das tut mir leid!»
«Muss es nicht.» Herbert fuhr sich mit der Hand über das schütter gewordene Haar. «Was machst du eigentlich hier?»
«Bin auf dem Weg zum Spar», antwortete ich, Herberts Frage bewusst missverstehend. «Es ist nichts Essbares im Haus, und der Hund wird unleidlich, wenn er Hunger hat.»
Herbert nickte, als sei das genau die Antwort, die er erwartet hatte. «Der Spar ist jetzt übrigens ein Edeka.»
«Okay, dann bin ich eben auf dem Weg zum Edeka.»
«Soll ich dich mitnehmen? Ich muss eh da lang. Die Gerti vom Blumen-Weidner muss zur Dialyse in die Uniklinik. Dreimal die Woche! Für mich ein gutes Geschäft, das schon, aber trotzdem: Es ist ein Elend, das sag ich dir! Dabei ist sie erst knapp über vierzig.»
Ich konnte mich nicht erinnern, dass beim Blumen-Weidner eine Gerti gewesen war, dann fiel mir ein, dass es wahrscheinlich auch bei Blumen-Weidners einen Generationswechsel gegeben hatte. «Lebt der Senior noch?»
«Ist zwei Tage vor seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag mit Schlaganfall vom Apfelbaum gefallen und hat sich das Genick gebrochen», sagte Herbert. «Willst du jetzt mitfahren oder nicht?»
«Was ist mit dem da?»
Ich deutete auf Loup, der zögerlich näher trat und die Schnauze zum Autofenster hob.
«Weiß der sich im Wagen zu benehmen?»
«Er beißt nur im Notfall, und kotzen tut er lediglich, wenn er Pansen zum Frühstück hatte oder übersäuert ist. Heute bloß übersäuert, würde ich schätzen.»
«Du spinnst noch genauso wie früher, Toni Bachmann! Der Köter kommt mir aber nach hinten, der haart sonst alles voll. Schönes Tier. Irgendwie edel. Ist das ein Wolf?»
Ich zuckte mit den Schultern. «Angeblich ein halber, aber dafür ist er eigentlich zu harmlos. Sag’s nicht weiter, die Lindbacher sollen ruhig Angst vor ihm haben.»
Herbert hob feierlich die rechte Hand zum Schwur. «Ich werde schweigen wie ein Badeschwamm!» Dann wuchtete er sich aus seinem Taxi, ging um den Wagen herum und öffnete die Heckklappe. «Darf ich bitten?»
Loup schien Herbert auf Anhieb zu mögen, trottete freundlich mit der Rute wedelnd auf ihn zu, wie es normalerweise gar nicht seine Art war. Ich ließ ihn ins Auto springen. «Couche-toi!»
Ohne zu zögern, gehorchte er und legte sich hin. Loup liebte Autofahren, und diesen Kofferraum musste er sich nicht einmal mit unseren Arbeitstaschen, Materialien und Werkzeugkisten teilen.
«Sprichst du Französisch mit deinem Hund?»
Ich nickte.
«Vornehm geht die Welt zugrunde», sagte Herbert und öffnete die Beifahrertür für mich.
«Kannst im Auto zu Ende rauchen, wir lassen einfach die Fenster auf.»
Als wir im Wagen saßen, griff Herbert zum Handschuhfach, kramte, mit seiner gewaltigen Wampe halb auf mir liegend, einen Plastikbeutel mit zwei Wurstbroten hervor.
«Mag der französische Wolf so was? Ess ich eh nicht mehr.»
Er reichte mir den Beutel, und ich warf die Stullen eine nach der anderen nach hinten. Loup fing sie jeweils in der Luft und verschlang sie gierig.
«Harmlos hin, harmlos her, bei dem möchte man lieber kein Wurstbrot sein.»
«Besser ist es.»
«Hinter Goßfelden hat übrigens letztens einer von den Wölfen, die jetzt überall auftauchen, zwei Alpakas gerissen. Die Leute hier sind gerade ein bisschen nervös deswegen.»
«Du meine Güte!»
«Ach, irgendwas ist immer.»
Herbert startete den Motor und lenkte den Wagen zurück auf die Straße. Wir fuhren in einem moderaten Ausflüglertempo durch den Wald, dann an der alten Mühle vorbei, weiter in Richtung Aussiedlerhöfe, rauchten schweigend aus den offenen Fenstern, und mir wurde etwas leichter ums Herz. Ich schaute hinaus, dankbar darüber, dass Herbert so aufmerksam oder, und das war mir ebenfalls recht, so gleichgültig war, mich nichts weiter zu fragen. Wieso ist mir in meiner Jugend eigentlich nie aufgefallen, was für ein angenehmer Mensch dieser Taxi-Herbert ist?, dachte ich. Er war früher auch öfter irgendwo drangefesselt gewesen, hatte aber keine Oma gehabt, die mit der Spatengabel auf die Arnoldjungs losging, sodass sie einen fortan mit Respekt behandelten.
«Sag mal, Herbert.»
«Ja?»
Das Taxi wurde noch langsamer.
«Wer ist eigentlich die schicke Alte, die mit dem kleinen Windhund im Forst Gassi geht? Wohnt die hier irgendwo?»
Herbert drehte sich zu mir hin, sodass der Wagen einen kleinen Schlenker nach rechts machte. «Wieso weißt du das nicht?»
«Wie sollte ich das wissen, ich war ewig nicht hier.»
«Na, die Baroness wohnt doch bei euch.»
Sie sagt: Die Menschen meiner Zeit nannten die, die ich bin,
eine Wahnsinnige,
eine Schamlose,
eine Bürgerin des Schreckens,
einen fleischgewordenen Skandal,
eine erotomane Wilde.
Einige nannten mich Muse, Künstlerin, Dichterin, Visionärin, Freigeist, Genie.
So oder so ist es besser, wenn ich nicht ausgelöscht bin.
3Elsa
«Ich habe sie Anfang April am Großeichener Bahnhof eingesammelt», sagte Herbert. «Nachts um halb zwölf, da hatte sie pures Glück, dass ich nicht schlafen konnte und noch ein bisschen in der Gegend herumgefahren bin. Der Bahnhof ist ja ziemlich ab vom Schuss, der Warteraum seit Jahren mit Brettern zugenagelt, die Telefonzelle funktioniert schon lange nicht mehr, und ein Handy scheint sie nicht zu besitzen. Die arme Frau hätte da unter Garantie bis zum nächsten Morgen allein auf dem Treppenabsatz gehockt. Hab ich mich erschreckt, als da plötzlich eine Gestalt im Licht meiner Scheinwerfer aufgetaucht ist!»
Sie habe einen großen abgenutzten Koffer dabeigehabt, mit unzähligen Aufklebern drauf und einem dieser Flug-Klebezettel am Griff: «JFK, also Flughafen John F. Kennedy, also New York», wie Herbert mit Kennermiene hinzufügte. «Dazu eine lederne Reisetasche, aus der der dünne kleine Hund herausgeschaut hat. Wie in einem dieser uralten Filme hat sie ausgesehen, wie Greta Garbo als Mata Hari in klein und uralt.»
Mit einer Selbstverständlichkeit, als habe sie ihn eigens herbeigerufen, war sie ins Taxi gestiegen und hatte die Adresse vom Waldhaus genannt. Herbert hatte sie hingefahren, ihr den Koffer hinters Haus zum Atelier geschleppt, wo sie ihn mit einem üppigen Trinkgeld bedachte.
«Soll ich noch warten, bis Frau Bachmann Ihnen aufmacht?», hatte Herbert gefragt. «Nicht, dass Sie doch noch draußen übernachten müssen.»
Die Baroness hatte in den kleinen Samtbeutel gegriffen, den sie an einer Kordel um den Hals trug, und einen Schlüssel herausgezogen. «Ich lasse mich selbst hinein», hatte sie gesagt und Herbert eine «zauberhafte Restnacht» gewünscht. Seitdem war sie in Lindbach.
«Die haben beide im Atelier gehaust?»
«Logisch», sagte Herbert.
Seltsame Logik, dachte ich, wollte das Thema Atelier aber nicht weiter vertiefen.
«Die Baroness ist wirklich nett», sagte Herbert, während er vor dem Edeka den Wagen zum Halten brachte. «Schräg, ja, aber auf ihre Weise ganz schön in Ordnung. Und deiner Mutter schien sie wirklich gutzutun. Na ja, jedenfalls bis …»
Ich fiel ihm ins Wort und sagte, wir könnten vielleicht ein anderes Mal reden, ich müsse jetzt wirklich etwas zu essen besorgen.
«Außerdem steht dort hinten vorm Blumen-Weidner eine Frau, die hektisch winkt.»
«Ach ja, die Gerti», sagte Herbert.
«Die Gerti muss jetzt dringend zur Dialyse», sagte ich und sprang aus dem Taxi.
Sie saß über ein Buch gebeugt auf der Bank unter dem Pflaumenbaum im Vorgarten, als ich, beladen mit einem Sack Hundefutter und einer mit Schnittbrot, Scheibengouda, Zigaretten und zwei Flaschen Zitronenlimonade gefüllten Plastiktüte, wieder am Waldhaus ankam. Den Umhang hatte sie abgelegt, die Schnabelschuhe von den Füßen gestreift, auch die Fliegerkappe trug sie nicht mehr, stattdessen hatte sie sich eine Fasanenfeder ins schlohweiße, zum Bubikopf geschnittene Haar gesteckt. Loup erstarrte, als uns der kleine Windhund, der neben der Alten auf der Bank gelegen hatte, kläffend entgegenrannte. Ich ließ den Sack von meiner Schulter rutschen und auf den Boden fallen, woraufhin das Hündchen erschrak und kreischend die Flucht ergriff. Die Baroness las ungerührt weiter. Sie wirkte von Nahem noch fragiler und älter, hatte gleichzeitig eine herbe Strenge und Entschlossenheit im Gesicht, die ich fast schon beängstigend, aber unbedingt faszinierend fand. Ich trat näher, wartete darauf, dass sie reagierte, betrachtete derweil die aus dicken bunten Perlen geknüpften Ketten, die sie sich in so großer Menge um den faltigen Hals gelegt hatte, dass man sich wundern konnte, wie die zarte Person dieser Last standhielt. Wahrscheinlich mit purer Willenskraft, schoss es mir durch den Kopf – die stahlblauen, hoch konzentriert auf die Lektüre gehefteten Augen legten diesen Verdacht nahe. An den Ketten hatte sie mithilfe von Nylonfäden, Silberdraht oder Schlüsselringen verschiedene Dinge befestigt: Rohrschellen, zu kleinen Sträußen gebundene Holzschrauben, Sechskantmuttern, Unterlegscheiben in verschiedenen Ausführungen, Federringe aus Messing, Flachverbinder, Schraubösen, diverse Zugfedern. Sie musste einen halben Eisenwarenladen geplündert haben, um ihren Schmuck zusammenzubasteln. Erstaunlicherweise sahen die eigenartigen Designobjekte an ihr aber kein bisschen lächerlich aus.
Ich räusperte mich.
Sie hob mahnend den Zeigefinger. «Nur noch den Absatz fertig.»
Nach einer weiteren Wartezeit, die vermutlich keine zwei Minuten gedauert hatte, mir aber endlos vorgekommen war, zog sie mit einer Bewegung von aufreizender Langsamkeit die Feder aus dem Haar, legte sie zwischen die Seiten und klappte das Buch zu. Endlich hob sie den Blick, um mich lange und durchdringend zu mustern. Das Urteil fiel anscheinend milde aus, denn ihr Gesicht erhellte sich zu einem Lächeln. «Bonjour, Antonia! Da bist du ja endlich! Ich darf doch Du sagen? Und einen Wolf hast du auch mitgebracht, wie sinnig!»
Sie klopfte einladend mit der flachen Hand neben sich auf die Holzbank. «Setz dich zu mir!»
Ich blieb stehen, wo ich war. «Kennen wir uns?»
«Ach, meine Liebe, kennen, das ist so ein butterdummer Begriff, findest du nicht auch? Man weiß nie so genau, was damit gemeint ist, er ist irgendwie glipschig und lässt viel zu viel Raum für Fehldeutungen, wir sollten ihn lieber meiden.»
«Darf ich dann vielleicht fragen, wer Sie sind und was Sie hier auf meinem Grundstück machen?»
Jetzt hatte ich es tatsächlich ausgesprochen: mein Grundstück.
Sie hob die Brauen, schmunzelte. «Oh, là, là! Da mutest du mir zwei weitere Fragen zu, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Willst du dich nicht doch lieber setzen?»
Ich schaute zu Loup, der sich neben dem Futtersack ins Gras gelegt hatte und wachsam auf den Pfad starrte, über den der kleine Windhund auf seiner Flucht hinter der Hausecke verschwunden war. Die Natursteinplatten hatte meine Oma eigenhändig verlegt, damit meine Mutter bei Regenwetter trockenen Fußes in ihr Atelier kam. Rechts und links des Plattenwegs wucherten Unkraut, Gras und Brennnesseln sowie braune Reste ehemals üppig blühender Stauden. Den Pfad selbst hatte jemand so weit vom Gestrüpp freigehalten, dass man ungehindert in den hinteren Garten gelangen konnte. Meine Mutter, dachte ich. Meine Mutter war bis vor Kurzem wahrscheinlich noch täglich diesen Weg entlanggegangen.
Die Baroness klopfte erneut auf die Bank. «Allez, vas-y! Komm her, es ist schon genug Zeit verplempert worden!»
Ich dachte, dass ich mich um die kaputte Elektrik kümmern sollte, dass der Hund gefüttert werden musste, dass es tausend Sachen zu erledigen gab, die keinen Aufschub duldeten. Dann dachte ich an den Geschirrschrank, stellte mir vor, wie ich einen Becher herausnahm, wie ich mir Limonade eingoss und meine Oma «was für eine widerliche Chemiebrühe!» sagte, und war plötzlich dankbar, dass da jemand war, der mich davon abhielt, das Haus zu betreten, selbst wenn es sich um eine Person handelte, mit der ich mutmaßlich über meine Mutter würde sprechen müssen.
Ich nahm neben der Baroness Platz.
Sie seufzte. «Na also! War doch nicht so schwer, oder?»
Ich kramte die Zigaretten aus der Edeka-Tüte, riss das Päckchen auf. «Stört es Sie, wenn ich rauche?»
«Im Gegenteil!»
Ich hielt ihr die Packung hin. «Auch eine?»
Sie nahm dankend an, ließ sich Feuer reichen und tat genüsslich einige tiefe Züge.
«So. Was möchtest du zuerst wissen: Woher ich deinen Namen kenne, was ich hier mache, oder wer ich bin?»
«Die Reihenfolge würde ich Ihnen überlassen.»
«Fangen wir mal mit mir an, das ist für dich die leichtere Übung. Also: Wer bin ich? Da müssen wir trotz der uns gebotenen Eile dann doch ein wenig tiefer graben.»
Ich fragte mich, von was für einer Eile sie sprach, wollte sie aber nicht unterbrechen.
«Wer oder was macht uns zu denen, die wir sind? Richtig: zunächst einmal die Herkunft, der Geburtsort, die Familie, bla, bla, bla, was selbstverständlich ein spießbürgerlich verbrämter Unsinn ist. Mein Vater war Maurer, meine Mutter Pianistin. Da fragst du dich, wie so etwas zusammenpasst? Es passte ganz und gar nicht. Hätten wir das also schon mal geklärt.»
Jemand musste nach Omas Tod diese Bank gestrichen haben, stellte ich fest, während ich mit dem Fingernagel ein Stückchen grüne Farbe von der Kante abknibbelte und das darunterliegende helle Braun freilegte, das noch von einem Anstrich meiner Großmutter stammte. Meine Mutter hatte ab und zu auf dieser Bank gesessen, wenn ich nachmittags von der Schule gekommen war, hatte mit trübem Blick an mir vorbeigesehen, als wäre ich gar nicht da.
«Was fällt dir ein, wenn du an Swinemünde denkst, Antonia?», unterbrach die Alte meine Gedanken.
«Wie bitte?»
«Weiße Strände, prachtvolle Villen, frischer Ostseewind, die Sonneninsel Usedom oder gar …» Sie hob das Buch an. «Effi Briest?»
Ich zuckte mit den Schultern. «Ja, von mir aus, ich hab das mal in der Schule lesen müssen.»
Die Baroness fuhr sich mit theatralischer Geste durchs Haar, reckte das Kinn, um mit gespitzten Lippen eine Rauchsäule gen Himmel zu pusten. «Ach, o weh! Die verhängnisvolle Kessiner Einsamkeit, das Leid einer ohnmächtigen Frau, auf das die Swinemünder so stolz sind, Fontane hier, Fontane da, meine Fresse! Warum haben die nicht mal was nach mir benannt, diese heuchlerischen Feiglinge? Einen Platz, eine Straße, von mir aus eine Autobahnausfahrt, aber nein, bis heute nichts, nothing, absolument rien! Ich war ihnen wohl nicht ohnmächtig genug. Obendrein habe ich mich so gar nicht wie eine Dame meiner Zeit betragen können, da wollten die Herren Stadträte mir zwielichtiger Person lieber kein Denkmal setzen, ‹schlechtes Beispiel für die Jugend› und so weiter, da muss man ja doch