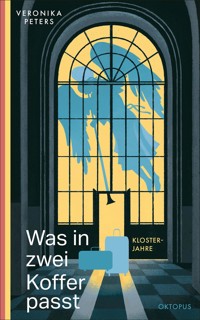
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: OKTOPUS by KampaHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit 21 Jahren beschließt Veronika Peters, in ein benediktinisches Kloster einzutreten. Ein Schritt, von dem sie sich erhofft, er werde das Ende einer langen Suche nach Sinn und Zugehörigkeit sein. Nachdem sie früh von zu Hause ausgezogen ist, hat sie sich mit einer Ausbildung zur Erzieherin beruflich verwirklicht, ist zum Katholizismus konvertiert, engagiert sich politisch - und doch quält sie »ein geistiger und emotionaler Dauerhunger«. Als sie eine junge Nonne kennenlernt, die Klarheit und Zufriedenheit ausstrahlt, weiß sie: Das ist ihr Weg. In ihrem bewegenden autobiographischen Bericht gibt Veronika Peters Einblicke in den strengen Tagesablauf im Kloster, wo sie unter anderem als Gärtnereigehilfin, Restauratorin und Buchhändlerin tätig war, erzählt von ihren Mitschwestern, schreibt offen darüber, wie es ist, auf Sex zu verzichten, oder wie im Kloster Karneval gefeiert wird. Mit viel Witz räumt sie mit Klischees auf und gibt ehrlich Auskunft über ihre Zweifel. Als sie in der Klosterbuchhandlung ihrer großen Liebe begegnet, packt sie abermals die Koffer …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Veronika Peters
Was in zwei Koffer passt
Klosterjahre
Mit einem Vorwort der Autorin zur Neuausgabe
Oktopus
Für Carla und Chris
Vorwort zur Neuausgabe
Das vorliegende Buch, mein erstes, erschien Anfang 2007, und zu diesem Zeitpunkt hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass fünfzehn Jahre und sechs weitere Buchveröffentlichungen später noch immer Menschen die Geschichte meiner Klosterjahre lesen wollen. Umso mehr freue ich mich über diese Neuausgabe.
Als ich mich damals entschloss, dieses Buch zu schreiben, lebte ich bereits seit einigen Jahren mit meinem Mann in Berlin, arbeitete an meinem ersten Roman, hatte ein kleines Kind und traf zu den verschiedensten Gelegenheiten – bei Lesungen, auf dem Spielplatz, bei Geburtstagspartys, Abendessenseinladungen, Sommerfesten – eine Menge unterschiedlicher Leute. Nahezu jedes Mal, wenn ich dabei jemand Neues kennenlernte und diese Person dann nach einer Weile in Erfahrung brachte, dass ich einige Jahre in einer klösterlichen Kommunität gelebt hatte, war die Lockerheit der Situation erst einmal vorbei. Das Gesicht meines Gegenübers changierte zwischen Ungläubigkeit, Entsetzen oder bestenfalls Belustigung, und es bedurfte eines langen Gesprächs und zahlreicher Erläuterungen meinerseits, bis ich wieder als einigermaßen ernstzunehmende Frau galt – ein ungläubiges Kopfschütteln blieb in der Regel dennoch. Ein streng religiöses Leben zu führen, oder wie in meinem Fall geführt zu haben, schien ein Zeichen psychischer Deformation, frömmelnder Naivität oder sich dem Leben verweigernder Weltflucht zu sein. Anscheinend nährten sich die gängigen Vorstellungen von Ordensfrauen, sofern sie nicht von einer garstigen Internatsschwester herrührten, überwiegend aus Hollywood-Streifen, in denen Sophia Loren oder Audrey Hepburn wunderschön und rehäugig in die Kamera litten, oder aus launigen deutschen Vorabendserien, in denen putzige Ordensschwestern den intriganten Ortsbürgermeister hereinlegten und minderjährige Kleinkriminelle auf den Pfad der Tugend führten. Das mochte unterhaltsam sein, und auch ich habe laut gelacht über die Nonne, die wie der Teufel in ihrer klapprigen Ente durch Luis de Funès’ Slapstick-Komödien rast, aber all diese medial vermittelten Nonnenbilder entsprachen so gar nicht den Erfahrungen, die ich selbst im Kloster gemacht hatte – und es wurde vor allem den klugen, eindrucksvollen sowie äußerst ernsthaften Persönlichkeiten, die ich dort teilweise kennengelernt hatte, nicht gerecht. Besonders Letzteres ärgerte mich manchmal schon sehr. »Dann schreib doch was über diese Klosterfrauen«, sagte eines Tages eine Freundin zu mir. »Du willst Schriftstellerin sein, also zeichne dein eigenes Bild.« Zunächst war ich skeptisch, wollte ich doch mit meinem Schreiben ganz andere Wege beschreiten, davon abgesehen meine Klostervergangenheit möglichst weit hinter mir lassen. Past is past and done is done, dachte ich. Je länger mir aber der Vorschlag meiner Freundin im Kopf herumging, und das tat er mit unausweichlicher Hartnäckigkeit, desto klarer wurde mir, dass ich mich vor der Herausforderung, diese Phase meines Lebens erzählerisch zu bearbeiten, nicht drücken sollte. Schließlich unterbrach ich also die Arbeit am ersten Roman, überwand meine Skepsis und kehrte noch einmal ins Kloster zurück, diesmal schreibend. Und auch wenn ich die Geschichte nur aus meiner sehr subjektiven Perspektive erzählte, einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit folglich weder erheben konnte noch wollte, so hoffte ich doch, einen authentischen Einblick in diese den meisten Mitmenschen so fremde klösterliche Lebensform zu geben. Das Buch wurde dann viel gelesen, herrlich kontrovers diskutiert – ja, auch in Klöstern! –, und nicht zuletzt öffnete es mir die Tür zu einer Existenz als freie Schriftstellerin. Grund genug, dankbar zu sein.
Wenn ich heute, an einem regnerischen Nachmittag im Frühjahr 2022, anlässlich dieser Neuauflage den Text wieder in die Hand nehme, begegne ich, nach all der Zeit und all den anderen Themen, mit denen ich mich seitdem lebend und schreibend beschäftige, der jungen Frau, als die ich mich vor Jahren beschrieben habe, mit in vielerlei Hinsicht beträchtlichem Abstand. Das ist eine interessante und sonderbare Erfahrung. Ein bisschen so, als würde ich ein altes Fotoalbum durchblättern und dabei denken: Das also soll einmal ich gewesen sein? Die Stimme, die da zu mir spricht, erkenne ich zwar noch immer als meine eigene, aber ebenso kommt sie mir befremdlich vor. Ganz nah und zugleich weit weg. Ich trete während der Lektüre in einen seltsamen Dialog mit meinem jüngeren Ich, dieser naturgemäß unzuverlässigen Erzählerin, möchte ihr dabei gelegentlich widersprechen, ihre aufsässige Halsstarrigkeit kritisieren, sie ermahnen, ihren Ton etwas zu zügeln und vielleicht auch etwas mehr Respekt zu zeigen, Milde walten zu lassen, sich selbst und noch mehr: den anderen gegenüber. Gleichzeitig vergegenwärtigt mir diese fremd-vertraute Stimme noch einmal aufs Neue, wie zerbrechlich und wie stark die Sehnsucht damals war, nach einer Lebensform, die sich jenseits gesellschaftlicher Normen und kapitalistischer Werte bewegte, wie dringlich der Wunsch nach Zugehörigkeit, nach einem Dasein, das von gelebter Spiritualität und gemeinschaftlich praktizierter Gottsuche geprägt ist.
»Fromme Rede« sucht man in diesem Buch allerdings vergeblich, es berichtet nur, will weder Zeugnis noch Bekenntnis ablegen – und Sinnfragen werden schon gar nicht beantwortet. Allenfalls werden hier und da welche aufgeworfen, aber das müssen die Leser*innen für sich entscheiden. »Das Faszinosum versteckt sich bei Ihnen zwischen den Zeilen«, hat mir einmal eine Ordensschwester gesagt, die zu einer meiner Lesungen gekommen war. »Berufung kann man letztlich nicht erklären.«
Ich habe mich über diese Rückmeldung sehr gefreut.
Schon lange bin ich nicht mehr im Katholizismus beheimatet und sehe mich in den vergangenen Jahren zunehmend dazu genötigt, auf Distanz zu einer Kirche zu gehen, in der sich ein vertuschter Missbrauchsskandal an den anderen zu reihen scheint, in der Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung diskriminiert werden und in der Frauen die Möglichkeit einer Berufung zum höheren kirchlichen Amt per se abgesprochen wird. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass von den Klöstern, entgegen ihres zumeist römisch-katholischen Kontextes, nach wie vor eine Signalwirkung auf unsere Gesellschaft ausgehen kann, dass es gut ist, dass es sie gibt, denn sie sind in unserer so sehr dem Materiellen wie dem unerträglich Diesseitigen verschriebenen Welt so etwas wie eine institutionalisierte Erinnerung daran, dass es da noch eine andere, uns gänzlich übersteigende Dimension gibt, welchen Namen man dieser Dimension auch immer geben mag. Und vielleicht könnte es gerade deshalb auch nach wie vor interessant sein, eine Erzählung zu lesen, in der es um Frauen geht, die sich auf das Wagnis dieses ganz anderen Lebens einlassen. Nirgends habe ich so viele originelle, schräge, mutige und handfeste Frauen auf einem Haufen getroffen wie im Kloster. Wenn das Buch davon auch nur eine Ahnung hinterlässt, hat sich das Schreiben allein dafür gelohnt.
Würde ich das Buch aus heutiger Sicht anders schreiben?
Wahrscheinlich schon.
Hatte ich das Bedürfnis, es für diese Neuauflage umzuschreiben?
Nein. Dies ist die Geschichte, sie soll es auch bleiben.
Ich bin auch heute noch voller Dankbarkeit den Klosterfrauen gegenüber, die es so lange mit mir ausgehalten haben. Sie ermöglichten mir, der Unbehausten, der Zweiflerin, die Jahre, die ich brauchte, um meinen Weg weitergehen zu können. Die Klosterfrau hat viel gelernt, was der Schriftstellerin später zugutekam: Die eigenen Abgründe auszuloten, Stille auszuhalten, ein leeres Konto nicht zu fürchten, nicht so leicht aufzugeben, eine Suchende zu bleiben … – die Liste ließe sich fortsetzen. Die Schwestern haben auch nach meinem Weggang aus dem Kloster mit mir Kontakt gehalten und mich, wie auch dieses Buch, auf ihre jeweils eigene Art begleitet, manche kritisch, manche wohlwollend, mit einigen bin ich bis heute befreundet.
Es ist nicht allzu lange her, dass ich das Kloster wieder besucht habe. Meine inzwischen erwachsene Tochter hat mich auf dieser Reise begleitet, weil sie, wie sie sagte, neugierig war auf den »Originalschauplatz«. Die liturgischen Gesänge und gestrengen Gottesdienstriten fand sie eigenartig, aber auch schön, die Warmherzigkeit, mit der wir dort empfangen und zum Essen eingeladen wurden, hat sie begeistert. Auch »mein« altes Kloster hat sich im Lauf der Zeit verändert: Gebäudeteile wurden abgerissen, andere aufwendig renoviert, ich finde ein Gelände vor, auf dem ich mich nicht mehr auskenne. Zudem ist die Schwesternschaft deutlich kleiner geworden: Statt der damals über vierzig Ordensfrauen lebt nunmehr nur noch ein gutes Dutzend dort. Viele der älteren Nonnen sind gestorben, von den jüngeren haben etliche, wie ich, die Kommunität wieder verlassen. Aber noch immer gesellen sich ab und zu interessierte Frauen zu ihnen, auf Zeit oder als Anwärterinnen für ein Leben als Benediktinerin, noch immer kümmern sie sich umeinander, sorgen für ihre Alten und Kranken, bewirten die Gäste, versammeln sich fünf Mal am Tag zu Psalmenrezitation und Gesang.
»Wir halten hier die Stellung«, sagte die Äbtissin, die es sich nicht hatte nehmen lassen, meine Tochter und mich ein wenig herumzuführen.
»Gott sei Dank«, antwortete ich, und sie lachte mich dafür ein bisschen aus.
Die Mutter Äbtissin, längst nicht mehr die, die ich im Buch »Raphaela« genannt habe, liest meine Bücher, ich schicke sie ihr, sobald sie erschienen sind.
»Das ist doch Ehrensache«, sagte ich, als sie sich während unseres Besuchs dafür bedankte.
»Finde ich auch«, antwortete sie.
Neben diesem Kloster gibt es viele andere, die in ihren Häusern Gäste beherbergen, die Menschen geistlich begleiten, Tage der Stille anbieten und an ihrer Lebensweise in den unterschiedlichsten Formen Anteil zu geben bereit sind: vom Kloster-auf-Zeit-Aufenthalt über Meditationskurse, bis zur »profanen« Mithilfe bei der Apfelernte findet sich so ziemlich alles. Entsprechende Angebote sind im Internet leicht zu finden. Wem also nach der Lektüre dieses Buches danach ist, sich ein eigenes Bild zu machen, dem oder der sei hiermit ein Gastaufenthalt in einem dieser meist äußerst schön gelegenen Klöster ausdrücklich empfohlen. Man muss dafür weder katholisch noch christlich oder überhaupt gläubig sein. Und während ich dies schreibe, erwische ich mich bei dem Gedanken, dass die sogenannte Amtskirche vielleicht gut beraten wäre, sich ein wenig mehr von der gedanklichen Weite abzuschauen, die in den monastischen Gemeinschaften praktiziert wird, zumindest in denen, die ich kennenlernen durfte.
Was in zwei Koffer passt versucht die möglichst wirklichkeitsgetreue Beschreibung eines Ortes zu sein, der in meinem Leben sehr real und wichtig gewesen ist, nimmt sich aber ebenso die Freiheit des Erzählens. Aus Respekt vor einer Lebensweise, die von Abgeschiedenheit und Stille geprägt ist, sowie zum Schutz von Menschen, die keine Öffentlichkeit wünschen, wurden Personen und Orte fiktionalisiert.
Dabei soll es auch bleiben.
Berlin, im März 2022
1Aufbruch, Ankunft und der Weg an die Grenze
Mit Abschieden habe ich mich nie lange aufgehalten.
Gerade mal einundzwanzig Jahre alt, werfe ich zwei Koffer in meinen alten Käfer und mache mich auf den Weg.
»Muss das unbedingt sein?«
Meine Freundin Lina steht am Straßenrand und weint, als ginge ich in den sicheren Tod. Auf der Fahrt denke ich, dass sie recht hat, ich muss völlig verrückt sein, mich auf so etwas einzulassen.
Warum wirft eine wie ich, die mit fünfzehn das von einem cholerischen Alkoholiker beherrschte Elternhaus verlässt und sich fortan allein durchschlägt, zu dem Zeitpunkt, als sie mit Job, Auto und Wohnung einen nach bürgerlichen Maßstäben geregelten Alltag zu führen beginnt, alles hin, um die merkwürdigste Art gemeinschaftlichen Lebens zu versuchen, von der sie je gehört hat?
»Soll ich deine Sachen für dich einlagern, falls du sie wieder brauchst?«, fragt Stefan an unserem letzten Abend.
»Keine Rückversicherung, keine Altlasten.«
»Tu, was du nicht lassen kannst, Mädchen. Ruf an, wenn ich dich abholen soll.«
Lina wird denen, die nach mir fragen, Auskunft geben.
Der Versuchung widerstehend, noch eine letzte Beruhigungszigarette zu rauchen, werfe ich das halb volle Päckchen aus dem Fenster und bin lange vor der vereinbarten Zeit an der Stelle, wo sich rechts eine schmale Straße, nicht mehr als ein asphaltierter Feldweg, in Richtung Kloster windet. Hinter hochgewachsenen Pappeln tauchen bald die roten Dächer von Gästehaus und Ostflügel auf, überragt vom schiefergedeckten Kirchendach, auf dem ein kleiner Dachreiter die Glocken beherbergt. Zisterziensische Bautradition, erinnere ich mich im Prospekt gelesen zu haben und schalte das Radio aus, wo eine gut gelaunte Sprecherin dabei ist, Empfehlungen für Jazzveranstaltungen am Wochenende auszusprechen.
Neben der Einfahrt steht in großen handgeschmiedeten Lettern Benedicite! – Seid gesegnet!. »Wollen wir’s hoffen«, murmle ich vor mich hin, während ich mein Auto unter die alte Kastanie lenke, an der ein verbeultes Schild angebracht ist. Soll ich eine Stunde spazieren gehen, zurück ins Dorf fahren, doch noch eine Packung Gitanes kaufen? Was soll’s, ich klingle an der Klosterpforte.
Nachdem Schwester Placida mir erklärt hat, dass sie mich von jetzt an konsequent siezen wird, weil das innerhalb der Gemeinschaft so üblich ist, drückt sie mir einen Becher Kaffee in die Hand und sagt: »Mit dem engen Rock wirst du dich bei der Kniebeuge ganz schön auf die Nase legen, wenn du nicht aufpasst.« Sie betreut das Gästehaus und kennt mich, seit ich das erste Mal für ein Wochenende herkam, um mir das Kloster anzusehen.
»Ich habe gewusst, dass du eines Tages zu uns gehören wirst.«
»Ich nicht«, will ich gerade sagen, als sie nach dem Telefonhörer greift.
»Schwester Hildegard kommt gleich; sie bringt dich in deine Zelle im Haus der Novizen.«
Sie sagen tatsächlich »Zelle«. Ich hätte doch noch eine rauchen sollen.
Hildegard, die ich für eine harmlose Person gehalten habe, bis sie »von heute an bin ich als Magistra für Sie zuständig« sagt, klappert mit dem Schlüsselbund, winkt mir, ihr zu folgen, und ich bin drin.
Die Klausur, der abgeschlossene, nur für die Nonnen zugängliche Bereich, verbirgt sich hinter einer schlichten Tür aus gemustertem Glas, nicht unähnlich der, die Linas Oma immer scheppernd hinter sich zuschlägt, wenn sie sich geärgert hat.
»Schwester Antonia wird Ihnen am Nachmittag das Haus und den Garten zeigen. Wir holen erst einmal den Rest Ihres Gepäcks.«
Sie sieht mich ungläubig an, als ich ihr zu verstehen gebe, dass es keinen Rest gibt, weil ich »nur das Notwendigste« wörtlich genommen habe.
»Löblich«, sagt sie im Weitergehen, »es gab welche, die sind mit dem Möbelwagen hier angekommen.«
Ich verkneife mir die Bemerkung, dass es mich beruhigt, meine Sachen in kurzer Zeit zusammenraffen und verschwinden zu können.
Meine Zelle stellt sich als freundliches kleines Zimmer unter dem Dach heraus: schöner alter Holzfußboden, Bett, Schrank, Schreibtisch und Blick über die Wiesen des benachbarten Reiterhofs. Jemand hat eine Vase mit bunten Sommerblumen hingestellt.
»Sie beginnen heute Ihre Probe- und Ausbildungszeit, um gemeinsam mit uns herauszufinden, ob ein Leben als Benediktinerin in dieser Abtei Ihre Berufung ist«, beginnt Hildegard mit ernster Miene zu deklamieren. »Zunächst werden Sie als Postulantin in Zivilkleidung unseren Alltag teilen, am Unterricht der Novizinnen teilnehmen, sich in unsere Lebensweise einüben. Wenn Sie und die Gemeinschaft nach einem halben Jahr der Meinung sind, dass Sie Ihren Weg bei uns fortsetzen sollten, können Sie das Gewand der Benediktinerin mit dem weißen Schleier der Novizin erhalten. Nach weiteren zwei Jahren wird die Gemeinschaft darüber abstimmen, ob Sie zu den einfachen Gelübden, mit denen Sie sich für drei Jahre an unsere Gemeinschaft binden, zugelassen werden. Eine vollgültige Aufnahme mit allen Rechten und Pflichten kann also frühestens nach fünfeinhalb Jahren erfolgen. Prüfen Sie sich gut; wir werden es auch tun. In einer halben Stunde hole ich Sie zur Mittagshore ab.«
Ich nicke beeindruckt und frage mich, ob ich nicht doch erst um den unverbindlichen Probeaufenthalt von drei Wochen hätte bitten sollen.
Das helle Läuten einer kleinen Glocke erinnert daran, zur Gebetszeit aufzubrechen, die in zehn Minuten stattfindet. Als ich die Tür öffne, steht Hildegard davor.
»Ich habe gesagt, dass ich Sie abhole.«
Langsam beginne ich mich darauf zu freuen, ohne Begleitung durch das Kloster zu streifen. Als wir dann durch Türen und Flure laufen, die für mich alle gleich aussehen, bin ich froh, dass mir jemand den Weg weist.
Wir durchqueren die der Kirche zugewandte Seite des Kreuzgangs, steigen eine schmale Treppe hinauf und lassen zwei ältere Nonnen, die uns freundlich zunicken, vor uns ins »Herz des Klosters« gehen, wie Priorin Germana es genannt hat.
Ich kannte das bislang nur aus der Perspektive der Gästekapelle. Der Nonnenchor bildet innerhalb der Kirche einen Raum für sich, der seitens der Besucher vom anderen Ende des L-förmig angelegten Baus nur mit Mühe eingesehen werden kann, wenn man sich in den vorderen Reihen platziert. Ich habe meistens hinten gesessen. Schon bei meinem ersten Besuch verspürte ich plötzlich den Wunsch, in das gesammelte Schwarz-Weiß auf der Seite jenseits des Gitters einzutauchen und darin unterzugehen. Die eigene Person mit ihren Nöten und Schwächen würde klein und unwichtig werden, stellte ich mir vor, angesichts der Größe und Erhabenheit des nur dem Geistigen dienenden Ortes und der alle Unterschiede auslöschenden Einheit des auf- und abklingenden Psalmengesangs. Ein paarmal bin ich morgens die hundertzwanzig Kilometer über die Autobahn hin- und wieder zurückgerast, nur um mich vor dem Mittagsdienst für eine knappe Stunde diesen Gesängen zu überlassen.
Als ich jetzt die knarrende Schwelle überschreite, nehme ich mir vor, meine Unsicherheit draußen zu lassen, es zu genießen, als säße ich noch immer allein in der letzten Kirchenbank, bis mir einfällt, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, Placidas Rat entsprechend, einen anderen Rock anzuziehen. Hildegard nimmt mich am Arm und führt mich zu einem freien Platz am unteren Ende des mit einfachen Ornamenten verzierten Chorgestühls, das sich allmählich mit Schwestern füllt.
Das Klopfzeichen ertönt, ein heller Sopran stimmt den Ton an, alle stehen auf. »Zum Altar wenden«, zischt es neben mir, und wenige Sekunden später: »Verneigen!«
Warum habe ich mich nicht vorher einweisen lassen? Auf der gegenüberliegenden Seite winkt mir jemand mit einer Handbewegung zu, die sich als »halb so wild« deuten ließe. Darf die das? Ich traue mich nicht zurückzugrinsen.
»Du aller Dinge Kraft und Grund, der unbewegt stets in sich ruht …«
Der Hymnus ist schön. Jemand drückt mir ein aufgeschlagenes Buch in die Hand. Soll ich mitsingen? Während ich noch die entsprechende Stelle suche, flüstert mir meine Hinterfrau ins Ohr: »Setzen!«
»In deiner Treue führe und lehre mich …«
Singe ich zu laut?
Zwanzig Minuten und zahlreiche Verneigungen später bin ich nichts als erleichtert, als ich an der Seite einer liebenswürdig lächelnden Nonne, die die Geistesgegenwart hat, mich bei der Kniebeuge mit einem beherzten Griff wieder hochzuziehen, die Kirche verlassen kann. Vielleicht stellen sich die erhabeneren Gedanken ein, wenn ich mit den Riten etwas vertraut bin. Ich werde das lernen!
Noch immer in Zweierreihe, gehen wir schweigend den Gang entlang, vorbei an einer großen weißen Magnettafel, die mit handgeschriebenen Zetteln, Postkarten und Kopien übersät ist. Aus der Ferne klingt Tellerklappern und das dumpfe Rauschen einer Industriespülmaschine. Wir schwenken links, und ich betrete mit meiner Begleiterin als Letzte das Refektorium.
Am Ende der hufeisenförmig angeordneten Tische wird mir mein Platz zugewiesen, an dem, wie bei allen anderen, ein weißer Teller mit grünem Tonbecher auf der blanken Resopalplatte gedeckt ist. Um nicht gleich als neugierig zu erscheinen, vermeide ich es, in die Runde der Schwestern zu blicken, die sich, jede hinter ihrem Stuhl stehend, aufgestellt haben.
Gesang, Tischgebet, »Amen«, Hinsetzen.
Eine Tür an der Seitenwand, die mir noch nicht aufgefallen war, öffnet sich schwungvoll und lässt einen riesigen, mit dampfenden Schüsseln beladenen Servierwagen herein, den die kleine, mit dem Tischdienst betraute Nonne tapfer vor sich herschiebt. Vor der Stirnseite bringt sie ihn zum Stehen, verneigt sich vor der Priorin, beginnt das Essen zu verteilen.
Aus dem Lautsprecher hinter mir ertönt die Stimme von Schwester Franziska: »Die Frau mit der Lampe. Das Leben der Florence Nightingale. Haben wir das Kapitel mit dem Armenhaus schon vorgelesen?«
Einige nicken in Richtung Fenster, wo die Tischleserin an einem kleinen mit Leselampe und Mikrophon ausgestatteten Pult sitzt und hektisch blätternd die Stelle sucht, an der ihre Vorgängerin gestern aufgehört hat.
Es gibt Auflauf. Als die Schüssel bei mir ankommt, ist er lauwarm. Ich muss an Stefan denken, der mich in den letzten Wochen dauernd zum Essen einladen wollte, damit ich mir »ein Polster gegen karge Klosterkost anfresse«.
Das hier würde wahrscheinlich ganz passabel schmecken, wenn die Küchenschwester halb so viel Fett gebraucht und das Ganze früher aus dem Ofen genommen hätte.
In die Schublade vor mir, die das für mich bestimmte Besteck nebst Serviette, Schneidbrett und Eierbecher enthält, hat jemand ein Schokoladenosterei gelegt. Wir haben Mitte September.
Florence Nightingale beugt sich gerade über eine dahinsiechende Witwe, als meine Nachbarin mir auf den Arm tippt und Zeichen macht. Es dauert eine ganze Weile, bis ich kapiere, dass sie den Wasserkrug haben möchte, der vor mir steht. »Entschuldigung«, flüstere ich, worauf sie den Finger an den Mund legt und mir bedeutsam zunickt.
Als die Auflaufschüssel ein zweites Mal herumgereicht wird, wage ich nicht abzulehnen, obwohl ich fürchte, dass die Haut auf dem Pudding, der gerade hereingebracht wird, mir alle Selbstbeherrschung abverlangen wird.
Müssen Leute, die keinen Sex haben, nicht wenigstens gut essen?
Plastikwannen mit Spülwasser werden herumgereicht, und ich lerne, dass das zweite weiße Tuch in meiner Schublade keine Ersatzserviette, sondern zum Abtrocknen des Bestecks ist. Als ich an der Reihe bin, schwimmen Fettaugen neben Schaumresten im Wasser.
Ein Glöckchen ertönt, Stühlerücken. Die Gemeinschaft erhebt sich zum Dankgebet, verneigt sich zum Kreuz hin, verlässt schweigend, je zwei nebeneinander, das Refektorium.
Als ich auf den Flur trete, empfängt mich kollektives Lächeln: Die Schwestern haben sich rechts und links aufgereiht, nach Amt und Alter absteigend, soweit ich das beurteilen kann.
»Nachdem wir bereits miteinander gebetet und gegessen haben, möchte ich Ihnen hiermit unsere neue Postulantin vorstellen …«
Dass Schwester Germana zwar weisungsbefugtes Oberhaupt der Gemeinschaft, aber nur für drei Jahre als Priorin-Administratorin, statt auf Lebenszeit zur Äbtissin gewählt ist, liegt daran, dass die Nonnen sich nicht darauf einigen konnten, einer aus ihrer Mitte das würdevolle Amt anzuvertrauen. So musste Germana, obwohl ihr das Alter bereits sichtbar zu schaffen macht, als »Platzhalterin und Zwischenlösung«, wie sie selbst es nennt, einspringen. In unseren Gesprächen vor meinem Eintritt hat sie mit ihrer warmen, bayerisch eingefärbten Stimme und scheinbar unerschöpflicher Geduld meine Fragen zu Kloster und Glauben zu beantworten versucht, mich mit einschlägiger Literatur versorgt und mir mit einem liebevollen »Versuchen wir’s« den Eintritt ins Kloster gewährt.
Neben ihr: Schwester Subpriorin Radegundis von Waltersleben, zweite Frau im Haus, eine der wenigen, deren Nachnamen ich weiß, weil man wohl doch etwas stolz darauf ist, jemanden aus altem Adel im Haus zu haben.
Sollte ich jetzt etwas sagen?
»Ich freue mich, hier zu sein. Also … danke … ich …«
Germana steuert auf mich zu, hakt sich resolut bei mir unter und führt mich an der Nonnenreihe entlang. Ich schüttle Hände, bekomme ermunternde Worte zugesprochen, werde umarmt.
Aus dem Augenwinkel sehe ich eine, die mich mit vor der Brust verschränkten Armen von Kopf bis Fuß mustert. Sieht nicht gerade so aus, als freue sie sich überschwänglich über den Neuzugang. Habe ich die schon einmal getroffen? Als ich mich ihr zuwenden und sie begrüßen will, ist sie verschwunden. Rock zu kurz, Haare zu wild, Strümpfe kaputt …? Zögernd schaue ich an mir runter, kann aber nichts Anstößiges finden.
Gibt es hier keine bekannten Gesichter? Placida und Paula kann ich nirgends entdecken. Beim Essen habe ich sie noch gesehen. Da kommt Schwester Raphaela, deren freundliche Erscheinung so gar nicht zu der Bezeichnung »Gastmeisterin« passen will, streicht mir über die Wange und versichert, sie werde mich mit ihrem Gebet begleiten. Mir fällt keine passende Antwort ein, und so beschränke ich mich darauf zu nicken.
»Na, sind Sie tatsächlich gekommen?« Schwester Hedwig legt mir beide Hände auf die Schulter. »Aber nicht verbiegen lassen, ja?«
Bevor ich etwas entgegnen kann, zieht mich Germana zur nächsten Schwester, die breit grinsend erzählt, sie sei die Postschwester, und das schon seit über zwanzig Jahren. Der Händedruck könnte glatt von Muhammad Ali in seinen besten Zeiten sein.
»Jetzt muss ich Sie aber doch noch mal in den Arm nehmen, nachher soll man ja Abstand halten, ha ha …«
Ich wünsche mir nichts sehnlicher als eine Pause und nicke dennoch so erfreut wie möglich, als Schwester Hildegard mir mitteilt, dass sie und die Schwestern des Noviziats mich noch zur Rekreation mitnehmen möchten, damit wir uns in der halben Stunde vor der Mittagsruhe bereits etwas kennenlernen.
Der Gemeinschaftsraum für die Novizinnen weicht so sehr von meiner Erwartung ab, dass ich im ersten Moment nicht weiß, ob ich erleichtert oder besorgt sein soll: Teppichboden, Pflanzen, die sich die Wände hochranken, ein Klavier, Kerzen, Fichtenholzmöbel, ein alter Plattenschrank. Auf einem Regalbrett liegt Asterix und Obelix auf Lateinisch, es riecht nach Räucherstäbchen. Auf dem Tisch steht eine Schale mit Keksen, drei junge gut aussehende Nonnen mit weißem Schleier sitzen bereits da, als Hildegard Platz nimmt und auf den freien Stuhl neben sich klopft.
»Zur Feier des Tages«, sagt die Schwester mit Nickelbrille, »gibt es Prinzenrolle.«
Sie stellt sich als Schwester Antonia vor, ehemals Latein- und Geschichtslehrerin in Paderborn, die im vergangenen Mai ihre ersten Gelübde abgelegt hat und nach mir die Jüngste ist, sodass sie sich ein wenig um mich kümmern darf, wenn Schwester Hildegard verhindert ist.
»Demnach habt ihr alle drei schon die ersten Gelübde abgelegt und seid nicht mehr Novizinnen im eigentlichen Sinn?«
Schwester Cäcilia, die »Noviziatsälteste«, klingt, als lege sie Wert auf diese Position und macht mich darauf aufmerksam, dass wir uns auch in dieser Runde siezen, weil das hilft, die nötige innere Distanz zu wahren. Als ich zu der Frage ansetzen will, was sie damit meint, stellt sich die dritte Schwester vor, in der ich meine Retterin beim Auszug aus der Kirche wiedererkenne: Maria, seit vier Jahren im Kloster, gelernte Psychologin und derzeit mit der Organisation des Gästehauses betraut.
Ich soll von mir erzählen und flüchte mich zum Thema Arbeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil das unerschöpflich ist und allzu persönliche Fragen verhindert. Cäcilia, die als Sozialpädagogin mit geistig behinderten Kindern gearbeitet hat, nutzt die Gelegenheit, von ihren eigenen Erfahrungen zu berichten. Gern überlasse ich ihr das Feld und merke, wie Maria mich von der Seite schmunzelnd betrachtet.
»Für Schwester Hildegard ist dies heute auch ein Neuanfang«, ergreift sie das Wort, »sie hat mit Ihrem Eintritt das Amt von Schwester Maura übernommen und da …«
»Höchste Zeit für die Mittagspause!«, sagt Hildegard und schaut auf die Uhr. Das Gespräch endet mitten im Satz, man erhebt sich schweigend, verneigt sich, »Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist«, und weg sind sie. Leicht desorientiert steige ich hinter Maria die Treppe hinauf und stelle fest, dass sie das Zimmer links neben meinem bewohnt, während die Magistra die Tür rechts neben meiner öffnet.
Ich bitte sie, noch einen Rundgang durchs Gelände machen zu dürfen, aber sie winkt ab.
»Ruhen Sie sich aus. Schwester Antonia kommt nachher bei Ihnen vorbei.«
Wie lange muss man Postulantin sein, um sich nicht mehr wie ein ahnungsloser Eindringling vorzukommen? Wahrscheinlich bin ich diese Art der Fürsorge nicht gewohnt und sollte dankbar sein, dass man mich nicht mir selber überlässt.
»Herein.«
Drei Uhr. Ich muss fast eine Stunde lang aus dem Fenster geschaut haben, ohne zu merken, wie die Zeit vergeht. Mein zweiter Koffer ist noch immer nicht ausgepackt.
Es klopft erneut.
»Sie müssen schon selbst aufmachen. Hat Schwester Hildegard Ihnen nicht gesagt, dass wir die Zellen der Mitschwestern nicht betreten?«, tönt es durch die geschlossene Tür.
Antonia hat die schwarze Klostertracht abgelegt, trägt einen blauen Arbeitskittel mit Kopftuch, dazu eine Strickjacke, die eindeutig aus nichtklösterlichen Zeiten stammt. In dem Aufzug könnte sie als polnische Erntehelferin durchgehen, wirkt jedenfalls deutlich jünger als mit dem vom weißen Schleier eingerahmten Gesicht. Fast hätte ich sie nicht erkannt.
Wir überqueren den Hof und betreten die um den Kreuzgang angelegten Hauptgebäude. Der Fahrstuhl zur Küche, Baujahr 1964, ist zwei Jahre älter als ich. »Mein Jahrgang«, sagt Antonia, als ich auf das kleine Schild deute, »vielleicht bin ich deshalb beim letzten Gewitter mit ihm stecken geblieben.«
Rechtzeitig bevor ich in Panik verfalle, stößt sie die Türen auf und führt mich in die große, mit modernsten Geräten ausgestattete Küche, in der es nach frischer Minze riecht. Die kleine dicke Schwester, die heute Mittag bei Tisch bedient hat, beugt sich, im gleichen blauen Arbeitskittel, über einen riesigen dampfenden Topf, in den sie mit beiden Händen saftig grüne Kräuter wirft.
»Aus dem eigenen Garten, wird Ihnen schmecken«, erklärt sie eifrig, während sie sich mit ihrer Küchenschürze den Schweiß von der Stirn wischt.
»Gilt während der Arbeit im Haus kein Schweigegebot?«, frage ich Antonia, als wir die Küche verlassen haben.
»Nicht so streng. Eigentlich soll man sich auf das Notwendige beschränken, aber das wird unterschiedlich ausgelegt.«
Im oberen Stock angekommen, klopft Antonia an eine schwere Eichenholztür. »Cellerariat«.
Die Abtei ist ein kleiner Wirtschaftsbetrieb mit unterschiedlichen Geschäftsbereichen und muss als solcher auch verwaltungstechnisch geführt werden. Schwester Simone, die als Cellerarin, eine Art Finanzministerin des Klosters, dafür verantwortlich ist, führt uns durch mehrere mit großen Schreibtischen, Computern und Aktenschränken bestückte Räume. Würden keine Nonnen darin sitzen, könnte man meinen, man betritt das Einwohnermeldeamt. Bei genauem Hinsehen denke ich, dass im Einwohnermeldeamt keine Kreuze an der Wand hängen und die aufgestellten Bilder Ehemänner, Töchter oder Humphrey Bogart statt Jesus von Nazareth und den heiligen Franziskus zeigen würden. An einem der Schreibtische sitzt eine alte Schwester, die hoch konzentriert wie in Zeitlupe abwechselnd auf den Bildschirm vor sich starrt oder mit langen spitzen Fingern beinahe ehrfurchtsvoll die Tastatur bedient.
»Schwester Apollonia«, erklärt Schwester Simone mit leicht entnervtem Unterton, »besteht darauf, sich mit ihren vierundsiebzig Jahren noch in den Computer einzuarbeiten.«
»Man muss mit der Zeit gehen«, entgegnet die Alte mit funkelndem Seitenblick auf ihre weitaus jüngere Vorgesetzte, »sonst kommt man nicht mehr mit und muss aufs Abstellgleis!«
Antonia erzählt im Weitergehen, dass Schwester Apollonia, in ihrem Hauptberuf Organistin, halbtags in der Verwaltung aushilft, momentan allerdings einer der vielen Gründe ist, weshalb die Kommunität ihre Cellerarin dringend zur Erholung schicken will.
»Ich finde sie ganz sympathisch.«
»Warten Sie, bis sie versucht, Sie zum Musizieren zu überreden. Und noch was: Auf dem Abstellgleis habe ich in den drei Jahren, die ich hier bin, noch keine gesehen.«
Neben dem Cellerariat befinden sich die Räume der Äbtissin. Sie werden zurzeit von Priorin Germana bewohnt, die gerade beim Zahnarzt ist, wie der kleine Zettel mitteilt, der mit Tesafilm an die Türklinke geheftet ist.
Das »Skriptorium« entpuppt sich als großer Leseraum, rundum bestückt mit Regalen bis zur Decke. Nachschlagewerke in jeder denkbaren Ausführung: der große Brockhaus, zwanzig Bände Geschichte der Musik, Kirchenvätertexte, theologische Zeitschriften, je ein Stapel Geo, Osservatore Romano und Frankfurter Allgemeine Zeitung.
»Habe mir schon gedacht, dass ihr nicht die Rundschau abonniert habt.«
»Wir vom Noviziat sollen uns nicht hier aufhalten; wir haben unseren eigenen Studienraum mit der Noviziatsbibliothek. Wenn wir Bücher benötigen, die dort nicht stehen, fragen wir die Magistra.«
»Keine Tageszeitung?«
»Dafür bleibt uns keine Zeit.«
Wir laufen einen Gang entlang, wo rechts Fenster zum Kreuzgarten und links die Türen zu den Zellen einiger Konventschwestern sind. Sr. Sophia, Sr. Radegundis, Sr. Clementia, Sr. Luise, Sr. Raphaela … steht auf den sämtlich in der gleichen Schönschrift gehaltenen Holztäfelchen.
Ich will etwas fragen, aber meine Führerin macht mir Zeichen zu schweigen. Dass man vor den Privatzimmern der Nonnen ruhig zu sein hat, leuchtet selbst mir ein.
Wenig später betreten wir einen großen, lichtdurchfluteten Raum mit Ausblick auf den Obstgarten.
»Dies ist der Konventraum. Hier finden die Vorträge des Paters oder anderer Referenten, die Gesangstunden und der Unterricht bei Schwester Hedwig statt. Abends treffen sich die Konventschwestern hier zur Rekreation. An hohen Feiertagen wird das Noviziat dazu eingeladen.«
Bequem aussehende Holzstühle mit lindgrünen Polstern sind zu einem Kreis aufgestellt, in der Ecke steht ein schwarzglänzender Flügel. Ein riesiger Christus am Kreuz hängt auf der weiß gekalkten Stirnwand, gegenüber eine moderne Holzschrankwand, aus der neben Büchern und Schallplatten ein großer Fernseher herausragt.
»Wofür ist der denn?«
»Um zwanzig Uhr läuft hier die Tagesschau.«
»Für alle?«
»Für die, die wollen.«
»Auch für die aus dem Noviziat, die wollen?«
»Soweit ich weiß, ja. Ich persönlich nutze die Zeit lieber sinnvoller.«
Falsche Frage, kann ich aus ihrem Blick lesen, habe aber gerade keine Lust, darauf einzugehen.
Neben dem Konventraum liegen die Zimmer der Infirmerie: die Zelle der Infirmarin, zwei rollstuhlgerechte Wohnzellen, Pflegezimmer, die Krankenstation, auf der man sich bei kleineren Blessuren verarzten lassen kann, der Ordinationsraum, in dem Hausarzt Dr. Hartmann alle vierzehn Tage Sprechstunde für die Schwestern hält. Mich wundert’s schon gar nicht mehr, als ich erklärt bekomme, dass vorher der Magistra Bescheid gegeben werden muss, wenn man die Absicht hätte hinzugehen.
Ein schmaler, zwischen Westflügel und Kirche gehefteter Bau beherbergt neben dem Aufgang zur Orgelempore auf zwei Etagen die Bibliothek der Konventschwestern: im oberen Teil Theologie und Philosophie, im unteren Kunstbuch und Belletristik. Eine schöne alte Ausgabe von Musils Drei Frauen fällt mir ins Auge, doch Antonia rät, erst einmal die monastische Literatur zu studieren, bevor ich Schwester Hildegard um die Erlaubnis bitte, etwas aus dem »weltlichen« Bücherbestand auszuleihen.
Ich beginne mich zu fragen, ob ich nicht doch ein zu großes Stück Eigenverantwortlichkeit aus der Hand gebe.
Im Kreuzgang hallen unsere Schritte von den schmucklosen Wänden wider, als Antonia mir mit gesenkter Stimme erklärt, dass hier strenge Schweigezone ist. Vor dem lebensgroßen Kruzifix an der Stirnseite des Statiogangs, wo die Nonnen sich vor dem Einzug aufstellen, bleibt sie kurz stehen und verbeugt sich. Ich werde Wochen brauchen, um mir die klösterlichen Alltagsgebräuche zu merken. Vom Klosterjargon gar nicht zu reden. Vielleicht sollte man ein Wörterbuch »Monastische Alltagssprache für Neuankömmlinge« entwickeln. Cellerarin, Refektorium, Skriptorium, Lintearium, Silentium, Habit, Skapulier, Offizialin … Gut, dass ich Der Name der Rose gelesen habe! Dass mit »Habit« das bodenlange schwarze Ordenskleid gemeint ist, weiß ich immerhin. Dank Eco kann ich mir auch unter einem Cellerar und dem Silentium etwas vorstellen, aber dass als »Offizialin« bezeichnet wird, wer für einen Arbeitsbereich verantwortlich ist, und »Lintearium« für die Wäscherei steht, darauf wäre ich nie gekommen.
In finem dilexit eos steht in kunstvollen Buchstaben an die Wand neben dem Kreuz gemalt. »Bis zum Letzten habe ich euch geliebt«, entgegne ich, als Antonia Anstalten macht, übersetzen zu wollen. Sie wirft mir einen anerkennenden Blick zu, und ich fühle mich für einen Augenblick nicht mehr wie eine konfuse Zwölfjährige. Hätte nicht gedacht, dass ich noch mal so froh über die sechs Jahre Latein in der Schule sein würde.
Wir öffnen die Holztür zum Kreuzgarten, wo die Rosen noch immer in voller Blüte stehen. Hier möchte ich in warmen Sommernächten unter der Hängeweide sitzen und Rilke lesen oder Tagebuch schreiben, aber vielleicht wäre auch dies in irgendeiner Weise unangebracht.
Eine steinerne Treppe führt in den Keller, zur Waschküche. Antonia erklärt mir gerade, wie ich samstags meine Schmutzwäsche in die nebeneinandergestellten Körbe einsortieren soll und wo ich das jeweils frische Wäschepäckchen finde, als eine schon fast magere Nonne mit weißer Schürze über dem Habit hereingestürzt kommt.
»Ach, da haben wir ja unsere Neue. Geht’s gut? Melden Sie sich, wenn Ihnen was fehlt, aber fragen Sie erst Ihre Magistra. Sonst kriegen wir beide Ärger.«
Sie stopft währenddessen in Windeseile Bettbezüge in die riesige Waschmaschine, schlägt geräuschvoll die Klappe zu, tippt auf den Knöpfen herum, rauscht mit »muss schnell die Germana vom Zahnarzt abholen« und einem kräftigen Schlag auf meine Schulter wieder raus. Nicht sehr kontemplativ, aber lustig, mit äußerst lebenstüchtiger Ausstrahlung, würde ich sagen. Die kommt auf jeden Fall auf meine Pro-Liste.
»Das war Schwester Margarita, Infirmarin und zuständig für die Wäsche.«
Sicher nicht Antonias Favoritin unter den Konventschwestern, wenn ich den Unterton richtig interpretiere.
Wir verlassen die Waschküche durch die Hintertür, betreten den Hof, der vom Noviziatshaus, lang gestreckten Bauten mit Imkerei und Wirtschaftsräumen, alten Scheunen, ehemaligen Stallungen und rechtsseitig von einem halbverfallenen großen Gebäude umrahmt wird.
»Kann man da rein? Das sieht aus, als könnte man dort drinnen den Tatort Mord im Nonnenkloster drehen.«
Wenn Antonia lacht, kann sie richtig locker und nett wirken. Sollte sie vielleicht öfter tun.
Wir stemmen gemeinsam die aus dicken Holzbrettern genagelte Tür auf, steigen vorsichtig über eine ausgetretene Steinschwelle und tasten uns durchs Halbdunkel des mit alten landwirtschaftlichen Geräten, Kisten und Gerümpel vollgestellten Innenraums. Das Ganze wird von einem barocken Kreuzgratgewölbe überspannt und erfüllt in jeder Hinsicht die wildromantischen Erwartungen, die es von außen weckt. Eine kleine getigerte Katze kommt angelaufen und streicht uns um die Beine. Ich nehme sie hoch, streiche ihr über das weiche Fell. Als ich sie wieder runtersetze, läuft sie maunzend hinter uns her.
»Schön hier.«
»Ich mag es auch. Mein Traum wäre eine Zelle unterm Dach. Man hätte einen wunderschönen Blick auf den Wald. Leider ist die Restaurierung zu teuer. So viel Geld werden wir wohl nie zusammenkriegen.«
Die so regeltreu und asketisch wirkende Antonia träumt also auch. Beruhigend.
Als wir wieder auf den Hof hinaustreten, kommt uns eine ältere Schwester entgegen, deren schneeweißes Haar unter dem blauen Kopftuch hervorquillt. Auf dem Rücken trägt sie einen gelben mit undefinierbarer Flüssigkeit gefüllten Plastikbehälter, der beinahe größer als die ganze Person ist. Bei näherem Hinsehen erweist sich das Ding als Giftspritze, deren Pumphebel die Schwester leise vor sich hin singend im Takt ihres Liedes betätigt.
»Ich weiß, ihr jungen Dinger habt es nicht gerne, wenn ich mit dem Unkrautvernichtungsmittel anrücke, aber sonst werde ich mit dem Zeug überhaupt nicht mehr fertig.«
Luise, die Gärtnerin, hat ein so strahlendes, gütiges Gesicht, dass man – Gift hin, Gift her – gar nicht anders kann, als sie auf Anhieb gern zu haben.
»Na, macht ihr Klosterbesichtigung?«
Und mit dem Siezen scheint sie’s auch nicht so streng zu nehmen.
»Wie gefällt’s Ihnen denn bis jetzt?«
»Schöne rätselhafte Welt, voller Fallen«, rutscht es mir heraus, aber sie lächelt nur und nimmt ihr Singen wieder auf, als sie sich weiterpumpend entfernt.
In den Torsturz der kleineren Scheune ist die Zahl 1712 eingemeißelt. Durch das halb offene Scheunentor kann ich den Traktor erkennen, dessen Anhänger mit Apfelkisten beladen ist.
Ob ich mich für die Baugeschichte des Klosters interessiere, fragt Schwester Antonia, worauf ich ihr von meiner Teilnahme an einem Seminar über Klosterbaukunst berichte, das ich in Linas Vorlesungsverzeichnis entdeckt hatte. Hocherfreut über mein Interesse, erkundigt sie sich nach den vorgestellten Anlagen, nennt den mir nur teilweise verständlichen Titel ihrer Promotion über irgendein Detail im St. Galler Klosterplan und verfällt zunehmend in einen engagierten Lehrerinnenton.





























