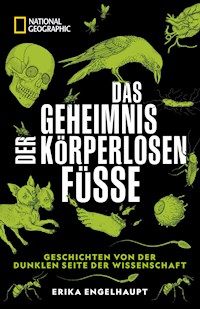
NATIONAL GEOGRAPHIC Buch: Das Geheimnis der körperlosen Füße. E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: National Geographic Deutschland
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Mörderische Erdmännchen, Blumen mit Leichengeruch und die Geheimnisse von Ohrenschmalz: Humorvoll, aber wissenschaftlich fundiert, erklärt Erika Engelhaupt vom National Geographic "Gory Details"-Blog erstaunliche und oft auch ein wenig befremdliche Wahrheiten aus der Biologie, Anatomie, Natur und Weltraumforschung und vielem mehr. Neueste wissenschaftliche Forschung leicht verständlich und mit viel Witz aufbereitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 227
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Gay, Darell und Jay
Inhalt
Einleitung
Teil einsMorbide Neugier
Nicht wirklich wie beim CSI
Über morbide Neugier und das Leichenschauhaus
Die kleinsten Tatorte der Welt
Über die Miniaturen, an denen Polizisten geschult werden
Würde Ihr Hund Sie fressen, wenn Sie sterben?
Gut möglich!(Aber Sie sind nun kein bisschen klüger!)
Die Leichen, die bluteten
Können die Toten ihre Mörder verraten?
Das Geheimnis der körperlosen Füße
Die Füßeflut von British Columbia
Teil zweiGebrochene Tabus
Die ultimativen Tabus
Wenn Wissenschaft auf innerste Hemmung trifft
Es ist schwer, einen Kopf zu bekommen
Die unvorstellbarste Operation der Welt
Die mörderischsten Säugetiere
Enthüllung: unsere furchtbarsten Mörder!
Anleitung zum Kannibalismus
Warum einige Tiere ihre eigene Art auf den Speisezettel setzen
Ein gigantischer Fortschritt für die Frauenwelt
Warum Menstruation auch etwas Kulturelles ist
Teil dreiSchaurige Tierchen
Rattenrennen
Warum man sie nicht aufhalten kann
Klein, aber fein
Was ist winzig, hat acht Beine und lebt in Ihrem Gesicht?
Kakerlaken entmystifiziert
Wenn man sie nicht besiegen kann, baut sie nach!
Du gehst mir unter die Haut
Was tun, wenn ein Insekt eindringt?
Der schlimmste Stich der Welt
Zwei Wissenschaftler opfern sich.
Teil vierUnfeine Anatomie
Absondern oder ausscheiden?
Rutschfahrt durch die ungeschätzten Bereiche unseres Körpers
Goldschürfer
Wenn Ihnen die Ohren lieb sind,Finger weg von Wattestäbchen!
Beckenpinkler
Es ist unanständig, es passiert – und es ist leicht giftig.
Wundenlecken
Nein, ein Hundemaul ist nicht sauberer als Ihr Mund!
Von der Notwendigkeit zu bluten
Eine kurze Geschichte des Aderlasses als Heilverfahren
Der Detox-Mythos
Können wir Körpergifte tatsächlich ausschwitzen?
Teil fünfGeheimnisvoller Geist
Fehler im Programm
Warum uns unser Verstand Streiche spielt
Unsichtbare Peiniger
Wie es zu Wahnvorstellungen kommt
Das Voodoo-Puppen-Rätsel
Ah, warum Stechen so befriedigend ist
Weich zurück, Bozo!
Wie sich herausstellte, sind Clowns wirklich gruselig.
Vergiss niemals ein Gesicht
Innenansicht einer speziellen Supermacht der Strafverfolgung
Zelluloidpsychopathen
Welche Filmmonster sind am realistischsten?
Nachwort
Einleitung
Meine Familie lebte, bis ich sieben war, in den sanften Hügeln am Rande von Kansas City in Missouri. Unsere kleine weiße Stuckvilla thronte auf einem runden Gipfel, zu dem sich eine lange Auffahrt in Kurven hinaufschlängelte. Jeden Nachmittag setzte mich der Schulbus unten ab, wo schon meine Mutter mit unserem großen schwarzen Deutschen Schäferhund wartete.
Eines Tages zierte die Zufahrt etwas Neues: zwei Berge. (Nun, eigentlich eher Hügel, aber bedenken Sie, ich war noch klein.) Sie bestanden aus Müll. Ein Lastwagen hatte seine lästige Fracht einfach auf dem nächstbesten Stück Land abgekippt. Als meine Mutter und ich uns näherten, erkannten wir in den Haufen einzelne Gegenstände. Da lagen Aktenschränke und Kartons voller Papier. Meine Mutter zog einen dunklen Bogen heraus und hielt ihn gegen das Licht. Es war eine Röntgenaufnahme von Zähnen. Uns wurde klar, dass an unserer Zufahrt die Überreste einer geschlossenen Zahnarztpraxis entsorgt worden waren.
In den Haufen lag zwar auch Spielzeug aus dem Wartezimmer, doch das Schmuckkästchen, das ich ausgrub, war interessanter. Es enthielt eine Silberkette mit winzigen jadegrünen Vögeln. Doch dann stieß ich auf das Beste: Gipsabdrücke von Patientenzähnen. Sofort sortierte ich die krassesten Fundstücke für mich heraus: Zähne mit Absplitterungen, Zähne, die wie lose Zaunlatten herauskippten, Gebisse mit Zahnlücken – je hässlicher, desto besser.
Meine Eltern ärgerte der Müll vor unserer Haustür. Ein Onkel verteilte und bedeckte ihn schließlich mit einem Bagger und schuf so unsere eigene Minideponie. Aber einige meiner schönsten Funde behielt ich. Bestimmt war ich das einzige Mädchen in dieser Ecke Missouris, das nicht nur eine eigene Spielhütte hatte, sondern darin Fensterbretter voller Gebissruinen. Gelegentlich arrangierte ich sie neu und fand immer andere und grässlichere Kombinationen von Ober- und Unterkiefern. An windigen Sommerabenden lag ich bei offenem Fenster auf meinem Lager und erfreute mich an den im Mondlicht grinsenden Lückengebissen.
Wären meine Eltern über meine Sammlung – oder später über mein anhaltendes Interesse für blutige Tierdokumentarfilme und Romane von Stephen King – entsetzt gewesen, hätte ich mich vermutlich anders entwickelt. Statt über eklige Dinge zu schreiben, wäre ich vielleicht Buchhalterin geworden oder jemand, dem beim Anblick von Blut schlecht wird.
Doch dieses Schicksal blieb mir erspart. Einige Jahre später zog meine Familie auf ein 30 Hektar großes Stück Sumpfland in Florida. Mein Vater, ein Ingenieur, baute sich neben unserem Wohnwagen ein elektrochemisches Labor aus Schlackebeton. Darin versuchte er, mir einige grundlegende wissenschaftliche Prinzipien zu vermitteln. Ich verstand nicht viel, war aber fasziniert davon, dass er am einen Tag einen Penny in einen Behälter mit Flüssigkeit legen und ihn am nächsten Tag mit einem glänzenden Nickelüberzug wieder herausnehmen konnte. Immerhin lernte ich dabei, dass es möglich ist herauszufinden, wie genau etwas funktioniert– und das mithilfe der Wissenschaft.
Ich überspringe mal die nächsten 30 Jahre. Nach einem Forschungsjahrzehnt (ich stapfte unter anderem durch Sümpfe und untersuchte Kohlenstoffverbindungen …) wurde ich in Washington, D. C., Redakteurin des Magazins Science News. Als sich die Gelegenheit zu einem eigenen Blog bot, wusste ich, das war mein Ding. Ich musste nur einen Blick in mein Bücherregal im Büro werfen, in dem Titel wie Blutbeute, Der Wandermörder und Abscheulichkeiten standen, und schon war das Konzept fertig. Obwohl ich nie gedacht hätte, dass ich an makabren Dingen besonders interessiert wäre, konnte ich nicht leugnen, dass ich schon immer eine morbide Neugier hatte. So entstand mein Blog Gory Details (was sich ja bekanntlich mit Eklige Details übersetzen lässt). Die Jahre seither1 waren ein einziges Abenteuer, denn ich schrieb über Themen, die ich ohne Vorwarnung niemandem erzählt hätte. Eine Zeitlang reichten mir die Kollegen gleich alle Artikel oder Forschungsarbeiten weiter, in denen es sich um Urin oder Kot drehte. (Wie mir gesagt wird, schnellen noch heute jedes Jahr zu Beginn der Badesaison die Besucherzahlen auf der Seite mit dem Artikel über Urin im Schwimmbecken in die Höhe.) Als ich später dann als Wissenschaftsredakteurin zur Website von National Geographic wechselte, wanderte auch mein Blog mit, und so ist es bis heute.
Einige Geschichten, die ich für die Primetime zunächst für zu bedenklich hielt, gehören inzwischen zu meinen Favoriten. Als mich zum Beispiel bei Science News ein Kollege fragte, ob es wahr sei, dass Haustiere manchmal ihre verstorbenen Halter fressen, wurde ich hellhörig und sah mir das genauer an; natürlich nur, um seine Neugier zu befriedigen. Da so eine Geschichte für Tierliebhaber ganz schön verstörend sein kann, war ich erst einmal skeptisch.
Wie sich herausstellte, interessierte das Thema sogar erstaunlich viele Menschen, und noch dazu gab es reichlich forensische Studien zu derartigen Vorfällen. Andere Journalisten hatten bereits darüber berichtet, also entschied ich, mich da einmal tiefer in die forensischen Zeitschriften hineinzufuchsen. Entgegen meiner Befürchtung, dass nun alle Hundeliebhaber über mich herfallen würden, wurde der Essay in dem betreffenden Jahr einer der populärsten Artikel der gesamten National-Geographic-Website. Anscheinend wollen die Menschen auch die Antworten, wenn es ans Eingemachte geht.
Mein Blog sollte nicht nur meine eigene, zugegebenermaßen verschrobene Wissbegierde befriedigen, sondern vor allem ein Ort sein, wo man eklige, tabuisierte oder morbide Themen ansprechen und dann bis ins Letzte wissenschaftlich ergründen konnte.
Warum verbringe ich meine Tage damit, über Themen nachzudenken, die, vorsichtig formuliert, unerfreulich sind? Vor allem aus diesem Grund: Ich fürchte mich letztendlich weniger vor Dingen, über die ich schon einmal geschrieben habe. Sehe ich mir an, was mich verunsichert, also Themen wie Tod, Krankheit, Gruselclowns, dann hilft mir der wissenschaftliche Ansatz, damit besser umzugehen.
Vermutlich sind eigene Ängste schuld daran, dass ich meine wissenschaftlichen Artikel ausgerechnet über Mord und Todschlag schreibe. Ich vertiefe mich gern in die neusten forensischen Techniken, aber auch in althergebrachte Untersuchungsmethoden wie die Miniaturtatorte, an denen Polizisten und Forensiker geschult werden. Schließlich beende ich mit meiner Stoffauswahl kein Leben, sondern verändere das Leben der Betroffenen – wie im Fall derjenigen, die an Dermatozoenwahn leiden, an der schrecklichen Überzeugung, dass unsichtbare Insekten sie terrorisieren.
Bei meinen Stoffen geht es aber nicht immer ums große Ganze. Gory Details sollte ein unterhaltsamer, aber auch informativer Blog sein. Ein guter Ort eben, um auch ekligen Fragen nachzugehen, wie der nach dem schlimmsten Insektenstich oder der überraschend komplexen Wissenschaft vom Ohrenschmalz.
Für meine Essays suche ich immer Themen, die abstoßen und zugleich fesseln, etwas, bei dem ich mir am liebsten zunächst mit der Hand die Augen zuhalte, dann aber doch durch die Finger spähe. Autoren nennen das gerne »dramatische Wirkung«. Und wenn mich eine wissenschaftliche Fragestellung so richtig fesselt, weil da zusätzlich diese dramatische Spannung aufkommt, dann hält mich nichts mehr.
Dieses Buch vereint einige der faszinierendsten Geschichten aus all den Jahren, in denen ich nun schon meinen Blog schreibe. Ich habe sie erweitert und aktualisiert. Sie finden auch neue Geschichten, die ich speziell für Sie, liebe Leser, ausgraben durfte. Falls Ihnen nach einem Happen abseitiger Wissenschaft ist, tauchen Sie einfach in einen der Essays ein – je nachdem, was Ihre Fantasie anregt; jeder ist einzeln für sich lesbar. Oder Sie verschlingen gleich ein ganzes Kapitel.
Ich habe abstoßende und fesselnde Geschichten ausgewählt, die mich angesprochen haben. Jedes Kapitel behandelt ein Thema, vom Tod (»Morbide Neugier«) bis hin zu unseren tief verborgenen, dunkelsten Gedanken (»Geheimnisvoller Geist«). Auf allen diesen Gebieten erweitern Wissenschaftler die Grenzen des Wissens über Schauriges, Erschreckendes und Verbotenes und enthüllen überraschende Wahrheiten über unsere Gedanken, Körper und die Welt.
Diese Themen zeigen, dass wir uns die kindliche Neugier bewahren können. Ich weiß nicht, was aus meinen Zahnabdrücken wurde; vermutlich gingen sie bei einem Umzug verloren. Doch die Halskette mit den jadegrünen Vögeln besitze ich noch immer. Sie erinnert mich daran, dass Schätze an überraschenden Orten verborgen sein können, Orten, an denen die meisten nie suchen würden. Mich erfreut es, in der Hässlichkeit der Welt überraschend Schönes zu entdecken und im Chaos Ordnung.
Es fängt mit der Bereitschaft an, eine Frage zu stellen, die ein Stirnrunzeln auslösen könnte. Zugegeben: Manchmal sind diese Fragen unangenehm, doch die Antworten sind immer spannend. Ich hoffe, Sie fühlen sich durch dieses Buch ermutigt, seltsame Fragen zu stellen. Und ich hoffe, die Antworten machen Ihnen Appetit auf mehr.
Teil eins
MORBIDE NEUGIER
Nicht wirklich wie beim CSI
Über morbide Neugier und das Leichenschauhaus
Meine erste Autopsie verlief nicht gerade so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Als Jugendliche dachte ich immer, die Untersuchung einer Leiche sähe so aus wie die grausigen Obduktionen in der Arzt-Krimiserie Quincy. (Um fair zu sein: Anfang der 1980er-Jahre waren Leichen im Fernsehen nur flüchtig zu sehen.)
Seit Jack Klugman den Rechtsmediziner Quincy spielte, der für uns Verbrechen aufklärte, ist die eine Autopsie im Fernsehen fast immer wie die andere: eine Leichenhalle im Keller, oft schlecht beleuchtet, helle Lampen nur über dem Seziertisch; eine Wand aus Kühltruhen für die Körper; eine hängende Schale, in die der Arzt die nasse, glitschige Leber wirft. Dann gibt es meist noch den Raum, in den die Familien durch ein Fenster hineinstarren, wenn der Assistent das Leichentuch vom Gesicht ihres Angehörigen zieht.
Quincy – ein streitsüchtiger, brillanter, sturer Mensch, der allein für sich auf einem Boot lebte – war das Rollenmodell par excellence für die abgedroschene Figur des kauzigen Rechtsmediziners. In den meisten Krimis umgibt die Pathologen und Forensiker seither generell etwas Verschrobenes: Sie sprechen zu den Leichen, und ihre Nüchternheit angesichts des Todes schreckt ab. (Obwohl das vermutlich mehr über das Publikum als über die Rechtsmediziner aussagt; uns ist einfach unwohl bei Menschen, denen der Tod nichts ausmacht.)
Aber ein gewisses Maß an morbider Neugier ist normal. Wir alle fürchten uns vor dem Unbekannten – und der Tod ist nun einmal der große Unbekannte. Er ist auch die letzte Gewissheit. Ganze Kunst- und Literaturgenres widmen sich ihm, die immer wieder den Schauer suchen, ihm von der Schippe zu springen. Deswegen sehen wir uns Gruselfilme an, und deswegen halten wir bei Unfällen und starren, obwohl wir uns über die Gaffer beim Weiterfahren aufregen.
Und auch wenn manche die Aufgüsse von Mordgeschichten in der Popkultur als morbide Unterhaltung abqualifizieren, ist die Beschäftigung mit Tod und Gewalt nichts Neues. Davon handeln die ältesten Geschichten, die Bibel ist voll davon, so wie weltweit beliebte Erzählungen, Legenden, Mythen und Märchen.
Neu ist nicht die Mordgeschichte, sondern wie wir sie erzählen. Heute streamen wir den Tod – manchmal im Detail –, holen ihn uns rund um die Uhr nach Hause, von Podcasts über True Crime bis zu Sendungen, wie sie der amerikanische Channel Investigation Discovery ausstrahlt. Der enorme Erfolg des Genres zeugt vom uralten Reiz der morbiden Neugier.
Einige Evolutionsbiologen erklären diese Neugier als rationale Analyse einer Gefahr; wir betrachten den Tod,2 um zu lernen, wie wir ihn vermeiden können. Auch Tiere zeigen dieses Verhalten. Krähen etwa versammeln sich um ein totes Schwarmmitglied und achten dabei auf Feinde. Genauso analysieren Menschen, fasziniert vom Mysterium des Todes, die Gefahren und suchen nach Vermeidungsstrategien. (Kürzlich erst sah ich eine Sendung, in der es nur darum ging, dass Menschen erzählten, wie sie lebensgefährlichen Situationen entkamen; es war ungemein fesselnd.) Auch das Motto des Kriminal-Podcasts My Favorite Murder – »Bleib sexy und lass dich nicht ermorden« – weist darauf hin.
Einige Psychologen erklären die Faszination des Themas damit, dass uns das Makabre anzieht, weil wir uns danach sehnen mitzufühlen. Wir wollen uns mit dem unglücklichen Opfer identifizieren, das ist Teil unseres sozialen Charakters. Andere sind der Ansicht, dass wir verstehen wollen, was jemanden dazu bringt, anderen zu schaden. Trifft nur eine dieser Theorien tatsächlich zu, dann sind unsere Intentionen jedenfalls nicht bösartiger Natur.
Meine morbide Neugier führte mich in die Räumlichkeiten der Rechtsmedizin von Baltimore, wo ich ein Seminar über Mordermittlungen besuchte. Dabei durfte ich auch eine Autopsie beobachten. In nur einem Punkt erkannte ich die Fernsehbilder wieder: Auch hier gab es diese Schalen. Oh, und noch ein kleines Detail: An der Wand hing mitten zwischen den Fotos von früheren Rechtsmedizinern das Bild von Jack Klugman im weißen Laborkittel mit dem Schildchen »J. Quincy«.
Ich wollte also sehen, wie eine echte Autopsie abläuft. Da Baltimore die größte rechtsmedizinische Abteilung Amerikas hat, findet dort eine Menge davon statt. In der sechsstöckigen Forensik führen 16 Leichenbeschauer pro Jahr etwa 4000 Autopsien an Toten aus dem ganzen Bundesstaat durch, was etwa zehn Prozent aller Todesfälle in Maryland entspricht; darunter sind nicht nur Morde und Unfälle, sondern alle Fälle, in denen jemand unerwartet tot aufgefunden wurde. »Wenn Sie nicht hier enden wollen«, sagte man mir, »sterben Sie besser im Krankenhaus unter ärztlicher Aufsicht.«
Die Gerichtsmedizin ist ein hochmodernes Gebäude, das 2010 fertiggestellt wurde und noch »Platz zum Wachsen« bietet, erzählt mir Bruce Goldfarb, der Assistent des Leiters, während er mich durch die Garage im Erdgeschoss lotst. Hier schieben sie die Bahren sofort in den Lastenaufzug und verfrachten sie ein Stockwerk höher. Dort rollen die Verstorbenen zum Wiegen über eine Waage und werden in 13 Sekunden ganzkörpergeröntgt3. Im Anschluss geht es weiter in einen der beiden Autopsiesäle mit acht Tischen. So schnell waren sie noch nie bei einem Arzt.
Dann gibt es noch die Fälle, deren Verwesungszustand – gleichzusetzen hier mit Gestank – zu extrem ist. Sie kommen in einen der zwei kleineren Sicherheitsräume mit einem speziellen Entlüftungssystem, die mit dem Symbol für eine potenzielle Biogefahr gekennzeichnet sind: Die Luft wird 30-mal pro Stunde komplett ausgetauscht. Der Geruch bleibt trotzdem hängen. Jeden, der danach so einen Raum verlässt, umweht ein stechender Hauch von Fettsäuren, wie sie für den Tod charakteristisch sind.
Was fehlt, sind die Reihen rostfreier, gekühlter Stahlschubladen für die Leichen, die viele mit einer Leichenhalle verbinden. Stattdessen gibt es einen Kühlraum für Leichen, die nach der Autopsie auf Abtransport zur Beerdigung warten. »Es gibt keinen Rückstau. Ziel ist es, jeden innerhalb von 24 Stunden abzufertigen«, erzählt mir Goldfarb weiter. Auch sucht man vergeblich den Besucherraum mit den trauernden Angehörigen, die zur Identifikation der Leiche geladen sind. Unbekannte werden hier in der Regel anhand von Fotos, Zahnarztunterlagen, Fingerabdrücken oder gleich anhand der DNS identifiziert.
Am ersten Morgen meines Besuchs finde ich 17 Leichen vor, darunter fünf in den Sicherheitsräumen. Um 8.30 Uhr machen die Leichenbeschauer ihre Morgenrunde. Die Aufteilung erfolgt kollegial und ruhig. Die Fälle werden gleichmäßig auf die fünf Rechtsmediziner verteilt, ohne Streit darüber, wer die Verwesten übernehmen muss.
An diesem Tag wiesen fünf der 17 Toten Schusswunden auf, wie es ordentlich auf einer Liste angegeben wurde – die wie jeden Morgen frisch ausgedruckt neben die Überzieher gelegt wird, die jeder sich über die Schuhe zieht. Sobald ich meine anhabe, geht es weiter in einen hellen, hohen Raum. An sieben der acht Autopsiestationen liegen Leichen auf Bahren.
Die Gruppe geht flott von Leiche zu Leiche, nickt und notiert Details. Bei einigen der Fälle mit Schusswunden sind die Polizisten zugegen, die die Fälle bearbeiten. Sie liefern wichtige Informationen: die Zahl der Einschusslöcher, gefundene Patronenhülsen und Augenzeugenberichte.
Nach der Besichtigung der beiden Autopsiesäle fragt der Medizinstudent, der mich begleitet, ob ich mit zu den Sicherheitsräumen gehen möchte. Unsere kleine Gruppe eilt weiter, und ich will nicht kneifen. Also stimme ich zu. Wir betreten einen viel kleineren Raum, in dem drei Leichen liegen, die Körper in Gelb- und Violetttönen, die an verfärbte blaue Flecken erinnern. Der Gestank überfällt einen sofort beim Betreten des Raums. Er ist aber nicht so stark, dass er einen umwirft; keiner trägt eine Maske oder verstopft sich die Nase.
Als wir hinausgehen, bin ich erleichtert, bis der Student fragt, ob ich auch mit in den zweiten möchte. In den zweiten Sicherheitsraum? Wieder eilt die Gruppe weiter, sie ist nun etwas kleiner. »Wenn schon, denn schon«, sage ich, und wir betreten den zweiten. Hier liegen zwei weitere Leichen, beide in einem fortgeschrittenen Verwesungszustand. Nach dem Tod setzen Bakterien innerhalb weniger Tage Gase frei, der Körper schwillt an, die Fäulnis setzt ein. In diesem Raum werde ich Zeuge davon – und von den Begleitprozessen, inklusive des Geruchs.
Dieser Raum bleibt den ganzen Tag an mir haften, buchstäblich. Noch nach einer Stunde rieche ich den Fäulnisgeruch, vor allem, wenn ich mich beim Gehen bewege. Ich befürchte, meine langen Haare verströmen ihn. »Keine Angst, niemand riecht das an Ihnen«, sagen zwei Studentinnen auf der Toilette zu mir, als sie sehen, wie ich an meiner Bluse schnuppere. Am Waschbeckenrand steht ein Deodorant, aber ich zögere, mich vor den beiden einzusprühen. Später, in einem leeren Raum, gebe ich einen Sprühstoß in die Luft und gehe durch die Duftwolke. Selbst die Dusche am Abend vermag es nicht, den Geruch zu vertreiben, der sich bis dahin wohl nicht nur in meiner Nase, sondern auch im Hirn festgesetzt hat.
Am nächsten Morgen, frisch nach der zweiten Dusche, stoße ich zu den Studenten, um vom Zuschauerbalkon über den zwei Autopsiesälen aus und durch das Glas hindurch den Ablauf einer Obduktion zu verfolgen. Ich bin tatsächlich dabei. Die Prozedur ist umfangreich, viele Details sind zu beachten. Labortechniker und Leichenbeschauer sichern verschiedene Beweise – Hosen werden eingetütet, Kugeln entnommen, der Dreck unter den Fingernägeln entfernt.
Im anderen Raum – dem ohne Schussopfer – sind die Obduktionen weiter. Sechs der Leichen sind bereits geöffnet. Der Brustkorb ist aufgespreizt, gelbe Fettlappen hängen neben roten Muskeln und Hautlappen.
Doch die Augen wandern zuerst zu den Köpfen. Bei einigen wurde die Kopfhaut abgezogen, der Schädel aufgesägt und das Hirn entnommen. Am meisten verstören die klaffenden leeren Löcher. Ich hatte angenommen, ein Leichenbeschauer entferne nur die Oberseite des Schädels, aber tatsächlich ist es über ein Viertel davon. Der Schnitt verläuft knapp über den Ohren und dann um die Hinterseite des Schädels herum.
Ein Assistent entfernt mit der Knochensäge in wenigen Minuten einen Teil des Schädels. Und schon greift er hinein und zieht das Hirn heraus. Ein schneller Schnitt am Hirnstamm, und es liegt frei, rosa und blutig. Er hüllt es in ein weißes Tuch und rollt es sanft auf eine Folie in der Hängeschale. Sieht man Menschen zu, die diese Arbeit täglich machen, schockiert das weniger, als es klingt. Die Rechtsmediziner und Assistenten wirken ruhig und aufmerksam. Geschieht etwas Ekliges, verzieht niemand das Gesicht. Hier geht es um die Realität und alles, was auf der Suche nach der Todesursache unternommen werden muss, ist ihr Job. Jeder Teil des Körpers muss genau untersucht werden.
Schön war das nicht, aber ich bin froh, dass ich dabei war. Sollte ich unter rätselhaften Umständen sterben, bin ich nun sicher, dass meine Leiche gut behandelt und umsichtig nach Hinweisen untersucht wird, um den Grund zu ermitteln. Die saubere, geräumige Rechtsmedizin mit ihren Laboren voll leise summender Geräte war in ihrer Nüchternheit tatsächlich äußerst beruhigend.
Meistens wird uns die Realität dessen, was mit unseren Körpern nach dem Tod geschieht, vorenthalten; selbst die schaurigste Episode von CSI: Crime Scene Investigation oder Bones ist geschönt. Die Toten sind nicht zu erkennen und holografische und bunte Animationen ersetzen weitgehend die Realität der forensischen Untersuchung. Viele bevorzugen es sicher, die ekligen Teile nicht zu Gesicht zu bekommen – und sie sind glücklich darüber.
Da Sie dieses Buch in der Hand halten, vermute ich, dass Sie nicht zu diesen Menschen gehören, daher habe ich einige Geschichten für Sie. Denn das Thema Tod führte mich für überaus faszinierende Recherchen an die überraschendsten Orte, ich habe mich mit Miniaturtatorten befasst, blutenden Leichen und ans Ufer gespülten, körperlosen Füßen wie denen in British Columbia. Ich widme mich hier diesen Geschichten, um zu verdeutlichen, was mit unserem Körper nach dem Tod geschieht.
Obwohl dieses Thema schon per Definition morbid ist, sind die Geschichten meines Erachtens weder traurig noch deprimierend. Obwohl der Tod die Lebenden emotional aus der Fassung bringen kann, heißt das nicht, dass jede Neugier diesbezüglich einer lustvollen Melancholie entspringt. Es ist vielmehr das Verlangen nach Wissen, das uns auf einen womöglich produktiven, wenn auch nicht immer heiteren Weg führt. (Fragestellungen, wie sie Forensiker antreiben, den Tod zu untersuchen und Verbrechen aufzuklären.) Und das Beste: Das Stillen dieser morbiden Neugier kann uns ein wenig beruhigen, da es uns zeigt, dass selbst der Tod den Regeln der Natur gehorcht. Und das ist etwas, was wir alle verstehen können – wenn wir nur bereit sind, einmal genauer hinzuschauen.
Die kleinsten Tatorte der Welt
Über die Miniaturen, an denen Polizisten geschult werden
Die gesamte Familie Judson ist tot. Bob Judson, Vorarbeiter in einer Schuhfabrik, liegt im blutigen Pyjama mit dem Gesicht nach unten auf einer Decke neben dem Bett. Seine Frau Kate daneben wirkt, als schlafe sie friedlich, sieht man von den Blutspritzern auf ihrem Kissen und an der Wand hinter ihrem Kopf ab.
Im nächsten Zimmer kommt es schlimmer. Ihr kleines Baby hat die winzigen Arme dicht vors Gesicht gezogen, es ist blutig. Lina Mae ist – ganz im Kontrast zum Blutbad um sie herum – ordentlich mit einer rosa Decke zugedeckt, auf der Elefanten tanzen und Hunde im Tutu mitmachen.
Es ist eine traurig-schreckliche Szene. Ich soll feststellen, was hier geschehen ist. Denn hier handelt es sich um meine erste Morduntersuchung, und ich bezweifle, dass ich das fertigbringe – trotz der Tatsache, dass alle Judsons nur um die fünfzehn Zentimeter groß und aus Porzellan sind.
Die tote Familie gehört zu einem puppenhausgroßen Tatort, den Frances Glessner Lee baute, die Erbin der Landmaschinenfirma International Harvester. Sie schuf in den 1940er- und 1950er-Jahren die 20 unheimlich präzisen Dioramen, die den Namen »Studien über unerklärliche Todesfälle – alles Wissenswerte in der Größe einer Nussschale« (Nutshell Studies of Unexplained Death) tragen. Lee war berühmt für ihre Liebe zum Detail und verwendete für die Modelle viele Spuren von echten Tatorten. Noch heute werden achtzehn dieser Studien bei der Ausbildung von Polizisten eingesetzt. (Ein weiteres wurde in den 1990er-Jahren auf dem Dachboden ihres Hauses in New Hampshire gefunden, und eins wurde leider bei einem Umzug zerstört.)
Ich stehe in einem dämmrigen Raum im Gebäude der Rechtsmedizin von Baltimore inmitten dieser 18 Miniaturtatorte. Die Judsons gehören zur Drei-Zimmer-Wohnung, der größten der Miniaturen. Es ist diejenige mit den meisten Puppentoten. (Das hat mich vermutlich angezogen – schließlich liebe ich Herausforderungen.)
Einige der Tatorte könnten Teile einer Hausrenovierungs-Fernsehsendung sein, die tragisch schiefging. Im Rosa Bad ist im Spiegel das Gesicht einer toten Frau zu sehen. In Die Küche scheint eine Frau mit dem Gasofen Selbstmord verübt zu haben – oder wurde sie ermordet? Und im Dunklen Bad liegt eine Frau tot in der Badewanne, das starre Plastikwasser steht über ihrem Gesicht.
Jeder Tatort ist gespickt mit kleinen Spuren, die die Ermittler finden müssen. Ich reihe mich unter die Polizisten, die ihr Bestes im 73. Frances-Glessner-Lee-Mordermittlungsseminar versuchen. Es ist finanziell unterstützt von der Stiftung Harvard Associates in Police Science und wird jährlich von der Rechtsmedizin Baltimore durchgeführt. Dutzende Kriminal- und Vollzugsbeamte, Staatsanwälte und Angehörige anderer Strafverfolgungsbehörden besuchen jedes Jahr die Einführungskurse und manchmal werden auch Journalisten wie ich geduldet.
In der einwöchigen Schulung für Strafjustizmitarbeiter halten sechzehn Rechtsmediziner und weitere Forensik-Experten Vorträge über die verschiedensten Fragestellungen, von der Deutung von Blutflecken bis zur Sammlung von Beweisspuren und zur Identifizierung von Verletzungsmustern. Was damit gemeint ist? Es gibt jeweils einen 90-minütigen Vortrag mit Hunderten Fotos der verschiedensten Wunden, verbunden mit der Frage nach stumpfer oder scharfer Gewalt. Darunter sind Wunden, die von allen möglichen stumpfen oder spitzen Dingen herrühren. (Die Fotos von scharfer Gewalt sind – nicht zuletzt dank der Pfählungen – grauenhafter, aber stumpfe Gewalt ist auch nicht ohne …)
Zwischen den Referaten – oder der Parade der schrecklichen Todesarten, wie ich sie in den vier Tagen bei mir heimlich nenne – untersuchen die Studenten in Dreier- oder Vierergruppen jeweils einen Miniaturtatort. Am letzten Seminartag, einem Freitag, präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse und verraten, ob ihrer Meinung nach ein Mord verübt wurde und welche Spuren sich am Tatort finden lassen. Am Ende erfahren sie, ob ihre Analysen mit dem Szenario übereinstimmen, das Frances Glessner Lee ursprünglich entworfen hat. Die Lösungen sind streng gehütete Geheimnisse, wie mir mehrfach eingeschärft wurde.
Lee gilt als die »Mutter der Forensik«, sie baute die Dioramen als Hilfen, um Ermittlern forensische Grundlagen zu vermitteln. Das Fach entstand damals erst und gehörte noch keineswegs zur regulären Ausbildung. Lee stiftete der Harvard Universität zudem ein Institut für Rechtsmedizin, das von 1931 bis 1966 Ärzte und Justizbeamte schulte. Dort wurde umfassende forensische Forschung betrieben, von der Analyse von Schmauchspuren bis zu Vergiftungsmethoden. Heute erinnern die Nutshells, Lees Dioramen, an ihren wichtigen Beitrag zur Forensik in Amerika.
Die Dioramen entstanden im Maßstab 1:12. Die aus Autopsie- und Polizeiberichten sowie Zeugenaussagen übernommenen Details wurden entsprechend verkleinert und zur Verschleierung etwas verändert. Manchmal änderte Lee die Namen und Daten in den Tatortbeschreibungen und nahm sich bei Einzelheiten, die keine wichtigen Hinweise lieferten, Freiheiten heraus wie bei Tapeten oder der Ausstattung.
Laut Bruce Goldfarb, dem Assistenten des Leiters der Rechtsmedizin von Maryland und de facto dem Kurator der Dioramen, gab Lee für manche von ihnen so viel Geld aus, wie damals ein ganzes Haus gekostet hätte. Goldfarb ist freundlich und energisch, er hat einen grauen Spitzbart und eine hippe schwarze Brille. Er war Journalist und fand in der Rechtsmedizin seinen Traumjob. Als ich ihn treffe, vollendet er gerade ein Buch über Lees Beitrag zur Forensik.
Während Goldfarb mich durch das Gebäude führt, muss ich hinter ihm herhasten. Wir flitzen in die Labore und wieder hinaus und sehen uns eine Wohnung in Originalgröße an, das Scarpetta-Haus, das die Krimiautorin Patricia Cornwell spendete. Dort werden Tatorte nachgebaut, um Kriminalbeamte zu trainieren. Er wird erst langsamer, als wir den dämmrigen Raum mit den Dioramen betreten.
Spricht Goldfarb über Lees Schöpfungen, klingt seine Stimme ehrfürchtig: »Wenn es einen einfachen und einen schwierigen Weg gab, nahm sie den schwierigen.« (Eine Miniatur-Mülltonne im Diorama Three-Story Porch, so stellt er fest, enthält authentischen Müll.) Er erzählt mir auch, dass alle Figuren Unterwäsche tragen. Leider kann ich keine Hose herunterziehen, um das zu überprüfen, da alles hinter Plexiglas steht.





























