Inhaltsverzeichnis
DER AUTOR
Vorwort
Prolog
ERSTES BUCH - Funkelaugen
Kapitel 1.
Kapitel 2.
Copyright
DER AUTOR
Robert Domes, geboren 1961 im bayerischen Ichenhausen, studierte Politik und Kommunikationswissenschaft in München. Er arbeitete jahrelang als Redakteur bei der Allgäuer Zeitung, zuletzt als Leiter der Lokalredaktion in Kaufbeuren, bevor er sich 2002 als Journalist und Autor selbstständig machte. Für das vorliegende Buch hat er fast fünf Jahre lang recherchiert.
Zu diesem Buch wurde eine Unterrichtserarbeitung erstellt. Sie kann unter www.randomhouse.de/kidsandteens/lehrer.jspabgerufen werden.
Vorwort
von Dr. Michael von Cranach (ehemaliger Leiter des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren)
Ernst Lossa begleitet mich seit siebenundzwanzig Jahren. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Freund bezeichnen darf, ich würde es mir sehr wünschen, kann mir aber auch vorstellen, dass er, vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen, die Freundschaft mit einem Psychiater strikt ablehnen würde. Das müsste ich akzeptieren. Die Umstände unseres »Kennenlernens« haben eine lange Vorgeschichte.
In der Nazizeit haben auf Hitlers persönlichen Erlass zwischen 1939 und 1945 Ärzte und ihre Mithelfer ungefähr 200 000 psychisch kranke Menschen getötet. Sie haben sie für »lebensunwert« erklärt, entwürdigt, gequält und ermordet. Die Täter waren nicht einige wenige, sondern die Mehrheit, die Elite der deutschen Psychiater.
Nach Ende des Krieges haben die Alliierten diese Ereignisse sehr gründlich untersucht, insbesondere die Amerikaner, die Beweismaterial für die Nürnberger Ärzteprozesse sammelten. Tatsächlich wurden dann 1947 in Nürnberg zwei der Hauptverantwortlichen dieser Euthanasieaktion zum Tode verurteilt und gehängt. Doch danach verlor sich das Interesse an weiterer Aufklärung.
Die Mehrheit der Täter und Mitläufer blieb unbehelligt, war weiterhin ärztlich tätig, es entstand keine Zäsur, kein Neuanfang, die schlimme Vergangenheit wurde verdrängt und verleugnet.
Andererseits hatte die Erfahrung des Krieges das Menschenbild unserer Gesellschaft verändert; das Wohl, die Rechte und auch die Verantwortung des Einzelnen bekamen einen hohen Stellenwert; individuelle Freiheit und Menschenrechte wurden die Grundwerte der neuen Demokratie. Diese Gedanken jedoch erreichten die abseits gelegenen, ver- und geschlossenen Großanstalten, in denen damals psychisch kranke Menschen behandelt wurden, sehr spät. Erst 1975 beschäftigte sich der Deutsche Bundestag mit den »brutalen und menschenverachtenden Realitäten« in den psychiatrischen Krankenhäusern, und man beschloss, eine Psychiatriereform in die Wege zu leiten mit dem Ziel der Abschaffung der Großkrankenhäuser und der Verlagerung der Behandlung und der Hilfen in das Lebensumfeld der Betroffenen. Dieser neue Wind hat damals viele von uns jungen Ärzten beflügelt, in die Anstalten zu gehen und die Reform in Gang zu setzen.
Als ich im Mai 1980 mit diesem inneren Auftrag die Leitung einer derartigen Klinik in Kaufbeuren übernahm, wurde mir nach wenigen Wochen bewusst, dass die Veränderung nur gelingen kann, wenn wir uns der Vergangenheit stellen, hinschauen auf alles, was geschehen ist, diesen Nebel der Verschwiegenheit und Lähmung lichten. Also sichteten wir Verwaltungsakten, Prozessakten, die noch vorhandenen Krankengeschichten der getöteten Menschen und wir sprachen mit Zeitzeugen. Dabei stießen wir immer wieder auf Ernst Lossa. Den amerikanischen Offizieren, die 1945 als Erste in der Klinik ermittelt hatten, war es offensichtlich ähnlich gegangen wie später uns. Bei ihren Verhören der Ärzte und des Klinikpersonals sahen sie sich mit so Unfassbarem konfrontiert, dass sie das Bedürfnis hatten, die Ereignisse besser verstehen zu können, und zwar in einem Einzelschicksal personifiziert. So fanden sich viele Zeugenaussagen über Ernst. Diese sind, erweitert um die Schilderungen von Ernsts Schwestern Amalie und Anna, die heute noch leben, und um die Ergebnisse von Robert Domes’ umfangreichen Recherchen, die Grundlage dieses Buches.
Millionen Menschen wurden Opfer des Holocaust, Hunderttausende wurden Opfer des Kriegs gegen psychisch kranke Menschen, diese Zahlen versperren uns den Blick auf den Einzelnen. Als ich Ernsts Krankengeschichte zum ersten Mal in die Hand nahm, hat mich das dort angeheftete Foto tief bewegt und nicht mehr losgelassen. Seitdem führe ich innere Gespräche mit ihm, und oft habe ich bei schwierigen beruflichen Entscheidungen versucht, mein zu lösendes Problem aus Ernsts Perspektive zu betrachten, und dann wusste ich, wie ich zu entscheiden hatte. Auf dem Foto schaut Ernst uns an, herausfordernd und zugleich tieftraurig, Kind und Erwachsener zugleich. Allen, die dieses Bild sehen, legt es nahe, sich in seine Lage zu versetzen, sich vorzustellen, wie ein Kind das Leben unter derartig grauenvollen Umständen erlebt und bewältigt hat. Die äußeren Ereignisse haben sich so zugetragen, wie Robert Domes sie schildert. Um Ernsts Innenleben darzustellen, hat Robert Domes auf empathische Weise zu den Mitteln des Romans gegriffen. Der Leser ist aufgefordert, sich in Ernsts Lage hineinzuversetzen und seine persönliche Version von Ernsts Erleben zu entwickeln.
Wenn ich Ernst heute anschaue, mag ich am liebsten alles ungeschehen machen, doch das ist unmöglich, wie wir alle wissen. Selbst wiedergutmachen (was für ein unglückliches und schönfärberisches Wort haben wir damals im Rahmen der Entschädigung der Opfer des Holocaust gewählt!) geht nicht. Doch Bücher wie dieses geben Ernst und allen Opfern die Würde zurück, die ihnen auf so schlimme Art genommen wurde.
Eggenthal, im November 2007 Michael von Cranach
Michael von Cranach, Dr. med, Jahrgang 1941, ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Nach Tätigkeiten in München und London übernahm er 1980 die Leitung des Bezirkskrankenhauses Kaufbeuren und war dort bis zu seiner Berentung 2006 tätig. Aus einer stark sozialpsychiatrischen Perspektive heraus engagierte er sich klinisch und in internationalen Gremien (WHO und EU) für die Aufhebung der Ausgrenzung psychisch kranker Menschen. In diesem Rahmen befasste er sich auch intensiv mit der Erforschung der Psychiatrie im Nationalsozialismus. Er betreibt heute eine psychiatrische Praxis in München und setzt seine Bemühungen um eine entstigmatisierte Psychiatrie fort.
Prolog
Die Tür zum Vorraum steht einen Spalt offen, dort brennt eine Glühbirne, doch ihr funzliges Licht schafft es kaum bis ins Krankenzimmer. Ernst lauscht auf die Atemzüge der anderen. Zwei schlafen fest. Nur Heinz1 ist wach, hält mit der rechten Hand sein Ohrläppchen fest und streicht mit der Linken unermüdlich die Bettdecke glatt, faltet sie auf, streicht sie wieder glatt. Mit Heinz ist nicht viel anzufangen. Er glotzt den ganzen Tag ins Leere, spricht mit Menschen, die keiner sieht, in einer Sprache, die keiner versteht. Die anderen beiden kennt Ernst nicht. Der eine hat sich, trotz der Hitze, fest in seine Decke gewickelt. Der andere schnarcht leise. Beim Einatmen gibt er ein Knurren von sich, beim Ausatmen blubbert er, als läge er unter Wasser.
Seine drei Zimmergenossen sind wesentlich jünger als Ernst, höchstens sechs oder sieben. In drei Monaten wird er fünfzehn und ist eigentlich schon zu alt für die Kinderkrankenstation. Er ärgert sich, dass er heute hier schlafen muss. Viel lieber wäre er drüben bei den Männern geblieben.
Meistens legen sie ihn auf die Krankenstation, wenn er etwas ausgefressen hat, weil sie ihn hier besser überwachen können. Aber diesmal hat er nichts angestellt. Heichele sagte, er sei typhusverdächtig. Typhus ist eine ernste Sache. In den letzten Wochen sind angeblich schon zehn Patienten daran gestorben. Aber sie waren alle schwach, hatten graugrüne Gesichter, krümmten sich vor Bauchweh und schissen die Betten voll. Ernst dagegen fühlt sich munter wie schon lange nicht mehr. Vielleicht ist die Geschichte mit dem Typhus nur ein Trick von Heichele, damit Ernst endlich die Tabletten nimmt.
Er schließt die Augen und versucht, sein aufgeregtes Herz zu beruhigen. Die Stimme seiner Mutter klingt aus einer fernen Zeit zu ihm her. Nach Sonnenuntergang beginnt die Stunde der Engel, hat sie immer gesagt. Er stellt sich vor, ein Engel geht durch die Station, vorbei an den Krüppeln und Idioten, an den Gelähmten und Blinden, an den Schreienden, die man ans Bett gebunden hat, und den Stillen, die nur vor sich hin sabbern. Der Engel geht vorbei und alle werden ganz friedlich. Am Ende kommt er auch zu Ernst, berührt ihn mit seinem Flügel an der Schulter und zwinkert ihm zu.
Er setzt sich im Bett auf, aber da ist keiner. Nur vom Flur hallen schwere Schritte herein. Klack-schlurf-klack, Heichele mit seinem Hinkebein auf Rundgang. Der Pfleger sperrt den Vorraum auf, der das Krankenzimmer vom Flur trennt. Als sein massiger Schatten die Tür ausfüllt, schließt Ernst schnell die Augen. Heichele soll glauben, dass er schläft. Sonst fängt er wieder mit seinen Tabletten an. Einige Atemzüge lang rührt sich nichts, dann gibt der Pfleger ein zufriedenes Grunzen von sich. Ernst hört, wie Heichele absperrt. Das Klack-schlurf-klack entfernt sich.
Zwei Stockwerke tiefer sitzt Georg Frick in seinem Büro. Der Verwaltungsleiter der Heil- und Pflegeanstalt trommelt nervös auf der schweren Schreibtischplatte, schiebt Papiere hin und her, kann sich nicht auf die Arbeit konzentrieren. Er steckt sich eine Zigarette an. Da klopft es an der Tür.
Frick ruft: »Herein!«, er hat den späten Besuch bereits erwartet.
Die Oberschwester macht ein griesgrämiges Gesicht. Frick deutet auf einen Stuhl und hält ihr die Zigarettenschachtel hin.
Sie greift zu und fragt gereizt: »Warum braucht ihr mich für diese Sache? Sonst ist der Heichele doch auch nicht so zimperlich.«
Frick zuckt die Achseln. »Er hat zum Chef gesagt, er kann es nicht.«
Sie lacht auf. »Der Herr Pfleger kann das nicht, also brauchen die Herren die Schwester Pauline.«
»Ist vielleicht auch besser, wenn das nicht einer allein macht«, sagt Frick. »Der Kerl ist nicht zu unterschätzen.«
»Ich dachte, er ist erst vierzehn?«
»Fast fünfzehn.«
Pauline bläst den Rauch aus. »Und da macht ihr so einen Zirkus.«
»Du kennst ihn nicht. Der ist zu allem fähig.«
Die Oberschwester schüttelt den Kopf. Dann warten die beiden, rauchen und warten. Pauline wandert durch den Raum, Frick sortiert die Papierberge auf dem Tisch. Endlich klingelt das Telefon.
Frick nimmt ab, horcht kurz, nickt und legt wieder auf. »Er schläft«, sagt er.
Sie stopft die Zigarette in den Aschenbecher. »Na dann, an die Arbeit! Gehst du mit?«
Frick nickt. »Ja, ist wohl besser.«
Ernst wartet, bis es still im Flur ist und die Tür des Pflegerzimmers ins Schloss fällt. Dann steht er auf, doch nicht mal am gekippten Fenster gibt es frische Luft. Er schielt durch den Spalt neben dem Verdunkelungskarton nach draußen, wo die Reste eines schwülen Augusttages in einer mondlosen Nacht verschwinden. Die dicken Klostermauern sind von der Hitze der letzten Tage gesättigt. Ernst hofft, ein paar Sterne zu sehen, aber der Himmel hat sich zugezogen. Das Gewitter wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Unruhig wirft er sich aufs Bett, schwankt zwischen Wachen und Schlafen, als würde er auf einem schmalen Grat laufen, wo es auf der einen Seite hell, auf der anderen dunkel ist. Bilder von früher tauchen in seinem Kopf auf, Stimmen aus dem Nebelland, Gerüche, Fahrtwind. Sommer 1933, seine letzte Reise mit den Eltern. Elf Jahre ist das her.
Ernst sieht Vater und Mutter in ihrem alten Planwagen, grüne Felder, rote Mohnblumen. Die Oma in Buchau, die Pfannkuchen mit Marmelade macht. Ein schwitzender Dorfpolizist, der von Zigeunerpack redet. Abende am Lagerfeuer, Mutter singt, Vater spielt Quetsche2 und die Sterne leuchten. Die modrige Wohnung in Augsburg. Mutter, die in der Haustür steht und winkt und im Rauch verschwindet. Babett-Oma, die im Winterdunst immer durchsichtiger wird. Er sieht seine Schwestern Malchen und Nanna in ihren Nachthemden durch einen schwarzen Flur schweben. Er sieht seinen Vater im schäbigen Anzug und mit dünnem Gesicht im Garten des Erziehungsheimes sitzen. Die Zugfahrt ins Allgäu, am Horizont glitzernde Berge. Die Anstalt mit ihren verlorenen Menschen und den vergessenen Kindern. Er spürt einen Kuss auf seiner Wange, sieht ein Mädchen mit roten Haaren und grünen Augen. Haferfeld mit Mohn.
Auf dem Flur hallen Schritte. Die Bilder vermischen sich und verblassen. Ernst will sie festhalten. Wo war der Anfang? Grünrote Felder, die Familie im Planwagen, der Stolpertakt der Landstraße. Die Schritte kommen näher.
ERSTES BUCH
Funkelaugen
1.
Sanftes Schaukeln, fast wie in einer Wiege. In Ernsts Ohren das Singen der Räder und der Takt, den die Hufe machen. Helles Licht wie Zuckermilch in der Luft. Die Haferfelder riechen nach Kraft und Großwerdenwollen. Ernst kann sie wachsen hören, sie knistern und wispern beim Strecken, und wenn man die unreifen Körner in den Mund steckt - Mutter sagt, das darf man nicht, weil man sonst krank wird, aber er tut’s trotzdem manchmal -, schmecken sie nach weichem Teig und Wärme und Regen.
Die Haferstängel werden bewacht von Mohn, ein roter Gürtel um das Feld, sie passen auf, dass niemand sie beim Wachsen stört. Ernst schaut hinten aus der halb offenen Plane. Das Feld hüpft und tanzt vor seinen Augen, er kann die Kieselsteine hören, sie halten die Luft an und stöhnen, wenn die harten Wagenräder über sie drüberrollen, und dann, wenn alles vorbei ist, atmen sie aus und seufzen leise.
Malchen und Nanna schlafen, sie sind noch klein und müssen viel schlafen, weil das Herumtollen und Schreien so anstrengend ist. Mutter schläft auch. Ihr geht es nicht gut, sie hat einen dicken Bauch und sieht krank aus. Aber sie jammert nicht, Mutter hat noch nie gejammert.
Ernst ist schon groß, nicht so groß wie Vater - der sitzt vorne und ist so stark, dass er mit einer Hand das Pferd halten kann -, aber viel größer als Malchen und Nanna. Ernst wird bald vier.
Anna ist die Kleinste, ist gerade ein Jahr alt geworden. Sie heißt so wie Mutter und hat schon jetzt dieselben Haare, noch nicht so lang, aber genauso dunkelbraun und dicht. Und sie hat dieselben großen braunen Augen, mit denen sie ständig neugierig alles untersucht. Alle nennen sie Nanna, weil sie zu sich selbst Nanna sagt. Meistens krabbelt sie durch die Gegend und frisst alles Mögliche, was sie am Boden findet, und Ernst muss es ihr aus dem Mund pulen.
Amalie ist zwei und sie plappert die ganze Zeit vor sich hin. Sie wird Malchen genannt, weil das schöner klingt als Amalie. Sie hat die blonden Haare vom Vater und das Näschen von Mutter bekommen. Wenn sie geht, ist ein Beinchen langsamer als das andere, irgendwas ist schief, sie watschelt und wackelt dabei mit dem Kopf. »Die Hüfte«, sagt Mutter, »aber das verwächst sich.« Trotzdem ist Malchen die Lustigste von allen. Wenn sie lacht, kann keiner mehr böse sein.
Ernst schafft meistens nur ein Grinsen, oft nicht mal das. »Das hat er von seinem Großvater«, sagt Mutter, »das Melancholische.« Deshalb hat er auch den Namen von Großvater, Ernst. Aber von ihm sprechen sie nicht oft, weil er die Großmutter mit neun Kindern hat sitzen lassen und mit einer anderen Frau weggegangen ist. Die Onkel und Tanten sagen alle, wenn sie den Jungen sehen: »Ganz der alte Lossa, die gleiche breite Nase und diese großen Elefantenohren.« Ernst kennt den Großvater nur von einem Foto und findet, dass er ihm überhaupt nicht ähnlich ist. Der Alte schaut streng und mürrisch drein. Direkt unter der Nase hat er ein schmales Bärtchen, was jetzt Mode ist, weil es der Führer* hat, der auf allen Plakaten zu sehen ist. Ernsts Vater findet es scheußlich, er mag den Führer nicht und deswegen rasiert er sich auch immer ganz gründlich.
Ernst macht sich Sorgen wegen seiner Ohren. Täglich prüft er, ob sie größer geworden sind. »Wenn die weiter wachsen, sehe ich wirklich mal aus wie ein Elefant und werde im Zirkus herumgezeigt.« Und dann zieht auch noch sein Vater dran herum, wenn er was angestellt hat. Er wünschte, er hätte auch so kleine Ohren wie Nanna und Malchen, oder lange Haare, die die Ohren verdecken. Aber seine Haare müssen immer ganz kurz sein wegen der Läuse. Überhaupt wäre er manchmal lieber ein Mädchen. Die beiden dürfen immer bei Vater auf dem Schoß sitzen, und er lässt ihnen alles durchgehen, während es bei ihm gleich was setzt, wenn er frech ist. Dafür ist er der Große, sagt Mutter immer, und dann lächelt sie, wie nur sie lächeln kann, ganz allein mit den Augen macht sie das, dunkelbraunes Knopffunkeln, und das ist fast so schön wie Streicheln. Ernst ist der Große, er passt auf die beiden Mädchen auf, damit sie nicht weglaufen oder Erdklumpen in den Mund stecken oder unter dem Pferd herumkriechen oder ihre Hände ins Feuer strecken, er darf sogar manchmal vorne auf dem Bock sitzen und die Zügel halten.
Mutter sagt, Ernst ist ein Geschenk, weil er eine Woche nach ihrem Geburtstag auf die Welt kam. Sie wurde zwanzig und er war praktisch ihr verspätetes Geburtstagsgeschenk. Das war vor vier Jahren, 1929. Ein schlechtes Jahr, ein armes Jahr, in dem die Geschäfte des frisch verheirateten Paares mehr als lausig waren. »Das einzig Gute warst du, Ernstl«, erzählt Mutter immer, »ein Fingerzeig Gottes, ein Glücksstern.« Weil genau an ihrem Geburtstag damals in Amerika der Schwarze Freitag* war und alle Angst hatten. »Doch dann kamst du«, lächelt Mutter, »und wir dachten nicht mehr an die Angst, sondern sagten, du bist ein Zeichen, dass es jetzt wieder aufwärtsgeht.«
Von Amerika weiß Ernst nur, dass es sehr weit weg ist und dass es dort Indianer gibt. Er hat keine Ahnung, was ein schwarzer Freitag ist, vielleicht hat es an dem Tag in Amerika Kohlen geregnet oder die Sonne ging nicht auf. Ernst wurde am 1. November geboren, an Allerheiligen, wenn überall für die Heiligen und die Verstorbenen Kerzen angezündet werden. »Du hast eine große Seele«, sagt Mutter, wenn sie von seiner Geburt erzählt.
»Was ist das, eine Seele?«, fragte Ernst einmal.
Sie legte ihm die Hand auf die Brust und sagte: »Deine Seele ist da drin, und sie sorgt dafür, dass du mutig und fröhlich und stark und lieb bist. Und wenn du dich fürchtest oder traurig bist und es ganz dunkel um dich herum ist, dann brauchst du nur deine Hand da drauflegen und dann kannst du das Licht spüren, das in dir ist und das niemals ausgeht.«
»Und wenn ich tot bin?«
»Auch dann nicht«, sagte Mutter, »dann fliegt deine Seele in den Himmel.«
Ernst stellt sich seitdem seine Seele vor wie einen großen weißen Ballon, der seine ganze Brust ausfüllt und warm leuchtet wie ein Lagerfeuer.
Vor vier Wochen, nachdem der letzte Schnee geschmolzen war, ist die Familie in Augsburg losgezogen. Christian Lossa beschloss, es sei nun wieder Zeit, auf Reisen zu gehen. Er nahm den großen Koffer und die Taschen und packte sie voll mit Stoffen und Bändern, Knöpfen und Hosenträgern, Zwirn, Schnürsenkeln und vielen anderen Dingen. Als seine Frau das sah, begann sie auch gleich zu packen. Christian war nicht begeistert. »Ob das wohl gut ist in deinem Zustand?«
»Ich halte es in Augsburg nicht mehr aus, ich muss raus aus dieser stinkenden Siedlung, weg von den Fabriken und matschigen Hinterhöfen«, sagte sie, immer wieder von Husten unterbrochen.
»Und was wird mit den Kindern? Du weißt, wie anstrengend es auf Wanderschaft sein kann.«
Vor Aufregung bekam Anna Lossa einen Hustenanfall und ihr Mann musste eine Weile auf die Antwort warten. »Christian«, begann sie. Immer wenn sie zu ihm Christian sagt, weiß er, dass sie es ernst meint. »Christian, mach dir mal keine Sorgen um mich und die Kinder, die haben es auf der Straße besser als in diesem Loch. Meinst du, ich will hier versauern, während du wie ein Lackaffe um die Hausfrauen herumschwänzelst.«
Christian sah ein, dass es besser war, darauf nichts zu sagen. Er zog die Augenbrauen hoch, schnaufte einmal tief durch und packte weiter. Ernst hätte seine Mutter dafür küssen können, dass sie aus der Stadt rauskamen, aber das wäre für seinen Vater wohl zu viel gewesen. Wahrscheinlich hat der Vater nur Ja gesagt, weil sie diesmal nicht mit dem Handkarren losgezogen sind, sondern einen richtigen Wohnwagen mit einem Pferd haben. Wagen und Pferd hat ihnen Tante Betti geliehen.
Von Augsburg ging es zuerst nach Ulm. Und jetzt über die Schwäbische Alb nach Buchau zu Annas Eltern, den Angers. Ulm war schön, weil der Vater ein gutes Geschäft gemacht hat. Er hat hinten auf den Wagen ein stinkendes schwarzes Fass gestellt und sich die Hände gerieben, obwohl es schwer war und stank, und er sich die Hose mit Öl versaut hat. Mutter hatte nur die Augen verdreht, als er mit dem Ding ankam, aber er hat mit der Zunge geschnalzt, als hätte er einen Schweinebraten vor sich. »Feinstes Motoröl - so etwas kriegst du heute fast nicht mehr, was meinst du, wenn wir das literweise in den Dörfern verkaufen, die reißen es uns aus der Hand.«
Mutter hat ihn fragend angeschaut und eine Handbewegung gemacht, die Ernst nicht verstand, Vater aber sehr wohl.
»Wo denkst du hin, Anna, so was mach ich doch nicht, sagen wir mal, es ist ein Geschenk, unter Freunden.«
Da musste sie husten und hielt sich ein Taschentuch vor den Mund. »Ich hoffe nur, dass du recht hast und dass deine … Freunde es sich nicht anders überlegen und wir Ärger bekommen. Und ich hoffe, dass wir den Gestank bald wieder los sind.«
Vater hob die ölverschmierten Hände wie ein Heiliger. »Mensch, Anna, ist doch’n gutes Geschäft. Das bringt Gore.«
Da hat Mutter eingelenkt. Ernst weiß, Gore ist Geld. Und wenn sie genug Gore haben, geht es der Familie gut und die Eltern haben keinen Streit.
In Ulm hatte es keinen Nebel und das ist eine Seltenheit, sagte Vater. Ernst dachte bisher, dass Augsburg die nebligste Stadt der Welt sei. »Aber da kennst du Ulm schlecht«, sagte Vater. »Hier ist im Sommer wie im Winter so dicke Suppe, dass Kinder und alte Leute nicht auf die Straße dürfen, weil sie sich sonst verirren.« Mutter stieß ihm den Ellenbogen in die Seite, aber er war gerade in Fahrt. »Die Leute fallen reihenweise in die Donau, weil man Straße und Fluss nicht mehr unterscheiden kann. Andere gehen freiwillig ins Wasser, weil sie das Grau in Grau nicht mehr aushalten, und werden dann am Schwarzen Meer rausgefischt als aufgedunsene, fette Wasserleiche. Und du wirst nicht erraten, was die da unten aus den ganzen Wasserleichen machen.« Wieder Mutters Ellenbogen. »Seife. Seife machen die.«
»Jetzt ist aber gut«, fuhr ihm Mutter ins Wort.
»Jaja«, sagte er, »doch merke dir, mein Sohn, wenn in Ulm mal die Sonne scheint, ist Feiertag.«
Bevor die Lossas in Buchau bei den Angers ankommen, ist das Stinkfass tatsächlich weg. Die Bauern waren ganz scharf auf das Öl. Wobei Ernst den Gestank gar nicht schlimm fand. Vater jedenfalls ist zufrieden, es gibt genug zu essen, er kauft in einem Krämerladen sogar Lakritzstangen. Ernst und Malchen sind glücklich. Nur Nanna verzieht das Gesicht, wo sie doch bisher nur die Erdklumpen und Steine von den Hinterhöfen kennt. Aber dann schmeckt es ihr auch.
Vater muss das gute Geschäft gleich feiern im Dorfwirtshaus. Als er zurückkommt, schimpft er über den Führer, weil er den fahrenden Leuten Arbeit und Brot wegnimmt, wo er doch allen Arbeit versprochen hat. Er schimpft so lange, bis Mutter wütend wird.
»Wenn du schon unser bisschen Geld im Wirtshaus versäufst, dann halte wenigstens deine Klappe. Du weißt, dass sie überall ihre Spitzel hocken haben. Nicht lange, dann lochen sie dich ein und ich sitze da mit drei Kindern, bald vier. Denkst auch nicht für fünf Pfennige. Die warten doch bloß drauf, dass einer wie du ihnen einen Grund gibt.«
»Was soll das heißen, einer wie ich?« mault er zurück. »Bin ich schlechter als die Gadschi*? Oder sehe ich aus wie ein Jude?«
»Lass die Juden aus dem Spiel«, sagt Mutter. »Es ist nicht richtig, dass alle auf ihnen herumhacken. Du weißt, wie oft wir schon gute Geschäfte mit ihnen gemacht haben.«
Doch Vater ist nicht zu bremsen. »Kann ich was dafür, wenn sie denen die Läden zusperren und die Scheiben einwerfen?«
»Du weißt genau, was ich meine«, sagt Mutter. »Du bist ein Zigeuner*, und du weißt, was das heißt.«
Stille.
Da ist es wieder, das böse Z-Wort. Es taucht in letzter Zeit immer öfter auf. Jeder, der die Lossas nicht leiden kann, benutzt es. Aber dass Mutter es ausspricht, ist selten. Da muss sie sich schon sehr aufregen. Deshalb ist Vater auch stumm und starrt sie an. Sie ist selbst darüber erschrocken. Aber es ist schon heraußen und steht zwischen ihnen, füllt den kleinen Raum unter der Plane fast komplett aus und vergiftet die Luft.
Da sagt Vater, und er sagt es ganz leise: »Ich bin kein Zigeuner und du auch nicht, wir alle nicht. Wir sind Jenische* und ich bin stolz darauf.«
Mutter winkt ab. »Zigeuner, Jenische, Landstreicher, Arbeitsscheue, Asoziale*, das ist doch dasselbe für die.«
Vater drückt den Rücken durch und macht sich ganz groß. »Aber für mich ist es nicht dasselbe. Wir sind Jenische, hörst du, Jenische, und das kann jeder hören und wissen, das ist keine Schande.«
Mutter nickt. »Natürlich ist es keine Schande.« Sie ist jetzt nicht mehr wütend, nur noch traurig. »Aber sie haben uns auf dem Kieker, Christian. Ich kann schon nicht mehr durch die Straßen gehen. Die Leute glotzen mich an, als wäre ich aus Afrika, und ich höre, wie sie tuscheln hinter meinem Rücken.«
Da fällt auch Vaters Wut zusammen und er nimmt Mutter in den Arm und wiegt sie wie ein kleines Kind.
Ernst hat es auch schon gehört. Wenn ihn die Nachbarskinder unten im Hof ärgern wollen, schreien sie es über den Zaun. Das böse Z-Wort. Sogar zu Nanna haben sie es schon gesagt, als sie sich am Zaun festgehalten und rübergeschaut hat. Dabei ist sie bestimmt kein Zigeuner, sie ist noch gar nichts, nur ein kleines Mädchen, das kräht und mit ihren vier Zähnchen lächelt und ihren braunen Haarschopf schüttelt, wenn sie einen Erdklumpen in den Mund steckt. Sogar sie bekommt das böse Z-Wort zu hören.
Am Abend, als sich Anna Lossa zu den Kindern setzt, um eine Geschichte zu erzählen, fragt Ernst: »Was sind denn das, Jenische?«
»Jenisch bedeutet so viel wie gescheit oder schlau«, sagt sie. »Wir haben eine eigene Sprache und die verstehen nur wir, also die Gescheiten. Und wenn wir wollen, dass die Gadschi nicht verstehen, was wir reden, dann sprechen wir Jenisch.«
Die Gadschi, das weiß Ernst, das sind die anderen, die nicht über Land fahren, also die Bauern und die Fabrikarbeiter und alle, die in einem festen Haus wohnen.
Aber wir haben doch auch eine Wohnung, wo wir leben, wenn wir nicht auf Reisen sind, denkt Ernst. Vielleicht sind wir dann auch Gadschi. Er nimmt sich vor, Mutter später danach zu fragen, denn sie fängt gerade an, eine Geschichte zu erzählen.
»Es gibt viele Legenden darüber, wo die Jenischen herstammen, einige sagen, aus Indien oder Ägypten, andere meinen, aus dem Osten oder vom Mittelmeer. Die einen sagen, wir seien ein Stamm der Zigeuner, andere glauben, unsere Vorfahren seien versprengte Gruppen aus dem 30-jährigen Krieg. Aber das ist eine typische Gadschi-Frage. Mein Großvater, also dein Ur-Opa, hat immer gesagt: ›Ich komme von da, wo meine Füße aufgestanden sind, und ich gehe dahin, wo mein Kopf sich niederlegt.‹ Er ist in der Schweiz aufgewachsen, wohin seine Eltern aus Italien geflüchtet sind. Und deren Eltern wieder waren aus Frankreich, wo man sie vertrieben hat. Die Vorfahren deines Vaters kommen aus Italien und einige von ihnen waren weit oben im Norden, andere tief im Osten. Du siehst, sie sind weit herumgekommen. Und sie sind oft verjagt worden. Aber sie sind nicht heimatlos. Denn ihre Heimat ist in ihrem Herzen, in ihrer Familie, in ihrer Sippe. Egal wo sie hingehen, sie finden stets Leute, die dieselbe Sprache sprechen, dieselben Lieder singen, dasselbe Blut in sich tragen. Das ist die Heimat des Herzens, im Gegensatz zur Heimat des Bodens, wie sie die Gadschi haben.«
Sie denkt einen Augenblick nach. Die Mädchen haben sich bereits eingerollt und atmen tief, aber Ernst starrt Mutter mit erwartungsvollen Augen an.
Sie nickt. »Es war einmal vor langer Zeit ein Goldschmied, der hatte eine bezaubernde Frau und 13 Kinder …«
Mutter erzählt die Geschichte von dem Goldschmied, auf den die anderen Handwerker in der Stadt neidisch waren. Sie verbreiteten so lange Lügengeschichten über ihn, bis er vom König verbannt wurde. Also zog er weg. Doch überall, wo er mit seiner Familie hinkam, erging es ihm ähnlich. Die einheimischen Handwerker fürchteten die Konkurrenz und sorgten dafür, dass er verjagt wurde.
»Das ist gemein von ihnen«, sagt Ernst.
»Ja, aber so sind die Menschen. Die Familie des Goldschmieds wurde zu Fahrenden, zu Außenseitern, die von den Sesshaften, den Gadschi, angefeindet wurden. Sie lernten, mit Regen und Kälte, Strapazen und Hunger umzugehen. Sie lernten auch, vorsichtig zu sein. Deshalb dachten sie sich eine eigene Sprache aus, die die anderen nicht verstanden. Auf den Landstraßen und geheimen Rastplätzen trafen sie andere Familien, denen es genauso ging. Sie hielten zusammen und teilten ihr letztes Hemd. Sie tauschten Neuigkeiten aus und lernten voneinander. Der Goldschmied lernte, Kessel und Pfannen zu flicken. Seine Kinder wurden Scherenschleifer, Bürstenmacher, Korbflechter, Wahrsager, Seiltänzer, Bärentreiber, Possenreißer, Musikanten, Gaukler, Puppenspieler und Artisten. Aber auch Nachrichtenüberbringer und Heiratsvermittler oder auch manchmal Bettler.«
»Hatten sie denn keinen Bauchladen?«
»Aber ja. Die Frau des Goldschmieds war nicht nur schön, sondern auch überaus klug. Sie kaufte, wenn sie durch eine Stadt kamen, günstig Waren ein und verkaufte sie unterwegs auf dem Land wieder. Knöpfe, Stoffe, Hosenträger, Schnürsenkel, kleine Taschenspiegel, Kochgeschirr, bunte Bänder, dazu selbst gemachte Ohrringe und Halsschmuck, alles, was du dir nur denken kannst.«
»So wie du und Vater?«
»Ja, genau wie wir. Es waren sehr findige Leute, die sich immer etwas einfallen ließen, damit sie ihr Auskommen hatten. Als die Kinder erwachsen waren, verteilten sie sich über das ganze Land und alle Nachbarländer, ihre Reiserouten reichten von den Wüsten im Süden bis zu den großen Wäldern im Norden, von den Steppen im Osten bis zum großen Ozean im Westen. Und weil sie so weit herumkamen, konnten sie viele Geschichten erzählen, manchmal solche, die sie unterwegs gehört hatten, manchmal selbst erfundene.«
Ernst will Mutter fragen, ob sie diese Geschichte auch selbst erfunden hat. Aber da fallen ihm die Augen zu, und Mutters Stimme begleitet ihn in eine Welt, in der er über weites Land fährt und gefährliche Abenteuer besteht.
2.
Anfang April 1933 trifft die Familie in Buchau am Rande der Schwäbischen Alb ein. Sie treffen nur die Großmutter an, die zur Feier des Tages Pfannkuchen macht mit dick Marmelade drauf. Für Ernst sind es die besten Pfannkuchen der Welt.
Sein Großvater hat auch einen Handelswagen. Vor einigen Jahren ist er nach Buchau gezogen, damit auf den Papieren ein festes Haus steht und die Dorfpolizisten zufrieden sind. Dort wohnt er aber nur ein paar Wochen im Jahr. Jetzt ist er unterwegs, kommt aber jede Woche nach Hause, um neue Waren zu besorgen und den Wagen wieder vollzuladen. Er ist schon über sechzig, und Großmutter sagt, das Geschäft wird ihnen langsam zu mühsam.
Die Großeltern sind verschieden wie Tag und Nacht. Opa groß mit stolzer Nase und silberblonden Haaren, Oma klein und rund, dasselbe Näschen wie Mutter, nur fleischiger, und rabenschwarzes Haar, das sie zu einem Dutt gebunden hat. Die Angers sind eine riesige Familie. Ernsts Mutter hat zwölf Geschwister. Ein paar der vielen Onkel und Tanten lernt Ernst kennen, als am 4. April Nannas erster Geburtstag gefeiert wird.
Oma hat ein mächtiges Essen gekocht. Die Stube ist vollgestopft mit Leuten, die alle durcheinanderreden und lachen. Im Hof hinter dem Haus rennt ein Dutzend Kinder herum, dafür drei Hühner weniger, die jetzt gebraten auf dem Tisch stehen. Dazu gibt es große Schüsseln dampfender Kartoffeln und Opa gießt aus einer riesigen Bauchflasche Wein in die Gläser.
Vater fragt ihn, wo er den Wein herhat, und Opa flüstert ihm etwas ins Ohr. Vater grinst mit der linken Gesichtshälfte, was er gern tut, wenn er etwas gut findet.
»Bist schon ein Hund, Bastl.«
Opa lehnt sich stolz zurück und nimmt einen gewaltigen Schluck Wein. »Von mir kannst du noch was lernen, Christian.«
Später gibt es Kaffee und die Männer schütten aus einer kleinen Flasche Schnaps dazu. Ernst wundert sich, dass sie ihren Kaffee verdünnen müssen, während die Frauen das schwarze Zeug pur trinken oder mit Milch. Oma tischt blechweise Streuselkuchen auf, den die Kinder gierig in sich reinstopfen.
»Sind das alles Jenische?«, fragt Ernst seine Mutter. Sie verschluckt sich, hält die Hand vor den Mund, und durch die Finger spritzt der Kaffee.
Onkel Walter, der neben ihr sitzt, hat es auch gehört. Er haut ihr mit der Hand kräftig auf den Rücken und tönt lauthals los. »Du bist richtig, mein Junge. Habt ihr das gehört? Ob wir Jenische sind, will er wissen. Aber natürlich! Die ganze Sippe hier, alles waschechte Jenische, das kannst du mir glauben. Alles Lumpensammler, Zuchthausmusiker, Arbeitsfaule, Herumstreuner und Tagediebe.«
Alle fallen in sein donnerndes Lachen ein. Mutter, die den Kaffee endlich runtergewürgt hat, prustet los und zugleich stupst sie Onkel Walter mit ihrem Ellenbogen.
»Hör auf, machst den armen Jungen noch ganz schalu*«, sagt Oma, aber sie muss selber grinsen und die Falten um ihre Augen knittern sich zu zwei halben Sonnen zusammen. »Lass dir nix erzählen, Ernst, der Walter ist ein bissl verrückt.«
»Und wir machen dazu noch eigenen Honig, das findest du selten«, sagt Walter. »So eine Sippe wie uns findest du nirgends sonst. Wenn bei uns gefeiert wird, bleibt kein Auge trocken.« Er nimmt einen Schluck Wein. »So wie damals,’28 im Sommer, wo die Anna den Christian kennengelernt hat. Komm, erzähl, Mutter.«
Großmutter zwinkert Anna zu, als sie erzählt. »Anna war noch nicht ganz neunzehn und Christian nicht viel älter.«
»Zweiundzwanzig«, sagt Vater und seine linke Gesichtshälfte grinst.
»Es war ein großes Fest der Fahrenden, mit Tanz und Musik, da haben sie zum ersten Mal zusammen getanzt«, röhrt Walter. »Der Kerl hat ihr sofort gefallen, so elegant wie er angezogen war und wie er tanzen konnte. Da war mein Schwesterlein ganz weg und hat die Augen verdreht.« Wieder der Ellenbogen, aber Onkel Walter lässt sich nicht bremsen. »Dann haben sie festgestellt, dass sie beide gut Quetsche spielen können, und haben miteinander musiziert den halben Abend lang, richtig um die Wette haben sie gespielt.«
»Na, und wer hat gewonnen?«, fragt Mutter schnippisch.
Walter zwinkert Ernst zu. »Deine Mutter war schon immer eine freche Tschaij*, hat sich nichts bieten lassen, war nicht auf den Mund gefallen, hat sich geschlagen wie ein Junge. Was, Anna?«
Mutter protestiert und wieder reden alle durcheinander. Ernst kriegt nur so viel mit, dass Mutter mit ihren Funkelaugen und dem kleinen Näschen und den kurzen schwarzen Haaren Vater den Kopf verdreht hat. In dem Zustand ist er weitergezogen.
Ernst versucht sich vorzustellen, wie man mit verdrehtem Kopf einen Wagen lenken und Sachen verkaufen kann. Jedenfalls hat Christian zu Annas neunzehntem Geburtstag ein Kleid geschickt und ein Vierteljahr später ist er nach Buchau gekommen.
»Zufällig«, ruft Vater und grinst schief.
Alle prusten. Jemand ruft: »Jaja, weil es gerade auf dem Weg lag. Dabei war gar keine Reisezeit Anfang Februar.« Aber es war Fasching, und Oma erzählt, dass sie einen großen Faschingsball mit Musik und Verkleidung organisiert haben.
Mutter fährt Ernst über den Kopf. »Und du bist das Ergebnis.« Sie funkelt ihn stolz an und hat so ein wissendes Lächeln, mit dem er nichts anfangen kann.
Am 1. März haben sie geheiratet. Und genau acht Monate nach der Hochzeit war Ernst da.
»War das ein schmissiges Fest!«, ruft Walter und strahlt.
Omas Faltenkranz leuchtet wieder. »Wie willst du das denn wissen, Walter? Du warst doch viel zu betrunken.«
Wieder brüllen alle vor Lachen und erzählen, wie Walter mit dem Wirt erst gestritten, aber dann Bruderschaft getrunken hat, bis beide unter dem Tisch lagen.
Walter grinst bis zu den Ohren. »Ich sag doch, ein schmissiges Fest.«
Die Familie bleibt zwei Wochen bei den Angers. Vater ist mit Opa unterwegs und Ernst darf mit den Großen herumtoben.
Mutter liegt fast die meiste Zeit auf dem Sofa. Sie hat Fieber und hüstelt vor sich hin, wie sie es schon seit dem Winter macht. Ab und zu kommt ein starker Hustenanfall, dann spuckt sie Blut in den Eimer, den Oma neben das Sofa gestellt hat. Oma gibt ihr selbst gebrauten Tee und Ziegenmilch, die scheußlich riecht. Auch hat sie ein weißes Pulver im Haus. Mutter würgt, wenn sie es einnimmt, und sieht aus, als würde sie jeden Moment speien, aber Oma ist unerbittlich. Wenn die Sonne scheint, sitzt Mutter auf der Bank vor dem Haus, weil ihr die Luft guttut. Oma ist eine Kräuterhexe und hat schon viele Menschen gesund gemacht. Doch sie macht sich Sorgen, ob es nicht doch besser wäre, einen Doktor zu holen.
Aber Mutter will nicht. »Das können wir uns nicht leisten. Und ich habe noch nie einen Doktor gebraucht, stimmt’s?«
Oma nickt und lächelt, aber ohne Strahlenkranz um die Augen. Sie schaut Vater an, er soll doch was sagen, aber der zuckt nur mit den Schultern.
Oma meint, es wäre am besten, wenn die Familie wenigstens so lange in Buchau bleibt, bis das Kind da ist. Doch Vater will, dass das Kind in Augsburg auf die Welt kommt, sonst gibt es nur Ärger mit den Ämtern. »Weißt doch, wie die jetzt sind.«
Oma nickt. »Hast schon recht, es wird immer schlimmer.«
Vater zieht an seiner Zigarette. »Wo du hinkommst, behandeln sie dich wie einen Verbrecher. Wenn das so weitergeht, wandern wir besser aus. Ich kenne einen, der geht jetzt nach Amerika.«
Mutter schaut nur zur Decke und Oma seufzt. »Dazu brauchst du Gore, Christian, einen ganzen Haufen Gore.«
»Wart’s nur ab«, sagt Vater, »ich hab Verbindungen und ich komme schon zu Gore.«
»Wo ist das, Amerika?«, fragt Ernst.
Vater erklärt ihm, dass es ein riesiges Land ist, ganz weit weg über dem Meer, ein Land, in dem viel Platz ist und wo die Leute reich sind und große Häuser und Autos haben. Dort könnten sie an einem Tag so viel verkaufen wie hier in einem Monat und hätten selbst ein Auto und jeden Tag Fleisch auf dem Teller.
Ernst hätte schon Lust auf Amerika, aber noch lieber würde er hierbleiben. Und er glaubt, auch Mutter hätte nichts dagegen. Aber sie widerspricht nicht, sondern packt die Sachen ein. Am nächsten Morgen ist Abreise, und sie ist ganz still und traurig, als sie sich verabschieden.
Ernst schaut hinten aus der Plane und denkt an Amerika mit seinen Autos und Häusern und reichen Leuten und jeden Tag Fleisch. Er sieht, wie das Haus davonfährt, wie Oma davonfährt, Buchau mit dem See, Wald und Wiesen. Er kann sehen, wie die Welt hinter ihm davonfährt, aber immer wieder kommt neue Welt nach, neue Felder, neue Wiesen, neue Bäume, neue Dörfer.
Die Dörfer sind schon zu riechen, lange bevor sie da sind. Holzfeuer, Kuhstall, Schweinemist, Heu, Mittagessen, Wirtshaus, Tabakrauch, Bauernschweiß, Brot, Wäsche. Wenn sie in ein Dorf kommen, nimmt Vater den Koffer und die große Tasche mit den Bändern und Stoffresten, den Schnürsenkeln und Knöpfen und noch vielen anderen nützlichen Dingen und geht von Haus zu Haus. Er kennt die Dörfer und weiß meistens schon vorher, ob er etwas verkaufen wird oder nicht.
Wenn Mutter ihn begleitet, ist das gut fürs Geschäft. Ihr dicker Bauch hat es den Bäuerinnen angetan, und sie sind viel freundlicher und überlegen, ob sie noch Stoff für eine Tischdecke brauchen könnten. Vater, der was versteht von Bäuerinnen und vom Verkaufen, sagt: »Dein Bauch zieht besser als mein Bauchladen.« Anfangs hat er der Mutter Stoffreste unters Kleid gestopft, um sie noch runder und die Bäuerinnen noch warmherziger zu machen. Das ist jetzt
1
Die Personen im Text werden, wo immer es möglich ist, mit ihren wirklichen Namen genannt. Ausnahmen sind: 1. Menschen, die aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht genannt werden. 2. Personen, die historisch nicht klar recherchierbar waren. Diese Namen sind geändert und bei der ersten Nennung kursiv gesetzt.
2
Mit einem Sternchen gekennzeichnete Wörter sind am Ende des Buches kurz erklärt.
cbt - C. Bertelsmann Taschenbuch Der Taschenbuchverlag für Jugendliche Verlagsgruppe Random House
Verlagsgruppe Random House
1. Auflage Originalausgabe April 2008
Gesetzt nach den Regeln der Rechtschreibreform © 2008 cbt/cbj Verlag, München
Mit einem Vorwort von Dr. Michael von Cranach Lektorat: Frank Griesheimer Umschlagfoto: Archiv Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren Umschlagkonzeption: init.büro für Gestaltung, Bielefeld st · Herstellung: CZ
eISBN : 978-3-894-80485-5
www.cbj-verlag.de
Leseprobe
www.randomhouse.de
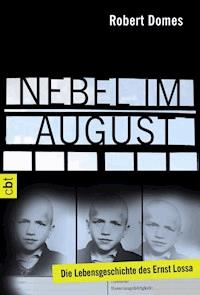
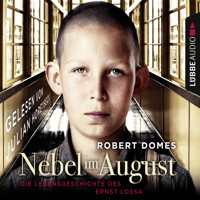
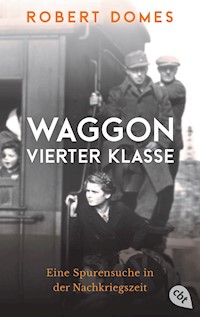
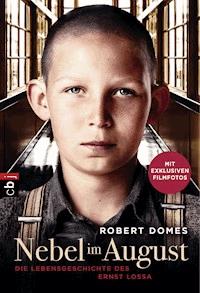













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












