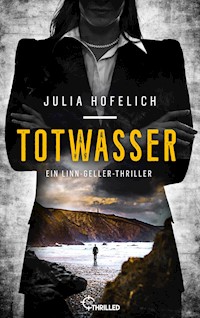4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Linn Geller
- Sprache: Deutsch
Ein abgelegenes Dorf, eine ermordete Frau und ein schrecklicher Verdacht
In einem kleinen Dorf auf der schwäbischen Alb wird die betagte Ines Schneider ermordet. Hauptverdächtiger: ihr Pflegesohn Jo Haug. Jo ist vorbestraft, außerdem geistern seit Jahren Gerüchte durchs Dorf, dass er auch seine vor vielen Jahren verschwundene Jugendfreundin Vanessa getötet haben soll. Jos Verteidigerin Linn Geller hält jedoch nichts von solchen Gerüchten und begibt sich allein auf Spurensuche. Ihre Ermittlungen rütteln an gefährlichen Geheimnissen, die die eingeschworene Dorfgemeinschaft lieber auf ewig in Schweigen gehüllt hätte ...
Ein packender Thriller mit einer toughen Ermittlerin - für alle Fans von Lucy Foley, Marcus Hünnebeck und Ruth Ware.
Weitere Fälle für Linn Geller:
TOTWASSER
BLUTNARBE
Stimmen unserer Leserinnen und Leser:
»Ein Buch, das bis zur letzten Seite voller Spannung ist.« (SCHLOSSHERRIN, Lesejury)
»Nebeljagd [überzeugt] durch einen unwahrscheinlich spannenden Fall und eine sympathische Protagonistin ohne Allüren« (SCHNAEPPCHENJAEGERIN, Lesejury)
»Ganz großes Kino. Eine wirklich spannende Suche nach den wahren Tathergängen mit einem absolut glaubwürdigen Ende.« (DANIELAAK82, Lesejury)
»Nebeljagd ist keinen Moment langweilig und hat mir einige spannende Lesestunden beschert, mein Fazit: unbedingt lesenswert!« (CHUCKIPOP, Lesejury)
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverWeitere Titel der AutorinÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumProlog12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243Weitere Titel der Autorin
Totwasser
Über dieses Buch
Ein abgelegenes Dorf, eine ermordete Frau und ein schrecklicher Verdacht
In einem kleinen Dorf auf der schwäbischen Alb wird die betagte Ines Schneider ermordet. Hauptverdächtiger: ihr Pflegesohn Jo Haug. Jo ist vorbestraft, außerdem geistern seit Jahren Gerüchte durchs Dorf, dass Haug auch seine vor vielen Jahren verschwundene Jugendfreundin Vanessa getötet haben soll. Jos Verteidigerin Linn Geller hält jedoch nichts von solchen Gerüchten und beginnt, auf eigene Faust zu recherchieren. Ihre Ermittlungen rütteln an gefährlichen Geheimnissen, die die eingeschworene Dorfgemeinschaft lieber auf ewig in Schweigen gehüllt hätte …
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.
Über die Autorin
Julia Hofelich studierte zunächst Germanistik und Komparatistik, bevor sie zu Jura wechselte. Nach ihrem Referendariat arbeitete sie als Rechtsanwältin und absolvierte ein Fernstudium zur Drehbuchautorin. Für ihre Kurzgeschichte Opfer wurde sie für den renommierten GLAUSER nominiert. Julia Hofelich ist verheiratet und hat zwei Kinder.
JULIA HOFELICH
NEBELJAGD
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2019/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven © Shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-1668-0
be-ebooks.de
lesejury.de
Prolog
Die Toten konnten nicht zurückkommen. Das, was dort über dem Tal aufstieg, war nur Nebel. Der Pfarrer hatte ihr das erklärt. Die Toten waren nämlich sehr glücklich da, wo sie waren. Jeder gute Christ wollte eines Tages nach Hause zurückkehren, zum Herrn. Die Frau erschauderte und lief ein bisschen schneller. Unter ihren Schritten raschelten die letzten braunen Blätter, die den Weg bedeckten. Vertrocknete Disteln reckten gespenstisch ihre stacheligen Köpfe in den düsteren Himmel. Die Toten konnten nicht zurückkommen. Mit zitternden Händen zog die Frau ihre Jacke enger um sich. Sie hätte gerne geglaubt, was der Pfarrer gesagt hatte. Vielleicht stimmte es ja auch für die Toten, die nach einem erfüllten Leben friedlich in ihren Betten einschliefen. Aber für jemanden wie Momo stimmte es nicht. Momo war nicht friedlich in seinem Bett eingeschlafen, und er hatte garantiert nicht heimgewollt zum Herrn. Er hatte sich gewehrt. Ein dumpfes, verzweifeltes Geräusch. Ihr Atem beschleunigte sich, wie eine Erstickende sog sie die Luft ein, die nach vergorenen Äpfeln und Rauch roch. Sie musste sich beeilen. Die Dämmerung wich unaufhaltsam der Nacht, und der Nebel wurde immer dichter, hinten beim Heitzhof verschluckte er schon den Weg. Noch verbargen sich die Schattenhände und Fratzen der verlorenen Seelen in dem undurchdringlichen Dunst. Aber bald würden sie hervorkriechen. Mit lautem Krächzen stob ein Rabe auf, und die Frau zuckte zusammen. Einen Moment lang war sie abgelenkt. Als sie wieder nach vorne sah, hatte der feuchte Unterweltnebel sie erreicht. Er hüllte sie rasend schnell ein, war überall, schien auf ihre Brust und ihr Gesicht zu drücken. Wie ein tonnenschweres Kissen. Sie keuchte und stolperte noch ein paar Schritte, bevor sie auf die Knie sank. Wenn die Toten zurückkamen, dann im Herbst. Dann waren die Grenzen zum Jenseits durchlässig. Etwas Feuchtes berührte sie, und ein Wimmern entrang sich ihrer Kehle. Er war da. Vor Angst bebend blickte sie in Momos blasses, fast durchscheinendes Gesicht. Seine toten Augen starrten sie anklagend an. »Du bist ein böser Mensch«, sagten die Augen. »Ich werde kommen und dich holen. Bald schon.«
1 Draußen wurde es langsam dämmrig, und es hatte angefangen zu schneien. Dicke Flocken schwebten auf die Straße vor der Kanzlei. Rechtsanwältin Linn Geller beendete das Telefonat mit einer Mandantin und sah auf die Uhr am Bildschirmrand ihres Laptops. Es war kurz vor fünf. Heute würde sie endlich einmal früher Feierabend machen. Sie würde in die Innenstadt fahren, ein wenig über den Weihnachtsmarkt schlendern, ein Nikolausgeschenkchen für ihren Kanzleipartner Götz kaufen und eine dieser köstlichen Zimtwaffeln essen, die es an einem der Stände zu kaufen gab. Und danach würde sie sich mit einem Krimi und einer Tasse Tee auf ihr Sofa setzen. Der perfekte Abend, von dem sie seit Tagen träumte. Sie hängte mehrere Akten zurück in den Aktenschrank hinter ihrem Schreibtisch, fuhr den Computer herunter und brachte ihre leere Kaffeetasse in die kleine Küche. Während sie die Tasse und die Kanne ausspülte und abtrocknete, betrachtete sie die beiden Schnappschüsse, die seit gestern an einem der weißen Hängeschränke klebten und die Götz und sie beim Renovieren ihrer Kanzlei zeigten. Götz, in einem schreiend bunten Hemd, das über seinem Bauch spannte, grinste freundlich von einer Leiter. Sie selbst stand mit zwei Pinseln vor einer frisch gestrichenen Wand und lachte. Sie trug einen Malerkittel, der über ihrer schlanken Figur schlabberte, und hielt ihre Hände ins Bild, die so voller Farbspritzer waren, dass man kaum noch ihre hellbraune Haut erkennen konnte. Auch ihre schwarzen Haare hatten einiges abbekommen. Sie berührte das Bild mit dem Zeigefinger und zwang sich zu einem Lächeln. Es war eindeutig ein Fortschritt. Noch vor einem Jahr wäre es undenkbar gewesen. Niemand hätte Fotos von ihr machen oder gar aufhängen dürfen. Und auch jetzt noch, obwohl sie auf dem Bild den Kopf leicht drehte und man die Narbe auf ihrer rechten Wange kaum und ihr kaputtes, leicht zur Seite abstehendes Bein in der weiten Hose überhaupt nicht erkennen konnte, verspürte sie einen winzigen Stich im Bauch. Musste für eine Sekunde an den Unfall denken. Als ihr ganzes Leben zusammengestürzt war wie eine baufällige Mauer. Sie wandte sich ab, stellte die Tasse zurück in den Schrank und humpelte zur Garderobe. Sie würde sich bestimmt nicht die Weihnachtsmarktstimmung verderben lassen. Sie tauschte ihre eleganten Schuhe gegen die warmen Stiefeletten, mit denen sie am Morgen in die Kanzlei gekommen war und die ebenfalls gut zu ihrem schwarzen Hosenanzug passten. Als sie gerade ihren Mantel anzog, hörte sie schwere Schritte auf der Treppe vor dem Kanzleieingang, kurz darauf öffnete sich die Tür.
»Linn? Zum Glück erwische ich dich noch.« Ihr Kanzleipartner Götz kam mit rotgefrorenem Gesicht und außer Atem herein, in der Hand eine Akte, die er ihr entgegenstreckte. »Das haben die mir gerade bei der Staatsanwaltschaft für dich mitgegeben. Du hast wieder die Pflichtverteidigung in einer Mordsache bekommen?«
Sie runzelte die Stirn und nahm die Akte. »Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wovon du redest. Was für ein Mord soll das sein? Die einzigen Strafrechtsfälle, die ich im Moment bearbeite, sind eine kleine Drogendealerin und …« Sie schlug die Akte auf. Johann Haug. Es dauerte eine Sekunde, bis sie den Namen des Beschuldigten einordnen konnte, ein Mann, der vor ein paar Tagen bei ihr angerufen und um einen Termin gebeten hatte. Er hatte aufgeregt von einer Diabetikerin im Unterzucker erzählt. Das Ganze hatte sich am Telefon wenn überhaupt nach unterlassener Hilfeleistung angehört. Da Haug zu dem Beratungstermin am nächsten Tag nicht erschienen war, hatte sie die Sache eigentlich schon abgehakt gehabt.
»Sie haben deinen Mandanten heute Mittag verhaftet, weil er seine ehemalige Pflegemutter ermordet haben soll. Die Polizei will ihn jetzt vernehmen. Hier«, Götz gab ihr ein Post-it und strich sich durch seine kurzgeschnittenen, graumelierten Haare, »habe ich dir die Adresse aufgeschrieben, Polizeirevier Ochsenwang. Ein Polizeioberkommissar Rösch. Ich habe da sofort angerufen und darauf bestanden, dass sie mit der Vernehmung warten, bis du da bist. Ich hoffe, das war in deinem Sinne? Wenn du jetzt einen anderen Termin hast, könnte ich für dich hingehen.«
»Nein, nein, danke, ich habe Zeit, ich wollte nur auf den Weihnachtsmarkt.« Sie zog die Augenbrauen hoch. »Wenn du nicht zufällig bei der Staatsanwaltschaft gewesen wärst, hätten die diesen Haug bestimmt ohne Anwalt vernommen, was meinst du?«
»Es ist immer einfacher, ohne einen Verteidiger ein Geständnis zu bekommen.« Götz’ Stimme klang resigniert. »Ich rege mich über so was seit Jahren nicht mehr auf. Doch, ich rege mich auf, aber ich habe kapiert, dass ich wenig machen kann. Egal. Jetzt wissen wir ja alles. Soll ich dich hinfahren? Mit den Öffentlichen bist du ewig unterwegs. Sofern du heute überhaupt noch hinkommst.« Er lächelte sie an.
Sie berührte ihn an der Schulter. »Das kann ich fast nicht annehmen.«
»Ich mache es gerne. Eine gute Ausrede, um dem inneren Schweinehund nachzugeben und bei dem eisigen Wetter nicht mehr zum Fußballtraining zu gehen.«
Sie nickte dankbar und mit einem schlechten Gewissen Götz gegenüber. Hoffentlich konnte sie sich bald wieder ein eigenes Auto leisten. Ihr Kanzleipartner hielt ihr die Tür auf. Mit leisem Bedauern dachte sie an die Zimtwaffel und den in weite Ferne gerückten Feierabend und steckte sich vor dem Hinausgehen noch zwei von Götz selbstgebackenen Mini-Lebkuchen in den Mund, die er dort auf einem Teller für wartende Mandanten hingestellt hatte.
Der Berufsverkehr verstopfte die zu engen Stuttgarter Straßen. Selbst Götz, den Linn als ausgesprochen friedliebend kannte, schlug mehrfach mit der Faust aufs Lenkrad und knurrte Verwünschungen. Auf dem Beifahrersitz seines Autos, die Füße zwischen ein Sixpack Bier und ihre Tasche gequetscht, angepustet vom Luftstrom der verbrannt riechenden Heizung, ging Linn mit ihrer Handytaschenlampe die neue Akte durch. Ihr Blick blieb an einem der Tatortfotos hängen, und der letzte Rest ihrer Vorweihnachtsstimmung verschwand. Die Abbildung zeigte eine tote alte Frau, die auf einem zerwühlten Doppelbett lag. Ihr Mund schien vor Entsetzen aufgerissen. Die Augen starrten leer an die Decke, der bleiche Körper war seltsam verdreht, die Hände mit den bläulich angelaufenen Nägeln krallten sich an etwas fest, das wie eine Stoffkatze aussah. Der Rock der Toten war, vielleicht im Todeskampf, hochgerutscht und gab den Blick auf mit Krampfadern durchzogene Beine und abgetragene Unterwäsche frei. Am Boden vor dem Bett sah man einen Brandfleck, auf dem die Reste eines verkohlten Adventskranzes lagen. Das Feuer war zum Bett hochgezüngelt, hatte einen Teil des Kissens und die Haare und Kopfhaut der Toten versengt.
Die Frau wirkte so einsam, verletzlich und gequält, dass Linns Kehle vor Mitleid ganz eng wurde. Auch Götz, der an einer roten Ampel zu ihr hinüberschaute, schien der Anblick ziemlich mitzunehmen. Mit einer hilflosen Bewegung fuhr er sich mehrfach über die Haare.
»Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass mein Mandant seiner Pflegemutter eine Überdosis Insulin gespritzt und dann abgewartet hat, bis sie gestorben ist«, sagte Linn. »Ines Schneider, so heißt die Pflegemutter, muss sich verzweifelt gewehrt haben, es gab entsprechende Kampfspuren im Schlafzimmer. Als das Insulin seine Wirkung entfaltet hatte, bekam sie Krampfanfälle und Bewusstseinsstörungen, bis sie schließlich ins Koma gefallen und gestorben ist. Mein Mandant soll bis zu ihrem Tod im Zimmer geblieben sein und aufgepasst haben, dass sie nicht den Notarzt oder ihren Mann anruft. Am Ende soll er den Adventskranz angezündet und hinuntergestoßen haben, vermutlich, um das Haus abzubrennen und seine Spuren zu verwischen. Aber das Feuer ging von selbst aus. Er hat dann noch den Hochzeitsschmuck und Geld geklaut.« Angespannt stieß sie Luft durch die Lippen. »Den Insulinpen, also dieses Gerät, mit dem sich das Opfer das Insulin normalerweise gespritzt hat, haben sie vollständig entleert bei ihm zu Hause gefunden. Die Staatsanwaltschaft hält meinen Mandanten für einen Mörder, der heimtückisch und aus Habgier gemordet hat.« Linn starrte die furchtbaren Fotos an, die vor ihr lagen. Schließlich klappte sie die Akte zu und schaltete die Taschenlampe aus. »Haug hingegen hat mir am Telefon erzählt, dass es seiner Pflegemutter gut gegangen sei, als er ihr Haus verlassen habe. Er hat behauptet, er sei unschuldig und die Polizei wolle ihm etwas anhängen.«
»Hat er auch gesagt, warum die Polizei so was tun sollte?«
»Er meinte, ganz Ochsenwang würde schon seit Jahrzehnten eine Art Hexenjagd gegen ihn veranstalten, auch die Polizei. Mehr wollte er nicht dazu sagen.«
»Das ist immerhin eine Erklärung, die ich noch von keinem meiner Mandanten gehört habe«, bemerkte Götz.
Eine Zeitlang schwiegen sie beide, während das Auto durch das Schneetreiben kroch. Das Flockengestöber war mittlerweile so dicht, dass man die roten Bremslichter der Fahrzeuge vor ihnen nur noch durch einen Vorhang wahrnahm. Die Scheibenwischer quietschten auf Hochtouren.
»Dieses Dorf ist weit oben auf der Alb«, sagte Götz, als sie endlich die Autobahn erreichten, auf der ebenfalls Schrittgeschwindigkeit gefahren wurde. »Hoffentlich kommen wir da bei dem Wetter überhaupt hin. Ich habe zwar Winterreifen, aber …«
»Und hoffentlich kommen wir nachher wieder zurück«, fügte sie hinzu.
Götz sah sie von der Seite her an und grinste, und für eine Sekunde hatte sie das Gefühl, dass er die Vorstellung gar nicht schlecht fand, mit ihr irgendwo in einem Kaff auf der schwäbischen Alb vom Schnee eingeschlossen zu sein. Das verunsicherte sie ein wenig, und sie wandte den Kopf ab und schaute aus dem Fenster.
Es dauerte fast drei Stunden statt eigentlich vierzig Minuten, bis sie bei der Polizeidienststelle ankamen. Immerhin hatte Linn die ganze Akte durchgelesen. Es war mittlerweile stockdunkel, nur zwei fahle Straßenlaternen beleuchteten den kleinen Parkplatz, auf dem Götz das Auto abstellte. Ihr Magen knurrte. Der Schneefall hatte zum Glück nachgelassen, aber als sie ausstiegen, wehte ein eisiger Wind. Die Luft war so kalt, dass sie in der Kehle brannte.
Sie warteten eine halbe Stunde am Empfangsschalter, bis Polizeioberkommisar Rösch sie abholte. Er war ein stämmiger Mann um die sechzig, der ein dünnes Lederband um den Hals trug und bei der Begrüßung keinen Hehl daraus machte, dass er nichts von Anwälten hielt, die die Arbeit der Ermittlungsbehörden nur »behinderten«, und von Anwältinnen erst recht nichts.
»Clever, dass Sie einen männlichen Kollegen als Verstärkung mitgebracht haben«, sagte Rösch zu Linn, als sie endlich nebeneinander einen schmalen Flur entlanggingen. Er starrte unentwegt auf die Narbe in ihrem Gesicht. »Sie sehen noch so jung aus. Haben Sie überhaupt schon ausreichend Erfahrung für so einen Fall?«
Sie begnügte sich damit, den Mann böse anzuschauen, während Götz »Sie ist seit Jahren Anwältin und die beste, die ich kenne« knurrte.
Rösch lachte herzhaft. »Soso, ja dann«, sagte er schließlich in einem Tonfall, als glaube er Götz kein Wort. »Wie auch immer. Hier brauchen Sie nicht viel zu können. Hier ist ein schnelles Geständnis angesagt. Dahingehend habe ich Ihren Mandanten schon beraten.« Er blieb vor einer Tür stehen.
»Sie haben meinen Mandanten überhaupt nicht zu beraten«, erwiderte Linn scharf. »Wurde er ordnungsgemäß über seine Rechte belehrt? Warum haben Sie mich nicht sofort informiert, als Sie ihn verhaftet haben?«
»Rechte, Rechte, ich höre immer nur Rechte. Was ist denn mit den Opfern? Denken Sie auch mal an die?« Der Polizist machte eine wegwerfende Handbewegung. »Aber um Ihre Frage zu beantworten, ja, natürlich, wir haben ihn so oft belehrt, dass ihm die Belehrungen aus den Ohren rauskommen müssten. Vom ersten Moment an, als wir diesen Gestörten aus seinem Versteck in einer Höhle gezerrt haben, wo er in zwei Daunenschlafsäcke gewickelt gesessen hat. Ich finde, man sollte viel weniger belehren. Damit nicht jeder Kriminelle weiß, was er darf und was nicht.«
»Ich muss gestehen, Ihre persönliche Meinung interessiert mich nicht«, entgegnete sie. »Ich wollte nur wissen, ob die Rechte meines Mandanten …«
»Ihr Mandant hat eine Frau umgebracht«, schnappte Rösch.
»Sie meinen, Sie beschuldigen ihn, eine Frau umgebracht zu haben.«
»Nein, ich meine, er hat sie umgebracht. Und er tut sowas auch nicht zum ersten Mal.«
»Was wollen Sie damit andeuten? Er wurde bisher noch nie wegen eines Tötungsdelikts verurteilt, ich habe gerade sein Vorstrafenregister gelesen.«
»Nichts, gar nichts will ich damit andeuten. Aber Sie können Ihren Mandanten ja mal fragen, warum jedes Mal, wenn er nach Ochsenwang kommt, jemand stirbt.«
»Wie soll ich das verstehen?«
Der Polizist lächelte sie an, es war kein freundliches Lächeln. »Ich sag Ihnen jetzt mal was, ganz im Vertrauen. Ich lebe seit dreiundsechzig Jahren hier. Wir verhaften Johann nicht das erste Mal. Der war schon als Kind nicht normal. Kam aus einer völlig verkorksten Familie. Ines hat ihn bei sich aufgenommen und versucht, ihm zu helfen. Aber der hatte nur Dreck im Hirn. Und jetzt dankt er es Ines so. Indem er sie zu Tode spritzt und genüsslich dabei zuschaut. So einer gehört eigentlich auf den elektrischen Stuhl.«
»Zum Glück haben Sie das nicht zu entscheiden«, sagte Götz.
Rösch bedachte ihn mit einem kalten Blick und wandte sich wieder Linn zu. »Wenn Sie sich hier ein bisschen umhören, bei den Alteingesessenen, werden Sie ganz schnell feststellen, dass ich nicht der Einzige bin, der so denkt«, sagte er. »Johann hat Tod und Unglück über das Dorf gebracht. Wie können Sie den guten Gewissens verteidigen? Wenn ich nur daran denke, was er Christian damals angetan hat, das war mehr, als ein Mensch …«
»Hey, guten Abend, sind Sie die Anwältin aus Stuttgart?« Ein jüngerer, freundlich aussehender Polizist kam hinter einer Biegung des Flurs hervor und streckte ihr die Hand entgegen. Sie schüttelte sie. »Linn Geller, und das ist mein Kollege Götz Nowak.«
»Markus Grabe. Götz kenne ich von diversen Gerichtsverhandlungen«, antwortete der junge Polizist, und Götz und er gaben sich ebenfalls die Hand. »Ist das die Anwältin, mit der du dich vor Kurzem selbständig gemacht hast?« Er machte eine Kopfbewegung in Linns Richtung, und Götz nickte.
»Habt ihr nicht neulich dieses Topmodel vertreten? Ich meine, ich habe da was im Fernsehen über eure Kanzlei gesehen.« Grabe grinste und deutete Linn gegenüber eine Verbeugung an. »Dann wollen wir euch Prominenz mal nicht länger warten lassen und anfangen.«
»Ich würde gerne vorher alleine mit meinem Mandanten sprechen«, sagte sie.
»Selbstverständlich, das dachte ich mir schon.« Grabe schloss die Tür auf, vor der sie standen. Bevor er die Klinke herunterdrückte, bemerkte er leise: »Es ist sicher alles richtig, was mein Kollege Rösch da über Johann Haug sagt. Aber ganz ehrlich: Von den meisten ›Alteingesessenen‹ im Dorf wurde Johann Haug immer wie Abfall behandelt. Und seine Pflegemutter hat nichts dagegen unternommen. Sie hat lächelnd zugeschaut, als sie ihn damals aus dem Dorf geprügelt haben. Er ist fast dabei gestorben. Es wundert mich, dass Ihr Mandant überhaupt noch einmal hierher zurückgekommen ist.«
»Er wollte Ines umbringen, deshalb war er hier«, schnaubte Rösch im Hintergrund.
Grabe öffnete mit ungerührter Miene die Tür und bedeutete Linn mit einer Handbewegung einzutreten.
2 Johann Haug saß zusammengekrümmt auf seinem Stuhl. Sein rechtes Knie wippte ständig auf und ab. Linn schätzte ihn etwa zehn Jahre älter als sich, ungefähr Mitte vierzig. Sein stämmiger Körper steckte in einem grünen Trainingsanzug. Er hatte einen Dreitagebart und kurze blonde Haare, die struppig vom Kopf abstanden. Ein erleichtertes Lächeln überzog sein Gesicht, als sie ihm die Hand gab und sich mühsam zu ihm an den Tisch setzte. Er schaute keine Sekunde auf die Narbe auf ihrer Wange oder ihr verkrümmtes Bein.
»Es tut mir leid, dass es so spät geworden ist, aber der Schnee …«, setzte sie an.
»Ich war’s nicht. Bitte, das müssen Sie mir glauben. Ich habe Ines nichts getan«, unterbrach er sie, noch bevor Grabe das Zimmer verlassen hatte. Sein Atem roch nach Bier und altem Zigarettenrauch. »Aber die werden das alle behaupten. Das ganze Scheißdorf wird das behaupten. Sobald da jemand stirbt, bin ich schuld. Das war schon immer so. Wissen Sie, manchmal wünsche ich mir, mein Vater hätte mich auch …« Er brach ab, kaute am Nagel seines Daumens herum. Seine vom Nikotin verfärbten Finger zitterten auf eine Art, die Linn von Süchtigen auf Entzug kannte. Nach der Besprechung musste sie umgehend dafür sorgen, dass sich ein Arzt um ihren Mandanten kümmerte, auch deshalb, damit er nicht in der Hoffnung auf Alkohol oder was er sonst so einwarf, der Polizei Dinge erzählte, die sich negativ auf seine Verteidigung auswirken konnten.
Sie holte einige Blätter und einen Kuli aus ihrer Aktentasche. »Sie haben ja vor ein paar Tagen bei mir in der Kanzlei angerufen«, begann sie. »Da hat sich der Tod ihrer Pflegemutter für mich allerdings nicht angehört wie ein Mord. Wäre es möglich, Herr Haug, dass Sie mir alles noch einmal erzählen, von Anfang an?«
»Von Anfang an.« Haug lehnte sich zurück. Sein Knie zuckte. »Von da, als ich als Baby zu Ines und Hans in die Pflegefamilie gekommen bin? Weil mein echter Vater meine Mutter mit dem Küchenmesser …« Er schaute auf den Tisch, knibbelte mit dem Daumen am abgekauten Zeigefinger seiner rechten Hand herum. Die Haut war wund und fing an zu bluten. Ihr Mandant sah schutzlos aus und ein wenig so, als würde er gleich in Tränen ausbrechen. Er tat ihr leid, auch wenn die Möglichkeit bestand, dass er ein Mörder war.
»Die vom Jugendamt waren jedes Mal begeistert, wenn sie zu mir in die Pflegefamilie gekommen sind, wissen Sie?«, fuhr Haug fort. Er sprach zu schnell, auf eine seltsame Art, als sei er es nicht gewohnt, viel zu reden. »Gemüse aus dem eigenen Garten, eine Kinderkrankenschwester als Pflegemutter.« Er schüttelte den Kopf, schien einen Augenblick nachzudenken. Schließlich fuhr er fort: »Ganz ehrlich, es war nicht einfach, Ines als Mutter zu haben. Sie … Manchmal habe ich mir gewünscht, sie hätte mich einfach in den Arm genommen. Stattdessen hat sie … sie war … Das ist lange her.« Er ballte seine Hände zu Fäusten. »Ich habe sie trotzdem nicht getötet. Warum auch«, sagte er schließlich, den Blick starr auf den Tisch gerichtet. Seine Stimme wurde lauter, aufgeregter. »Ines war nicht tot, als ich weg bin, sie hat mich zur Tür gebracht. Sie war auch nicht krank. Die schieben mir das in die Schuhe. Weil die wollen, dass ich für immer in den Knast komme.«
»Warum sollte jemand das wollen?«
»Das können Sie sich doch denken bei meinen Familienverhältnissen. Jemand wie ich kann nicht normal sein. Die haben Angst vor mir.« Haug lachte freudlos auf.
Linn verstand nicht ganz. »Meinen Sie mit ›Familienverhältnissen‹, dass Ihr leiblicher Vater Ihre Mutter mit dem Küchenmesser angegriffen hat? Da können Sie doch nichts dafür.«
»Sie reden ja wie ein Seelenklempner.« Haug machte ein schnaubendes Geräusch. »Angegriffen«, sagte er und pulte wieder an seinem Finger herum. Ein blutiger Hautfetzen fiel auf den Tisch. »Er hat sie nicht angegriffen, er hat sie erstochen. Mein Babybettchen muss durchtränkt gewesen sein von ihrem Blut, so wurde es mir jedenfalls erzählt.«
»Oh Gott, das ist furchtbar.« Erneut verspürte sie eine Woge des Mitleids für ihren Mandanten.
»Mein richtiger Vater ist nicht der einzige Gewalttäter, mit dem ich blutsverwandt bin. Fast alle aus meiner leiblichen Familie sind so. Hasserfüllt. Böse. Über dem Heitzhof liegt ein Fluch, sagt man.« Er schluckte. »Wir tragen ein Verbrechergen in uns. Alle im Dorf haben gehofft, dass die Assos vom Heitzhof mit meinem Vater aussterben. Leider hat er es geschafft, sich noch zu vermehren, bevor er lebenslang eingefahren ist. Das stolze Ergebnis bin ich. Mit zwölf habe ich das erste Mal ein Auto mit dem Baseballschläger zerstört. Von da an ging es stetig abwärts. Aber steil.« Er schaute aus dem Fenster. »Ich werde der Letzte sein«, fügte er leise hinzu. »Das habe ich mir geschworen. Nach mir wird es keinen Heitzhofsippler mehr geben.« Kurz war nur das Klacken seines auf und ab wippenden Schuhs zu hören. »Jetzt denken Sie es auch, oder?«, fragte er. »Dass jemand wie ich nicht normal werden kann? Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich denke es ja selbst.«
»Nein«, widersprach sie, während sie versuchte, das Gehörte zu verdauen. »Nein, das denke ich nicht. Ich glaube nicht an Verbrechergene. Und nur, weil jemand ein paar Vorstrafen hat oder als Jugendlicher viel Unsinn gemacht hat, heißt das nicht, dass er oder sie ein böser Mensch ist. Ich war früher auch keine Heilige.«
»Ach wirklich? Und was stellt eine wie Sie an? Sind Sie mal schwarz mit dem Bus gefahren?«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. Sie hätte nicht mit dem Thema anfangen sollen.
Haugs Lippen verzogen sich zu einem traurigen Lächeln. »Ich habe eine Menge Scheiß gebaut in meinem Leben, da stehe ich dazu. Aber ich habe noch nie jemanden getötet.« Er sprach zu schnell, verhaspelte sich fast und gestikulierte fahrig mit den Händen.
»Wieso sind Sie an dem Tag überhaupt zu Ihrer Pflegemutter gefahren?«, fragte Linn.
Haug zögerte. »Ich wollte mit ihr reden«, sagte er schließlich.
»Worüber denn?«, hakte sie nach.
Ihr Mandant wand sich. »Über dies und das, was es so Neues im Dorf gab«, antwortete er nach einer Weile. »Nichts Bestimmtes.«
»Einer der Polizisten hat erzählt, Sie seien in Ochsenwang wie Dreck behandelt worden. Man hätte Sie gar aus dem Dorf geprügelt. Und Ihre Pflegemutter hätte da mitgemacht. Sie selbst sagen, dass die Leute hier Sie am liebsten für immer wegsperren wollen. Dass sie Angst vor Ihnen haben und Sie für einen Asso halten. Und dann fahren Sie einfach so ohne Grund hierher, um mit Ihrer Pflegemutter darüber zu reden, was es Neues im Dorf gibt?«
Haug zuckte mit den Schultern. »Ich hatte einfach Lust, mit Ines zu quatschen. War Jahre her. Vielleicht haben wir uns nicht super verstanden, aber sie ist die einzige Mutter, die ich habe, verstehen Sie?«
Linn betrachtete ihren Mandanten. Er sah nicht so aus, als habe er Lust gehabt, mit seiner »einzigen Mutter« über den Dorfklatsch zu »quatschen«. Ganz und gar nicht. Es musste einen anderen Grund gegeben haben, warum er zu ihr gefahren war. Sie strich über die Narbe auf ihrer Wange. »Haben Sie Geld gebraucht? Waren Sie vielleicht deshalb dort?«, fragte sie. Sie wusste aus den Unterlagen, dass Haugs finanzielle Situation angespannt war.
»Schwachsinn. Nein, ich habe mein eigenes Geld.« Haug knibbelte an seinem Daumen.
Linn sagte: »In der Akte habe ich gelesen, dass Schmuck und Geld aus Ines Schneiders Wohnung …«
»Wenn ich jemanden abziehe, dann bestimmt nicht Ines. Die hat nur Schrott im Haus.«
Sie gab sich vorerst geschlagen. »Lassen wir den Grund einmal beiseite. Nachdem Sie in Ochsenwang waren, was ist dann passiert?«
»Ich habe hinter der Hecke gewartet, bis Hans, mein Pflegevater, aus dem Haus gegangen ist, weil ich wusste, dass er mich nie im Leben reinlassen würde. Es war arschkalt, ich bin fast erfroren. Ich habe geklingelt. Ines und ich haben Kaffee getrunken, geredet, und ich bin wieder gegangen. Sie war nicht krank. Sie war nicht tot. Ende der Geschichte.« Er schaute Linn nicht mehr an, leckte Blut von seinem Daumen. Sein Knie wippte auf und ab.
»Worüber haben Sie beim Kaffeetrinken geredet?«
»Das Wetter und dies und das, wie ich schon gesagt habe.«
»Was haben Sie in Ines Schneiders Schlafzimmer gemacht?«
Haug antwortete zuerst nicht, schaute zum Fenster, dann wieder zu ihr. »Ich wollte mir mal wieder das Haus anschauen. Wo ich aufgewachsen bin.«
»Die Spuren deuten darauf hin, dass im Schlafzimmer ein Kampf stattgefunden hat.«
»Ach so, das.« Ihr Mandant setzte ein Lächeln auf, es wirkte unecht. »Ines ist einfach auf mich losgegangen. Sie war so. Manchmal hat sie gesponnen. Es war nichts als eine harmlose Kabbelei. Der einzige Schaden war ein abgerissener Hemdknopf, wie ich später bemerkt habe. Wir haben kurz danach weiter Kaffee getrunken.«
»Eine harmlose Kabbelei?« So richtig konnte Linn die Geschichte ihres Mandanten nicht glauben. Das Schlafzimmer hatte auf den Fotos in der Akte ausgesehen wie ein Schlachtfeld.
Haug nickte.
»Wussten Sie, dass Ihre Pflegemutter Diabetes hatte?«, fragte sie.
»Klar. Klar, das wusste ich.«
»Und was für Medikamente musste sie dagegen nehmen?«
Haug starrte auf den Tisch. »I…Insulin natürlich. Die hatte immer so ein D…Ding dabei, um sich das zu spritzen. So ein schwarzes. Manchmal war es auch weiß. Wie so ein Stift sieht das aus. Es heißt ›Pen‹.«
»Wissen Sie, wie dieser Insulinpen funktioniert und welche Dosis Ihre Pflegemutter normalerweise gebraucht hat?«
»Nein, keine Ahnung. Ich habe sie Jahre nicht gesehen, wie gesagt.« Er richtete sich auf. Seine Hände zitterten unkontrolliert.
»In der Akte habe ich gelesen, dass man bei Ihnen zu Hause einen vor Kurzem benutzten und vollkommen entleerten Insulinpen gefunden hat, der vier Dosen Insulin enthalten hatte«, sagte Linn. »Und Ihre Pflegemutter hat die vierfache Dosis bekommen.«
Haugs Augen weiteten sich, und seine zitternden Hände klopften mehrfach auf den Tisch. Sein Gesicht war rot. »U…und?«
»Wie ist der Pen in Ihre Wohnung gekommen?«
Ihr Mandant sah aus wie ein Tier in der Falle. »Woher soll ich das wissen? Vielleicht haben die Bullen ihn in meine Tasche gelegt? Ich fand es sowieso komisch, dass sie ihn bei der Hausdurchsuchung sofort gefunden haben. Sie kamen in meinen Flur und sind direkt auf die Tasche zu, in der der Pen drin war. Ich hatte das Ding vorher noch nie gesehen. Das schwöre ich Ihnen.« Ihr Mandant schaute sie nicht an. »Ganz ehrlich, wenn ich Ines getötet hätte, hätte ich den Pen entsorgt.« Seine Kieferknochen mahlten unter seiner Haut, sein Körper bebte vor Anspannung.
Eine Weile sprach keiner. Haug starrte auf sein wippendes Knie und ballte die Fäuste. Öffnete sie wieder, ballte sie erneut, öffnete sie.
Linn holte die Akte aus ihrer Tasche und suchte den Bericht zu dem Insulinpen heraus. Die Mordwaffe war mit Desinfektionslösung abgewischt worden. Man hatte unter anderem Staub aus Ines Schneiders Schlafzimmer darauf gefunden. Aber keine Fingerabdrücke. Das war seltsam, denn warum hätte Haug den Pen zwar abwischen, ihn dann aber mit nach Hause nehmen sollen, wo ihn die Polizei mit Sicherheit finden würde? War das versehentlich passiert, in der Aufregung nach der Tat?
Denn dass die Polizei ihrem Mandanten die Tatwaffe untergeschoben hatte, hielt Linn für nahezu unmöglich. Natürlich würde sie dem zur Sicherheit nachgehen, auch deshalb, weil sie diesen Rösch vorhin so voreingenommen und unsympathisch gefunden hatte. Aber die Wohnung ihres Mandanten lag in einem Stuttgarter Vorort, und ein Polizist von der Polizei in Ochsenwang hatte nichts mit einer Hausdurchsuchung in Stuttgart zu tun. Sie klappte den Bericht zu. Auch wenn es eine kleine Ungereimtheit geben mochte, hörte sich die Geschichte ihres Mandanten insgesamt nicht richtig glaubwürdig an.
»Gut«, sagte sie, »ich denke, wir sind fürs Erste fertig. Wenn wir gleich mit den Leuten von der Kripo reden, schweigen Sie bitte einfach.« Sie packte ihre Sachen zusammen. »Ach, eine Frage hätte ich noch. Herr Rösch hat vorhin angedeutet, dass jedes Mal, wenn Sie nach Ochsenwang kommen, jemand stirbt. Was meint er damit?«
Haugs Gesicht wurde totenblass. Seine zitternden Finger rissen an einem Häutchen seines Daumens. Dann sprang er mit einer plötzlichen Bewegung auf. »Verdammt noch mal!« Sein Stuhl kippte krachend nach hinten.
Sie zuckte zusammen, versuchte, sich von ihrem Stuhl hochzustemmen, kam versehentlich mit ihrem versehrten Bein falsch auf und fiel wieder zurück. Was, wenn er sie angriff? Sie war nicht die erste Verteidigerin, die von einem Mandanten angegriffen wurde, nur weil sie zu viele Fragen stellte. Aber Haug kam nicht auf sie zu, er ging zur Wand neben der Tür, schlug mit der rechten Faust dagegen, immer und immer wieder. Er schien es offenbar nur auf sich selbst abgesehen zu haben. Seine Faust war schon ganz aufgeschrammt.
»Herr Haug, würden Sie bitte damit aufhören und sich wieder setzen?«, bat sie ihn.
Er schlug noch zwei Mal zu, nahm dann seine verletzte Hand in die andere. Drehte sich um. Eine Träne lief über sein Gesicht. Schnell wischte er mit dem Ärmel darüber. Sein Brustkorb hob und senkte sich. »Tut mir leid«, murmelte er, ging auf seinen Platz zurück und setzte sich schwerfällig hin. »Tut mir wirklich leid. Ich wollte nicht … Aber dass Sie jetzt auch noch mit dem Dorfklatsch anfangen …«
»Was für Dorfklatsch?«
Haug ging nicht darauf ein. »Wissen Sie, was ich witzig finde?«, sagte er leise. »Seit ich ungefähr achtzehn bin, führe ich ein gesetzestreues Leben. Gut, es gab vor ein paar Jahren ein paar kleine Diebstähle, aber sonst …« Er machte eine abwinkende Handbewegung. »Ich habe einen guten Job bei einer Firma in Stuttgart. Ich bin Automechaniker, wissen Sie? Seit Kurzem habe ich sogar eine Freundin. Niemand von meinen Bekannten weiß, woher ich komme und was für Gerüchte es über mich gibt. Ich war glücklich. Und ausgerechnet jetzt schaffen die Leute von diesem Kaff es doch. Endlich bin ich das Monster, das sie immer in mir gesehen haben. Warum eigentlich noch die Gerichtsverhandlung? Egal, was die Wahrheit ist, am Ende werden die mich in den Knast stecken.«
»Das werden sie nur, wenn Sie schuldig sind.«
Haug drehte langsam den Kopf und schaute ihr in die Augen. »Glauben Sie wirklich an so einen Schwachsinn?«
Sie nickte. »Und ich beschränke mich nicht aufs Glauben. Ich werde tun, was ich kann, um Ihnen zu helfen. Das ist mein Job. Selbst wenn Sie …«
»Sie können mir nicht helfen. Sie scheinen ein netter Mensch zu sein. Das hier wird kein fairer Prozess. Machen Sie es wie mein letzter Anwalt. Rennen Sie weg, solange Sie noch können.« Sie hörte tiefe Verzweiflung in Haugs Stimme. In seinen Augen waren ein solcher Schmerz und eine solche Enttäuschung, dass Linn sich für eine Sekunde fragte, ob seine dünne Geschichte wahr war und hier eine Hexenjagd stattfand.
»Jetzt geben Sie nicht schon auf, bevor wir überhaupt angefangen haben!«, sagte sie. »Die Unschuldsvermutung …«
Haug lachte heißer auf. »Die Unschuldsvermutung«, sagte er, »die gibt es hier in Ochsenwang nicht. Das werden Sie ganz schnell merken.«
3 Nachdem Linn spät in der Nacht nach Hause zurückgekommen war, hatte sie alle Heizungen voll aufgedreht, aber es war immer noch kalt in ihrer kleinen Wohnung im Dachgeschoss eines Altbaus. Ein eisiger, abgasgeschwängerter Lufthauch drang durch die Ritzen in den Fensterrahmen und unter den Türen. Es war weit nach Mitternacht, und sie lag unter der dicken Daunendecke ihres Bettes, konnte aber nicht einschlafen. Das Gespräch mit ihrem neuen Mandanten ging ihr nicht aus dem Kopf. Außerdem horchte sie ständig auf die Geräusche in ihrer Wohnung, auf das Stöhnen des Windes, das Pochen des Eisregens auf ihren Scheiben und das Knarren der alten Dachbalken. Gegen halb vier stand sie schließlich auf und kochte sich einen Tee. Sie machte überall Licht und im Wohnzimmer Musik an, damit sie die Geräusche des Windes und das Knarren nicht mehr hören musste, und setzte sich eingehüllt in ihre Bettdecke mit der Akte Haug auf ihr Sofa.
Als Erstes nahm sie sich den Bericht über den Tatort vor. Ines Schneider war im Schlafzimmer getötet worden. Auf dem Bett, wo auch ihre Leiche gelegen hatte.
Spuren ihres Mandanten hatte man überall in diesem Zimmer gefunden: Seine DNA am Bett und an der Leiche. Dreck, der einer Analyse zufolge von seinen Schuhen stammen musste, und Fasern seiner Kleider. Zwei Haare von ihm in einem Sessel. Fingerabdrücke. Auf dem Bettschränkchen seine leere Kaffeetasse. Am belastendsten aber war ein Knopf im Bett, der den Spuren zufolge von Haugs Hemd abgerissen worden sein musste. Auch eine Abschürfung an einer Hand der Toten konnte darauf hindeuten, dass Ines Schneider verzweifelt versucht hatte, sich zu wehren. Einige Gegenstände wie die Bettlampe waren umgefallen und kaputtgegangen. Das sah definitiv nicht nach einer harmlosen Kabbelei aus.
Nach Ansicht der Polizei hatte Haug seine Pflegemutter zuerst aufs Bett gezwungen und dann in Tötungsabsicht niedergerungen. Im Todeskampf hatte sie den Knopf zu fassen bekommen und abgerissen. Haug hatte ihr das Insulin gespritzt, sie eine Weile auf dem Bett festgehalten und dann mit einer Tasse Kaffee in der Hand im Schlafzimmer darauf gewartet, bis sie gestorben war. Die Tatsache, dass das Opfer bis auf einen Espresso noch nichts gefrühstückt gehabt hatte, als ihr das Insulin gegeben worden war, hatte den Tod beschleunigt. Haug hatte den Pen nach der Tat abgewischt und eingesteckt, vermutlich den Schmuck aus dem Bad geholt, den Geldbeutel des Opfers geleert, Feuer gelegt, das Haus verlassen und auf der Wegfahrt noch sein kaputtes Hemd in einem nahegelegenen Mülleimer entsorgt, wo es kurz nach der Tat gefunden worden war. Das Diebesgut hatte man hingegen bislang noch nicht finden können. Trotzdem ging die Polizei davon aus, dass es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Raubmord gehandelt hatte, auch eine familiäre Streitigkeit wurde als mögliches Motiv angegeben.
Linn hatte das Gefühl, dass Haug seine Pflegemutter nicht sonderlich gemocht hatte. Aber er wohnte schon lange nicht mehr dort und hatte sie offenbar viele Jahre nicht gesehen. Warum hätte er sie ausgerechnet jetzt töten sollen? Und wo war das Diebesgut? Denn es erschien doch seltsam, dass Haug zwar die Mordwaffe mit nach Hause genommen, das Diebesgut aber irgendwo versteckt hatte. Linn drehte eine Haarsträhne über ihren Zeigefinger. Trotzdem. Die Version der Polizei klang plausibel.
Eisregen wurde gegen die Dachfenster gepeitscht. Der Sturmwind rüttelte an den morschen Rollläden, und Linn lief ein Schauer über den Rücken. Sie machte einen Rundgang durch die Wohnung, kontrollierte, ob das Sicherheitsschloss an ihrer Tür verriegelt war und, obwohl ihr das peinlich war, ob sich niemand in ihrem Kleiderschrank versteckte. Schließlich setzte sie sich wieder aufs Sofa und suchte den Autopsiebericht heraus. Lange schaute sie das Foto mit der winzigen, blutunterlaufenen Einstichstelle hinten am Rücken zwischen den Schulterblättern der Toten an. Der Insulinpen musste Haugs Pflegemutter, so erläuterte die Rechtsmedizinerin, mit Gewalt in den Rücken gerammt worden sein, daher der Bluterguss.
Die frische Einstichstelle an einer so ungewöhnlichen Stelle, der Bluterguss, die extrem hohe Insulindosis, die Tatsache, dass der Einstich durch die Bluse hindurch erfolgt war und vor allem der abgewischte Insulinpen in Haugs Wohnung waren die Hauptgründe, warum die Polizei davon ausging, dass Ines Schneider von Haug getötet worden war. Der Pen war den Spuren zufolge auch eindeutig die Mordwaffe gewesen, man hatte unter anderem frisches Blut der Toten sowie Fasern der durchstochenen Bluse daran gefunden.
Linn dachte nach, blätterte durch die Akte, las Untersuchungsergebnisse. Haug hatte gesagt, er sei unschuldig. Zwei alternative Tathergänge waren in diesem Fall möglich: Entweder, ein anderer Täter war zufällig am gleichen Tag in der Wohnung der Pflegemutter gewesen und hatte sie getötet. Nur warum hatte ihr Mandant dann den benutzten Insulinpen zu Hause gehabt? Ein möglicher anderer Täter hätte gewusst haben müssen, dass Haug bei Ines Schneider gewesen war, er hätte ihr das Insulin verabreichen und dann sofort von Ochsenwang nach Stuttgart losfahren müssen, um den Pen noch vor Haugs Ankunft unbemerkt in dessen Wohnung deponieren zu können. Haug war nämlich von seiner Pflegemutter recht schnell nach Hause gefahren. Linn sah eine Weile zum Dachfenster, auf das es jetzt herunterschneite. Ein alternativer Täter war ziemlich unwahrscheinlich.
Die zweite Möglichkeit war, dass Ines Schneider sich die Überdosis Insulin selbst verabreicht hatte, absichtlich oder versehentlich. Dafür, dass der Fall diesbezüglich jedenfalls nicht eindeutig war, konnte sprechen, dass die Polizei nach dem Auffinden der Leiche nicht sofort von einem Tötungsdelikt ausgegangen war, sondern zunächst von einem unklaren Todesfall, der auch ein Unfall hätte sein können. Offenbar war angenommen worden, die »Kampfspuren« hätten auch durch das Opfer selbst verursacht worden sein können, vielleicht, weil Ines Schneider im Delirium durch das Zimmer getorkelt war. Und selbst nach dem Auffinden des Pens in seiner Wohnung war Haug noch nicht gleich verhaftet worden. Erst die Untersuchung des entleerten Pens und die gerichtsmedizinische Untersuchung hatten das Pendel in Richtung Tötungsdelikt ausschlagen lassen, auch sie hatten allerdings lediglich »starke Hinweise« auf eine Gewalttat ergeben. Die Rechtsmedizinerin führte dazu aus, dass im Falle eines Selbstmords oder eines Unfalls der Insulinpen mit ziemlicher Sicherheit nicht so brutal durch die Bluse in den Rücken gerammt worden wäre, sondern das Opfer sich das Insulin wie sonst auch in die Bauchdecke gespritzt hätte. Abgesehen davon war Ines Schneider recht alt gewesen und hatte zusätzlich seit Jahren an einer Bewegungseinschränkung ihres rechten Armes gelitten. In der Akte wurde zwar nicht ausgeschlossen, aber angezweifelt, dass Haugs Pflegemutter beweglich genug gewesen wäre, um sich den Pen an einer so merkwürdigen Stelle so weit hinten am Rücken selbst zu spritzen. Und dann waren da natürlich noch all die Spuren von Haug im Schlafzimmer und an der Leiche. Auch ein Selbstmord oder Unfall war also ziemlich unwahrscheinlich.
Linn trank ihre Teetasse leer und goss sich eine neue ein. Egal, wie man es drehte und wendete, es sah so aus, als habe ihr Mandant seine Pflegemutter getötet. Sie würde das alles noch einmal nachprüfen, aber man musste sicherlich bald über ein Geständnis nachdenken. Wahrscheinlich würde das kein sonderlich langer Gerichtsprozess werden.
Linn war todmüde von der durchwachten Nacht und halb erfroren, als sie einige Stunden später nach einer nervtötenden U-Bahnfahrt und einem halbstündigen Fußmarsch die Tür ihrer Kanzlei aufschloss. Sie war noch bei der Polizei vorbeigegangen, und jetzt hatte sie die Gewissheit, dass ihr Mandant sie, jedenfalls was den Insulinpen anging, angelogen hatte. Er und nur er hatte die Mordwaffe in seine Wohnung gebracht. Eine freundliche Polizistin hatte Linn einen Film gezeigt, wie er in letzter Zeit von jeder polizeilichen Maßnahme angefertigt wurde. Auf dem Film war eine vollkommen ordnungsgemäße Wohnungsdurchsuchung durch die Stuttgarter Kripo bei Haug dokumentiert. Es war eindeutig zu erkennen, dass der Pen bereits in der Tasche gewesen und nicht von einem Polizisten dort platziert worden war. Außerdem hatte Linn die Videoaufzeichnungen eines Ladengeschäfts neben Haugs Wohnungstür im Erdgeschoss seines Hauses angeschaut. Sie hatte einige Tage dieser Aufzeichnung im Schnelldurchlauf durchgesehen. Nur sieben Mal war außer der Polizei jemand in den Tagen und Stunden vor und kurz nach Ines Schneiders Tod in Haugs Wohnung gegangen, und das war jedes Mal Haug selbst gewesen. Beim letzten Mal hatte er die Tasche dabeigehabt, in der man später den Pen gefunden hatte. Die Fenster von Haugs Wohnung waren vergittert, so dass auch niemand auf diesem Weg den Pen in die Wohnung hätte schmuggeln können.
Die Mordwaffe war ihrem Mandanten nicht untergeschoben worden.
Sie ärgerte sich ein bisschen darüber, dass Haug versucht hatte, sie für dumm zu verkaufen. Ihrer Laune war zusätzlich abträglich, dass sie vorhin trotz des eisigen Morgens und der nachtschlafenden Uhrzeit, zu der sie aufgebrochen war, mal wieder einen riesigen Umweg über eine dunkle Nebenstraße gewählt hatte, um zur U-Bahn zu kommen. Ihr Unfall war lange her, aber obwohl sie Jahre der Therapie hinter sich hatte, schaffte sie es oft immer noch nicht, die kurze Strecke an der Hauptstraße entlangzugehen, ohne wackelige Knie und Atemnot zu bekommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch einmal von einem Auto angefahren wurde, war winzig, das war völlig klar, und es war sicherlich ungefährlicher, an der Hauptstraße entlangzugehen als in der winzigen Straße, an der so früh nur menschenleere Geschäftshäuser aufragten, nur … Sie hängte ihre Jacke wütend an den Haken und pfefferte ihren Schal hinterher. Heute hatte sie sich zur Abwechslung mal wieder eingebildet, Schritte hinter sich zu hören. Aber da war niemand gewesen. Natürlich nicht. Es war müßig, darüber nachzudenken. Irgendwann. Vielleicht. Würde sie wieder ein normales Leben führen. Sie ging in die Küche und brühte einen starken Espresso an.
Während sie die Akte Haug kopierte, ging sie im Geiste noch einmal durch, was sie bislang über den Fall wusste, und stockte plötzlich, weil ihr einfiel, wie ihr Mandant ausgerastet war, als sie den »Dorfklatsch« angesprochen hatte. Ihr Mandant verheimlichte ihr etwas, so viel war klar. Und es war doch auch komisch, dass dieser Ochsenwanger Polizist, dieser Rösch, ständig merkwürdige Andeutungen gemacht hatte und dass er Haug so sehr zu hassen schien.
Linn steckte die Originalakte in ihre Tasche. Sie würde sie persönlich bei der Staatsanwaltschaft zurückgeben. Und bei der Gelegenheit würde sie herausfinden, was es war, worüber weder ihr Mandant noch die Polizei hatten sprechen wollen.
4 Nach einer Mandantenbesprechung und einem schnellen Mittagessen an einem Maultaschenstand fuhr Linn zur Staatsanwaltschaft.
Oberstaatsanwalt Dr. Faber stieß gerade eine Gabel in eine Plastikschale welken Ackersalats mit Käsestreifen, als sie durch die offene Tür seines Büros schaute. Er sah alles andere als erfreut aus, bat sie aber mit einer Handbewegung herein und knallte den Deckel seines Salates zu. Der Deckel stieß auf die Gabel und schnellte wieder hoch. Einige Tropfen Salatsoße spritzten auf eine Akte.
»Mit der Mordsache Haug haben Sie sich aber ein richtig nettes Mandat an Land gezogen«, bellte er und wischte mit einer Papierserviette die Spritzer weg. »Glauben Sie mir, den Typen holen nicht mal Sie wieder raus. Und das ist auch gut so.«
Obwohl er ihr keinen Sitzplatz angeboten hatte, räumte sie einige Akten von einem Stuhl, zog ihre Jacke aus und setzte sich gegenüber von Fabers Schreibtisch. »Ich gehe bis zum Beweis der Schuld von der Unschuld meines Mandanten aus.«
»Natürlich.« Fabers rechter Mundwinkel zuckte nach oben. »Ich fürchte nur, da sind Sie die Einzige. Die meisten Leute, die Ihren Mandanten kennen, sind anderer Ansicht. Auch sein Pflegevater.«
»Herr Haug hat angedeutet, dass in diesem Dorf eine Art Hexenjagd gegen ihn veranstaltet wird, weil er aus ziemlich schwierigen Familienverhältnissen kommt.«
»Hexenjagd, natürlich.« Faber lachte herablassend und fuhr sich mit der Hand durch seine schütteren eisgrauen Haare. »Ich befürchte, ganz so einfach ist es nicht. An den Vorwürfen ist etwas dran.«
»An der Unschuldsvermutung auch. Wenn ich einem der Polizisten aus Ochsenwang so zuhöre, dann erscheint mir das mit der Hexenjagd gar nicht so abwegig.«
Faber schnaubte. »Spielen Sie auf POK Rösch an? Ich gebe zu, dass er vielleicht ein bisschen eifrig ist, was die Verfolgung von Haug angeht, aber er ermittelt in dieser Sache überhaupt nicht. Keiner aus dem Dorf. Da gibt es eine Soko aus Stuttgart. Und diese vollkommen unabhängigen Ermittler, alles erfahrene Kripobeamten, sind überzeugt davon, dass Ihr Mandant ein sehr gefährlicher Mann ist.« Er zeigte mit der linken Hand auf seine Brust. »Abgesehen davon leite ich die Ermittlungen, und Sie können mir eins glauben, ich führe keine Hexenjagd gegen Ihren Mandanten. Mir ist es völlig egal, wen wir am Ende überführen, solange es der Richtige ist.« Fabers Stimme klang weniger angespannt, als er fortfuhr. »Verstehen Sie, Frau Dr. Geller, es mag ja noch ein böser Zufall sein, wenn jemand einmal unschuldig in eine Mordermittlung gerät. Aber zweimal? Bei völlig unterschiedlichen Ermittlungsteams? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich.«
Sie musste erst mal schlucken. Zwei Mordermittlungen? War das das Geheimnis, über das keiner sprechen wollte? Bevor sie nachfragen konnte, fuhr Faber fort: »Glauben Sie, der gesamte Polizeiapparat hat sich gegen Ihren Mandanten verschworen? Die hätten ihm ja sämtliche Beweise unterschieben müssen, damals und heute. Wie soll das denn abgelaufen sein?« Er schob seine strenge, randlose Brille nach oben. »Ich weiß natürlich, dass Sie Verschwörungstheorien mögen, nur …«
Es gelang ihr, lediglich »haha« zu sagen, obwohl sie am liebsten aufgestanden und gegangen wäre. Verdammter Faber. Er wusste von den riesigen Fehlern, die sie bei den Ermittlungen zu ihrem eigenen Unfall gemacht hatte. Sie war damals so sicher gewesen, dass sie recht gehabt hatte – und sie hatte sich getäuscht.
Sie räusperte sich und sagte dann: »Es gibt also noch eine weitere Mordermittlung gegen meinen Mandanten?«
Faber nickte. »Wir sind ernsthaft um die Sicherheit von Herrn Haug besorgt, daher halten wir uns in dieser Sache im Moment noch bedeckt. Eine Menge Leute haben damals deutlich gemacht, dass sie ihn lynchen wollen, sollte sich herausstellen, dass er wirklich der Täter ist. Und ich hatte den Eindruck, an dieser allgemeinen Stimmung hat sich bis heute wenig geändert.«
»Was ist das für ein Mordfall? Wer ist das Opfer?«
»Vanessa Beckmann.«
In ihr regte sich eine Erinnerung, aber sie kam nicht darauf, wo sie den Namen schon einmal gehört hatte. Sie schaute Faber fragend an.
»Ich war damals noch Zivilrichter, aber natürlich habe ich von der Sache gehört, und so etwas vergisst man nie wieder. Ein furchtbarer Fall. Das arme Mädchen. Und der arme Vater.« Faber stellte seinen Salat beiseite, zog einen Aktenordner unter einem Stapel Blätter hervor und schlug eine Seite auf. »Vanessa Beckmann wurde vor über zwanzig Jahren, im Herbst 1995, tot im Randecker Maar aufgefunden. Das ist ganz in der Nähe von Ochsenwang. Sie wurde mit einem Hammer erschlagen. Ausgeweidet und aufgebahrt wie ein Stück Wild. Sie war gerade mal neunzehn. Riesiges Medieninteresse damals. Der Mörder wurde nie überführt, aber Ihr Mandant … Sagen wir es mal so: Er stand im Fokus der Ermittlungen. Der Fall wurde vor einigen Monaten wieder aufgenommen. Die Tatwaffe wurde gefunden, als Probegrabungen für den Bau eines Freibads durchgeführt wurden. Zum Glück konnten wir die Medien bisher aus der Sache heraushalten.« Faber hustete. »Die Presse hat den Täter damals den ›Schlächter vom Maar‹ genannt. Und es gibt einige ziemlich gute Gründe für die Annahme, dass Ihr Mandant dieser Schlächter ist. Auch wenn er sich immer als Justizopfer dargestellt hat.« Fabers Mundwinkel zuckten nun beide. »Ich dachte, Sie wüssten das und hätten das Mandat deshalb übernommen. Sie haben doch ein Herz für Justizopfer. War diese Kaufhausdiebin neulich, die gleich nach ihrer Entlassung aus der U-Haft drei Brüche gemacht hat, nicht auch eine von Ihren Schützlingen? Eine Unschuldige?« Er lachte, es klang nicht echt.
Sie verkniff sich eine Antwort und lächelte Faber an. Solange er nicht auf ihren Unfall anspielte, langweilten sie seine Versuche, sie zu ärgern.
Der Oberstaatsanwalt wurde wieder ernst. »Es besteht die Möglichkeit, dass der Mord an Herrn Haugs Pflegemutter nicht primär ein Mord aus Habgier war, sondern mit dem Mord an Vanessa in direktem Zusammenhang steht«, sagte er. »Die Pflegemutter könnte etwas gewusst haben, das für Ihren Mandanten hätte gefährlich werden können. Vermutlich etwas über die gefundene Tatwaffe. Und das wollte sie jetzt der Polizei erzählen, und da hat er sie zum Schweigen gebracht. Frau Schneider hat Herrn Haug von Anfang an für den Mörder von Vanessa gehalten, und das will doch etwas heißen, oder? Wenn die eigene Pflegemutter dich für schuldig hält?«
»Wenn solche merkwürdigen Ansichten die Grundlage Ihrer Beweisführung sind, dann werde ich Haug in ein paar Tagen wieder draußen haben.« Sie lehnte sich zurück und schlug ihre Beine übereinander. »Wusste Herr Haug überhaupt von der Wiederaufnahme?«
Faber nickte. »Wir haben gleich zu Anfang noch einmal mit ihm gesprochen. Er hat sich auf sein Recht zu schweigen berufen. Ganz anders als die Pflegemutter. Die hat in einem fort auf Ihren Mandanten geschimpft, wir mussten die Vernehmung unterbrechen.«
»Aber das Ganze ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Sie sagten doch gerade, der Fall Vanessa sei vor Monaten wiederaufgenommen worden. Warum sollte Herr Haug seine Pflegemutter erst jetzt zum Schweigen gebracht haben? Sie hätte ja ewig Zeit gehabt zu reden.«
Faber hob die Hände, seine Handflächen zeigten in einer Geste des Nichtwissens zu ihr. »Er wird seine Gründe gehabt haben.«
»Ich bin schon gespannt auf Ihre Ausführungen.«
Faber schüttelte mit einem Gesichtsausdruck den Kopf, als sei sie ein kleines Kind, das nicht akzeptieren wollte, dass der Himmel blau war. »Das Warum dieses Mordes ist für mich im Moment zweitrangig, genauso wie das Warum des Mordes an Vanessa«, knurrte er. »Im Moment zählen für mich vor allem die forensischen Beweise, und die deuten alle auf Ihren Mandanten als Täter hin. In beiden Fällen. Wenn es Sie interessiert, warum er seine Pflegemutter getötet hat oder warum er es erst jetzt getan hat, fragen Sie ihn doch einfach. Er wird es wissen.«
Kurzzeitig schwiegen sie beide.
»Warum stand mein Mandant 1995 im Fokus der Ermittlungen?«
»Nun, er hatte ein Motiv und die Gelegenheit«, antwortete Faber. »Es war allgemein bekannt, dass er seit Jahren für Vanessa geschwärmt hat und dass sie ihm die kalte Schulter gezeigt hat. Er wurde mehrfach dabei erwischt, wie er nachts vor ihrem Fenster gestanden und heimlich Fotos gemacht hat. Er hat auch schon versucht, sie zu vergewaltigen. Ihr Mandant wurde zudem gesehen, wie er am Mordabend in Richtung des Tatorts im Randecker Maar gegangen ist. Herr Haug hatte einen grauen Trainingsanzug an, der seit diesem Abend merkwürdigerweise unauffindbar ist. Sie können sich ausmalen, wenn man jemand mit einem Hammer erschlägt, ihn später ausweidet und dann auf Tannenzweige legt, dass das mehr als ein paar Spritzer verursacht. Die Kleider können Sie wegschmeißen.« Er räusperte sich. »Seit wir die Tatwaffe haben, wissen wir auch mit Sicherheit, dass es ein Hammer der Marke Siegle war. Siegle-Werkzeug befand sich in der Werkstatt, in der Haug damals gejobbt hat.« Faber fuhr sich erneut durchs Haar. Er sah plötzlich erschöpft aus. »Und dann war da natürlich noch Herr Haugs Interesse am Töten und an der Jagd. Wissen Sie, aufgrund seiner Vorstrafen konnte er damals den Jagdschein nicht machen, aber er hat es mehrfach versucht. Er muss jedes Buch über das Ausweiden von Tieren zu Hause gehabt haben, das man sich vorstellen kann. Er hat sogar mal ein Praktikum in einem Schlachthof gemacht.«
Linn faltete die Hände, legte sie locker auf Fabers Schreibtisch. »Wenn die Beweislage damals so erdrückend war, wie Sie mir das gerade verkaufen wollen, warum wurde er 1995 nicht angeklagt und verurteilt?«
Faber schwieg eine Weile, bevor er weitersprach: »Was die Ermittler seinerzeit hatten, hat am Ende nicht ausgereicht. Die DNA-Analyse war noch nicht so weit wie heute, und es hatte die halbe Tatnacht lang immer wieder geregnet, so dass viele Spuren an der Leiche nicht …« Er fuhr sich mit der Hand über den Mund. »Als dann auch noch seine leibliche Oma Luise Heitz behauptet hat, Haug sei die ganze Nacht bei ihr gewesen, mussten sie ihn laufen lassen.«
Linn setzte sich aufrecht hin. »Mein Mandant hat ein Alibi?«
»Es ist falsch.«
»Warum?«
»Seine Oma war an dem Abend gar nicht die ganze Zeit zu Hause, wie sich jetzt herausgestellt hat. Und es gibt weitere Anhaltspunkte.« Faber schob erneut seine Brille nach oben, die über den Nasenrücken nach unten gerutscht war. »Nach der Wiederaufnahme des Falls wurden zum Beispiel die Kleider, die Vanessa in der Tatnacht getragen hat, noch einmal genau untersucht. Es stellte sich heraus, dass sich auf dem Ärmel ihres Pullis Nasensekret befand, das mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von Haug stammt. Er hat damals aber behauptet, er habe Vanessa schon seit zwei Jahren nicht mehr gesehen. Glauben Sie, das Mädchen hat den Pulli zwei Jahre nicht gewaschen? Wenn sie ihn überhaupt schon zwei Jahre besessen hat, er sah ziemlich neu aus. An Haugs Geschichte kann etwas nicht stimmen, meinen Sie nicht?«
»Vielleicht hat mein Mandant nur darüber die Unwahrheit gesagt, wie lange er Vanessa schon nicht mehr gesehen hat?«
»Möglich, natürlich wäre das möglich.« Fabers Stimme triefte vor Sarkasmus.
»Ich denke, ich werde mit dieser Frau Heitz sprechen«, sagte Linn.
Die Mundwinkel des Staatsanwalts zuckten. »Da müssen Sie auf den Friedhof gehen. Luise Heitz ist seit zwei Jahren tot. Gestorben im Übrigen ganz kurz, nachdem ihr Mandant bei ihr war. Die Leute haben gemunkelt, da könnte Gift im Spiel gewesen sein, aber ihr wurde von der Rechtsmedizin ein natürlicher Tod bescheinigt. Sie war ziemlich alt. Hoffen wir, dass das auch gestimmt hat, denn die Leiche wurde eingeäschert.«
Linn dachte fieberhaft nach. Das hörte sich alles andere als gut an.
Faber schaute sie durch seine Brillengläser an. »Ihr Mandant hat in den letzten 22 Jahren drei Mal das Dorf besucht, in dem er aufgewachsen ist, und jedes Mal ist danach jemand tot. Finden Sie das nicht auffällig?«
Sie sagte nichts dazu.
»Und wissen Sie, was ich noch auffällig finde? Kurz vor dem Mord an Vanessa hat Ihr Mandant das erste Mal in seinem Leben Kontakt zu seinem leiblichen Vater Andi Heitz gesucht, der, wie Sie vielleicht wissen, ebenfalls wegen Mordes einsaß. Wegen Mordes an Karin Haug, der Mutter Ihres Mandanten, wohlgemerkt. Warum hätte Haug mit dem Mörder seiner eigenen Mutter sprechen sollen, den er nach eigenen Worten ›hasst und verachtet‹, wenn er nicht ein paar Tipps wollte, wie man jemanden umlegt?«
»Haben Sie mit dem Vater gesprochen? Oder sind das nur Vermutungen?«
»Wir haben es versucht«, erwiderte Faber. »Er war nicht sonderlich gesprächig. Wenn er was gesagt hat, waren es Dinge wie ›Arschfresse‹, und das waren noch die netteren Titel, mit denen er mich bedacht hat. Er ist nach dem Mord an der Mutter Ihres Mandanten, das kann ich noch anfügen, bis heute nicht aus der Haft entlassen worden, obwohl er anfänglich ganz gute Chancen gehabt haben soll. Hat sich selbst verlängert, sozusagen. Ein Sozialarbeiter wollte mit ihm über seine Aggressionen reden, dafür hat er ihn mit dem Kopf gegen die Wand geschlagen. Der Sozialarbeiter ist zwei Tage später gestorben. Aber das nur am Rande.« Faber räusperte sich. »Der leibliche Vater Ihres Mandanten ist ein Täter, den ich verstehe. Er verstellt sich nicht. Er wird schnell aggressiv, und dann schlägt er zu, so einfach ist das. Aber Ihr Mandant …« Faber machte eine kurze Pause, ehe er fortfuhr. »Frau Dr. Geller, wenn Ihr Mandant der Schlächter vom Maar ist und mit so einer abartigen Tat wie dem Mord an Vanessa über zwanzig Jahre lang ein nach außen hin vollkommen normales, unauffälliges Leben führen konnte, dann ist er einer der gefährlichsten Mörder, die wir hier je hatten.«
»Oder vollkommen unschuldig«, zwang sie sich einzuwerfen, obwohl ihr mittlerweile mulmig war.
Faber schüttelte den Kopf. Als er wieder sprach, klang seine Stimme belegt. »Haug hat lange im Ausland gelebt, und wir denken, es gibt noch weitere Opfer, von denen wir bislang nichts wissen. Was ich damit sagen will: Fürchten Sie sich vor ihm. Lassen Sie Ihren Idealismus und die Unschuldsvermutung mal kurz beiseite, wenn Sie eine Besprechung mit ihm haben. Und seien Sie vorsichtig mit juristischen Tricks. Wenn Sie ihn rausholen und er noch eine Frau umbringt …«
Und obwohl er schnarrend anfügte: »Auch wenn ich nicht denke, dass Tricks hier helfen, der Fall ist bombenfest«, wurde Linn plötzlich klar, dass Faber Angst hatte, und das hatte sie bei ihm noch nie erlebt. Es beunruhigte sie mehr als alles andere, was sie heute gehört hatte.
5 Es war kurz vor fünf, als Linn in die Kanzlei zurückkehrte. Sie hatte mit Faber ausgemacht, am Freitag noch einmal vorbeizukommen, um die Akte Vanessa Beckmann einzusehen, die offenbar einen ganzen Kellerraum im Gebäude der Staatsanwaltschaft füllte. Am Freitag stand außerdem die 3-D-Visualisierung des Schlächter-Falls an, und Faber hatte ihr angeboten dabei zu sein. Sie hatte keine Ahnung, was sie erwartete, aber natürlich hatte sie zugesagt.
Sie klopfte an Götz’ Tür und öffnete sie schwungvoll. Ein Geruch nach Zitronentee kam ihr entgegen. Götz saß hinter seinem Schreibtisch, eine gegnerische Klageschrift, eine Tasse und einen dicken Zivilrechtskommentar vor sich. Er strahlte sie an. »Komm rein und nimm dir auch einen Tee, wenn du magst. Gibt es was Neues in deinem Mordfall?«
»Es wäre möglich, dass Ines Schneider nicht das einzige Opfer meines Mandanten ist.« Sie setzte sich in einen von Götz’ Mandantenstühlen. Ihr war im Moment nicht nach Zitronentee zumute.
Götz’ Augen weiteten sich.
»Hast du schon mal vom Fall Vanessa Beckmann gehört? Sie wurde 1995 in der Nähe von Ochsenwang auf ziemlich brutale Art ermordet«, fuhr sie fort.
»Großer Gott«, sagte Götz. »Das … das ist nicht dein Ernst. Haug soll der Schlächter vom Maar sein? An den Fall kann ich mich erinnern. Es gab damals Gerüchte, dass die junge Frau aufgeschnitten wurde. Dass der Täter ihre Gedärme gegessen hat oder so. Sie haben der Presse vermutlich nichts Genaues gesagt, denn es gibt verschiedene Versionen, aber alle gehen in die gleiche Richtung. Erst neulich habe ich eine Reportage über Kannibalismus gesehen. Und dieser Fall wurde als ein Beispiel gebracht. Das … Linn, das ist vielleicht eine Nummer zu groß für unsere Kanzlei.«
»Kannibalismus?«, brachte sie heraus. Das hatte Faber nicht erwähnt. Schon wieder wurde ihr mulmig.
Götz nickte. »So wurde es in der Reportage jedenfalls behauptet.«
Eine Zeitlang war es still. Sie betrachtete das neue, halbleere Regal in Götz’ Büro, in dem sich Akten, eine kleine Kaktee mit weichen weißen Stacheln und ein paar Whiskeyflaschen befanden.
»Es darf keine Rolle spielen, was er gegebenenfalls getan hat. Jeder hat das Recht auf bestmögliche Verteidigung«, sagte sie schließlich. Ihre Stimme klang nicht ganz so entschlossen, wie sie sich das vorgestellt hatte.
»Das ist natürlich richtig.« Götz lächelte nachdenklich. »Aber weißt du, vor ein paar Jahren habe ich mal einen Typen verteidigt, dem sie vorgeworfen haben, ein pädophiler Sexualstraftäter zu sein. Vier Kinder. Eines noch ein Kleinkind. Ich musste das Mandat irgendwann niederlegen. Das war noch blöder für den Mandanten, als wenn ich es erst gar nicht angenommen hätte, aber … Es ging einfach nicht.« Er hob die Hände, eine Geste des Aufgebens. »Das war nicht gerade die Sternstunde meiner Verteidigerkarriere, das weiß ich, aber ich habe einfach eine Grenze, die ich nicht überschreiten kann.«
»Das verstehe ich vollkommen. Ich könnte auch keinen pädophilen Sexualstraftäter vertreten.«
»Aber jemanden, der eine junge Frau ausgeweidet und ihre Gedärme gegessen hat, schon?«
»Jemand muss ihn verteidigen. Gerade bei so einer Anklage braucht er einen Anwalt, da sind wir uns doch einig, oder? Abgesehen davon besteht die Möglichkeit, dass er nicht schuldig ist. Er hat die Tat immer abgestritten und wurde damals nicht einmal angeklagt. Er hat mir ins Gesicht gesagt, dass er noch nie jemanden getötet hat. Soweit ich das bisher überblicke, war er sein ganzes Leben ein unbeliebter Außenseiter, dem man in diesem Dorf alles zugetraut hat. Ist es da nicht logisch, dass er in so einem Mordfall der Hauptverdächtige wird?«
»In zwei Mordfällen.« Götz spielte mit dem Henkel der Teetasse. »Ich bin der Letzte, der die Unschuldsvermutung untergraben will, aber ganz ehrlich, wie viele Leute geraten zweimal grundlos unter Mordverdacht?«