
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Witamy heißt Willkommen! Ganz schön viel auf einmal, was da auf Edith niederprasselt, als sie mit ihren Eltern und dem kleinen Bruder von Berlin nach Krakau zieht. Natürlich wusste sie von den Plänen ihrer Eltern, sich im Nachbarland niederzulassen. Und sie hatte auch schon Polnischunterricht. Doch die eigene Stadt, die Freunde und die Sprache hinter sich zu lassen ist ganz schön anstrengend. Aber Edith nimmt die Herausforderung an. Erst vorsichtig, dann immer gewagter stürzt sie sich in ihr neues Leben. Mit ihren Freunden Milena und Antek erkundet sie ihr neues Zuhause und entdeckt in einem verborgenen Zimmer Briefe. Was hat es mit denen auf sich? Ein Abenteuer beginnt, das Edith Krakau näherbringt, die Stadt, die so fremd ist und nah zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Ganz schön viel auf einmal, was da auf Edith einprasselt, als sie mit ihren Eltern und dem kleinen Bruder von Berlin nach Krakau zieht. Wie soll das nur gehen ohne ihre beiden besten Freundinnen – plötzlich hineingeworfen in ein anderes Land und eine fremde Sprache? Aber Edith nimmt die Herausforderung an. Sie lernt ihre Schulklasse kennen, erkundet ihr neues Zuhause und steckt im Nu mitten im größten Abenteuer ihres Lebens.
Eine Geschichte vom Loslassen und Ankommen, über die Vergangenheit und das Heute – über Freundschaft und so viel mehr.
Antje Bones
Nebenan ist auch weit weg
Mit Bildern von Michael Szyszka
Bei dem folgenden Motto handelt es sich um einen Textauszug aus:
Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, in: ders.,
Gesamtausgabe in 16 Bänden. Band 5. © Suhrkamp Verlag
Frankfurt am Main 1959. Alle Rechte bei und vorbehalten
durch den Suhrkamp Verlag Berlin.
So entsteht in der Welt etwas,
das allen in die Kindheit scheint
und worin noch niemand war: Heimat.
Ernst Bloch
1
Ich wusste, dass es passieren würde. Ich wusste sogar, wann. Ich kannte das genaue Datum. Seit Monaten bereitete ich mich darauf vor. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ganz allein auf der Welt zu sein. Heute ist der letzte Schultag vor den Sommerferien, und meine Freundinnen verstreuen sich in alle Himmelsrichtungen. Wenn sie wiederkommen, werde ich weg sein. Für immer.
In unserer Wohnung hallt es wie in einer Kirche. Meine Mutter hat die Bilder abgehängt. Wie Vermummte stehen sie jetzt in Decken und Tücher gehüllt in einer Ecke im Esszimmer und warten auf den Abtransport. Zusammen mit Sławo hat mein Vater die hohen Regale abmontiert. Stück für Stück. Etage für Etage. Brett für Brett. Tagelang hat das gedauert.
Sławo schüttelte die ganze Zeit nur den Kopf. Weil er nicht versteht, wie man so viele Bücher haben kann. Überhaupt versteht er das Ganze hier nicht, sagt er immer wieder. Trotzdem hat er jedes einzelne Buch in einen Karton gepackt und in den Flur geschleppt. Dort sieht es inzwischen aus wie im Lager eines Möbelhauses. Kisten und Kartons stapeln sich bis unter die Decke, und es ist stickig und dunkel, weil mein Vater auch das Fenster zugestellt hat.
»Ist doch nur für ein paar Tage«, hat er gesagt. Das ist jetzt zwei Wochen her, und seitdem geistern wir durch die halb leeren Zimmer, die mal unsere Wohnung waren. Ein merkwürdiges Gefühl, denn wir sind nicht mehr wirklich hier, aber auch noch nicht dort.
Die Möbel sind ausgeräumt, in den Schreibtischen, Schränken, Kommoden und Schubladen ist nichts mehr zu finden außer Krümeln und Staub. Morgen werden sie auseinandergeschraubt und in ihre Einzelteile zerlegt. Überall auf dem Fußboden rollen kleine und große Schraubenzieher umher. Und Filzstifte, mit denen wir die Kartons beschriften: Bücher, Kleidung, Besteck, Handtücher, Bettwäsche, Spielzeug.
Als Mama Jakobs Zimmer ausräumt, weint sie die ganze Zeit. Nicht, weil ihr das Packen schwerfällt, sondern weil ihr bei jedem Pullover, den sie zusammenfaltet, und bei jedem Paar Socken, das sie aufrollt, auffällt:
»Vor einem Monat hat ihm das noch gepasst …« Dann verstaut sie die Sachen in einer Kiste und schreibt drauf: Jakob – zu klein. »Wie schnell doch die Zeit vergeht«, schluchzt sie und zieht die Kiste rüber in den dunklen Flur.
Das mit der Zeit, das finde ich auch. Sie ist gnadenlos. Die Tage vergehen, als wäre nichts geschehen. Und als würde nicht noch etwas geschehen. Etwas, das mein Leben komplett verändern wird.
Aber die Zeit interessiert das nicht. Die Sekunden, Minuten, Stunden scheren sich nicht um ein zwölfjähriges Mädchen, das irgendwo in Berlin zwischen den Scherben seines Lebens hockt. Die Zeit tut, was sie immer tut: Sie tickt, sie läuft, sie rennt! Und ich kann sie nicht aufhalten.
Nicht einmal verlangsamen. So wie in den Mathestunden bei Frau Sibbing, wenn die Zeiger übers Zifferblatt kriechen, als hätte jemand Honig oder Schleim auf sie gekippt.
Jetzt geht alles viel zu schnell.
Noch heute Morgen saß ich mit Anne und Jack auf unserer Bank auf dem Schulhof. Die ist alt und morsch, und jedes Mal, wenn wir aufstehen, haben wir Splitter oder abgeblätterte grüne Farbe an unseren Klamotten. Aber es ist unsere Bank. In den großen Pausen sitzen wir da und erzählen uns das Wichtigste vom Tag. Und vom Abend zuvor. Wir beschweren uns über die Hausaufgaben, machen Pläne fürs Wochenende, für die nächste Geburtstagsparty, und manchmal erzählt Jack von ihrem Freund. Die grüne Bank.
Steht nun ganz allein da. Sechs Wochen lang. Danach werden Anne und Jack wieder dort sitzen, ohne mich. Vielleicht suchen sie sich eine neue Freundin, und mit der finden sie dann einen neuen Platz und …
»Nein!«, rufe ich und schmeiße mich aufs Bett. Die Betten sind das Einzige, das noch steht. Und obwohl es Mitte Juli ist, weht plötzlich ein kalter Wind durch mein Zimmer und treibt graue Wollmäuse vor sich her. Ich lasse meinen Kopf von der Matratze herunterhängen und streife mit den Füßen über die Tapete. Überall helle Flecken, wo eben noch Fotos hingen. Das ist also, was bleibt: helle Flecken an den Wänden.
Ich werde weiterhin in diesem Bett schlafen, sage ich mir zur Beruhigung. Nur wird es woanders stehen. Über mir wird dieselbe Lampe hängen. Und die Fotos werden an einer der vier Wände hängen. Nur werden die nicht mehr rosa sein, sondern gelb, die Farbe habe ich schon ausgesucht. Meine Gedanken drehen sich im Kreis. Ich höre das Blut in meinem Kopf rauschen. Und immer wieder diesen einen Satz: Ich werde dich besuchen.
Diesen Satz habe ich in den letzten Tagen oft gehört. Er ist die größte Lüge! Ich selbst habe ihn schon ausgesprochen. Und auch so gemeint. Gemacht habe ich es trotzdem nicht. Nicht, als Lara nach Hamburg gezogen ist, und nicht mal, als Ole im Krankenhaus lag.
Ich werde dich besuchen. Anne meint es ernst, das weiß ich. Und das spüre ich. Wir kennen uns schließlich schon immer. Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mit ihr verstehe ich mich besser als mit meiner eigenen Familie. Sie weiß, was ich denke, und sie weiß, wie es mir geht, selbst wenn wir gar nicht drüber reden. So wie in den letzten Tagen.
Und Jack, die wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um mich zu besuchen. Aber ihren Eltern wird das nicht passen. Ich sehe sie noch vor mir, als ich ihnen erzählte, dass wir umziehen. Polen?
Wie sie mich anstarrten, als wäre ich eine streunende nasse Katze, die ihnen soeben ein totes Tier vor die Füße gelegt hat. Polen?
In der letzten Zeit habe ich festgestellt, dass das Land, in das meine Eltern und ich in zwei Tagen ziehen werden, von den meisten Leuten wie ein gefährliches Tier betrachtet wird. Ein Tier, das es noch zu zähmen oder zu zügeln gilt.
Selbst die, die Polen gut kennen, verstehen es nicht. So wie Sławo, der richtig Sławomir heißt. Er lebt seit vielen Jahren in Berlin, in Kreuzberg, im selben Haus wie wir. Geboren ist er in Warschau. Und er schüttelt den Kopf.
»Viele Polen wollen nach Deutschland. Aber kaum Deutsche wollen nach Polen. Wer in Deutschland Polnisch lernt, muss einen guten Grund haben«, hat er zu mir gesagt, als ich vor einigen Wochen mit Magdalena und dem Vokabelheft in der Hand unten im Hof auf- und abgegangen bin. Ich kann am besten auswendig lernen, wenn ich herumlaufe.
Mein »guter Grund« sind meine Eltern. Die beiden schwärmen von Polen, seit ich denken kann. Sie haben dort studiert. Sie haben sich dort kennengelernt. Sie haben sich in Polen ineinander verliebt. Jetzt haben sie dort einen Job. Papa als Restaurator und Mama als Dozentin für Filmschnitt an der Universität. Und ein Haus haben sie. Und Jakob und ich auch.
Unzählige Male sind meine Eltern nach Polen gefahren, um nach einer passenden Bleibe für uns zu suchen. Während Jakob und ich bei Oma und Opa blieben, juckelten sie durch die Straßen von Krakau. Dabei wurde ihnen allerdings schnell klar, dass sie nicht mehr im Zentrum leben wollen. Diesen Trubel, diese Hektik wollten sie sich selbst und uns Kindern zukünftig ersparen.
Dabei habe ich gar nichts gegen die Stadt. Ich würde alles geben, um Kreuzberg nicht verlassen zu müssen und bei Anne und Jack bleiben zu können. Aber habe ich eine Wahl?
Also fuhren Jakob und ich an den Wochenenden bald auch mit nach Polen. Wir stapften durch hügelige Graslandschaften, wanderten Feldwege entlang, schlurften über losen Schotter und erkundeten Siedlungen, in denen kleine und große Häuser kreuz und quer standen und in denen wir uns verliefen. Bei manchen Häusern war ich mir nicht sicher, ob sie gerade gebaut oder abgerissen wurden. Sie standen leer und verlassen da. Niemand arbeitete auf dem Dach oder zog Mauern hoch oder bepflanzte den Garten. Irgendwo im Nirgendwo standen diese Häuser und ergaben sich ihrem Schicksal.
Unser neues Zuhause. Mein Zuhause ist doch Berlin! »Ich will keine Polin werden!«, rief ich, als meine Eltern dabei waren, die Papiere für den Kauf zu unterschreiben.
»Edith! Schatz! Was redest du denn da?« Ich weiß noch genau, wie erschrocken sie mich anschauten. Als würde ich ihnen einen Strich durch die Rechnung, durch ihren Vertrag machen. Als ob ich das gekonnt hätte!
Ja, wir haben natürlich lange und immer wieder über alles gesprochen. Dass sich einiges ändern wird, aber nicht alles. Und wir Oma und Opa und unsere Freunde jederzeit besuchen könnten. Besuchen.
Dieses Wort! Es macht mich traurig. Und wütend! Es brüllt mich an: Bald bist du weg! Und die anderen bleiben hier.
2
Irgendwo in dem Kartongebirge steckt mittlerweile doppelt und dreifach eingewickelt auch unser ganzes Geschirr. Das gute aus dem Wohnzimmer und das Sammelsurium aus der Küche. Unglücklicherweise hatte meine Mutter erst danach die Idee für ein Abschiedsessen. Ein kleines, nur für die besten Freunde. Und anstatt die Kisten im dunklen Flur durchzusuchen, hat sie sich alles Nötige von unseren Nachbarn zusammengeliehen.
Zwei Tage vor unserer Abreise steht Mama also in der Küche und macht alles gleichzeitig: Sie frischt ihr Polnisch mit einem Buch auf, das aufgeschlagen zwischen Eiern, Milch und Mehl liegt. Sie rührt in der Rote-Bete-Suppe, schaut nach dem Braten im Ofen und jammert über ihre Frisur.
Jakob sitzt auf seinem Hocker in einem warmen Sonnenstrahl, der durchs Küchenfenster fällt, und schaut ihr zu. Er wird andauernd samt Hocker von Mama oder Papa verschoben, weil sie noch so viel tun haben. Obwohl nichts mehr geordnet ist in dieser Wohnung, scheint Jakob ständig im Weg zu sitzen.
Mein Vater bügelt ein Hemd im Türrahmen zwischen Küche und Flur, wo man eh kaum durchkommt, und ich entkerne Aprikosen für den Nachtisch auf dem Balkon, dem einzigen Platz, an dem es noch so aussieht wie immer. Sie haben ihn bisher übersehen.
Lina liegt unter meinem Stuhl und döst. Sie hat ein Auge geöffnet – für den Fall, dass mir eine Aprikose herunterfällt. Ich kraule sie hinter den Ohren:
»Sei froh, Linchen. Du weißt ja gar nicht, was dir bevorsteht.« Bestimmt wird auch sie ihre Kumpels vermissen, mit denen sie über den Mariannenplatz tobt. Lina seufzt. Vielleicht ahnt sie es doch. Ich stecke mir eine Aprikose in den Mund. Sie ist süß und saftig.
»Morela«, nuschle ich, als mein Vater auf den Balkon tritt. Er freut sich über meine Polnischkenntnisse, über sein gebügeltes Hemd und auf unsere Freunde.
»Du hast wirklich viel gelernt in den letzten Wochen«, sagt er und klaut eine morela.
»Smaczny«, sagt er.
Ich lache. Smaczny ist eins meiner Lieblingswörter. Lecker!
26. Juli
Das Abendessen! Das Abendessen aller Abendessen. Das schönste Abendessen, das wir jemals hatten. Alle waren da: Zora und Sophia von oben, Lilly, Sven und die Kinder von unten. Sławo und Marlene von nebenan. Oma und Opa sind gekommen und Mamas Lieblingskollegin Jenny auch.
Und dann stand plötzlich Anne vor der Tür! Sie hat mir vorher nichts verraten. Kein Wort! Ich wusste von nichts. Ich dachte, dass sie schon auf dem Weg nach Italien ist.
Anne. Sie ist und bleibt die Beste! Jack auch, klar. Aber Anne macht eben so was. Steht einfach vor der Tür und grinst und sagt: »Dzień dobry.« (Zumindest etwas, das »dzień dobry« heißen sollte.)
Wir haben ein paar von den Umzugskisten zusammengeschoben und einen langen Tisch daraus gemacht. Papa hat die Lampions vom Balkon ins Wohnzimmer gehängt und Mama alle restlichen Kerzen in den leer geräumten Zimmern aufgestellt.
Wir haben auf dem Boden gesessen und Braten gegessen. Jeder hatte einen anderen Teller. Das sah schön aus. Schön bunt.
Dann hat Sławo Gitarre gespielt! Und Papa ein letztes Mal in unserer Berliner Wohnung auf dem Klavier. Wir haben alle gesungen. Sogar Anne. Dabei hasst sie singen. Weil sie es nicht kann, sagt sie immer. So ein Quatsch! (Sie hat eine schöne Stimme.) Zora und Sofia haben getanzt wie die Wilden. Und dann hat Oma mich vom Boden hochgezogen und mich quer durchs Zimmer gewirbelt!
Den ganzen Abend lang haben alle durcheinandergeredet. Ich glaube, weil wir uns noch so viel zu sagen hatten. Weil wir ja nicht wissen, wann wir uns wiedersehen. Darum bin ich später auch mit Anne in mein Zimmer gegangen. Wir haben uns aufs Bett gelegt, und dann wurde es auf einmal so komisch still. Der Trubel aus dem Wohnzimmer war zwar zu hören. Aber wir beide, wir beiden besten Freundinnen, wir wussten einfach nicht mehr, was wir sagen sollten.
Als mir die Tränen liefen, nickte Anne nur und drehte ihren Kopf weg. Ich habe aber gehört, dass sie auch geweint hat. Wir haben uns fest gedrückt, und dann war endlich klar, dass wir uns sowieso nie verlieren werden. Selbst dann nicht, wenn ich nach Afrika ziehen würde und sie an den Nordpol!
»Es liegt etwas in diesen Abschieden«, sagte Opa, als das Abendessen aller Abendessen zu Ende ging. Und Oma sagte: »Ja, ein Anfang. Das weißt du doch!«
Weiß nicht. Aber so muss es wohl sein. Wenn Oma das sagt.
Zum Kopfschmerz von Sławos Wodka kommt heute Morgen bei meinen Eltern noch ein anderer Schmerz. Abschiedsschmerz. Bisher hatten sie sich nicht anmerken lassen, dass auch sie ein mulmiges Gefühl dabei haben, hier so viel zurückzulassen.
»Wir haben tolle Freunde«, sagt Papa und lässt eine Tablette ins Wasser plumpsen, die sich unter lautem Sprudeln auflöst. Er hält sich den Kopf. »Und du auch.« Er streicht mir übers Haar, was ich überhaupt nicht leiden kann, aber heute lasse ich es zu.
»Ja«, sage ich und setze mich auf einen Stuhl am Fenster. Ich schaue in den Hof. Als ich mit dem Polnischlernen begonnen habe, stand die Wand noch weiß und kahl da. Nur ein dürres Geäst krallte sich wie ein urzeitliches Tier mit letzter Kraft an die meterhohe Mauer. Jetzt haben die Blätter die Wand dunkelgrün eingekleidet.
»Werde ich in Krakau auch Freunde haben?«
Papa sieht mir direkt ins Gesicht, und ich habe das Gefühl, dass er zum ersten Mal nicht versucht, so zu tun, als ob der Umzug keine große Sache wäre.
»Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Und es wird womöglich auch schwierig für dich, für uns alle in der ersten Zeit.« Er atmet tief ein und aus. »Aber sicher, Edith. Ganz sicher wirst du Freunde haben.«
Die Tür fliegt auf. Jakob schiebt seinen Hocker in die Küche. Gefolgt von meiner Mutter, die versucht, ihm ein T-Shirt anzuziehen.
»Nein! Ich will nicht! Ich will das blaue. Mit den Schiffen!«, kreischt er.
»Das ist irgendwo in einem Karton, Jakob!« Mama gibt nicht auf. Aber Jakob auch nicht.
»Schiffe!«, ruft er und quetscht sich mit dem Hocker in das einzige Fleckchen Sonne in der Küche.
»Weißt du, was gut ist, Jakob?«, frage ich ihn.
Er schüttelt den Kopf.
»Gut ist, dass du es dann frisch gewaschen auspacken und im neuen Haus gleich anziehen kannst …«
Meine Mutter schaut uns beide verwundert an. Jakob, weil er plötzlich still ist. Und mich, weil sie wahrscheinlich denkt, dass ich gerade tatsächlich etwas Positives über den Umzug gesagt habe.
Es klingelt. Jakob rennt an den Türsummer. Knöpfe drücken gehört zu seinen Lieblingsbeschäftigungen. Ab morgen wird es keinen Türsummer mehr geben. Ab morgen leben wir in einem Haus. Dann werden wir einfach zur Tür gehen und sie öffnen, wenn es klingelt. Nur wird es nicht klingeln. Weil uns niemand besuchen wird.
Jemand vom Umzugsunternehmen knarzt durch die Sprechanlage: »Ja, wird dit heute noch watt?«
»Berlin, ick werde dir vermissen«, seufzt Papa und rappelt sich auf.
Jakob gibt den Hörer der Klingelanlage nicht her, also geht Papa zum Balkon und ruft von der Brüstung, dass sie in den zweiten Stock hoch müssen. Unten stehen vier Typen, jeder von ihnen größer als mein Kleiderschrank.
Schlagartig wird es hektisch – und zwar im ganzen Haus. Türen fliegen auf, laute Stimmen und Schritte auf den Treppenstufen, wieder schellt es, dieses Mal ist es Sławo, der gekommen ist, um die Betten abzubauen. Mama schnappt sich Jakob, weil er noch immer den Hörer nicht aus der Hand geben will, Sven und Lilly quetschen sich durchs Treppenhaus, wollen beim Kistenschleppen helfen, mein Handy brummt, ich rette mich ins Badezimmer. Tür zu!
»Anne?«
»Wann geht es los?«, will sie wissen. Ruft extra von unterwegs nach Italien an.
»Jetzt«, sage ich.
Ich weiß nicht, wie lange ich auf dem heruntergeklappten Klodeckel gesessen habe, wie lange Anne und ich gesprochen haben. Ich weiß auch nicht, worüber. Weil das auch nicht wichtig ist. Wichtig ist, ihre Stimme zu hören. Zu wissen, dass sie bei mir ist, egal, wo wir beide sind oder sein werden.
Als ich aus dem Bad komme, ist es plötzlich sehr hell um mich herum. Die Kisten sind weg. Das Fenster ist frei und lässt Sonnenlicht in den langen Flur fallen. Aus meinem Zimmer höre ich Hämmern und aus dem Treppenhaus einen der Umzugsmänner: »Fahren Sie nach Polen. Ihr Auto ist schon dort.«
Das halte ich nicht aus! Mein Tagebuch! Wo ist mein Tagebuch? Im Bad. Am besten, ich lege es überhaupt nicht mehr aus der Hand. Und der Kuli, den ich von Oma bekommen habe? Unters Klo gerollt … Wann ist das denn passiert? Ich bin echt durch den Wind.
27. Juli
»Fahren Sie nach Polen – Ihr Auto ist schon dort.« Ha, ha. Kenne ich schon. Den auch: »Woran erkennt man, dass noch kein Pole im All war? Der Große Wagen ist noch da!« Und den: »Was ist der Unterschied zwischen einem Arzt und einem Polen? Der Pole weiß, was dir fehlt.« So was habe ich mir in den letzten Tagen in der Schule immer wieder anhören müssen. Und auf meine Frage: »Was hast du eigentlich gegen Polen?« habe ich die total lustige Antwort »Eine gute Autoversicherung!« bekommen. Hä? Ich verstehe das nicht! Ich war zwei Jahre mit ihnen in einer Klasse. Was ist denn los mit denen? Die haben doch überhaupt keine Ahnung!
Ich aber auch nicht … Was sollte ich denen schon erzählen über Polen? Von dem Land, in dem ich auch nur ein paarmal war und in dem ich ab heute Abend wohnen werde. Keine Ahnung haben die! Keine Ahnung – und kein Auto! Nicht mal einen Führerschein … idioci!
Mir ist noch nie aufgefallen, wie sehr der Dielenboden quietscht. Wie zerschlissen er an manchen Stellen ist, wie ausgeblichen vor den Balkontüren. Ich sehe die Risse im Putz an den Wänden, die Delle mit dem abgeplatzten weißen Lack an der Küchentür, in die Jakob mit seinem Dreirad reingefahren ist. Mein ganzes Leben lang habe ich hier gewohnt. Hier im zweiten Stock, in Kreuzberg, in Berlin. Wie soll ich in Polen leben? Wie soll das gehen?
In der Wohnung gegenüber läuft der Fernseher. Die haben es gut, dass sie einfach fernsehen können. Gegenüber ist ein ganz normaler Samstag.
»Das war’s«, höre ich Sławos Stimme. Ich gehe in mein Zimmer, wo er die einzelnen Bretter von meinem Bett stapelt. Er reibt sich mit der Hand den Schweiß von der Stirn, und wir schauen den Möbelpackern zu, wie sie sich die Bretter unter die Arme klemmen.
»Das war’s«, sage ich.
3
Zwei große Lkw – und ein kleinerer nur für das Klavier – stehen auf der Straße vor unserem Haus. Sie setzen sich langsam in Bewegung. In ihnen unsere Wohnung und mein bisheriges Leben. Und ich schaue zu, wie es mir vorausfährt.
Meine Eltern liegen sich mit Lilly und Sven in den Armen, Jakob hält Lina an der Leine und versucht sie davon abzuhalten, einen platt getretenen Schokomuffin vom Bürgersteig zu fressen, und ich drücke Sławo. Ich drücke ihn, weil man das so macht zum Abschied, denke ich in irgendeiner meiner Hirnwendungen. Fühlen kann ich gerade nichts. Außer dass mein Herz rast und irgendwas mit meinen Augen nicht stimmt, ich kann nicht richtig sehen.
Papa öffnet sämtliche Türen von unserem Auto, damit es abkühlen kann. Es ist ziemlich heiß geworden. Eigentlich ein Tag, um an den See zu fahren oder ins Prinzenbad zu gehen. Stattdessen steigen wir ein, um nicht wiederzukommen.
»Ruft an, wenn ihr da seid«, sagt Lilly.
»Wenn’s nicht zu spät wird«, sagt Mama.
»Egal, wie spät es ist«, widerspricht Lilly und schlägt die Beifahrertür zu.
Dann winken wir. Sie zu uns, wir zu ihnen. Oben im Fenster steht Sofia und winkt auch.
Berlin lässt seinen Verkehr durch die Straßen brodeln, die Lkw reihen sich ein, und wir gleiten hinein, hinterher.
27. Juli, immer noch
Lina schläft. Jakob schläft. Mama tut so, als ob sie schläft. Ihre Augen zucken. Und ihr Mund auch. Oder träumt sie? Papa fährt. Lesen kann ich im Auto nicht, dabei wird mir schlecht. Außerdem kann ich mich sowieso nicht konzentrieren. Ich zähle die blauen Flecken an meinem Körper. Zwölf sind es. Ganz schön anstrengend so ein Umzug. So viel einzupacken, so viel auszusortieren, so viel zu schleppen, so viel auszuhalten. Wir haben schon das überquert, was mal die Grenzanlage war. Das merke ich gerade an den Straßen, der autostrada. Die sind nicht mehr so leise. Haben Löcher, so groß wie Krater. (Solche Straßen gibt es in Berlin aber auch. In Jacks Straße steht noch tagelang nach dem Regen das Wasser in den Schlaglöchern. Da muss man mit dem Fahrrad immer total aufpassen.) Und an diesen Stationen merkt man das auch, diese seltsamen Anlagen, die plötzlich vor einem auftauchen und quer über die Straße gehen. Hier muss man die Maut bezahlen. Papa hat mit Euroscheinen bezahlt und bekommt einen Haufen klimpernder Zlotys zurück. Ach ja, an den Zlotys merkt man es auch. Hat er eigentlich kein Geld umgetauscht? Ist unser Geld auf dem Bankkonto jetzt eigentlich mehr wert oder weniger? Bekommen wir jetzt automatisch polnisches Geld, wenn wir zum Bankschalter gehen? Ja, sicher. Muss ja. Ist ja Polen ab jetzt.
Ich bin müde, kann aber nicht schlafen. Aufschreiben kann ich eigentlich auch nichts mehr. Ich weiß nichts mehr. Nur, dass mein Leben ab sofort eingeteilt ist in das Leben vor dem Umzug und das Leben danach. Das wird mir mit jedem Kilometer, den wir uns von Berlin entfernen, klarer.
Ich muss doch eingeschlafen sein. Das Autobahnschild verkündet: Kraków – 87 Kilometer.
Vor uns fährt ein Lieferwagen. Hinten auf den Türen in Lebensgröße ein Mann mit einem seltsamen Lächeln im Gesicht und in grellen Farben, wie bei einem Autoscooter oder irgendeinem anderen Kirmeswagen. Er hat ein komisches Gewand an – wie ein Heiliger oder so was.
»Wer ist das?«, frage ich Papa, der gerade Gas gibt, um den Lieferwagen zu überholen.
»Meinst du den hier?«, grinst er.
»Ja. Wer soll das sein?«
»Johannes Paul der Zweite. Schon mal gehört?«
Ich krame in meinem Kopf. »Ist das … ist das nicht ein Papst?«
»Dobry«, sagt Papa.
»Aber … auf einem Auto, auf einem Lieferwagen? Wieso?« Ich verstehe das nicht.
»Wieso nicht?«
»Weil es ein Papst ist?«
»Er wird hier sehr verehrt, verstehst du? Er wurde in Krakau geboren. Und wir sind auf dem Weg nach Krakau …«
Als hätte ich das vergessen.
Wir haben den Lieferwagen überholt. Vorne neben dem Fahrer fläzt sich ein Junge gegen die Scheibe. Der ist jünger als ich. Was hat der mit dem Papst zu tun?, frage ich mich.
Es wird dunkel. Im Osten geht die Sonne auf – also auch früher wieder unter. In Berlin ist es wahrscheinlich noch heller. In Italien ganz bestimmt. Bei Anne. Sie kommt vielleicht gerade mit ihrer Familie vom Strand. Oder sie isst Pizza. Anne liebt Pizza über alles.
»Hast du Hunger?«, fragt Papa, als ob er sehen kann, dass ich an Anne und ihre Pizza denke. Ich schüttle den Kopf.
»Also, wenn du einen Schinken-Käse-Toast möchtest, dann schnapp dir lieber einen, bevor Jakob wach wird.« Papa lacht. Durch den Rückspiegel schauen seine Augen in meine. Ich lache auch. Und nehme mir einen Toast aus dem Beutel, der zwischen den Vordersitzen liegt. Vielleicht ist der ja gut gegen das flaue Gefühl im Magen.
Mamas Handy summt, sie greift danach, und das Display erleuchtet ihr Gesicht. Es ist Oma. Sie will wissen, wo wir sind und wie es uns geht, sagt Mama wie eine Übersetzerin ins Auto hinein.
»Gut. Uns geht’s gut«, sagt sie und schaut sich dabei nach Papa, Jakob und mir um, wie um sich zu vergewissern.
»Wir sind ungefähr in einer halben Stunde da.« Mama drückt die Austaste, und ihr Gesicht verschwindet wieder.
27. Juli - immer noch
Ich konnte Mamas Gesichtsausdruck nicht erkennen. Weiß eigentlich gar nicht, wie es ihr geht. Heute. Und überhaupt. Wie geht es ihr wohl damit, ihre Kinder in ein fremdes Land zu verschleppen? »Edith!«, würde sie jetzt sagen, »Edith, wir haben doch alles besprochen!« Was stimmt. Aber auch nicht! Wir hatten einfach keine Wahl, Jakob und ich. Kinder müssen immer das tun, was die Eltern wollen. Und fremdes Land – das würde sie sicher auch bestreiten. Wir waren schließlich schon ein paarmal in Polen. In Krakau …
Dieser Tag nimmt kein Ende! Ich will in mein Bett. In mein Bett in Kreuzberg!
P. S. Wie Lina einfach zusammengerollt neben mir liegt, wie sie einfach tief und ruhig schläft. Lina ist mein weicher Punkt. Oder mein schwacher Punkt. Wenn ich sie ansehe, werde ich weich – ob ich will oder nicht. Okay, Krakau, komm doch!
Wir fahren von der Autobahn, wir biegen von einer Landstraße in die andere, und dann spüre ich, wie die holprige Allee, die zu unserem Haus führt, mich durchrüttelt. Dunkel steht es da – noch dunkler der Garten drum herum. Die Scheinwerfer unseres Autos beleuchten den alten Kasten wie in einem Gruselfilm.
»Witamy«, sagt Papa leise und klettert aus dem Auto.
Er hat »Willkommen« gesagt, nicht »Willkommen zu Hause«. Ob er sich das nicht getraut hat, frage ich mich, als ich mein rechtes Bein unter Linas warmem Körper hervorziehe. Lina wacht auf, und es dauert keine fünf Sekunden, und sie springt raus und flitzt in den Garten.
»Lina!«, ruft Mama in die Dunkelheit hinter ihr her.
»Sind wir da?«, murmelt Jakob verschlafen.
»Ja, Schatz«, antwortet Papa. Er streckt sich, hebt Jakob hoch und setzt ihn draußen ab.
Jakob reibt sich die Augen: »Das sieht gar nicht schön aus hier«, sagt er.
»Es ist dunkel, Jakob. Du kannst doch gar nicht richtig sehen«, erklärt Mama.
Wie sie wohl reagiert hätte, hätte ich das gesagt. Das sieht gar nicht schön aus hier. Kleine Kinder dürfen das. Sie dürfen die Wahrheit sagen. Wenn man älter wird, muss man es besser wissen, muss man verstehen, muss man vernünftig sein.
Ein Rumpeln hinter mir, und plötzlich stehen wir, das Haus und der Garten, in weißgelblichem Licht. Unsere lustigen Möbelpacker sind unüberhörbar eingetroffen. Die Fahrer hupen und grölen irgendwas aus den Fenstern. Lina rast auf sie zu und um die Lkw herum.
Irgendwie wird es immer hektisch, wenn diese Typen auftauchen. Meine Eltern wirken unsicher in diesem Moment. Weil sie erst mal nicht alles unter Kontrolle zu haben scheinen. Es dauert eine Weile, bis geklärt ist, wann und wie ausgeladen und aufgebaut wird. Man einigt sich auf morgen früh um neun. Dann werden die Kerle von jemandem vom Transportunternehmen abgeholt. Die riesigen Wagen bleiben vorm Haus stehen wie eine Mauer.
»Wollen wir vielleicht doch in ein Hotel?«, fragt Papa und steht irgendwie verloren da. Mama nimmt ihm die Autoschlüssel und die Hausschlüssel aus der Hand. »Warum? Wir bleiben hier. Wie geplant. Wir campen! Im Haus! Die Schlafsäcke sind im Kofferraum …«
Jakob springt begeistert herum. Campen im Haus – damit haben sie ihn!
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie mein erster Eindruck war, als wir vor ein paar Monaten das Haus zum ersten Mal betreten haben. Es waren einfach überall Zimmer. Über drei Etagen verteilt. Leere Zimmer. Große und kleine. Dazwischen Flure und Treppen. Alles viel unübersichtlicher als in unserer Wohnung in Kreuzberg. Unten Küche, Wohn- und Esszimmer, Gästeklo. In der Mitte ein Badezimmer und zwei Räume, die wir gleich in das Schlafzimmer meiner Eltern und Jakobs Zimmer aufgeteilt haben. Mein Zimmer oben. Und ein zweites Bad. Ganz oben das Dach, ganz unten der Keller. Ein Haus eben, ein altes Haus. Das ist schon alles, was ich gedacht habe, glaube ich. Bisschen düster. Was ich jetzt denke, kann ich nicht sagen. Irgendwie nichts.
4
28. Juli, noch ganz früh, 2:30 Uhr
Im Licht der Taschenlampe von meinem Handy kann ich schreiben. Keine Ahnung, wo meine ganzen Sachen sind, in welcher Kiste, in welchem Lkw. Aber wo mein Tagebuch ist, das weiß ich – immer in meiner Nähe. Was würde ich sonst jetzt tun?
Es riecht nach altem Haus. Seit wir gestern Abend die Tür geöffnet haben, kriege ich diesen Geruch nicht mehr aus der Nase – seltsamerweise Küchengeruch, nach Essen. Als ob im Gemäuer der Dunst von 100 Jahren Borschtsch steckt. Dazu kommen Staub und Muff. Kein Wunder, hat ja lange leer gestanden, der Kasten. Schon Jahre bevor meine Eltern sich entschlossen haben, ihn zu kaufen.
Wir sind nicht mal mehr durchs Haus gegangen, haben nur die Schlafsäcke ausgebreitet in dem Zimmer, das das Wohnzimmer ist – oder wird. Jakob und meine Eltern sind gleich eingeschlafen. Ich muss eine ganz andere Natur haben als sie. Ich liege noch immer da, schreibe und schaue ihnen beim Schlafen zu. Unsere Familie ist klein. Das fällt auf in einem so großen Haus. Unsere Familie war größer. Der andere Teil ist in Deutschland, in Berlin. Das kreist die ganze Zeit in meinem Kopf. Und die Frage: Was soll ich hier?
Wir essen die durchgeweichten Brötchen, die von der Fahrt übrig geblieben sind, und es gibt lauwarmen Tee aus der Thermoskanne. Jakob rennt los. Durch die Flure, durch die Stockwerke und die Zimmer.
»Wo bin ich?«, ruft er andauernd, und ich denke: Gute Frage.
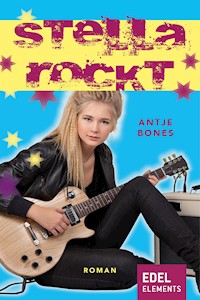














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













