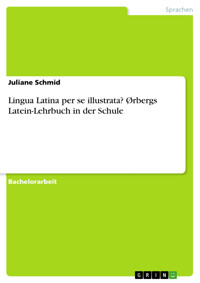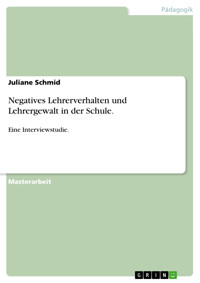
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Pädagogik - Der Lehrer / Pädagoge, Note: 1,0, Technische Universität Dresden, Sprache: Deutsch, Abstract: Wenn man an Gewalt in der Schule denkt, denkt man häufig zuerst an die Gewalt, die bei Schülern untereinander stattfindet. Dass es aber auch Lehrer und Lehrerinnen gibt, die gegenüber Schülern in verschiedenen Formen gewalttätig sind, wird mitunter verschwiegen. Mit Hilfe von Fragebögen und Interviews konnten Daten erhoben werden, die den Schluss zulassen, dass Gewalt oder negatives Verhalten durch Lehrer weitaus häufiger stattfindet als angenommen. Die Arbeit förderte verschiedene Ausprägungsformen und Häufigkeiten von Gewalt im weitesten Sinne gegenüber Schülern aller Altersklassen zu Tage.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung: Entwicklung der Forschungsfrage
2 Bisheriger Forschungsstand
2.1 Definition der Begriffe „Lehrergewalt“ und „negatives Lehrerverhalten“
2.2 Ausgewählte Studien zum Thema
3 Vorgehensweise zur Gewinnung der Daten
3.1 Gewinnung der Interviewpartner
3.2 Vorbereitung der Interviews
3.3 Durchführung der Interviews
3.4 Transkription der Interviews
3.5 Auswertung der Interviews
3.6 Auswertung der Online-Fragebögen
4 Auswertung der Daten
4.1 Quantitative und qualitative Daten der Fragebögen
4.2 Qualitative Daten der Interviews
4.2.1 Gewaltbegriff
4.2.2 Erlebte Formen
4.2.3 Häufigkeit
4.2.4 Entwicklung der Situation
4.2.5 Rolle der Klasse
4.2.6 Rolle des Lehrers/der Lehrerin
4.2.7 eigene Rolle
5 Methodenkritik
6 Fazit
7 Literaturverzeichnis
8 Anhang
Eigenständigkeitserklärung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Soziodemografie. Geschlecht
Tabelle 2: Soziodemografie. Geburtsjahre
Tabelle 3: Soziodemografie. Ausbildungsdauer
Tabelle 4: Situationen
Tabelle 5: Lehrerverhalten
Tabelle 6: Erfahrungen
Tabelle A1: Kategoriensystem Texteingaben Fragebogen, alphabetisch sortiert
Tabelle A2: Beispielcodierungen für Texteingaben Fragebogen
Tabelle A3: Kategoriensystem für Interviews, alphabetisch sortiert
Tabelle A4: Beispielcodierungen für Interviews
1 Einleitung: Entwicklung der Forschungsfrage
Schon seit vielen Jahren hat sich die Gewaltforschung in der Soziologie, aber auch in der Erziehungswissenschaft etabliert. Beide Bereiche arbeiten dabei oft Hand in Hand. Allerdings ist die Gewaltforschung, wie sie seit Jahren und auch aktuell betrieben wird, weitestgehend auf Gewalthandlungen konzentriert, die vom Schüler[1] ausgehen. So wird die Gewalt von Schülern untereinander am häufigsten erforscht, auch Gewalt von Schülern gegenüber Lehrern findet zunehmend Beachtung. Was aber bisher kaum erforscht ist, ist die Gewalt in der Schule, die von den Lehrern ausgeht[2].
Ab und zu findet man Meldungen, in denen es heißt, ein Lehrer oder eine Lehrerin habe einen Schüler ernsthaft beleidigt ober habe ihn unter besonderer „Beobachtung“. Das nachfolgende Szenario liefert einen Eindruck zum Geschehen in den Klassenzimmern:
Es war im November vergangenen Jahres, in der Klasse des Viertklässlers ging es laut her, wie das eben oft der Fall ist, wenn die Klassenleiterin fehlt. Die Vertretungslehrerin versuchte, sich Gehör zu verschaffen, die Kinder alberten weiter – und plötzlich dieser Ausraster. „Die Lehrerin, so hat es uns unser Sohn erzählt, trat von hinten an eine Gruppe sitzender Kinder heran und knallte deren Köpfe auf die Pulte“, sagt Marks Vater Michael K.*.[3]
Man mag dies für einen Einzelfall halten – schließlich ist die Prügelstrafe oder anderweitige Anwendung körperlicher Gewalt in der Schule seit den 1970er Jahren verboten – doch im Rahmen dieser Arbeit soll gezeigt werden, dass Gewalt jeglicher Art durch Lehrer und Lehrerinnen kein Einzelfall ist[4]. Außerdem soll das Spektrum der Art der Gewaltanwendung, das von psychischer bis zu physischer Gewalt reichen kann, dargestellt, Aussagen zur erlebten Intensität getroffen und spezielle Auswirkungen des Erlebten deutlich gemacht werden. Somit lässt sich die folgende Forschungsfrage aufstellen:
Welche Erfahrungen haben Studenten insbesondere während ihrer Schulzeit mit negativem Lehrerverhalten und/oder Lehrergewalt gemacht?
Dabei sollen außerdem der Einfluss der Lehrperson, der Einfluss der Klasse und das eigene Verhalten in die Analyse einbezogen werden. Die maßgeblichen Daten wurden über problemzentrierte Interviews mit 10 freiwilligen Teilnehmern erhoben. Die genaue Vorgehensweise wird in Kapitel 3 beschrieben.
Um vorher einen Überblick über die Lage der Gewaltforschung im Themengebiet „Lehrergewalt“ zu erhalten, werden im Kapitel 2, nachdem eine Definition des Begriffs „Lehrergewalt“ erfolgt ist, einige Studien mit samt ihren Ergebnissen zum Thema vorgestellt. Der Kern der Arbeit ist jedoch die detaillierte Auswertung der Interviews nach den Gesichtspunkten Form, Häufigkeit, Zustandekommen und Entwicklung der Situation, Rolle der Klasse, des Lehrers, die eigene Rolle sowie der Beschreibung des Lehrertyps.
Da die empirische Sozialforschung zwar viele Möglichkeiten zur Beschreitung verschiedener Forschungsgebiete bereithält, aber auch viele Fehlerquellen birgt, muss im Anschluss an die Analyse eine kritische Betrachtung des methodischen Vorgehens anhand der einschlägigen Gütekriterien erfolgen.
Abschließend sollen die wesentlichen Ergebnisse zusammengefasst werden. Obwohl aufgrund der Auswahl und Größe der Stichprobe keine repräsentativen Aussagen getroffen werden können, lässt sich doch wenigstens zeigen, dass Gewalt durch Lehrer existent ist und nicht aus dem Fokus der Forschung verloren gehen darf, sondern vielmehr in das Forscherblickfeld aufgenommen werden muss.
2 Bisheriger Forschungsstand
Wie bereits erwähnt ist die Gewaltforschung in vielen Facetten in Soziologie und Erziehungswissenschaft seit spätestens den 1980er Jahren sehr ausgeprägt. In den einzelnen Jahrzehnten lassen sich gewisse Trends bezüglich thematischer Fokussierung und der Wahl spezieller Forschungsmethoden erkennen[5]. Doch bis heute gibt es kaum Untersuchungen zur Gewalt, die von Lehrern ausgeht. Um sich diesem Thema nähern zu können, soll zunächst eine Definition aufgestellt werden, um abzustecken, was mit den Begriffen „Negatives Lehrerverhalten“ und „Lehrergewalt“ zum einen in der Forschung, zum anderen auch in dieser Arbeit verstanden werden soll. Davon ausgehend werden im Anschluss eine Auswahl der wenigen Erkenntnisse zum Thema Lehrergewalt vorgestellt und deutlich gemacht, in welchem Verhältnis diese zur vorliegenden Arbeit stehen.
2.1 Definition der Begriffe „Lehrergewalt“ und „negatives Lehrerverhalten“
Die beiden Begriffe werden in dieser Arbeit häufig gebraucht und müssen daher differenziert dargestellt werden. Sie bezeichnen dabei jeweils unterschiedliche Phänomene im Schulkontext. Dem Begriff Lehrergewalt liegt eine engere Definition zugrunde. Er meint die Vorfälle, die in der einschlägigen Forschung als „Gewalt“ bezeichnet werden und umfasst folglich das gesamte Spektrum struktureller und personaler Gewalt mit der Unterteilung in physische und psychische. Mit diesen Formen wird die Schädigung von Menschen beabsichtigt und ist durchgehend negativ konnotiert[6]. Die Gewalt aber, die als Voraussetzung für Demokratie – auch in der Schule – zu sehen ist, soll nicht unter den Begriff der Lehrergewalt gefasst werden, da ihr Einsatz keine absichtliche Schädigung zur Folge hat. Für die sprachliche Unterscheidung kann die lateinische Sprache herangezogen werden: Die erstgenannte, „negative“ Gewalt wird mithin als violentia[7] bezeichnet, die zweitgenannte als potestas[8]. Im Verlauf der Arbeit wird zu beobachten sein, dass es Passagen, Ereignisse und Schilderungen gibt, an denen eine solche Trennung zunehmend schwierig wird.
Um dies ein Stück weit zu kompensieren, soll der Begriff „negatives Lehrerverhalten“ zum Einsatz kommen. Hierunter soll alles das verstanden werden, was sowohl als beabsichtigte Schädigung als auch unbeabsichtigte Schädigung in der Schule geschieht. In der Literatur wird die Verwendung dieses Begriffs als „diffus“ kritisiert[9], dennoch öffnet diese Perspektive weitere Räume zur Schilderung erlebter inakzeptabler oder negativer Verhaltensweisen, die unter dem Schlagwort „Gewalt“ möglichweise nicht zutage treten würden. Somit wird auch der Forderung von Schubarth und Winter (2012) entsprochen, dass die Wahrnehmung der „Opfer“ als Kriterium angemessener sei[10]. So wird nicht nur die personelle Ebene, sondern auch die institutionelle Ebene einbezogen.
Schließlich haben die Vorgaben der Institution Schule nicht auf alle Schüler dieselbe Wirkung. Um mit Melzer et al. (2011) zu sprechen, handelt es sich um den „Missbrauch politischer Macht“[11]. Auf den Schulkontext angepasst muss man nicht ausschließlich von politischer Macht sprechen, vielmehr umfasst diese Macht die gesamte institutionelle Ebene der Schule mitsamt ihren Funktionen, d.h. Qualifikations-, Selektions-, Legitimations- und Sozialisationsfunktion[12]. Der Begriff „negatives Lehrerverhalten“ schließt also den Begriff der Lehrergewalt in sich ein. Diese Differenzierung erschien nötig und wichtig, da „echte“ Gewalttätigkeit durch den Lehrer oftmals als legitim wahrgenommen und nicht als Gewalt als solche erkannt wird. Dies zeigt auch die Einschätzung einer Teilnehmerin am Interview:
„Wir haben es [den Klaps auf den Po] vielleicht jetzt nicht so ernst genommen, obwohl es uns natürlich schon gestört hat. Aber so die Dimension, dass das also eigentlich nicht geht, das Verhalten, das haben wir da noch nicht so eingeschätzt (…).“ (A83, Z. 230-233)
Mit der Vergabe von Zensuren wird der Selektionsfunktion der Schule Rechnung getragen. Da die Notenvergabe anhand bestimmter Gütekriterien stattfinden soll, deren 100%ige Umsetzung in der Praxis aber mehr als schwierig ist[13], kommt es ggf. zu fehlerhaften Willkürbehauptungen bzw. werden unter dem Deckmantel „nicht praktikabel“ willkürlich verteilte Noten vertuscht. In die Analyse fließt folglich die subjektive Wahrnehmung des Benotungsvorgangs mit ein. So kann u.U. eine Note, die sich im Rahmen der Vorgaben bewegt, als ungerecht empfunden werden.
Dass nicht nur die Notenvergabe, sondern auch andere Handlungen als negatives Verhalten bzw. Gewalt wahrgenommen werden, zeigen die nun folgenden Studien zum Forschungsbereich „Lehrergewalt“.
2.2 Ausgewählte Studien zum Thema