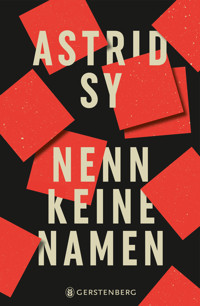
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gerstenberg Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Amsterdam 1942. Heimlich schmuggeln Rosie, Kaat und die anderen jüdische Kinder aus der Kinderkrippe, um sie vor der drohenden Deportation zu bewahren. Sie bringen sie zu Untertauchadressen im ganzen Land. Ihren wirklichen Namen dürfen die Kinder von nun an nicht mehr sagen. "Nenn keine Namen. Vergiss, wer du bist!", schärfen die jungen Leute ihnen ein. Die Arbeit im Widerstand ist anstrengend und gefährlich, doch es gibt kein Zurück. Eine Geschichte von Mut, Angst und Hoffnung, von Verzweiflung, Liebe, Freundschaft und Verrat. Der packende Roman der niederländischen Historikerin Astrid Sy, der auf wahren Begebenheiten beruht, geht unter die Haut.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für die drei tollsten und wichtigsten Männer der Welt:
Pim, Pelle und das noch namenlose kleine Baby in meinem Bauch
Inhalt
Prolog
TEIL 1: 1942
1 Mutlos
2 Der Stern
3 Das Abendessen
4 Hinter verschlossenen Türen
5 14. Juli
6 Die Hollandsche Schouwburg
7 Ein nächtlicher Streifzug
8 Bleiche Gesichter in der Nacht
9 Mariahoek
10 Bis zu Ihrer Rückkehr
11 Die Tram
12 Der Dachboden
13 Die Arbeit mit den Kindern
14 Der kleine Fratz
15 Ein glückliches Neues Jahr
TEIL 2: 1943
16 Entscheidungen
17 Zeitweilig schien alles gut
18 Der Spaziergang
19 Die Familie Schutte
20 Großes Dilemma
21 Die Liquidierung
22 Leere in Amsterdam
TEIL 3: 1944
23 Die Hölle auf Erden
24 Unterwegs
TEIL 4: 1945
25 Champagner und Kaviar
26 Endloses Warten
27 Die weißen Busse
28 Amsterdam
29 Die roten Häuschen
Epilog
Nachwort
Namensliste
Glossar
Bildnachweis
Dank
»Auch Frauen spielten bisweilen eine Rolle im Krieg.«
L. de Jong, Historiker und Journalist (1914–2005)
Die bei ihrem ersten Auftreten mit einem Sternchen* gekennzeichneten Wörter und Begriffe sind im Glossar ab Seite 433 erklärt.
Prolog
Rosie und Betje hoben den Karton hoch und gaben ihn Kaat. Zu dritt hasteten sie hinaus in den Garten. Aber vor der Hecke ganz hinten drehte Kaat sich um und sah sie beide zögernd an.
»Ich … ich komme danach nicht mehr wieder«, sagte sie mit einem Blick, der Unbehagen und Sorge zugleich verriet.
»Danke für alles«, sagte Betje.
»Ich wünschte, es wäre anders, aber ich habe noch etwas zu tun. Etwas Wichtiges, das nicht warten kann.«
»Dann alles Gute damit«, sagte Rosie ungeduldig. »Wir müssen weitermachen.«
»Ja natürlich«, beeilte sich Kaat zu erwidern. Aber sie blieb stehen. »Ich wollte nur sagen … Wir haben Adressen für euch. Sorgt bitte dafür, dass ihr rechtzeitig wegkommt.«
Betje schenkte ihr ein Lächeln, das Kaat verlegen erwiderte. Ihr Blick ging zu Rosie, aber die schaute gespannt über ihre Schulter zur Tür.
»Sorgt bitte dafür, dass ihr wegkommt«, wiederholte Kaat, während sie sich durch das Loch in der Hecke zwängte. »Und gebt gut auf euch acht.«
»Du auch«, sagte Betje.
Kaat nickte und dann war sie verschwunden. Nur ihre sich rasch entfernenden Schritte waren noch zu hören.
»Was, glaubst du, hat sie gem…« Ein lautes Schreien unterbrach Betje. »Ist das Kaat?«, fragte sie erschrocken.
»Nein, es kommt von der Plantage Middenlaan*«, sagte Rosie.
Sie rannten zurück ins Haus, durch den langen Flur bis zur Haustür.
»Es hat angefangen«, sagte Rosie nur.
TEIL 1
1942
1
Mutlos
April
Kaat holte die Rahmen mit dem schwarzen Papier vom Fenster und schob es auf. Frische Luft strömte herein. Ein einsamer Lastkahn glitt träge durchs Wasser und ließ das Spiegelbild der Bäume erzittern. Es war ein herrlicher Frühlingsmorgen, gestört wurde das Bild lediglich von den vielen noch verdunkelten Fenstern am gegenüberliegenden Ufer der Gracht. Gähnende schwarze Löcher waren es, die einen trostlosen Anblick boten.
»Guten Tag«, schallte es über die Gracht.
Kaat schrak aus ihren Gedanken hoch und suchte, woher die Stimme kam. Unter ihrem Fenster stand ein junger Mann und beobachtete sie.
»Was für ein schöner Morgen, nicht wahr?«, rief er und nahm seinen dunkelgrünen Helm ab.
Sie schenkte ihm ein unsicheres Lächeln. Der Mann antwortete mit einem Grinsen, knallte die Absätze seiner schwarz glänzenden Stiefel zusammen und setzte seinen Weg fort. Sofort reute es Kaat, dass sie sein Lächeln erwidert hatte. Ein Weilchen schaute sie noch gedankenverloren hinaus, als das leise Klirren von Geschirr an ihr Ohr drang. Sie drehte sich um und ging in die Küche.
»Guten Morgen, Anne«, sagte sie und öffnete ein paar Schranktüren. »Ist der Kaffee schon wieder alle?«
»Ja, aber du kannst neuen kaufen. Ich glaube, wir haben noch ein paar Marken«, sagte Anne, ohne den Blick vom Abwasch zu heben.
Kaat ließ sich auf einen Stuhl fallen und betrachtete Anne. Die war schon angezogen und wusch gerade einen Teller ab. Sie trug einen einfachen schwarzen Rock bis kurz über die Knie und darüber eine kurzärmelige weiße Bluse, die ihre blassen Arme freigab. Künstliche Locken schafften es nicht ganz, die Kraftlosigkeit ihrer glatten Haare zu verbergen.
»Für eine Tasse echten Bohnenkaffee mit einem großen Löffel Zucker würde ich alles geben«, sagte Kaat. »Ich habe genug von diesem ekligen Ersatzzeug.«
Anne nahm ein Geschirrtuch und trocknete sich die Hände daran ab. »Nun hab dich doch nicht gleich so. Ich werde Pim fragen, ob er uns nicht schwarz welchen besorgen kann.« Sie setzte sich zu Kaat an den Tisch und begann, eine Tomate zu schneiden.
»Mmmh, Tomate aufs Brot!«, sagte Kaat sarkastisch, während sie sich ein Scheibchen nahm.
»Wir können froh sein, dass wir überhaupt welche haben. Und Brot.«
»Sofern man dieses pampige Zeugs Brot nennen kann«, murmelte Kaat.
Nach dem Frühstück packte Kaat das Kompendium der römischen und altniederländischen Rechtsgeschichte auf den Tisch. Eine Stunde später bemerkte sie, dass sie den Abschnitt über die Leges Romanae schon dreimal gelesen und nichts davon behalten hatte. Seufzend blätterte sie an den Anfang zurück. Aber nach zwei weiteren misslungenen Versuchen, etwas von dem Stoff in sich aufzunehmen, klappte sie ihre Bücher zu und verschwand in ihr Zimmer.
Sie suchte in dem Kleiderberg auf dem Sofa und zog einen hellgrauen Plisseerock und ihre Lieblingsbluse aus dunkler Seide mit weißen Perlmuttknöpfen daraus hervor. Dann nahm sie hinter dem Frisiertisch Platz und betrachtete sich sorgsam im Spiegel. Wenn sie ihrer Mutter glauben sollte, dann war ihre Schönheit ihre wichtigste Eigenschaft. Vielleicht sogar ihre einzige.
Auf dem Frisiertisch lag eine Modezeitschrift mit Veronica Lake* auf dem Titel. Mit einem halben Auge auf deren Starfrisur rollte Kaat ihr kastanienbraunes Haar an einer Seite auf und steckte es mit Nadeln fest. Den Rest ließ sie in offenen Locken über ihre Schultern fallen.
Nachdem sie angezogen war, setzte sie sich draußen in den Hauseingang, ganz oben an der Treppe. Mittlerweile war es fast zwölf Uhr und das Wasser der Gracht glänzte in der Sonne.
Die Raamgracht war eine ruhige Wasserstraße, umgeben von dem geschäftigen Gewühl der Amsterdamer Innenstadt. Ging man nach rechts, gelangte man zum Nieuwmarkt und zur Nieuwe Hoogstraat mit ihren Geschäften und Lokalen. Aber Kaat entschied sich für links, angelockt von den Rufen der fliegenden Händler auf dem Waterlooplein.
Dort, wo die Raamgracht den Zwanenburgwal kreuzte, blieb sie stehen und lehnte sich gegen das Brückengeländer. Auf der anderen Wasserseite erstreckte sich ein weitläufiges Netz aus bunten Marktständen, die alles verkauften – von Schuhsohlen bis hin zu Zigaretten.
Früher, als sie noch ganz neu in Amsterdam war, war sie sonntags oft mit Anne zum Markt auf dem Waterlooplein gegangen. Aber das letzte Mal war vor mehr als einem Jahr gewesen.
Lokalbesitzer und Schlägertrupps hatten sich mit der Weerbaarheidsafdeling* der NSB* eine Prügelei geliefert und auch Schaufensterscheiben waren dabei zu Bruch gegangen. Eine spannungsgeladene, ja aufständische Atmosphäre hatte über allem gehangen und im Februar vergangenen Jahres erreichte sie mit den Streiks* ihren Siedepunkt. Jetzt dagegen überwog ein Gefühl von Niedergeschlagenheit und Unterdrückung. Sie schaute nach links, wo sie am Anfang der Jodenbreestraat* ein großes Schild mit von hier aus unleserlichen Worten ausmachen konnte, die ihr aber nur zu bekannt waren.
Man schlug einen großen Bogen um das wunderschöne alte Quartier im Osten von Amsterdam, als würde dort eine ansteckende Krankheit umgehen. Das Viertel war mit Schildern abgesperrt, auf denen JUDENVIERTEL oder JOODSCHE WIJK stand. Kaat kam sich da wie eine Außenstehende, eine Zuschauerin vor. Aber auch sie war nicht frei, nicht wirklich. Niemand war das.
Sie kratzte ein wenig an dem Brückengeländer, wo unter dem weißen Anstrich das traditionelle vormalige Dunkelgrün zum Vorschein kam. Ihr Blick ging von den Laternenpfählen und Bordsteinkanten zu den hässlichen riesengroßen Hausnummern auf den Wänden der Häuser: allesamt im Auftrag der Besatzer weiß gestrichen* beziehungsweise aufgemalt. Sie drehte sich zur Seite und stand jetzt mit der Hüfte an das Geländer angelehnt da. Widerwillig betrachtete sie das Haus schräg gegenüber dem ihren.
Es lag mittlerweile schon zwei Jahre zurück. Der 10. Mai 1940. Sie studierte noch kein Jahr in Amsterdam und verbrachte gerade ein langes Pfingstwochenende bei ihren Eltern in Utrecht. Frühmorgens hatte ein tiefes Dröhnen von Motoren sie aus dem Schlaf gerissen. Sie war ans Fenster gerannt. Unzählige Kampfflugzeuge hatten den Himmel verdunkelt. In den fünf darauffolgenden Tagen hatte sie mit ihren Eltern wie gebannt vor dem Radio gesessen, während die unwirklich anmutende Erkenntnis, dass tatsächlich Krieg herrschte, sich wie Blei auf sie legte. Wie eine drohende Warnung vor den dunklen Zeiten, die ihnen bevorstanden, verbreiteten sich merkwürdige Staubwolken am Himmel. Sie stammten von dem durch Bomben in Schutt und Asche gelegten Rotterdam.
Kaat war gleichzeitig mit den Deutschen in Amsterdam eingetroffen. Autos, Panzer und Lastwagen, beladen mit Soldaten in Tarnuniform und mit Sturmhelmen, fuhren über den Damrak. Tränen der Wut, aber zugleich der Hilflosigkeit waren ihr übers Gesicht gelaufen. Diese Empfindung verstärkte sich noch, als sie hinterher sah, dass die gegenüberliegende Seite der Raamgracht von Polizisten abgesperrt war. Umgeben von einem dichten Spalier von Nachbarn und Passanten wurden die Bahren mit den Leichen von Herrn und Frau Schwartz und ihren beiden kleinen Söhnen herausgetragen.
»Du solltest dich lieber vorsehen. Wenn du zu lange an ein und derselben Stelle herumlungerst, denken sie noch, du führst irgendwas im Schilde«, klang es hinter ihr.
»Du liebe Güte, Pim, hast du mich erschreckt«, sagte Kaat, während sie sich umdrehte.
Neben ihr stand ein junger Mann mit einer Mütze auf dem Kopf. Er hatte beide Arme auf das Geländer gestützt. »Ich habe Louis gefragt«, sagte er mit einem nachdenklichen Blick auf das Schild am Anfang der Jodenbreestraat, »wie sich das alles für ihn anfühlt. Ich meine, so behandelt zu werden. Und weißt du, was er da zu mir gesagt hat?«
»Nein?«
»›An einem stinknormalen Tag bin ich als Louis Beekman aufgestanden. Ich las die Zeitung und besuchte als Louis Beekman die Uni. Ich trank ein Bierchen als Louis Beekman und legte mich als Louis Beekman schlafen. Aber am nächsten Morgen wachte ich auf und las in der Zeitung, dass ich nicht mehr Louis Beekman war, sondern ein Jude und sonst gar nichts‹«, sagte Pim. »Am darauffolgenden Tag haben die Moffen* ihn aus seinem Haus gezerrt. Ist mittlerweile auch schon über ein Jahr her, nicht zu glauben …«
Kaat hätte gern etwas Tröstliches erwidert. Stattdessen nahm sie ihre letzten zwei Zigaretten und reichte ihm eine. Schweigend rauchten sie.
»Warum hast du das gesagt?«, fragte sie nach einer Weile.
»Was?«
»Dass man etwas im Schilde führt, wenn man irgendwo zu lange steht.«
»Leute, die an Straßenecken herumlungern – oder wie in deinem Fall auf Brücken –, die … haben immer etwas vor.«
»Manche vielleicht«, sagte sie. »Ich bin schlicht eine Studentin, die sich nicht konzentrieren kann.«
»Aha!«, meinte Pim und lachte. »Das ist die längste Zeit mein Problem gewesen.« Er zog sich die Mütze vom Kopf, wühlte kurz durch sein dunkelblondes Haar und stopfte sich die Mütze in die Hosentasche.
»Das heißt, du willst zum Herbst immer noch nicht zurück an die Uni?«, fragte sie. »Hast du keine Angst, zu sehr ins Hintertreffen zu geraten, bis der Krieg vorbei ist?«
»Nein«, sagte er entschieden. »Ich kann nicht diesem öden Professor Adriani zuhören, wenn er sich über das Steuerrecht und dergleichen auslässt … Als wäre alles so wie eh und je. Da habe ich Dringlicheres zu tun.«
Wieder so eine vage Andeutung, dachte Kaat. Sie fragte lieber nicht, was er damit meinte, das hatte ja doch keinen Sinn. Es waren merkwürdige Zeiten. Gerüchte und Tratsch schwirrten durch die Studentenheime. Flüsternd erzählte man sich, wer in den Untergrund gegangen war und wer auf der falschen Seite stand, wer jetzt wieder verschwunden oder geflohen war. Jeder schien Informationen über jeden zu haben, aber niemand wusste je etwas Genaues. Man musste sich vorsehen mit dem, was man sagte, und zu wem.
Eins wusste Kaat mit Sicherheit: Wenn einer für den Untergrund arbeitete, dann war das Pim. Die Frage war bloß: Was tat er da? Jemand hatte gemeint, er gehörte zu einem Rollkommando*, aber das erschien ihr unwahrscheinlich. Die meisten Jungs in derartigen Kommandos waren in der Armee gewesen und Pim hatte sich ausmustern lassen, weil er gegen Gewalt war. Aber was machte er dann? Und noch wichtiger: Wie gefährlich war es?
Heimlich betrachtete sie ihn. Wo seine Augenbrauen beinahe zusammenstießen, bogen sie sich ganz leicht nach oben, was ihm fortwährend einen fragenden Blick verlieh. Es hätte auch einfältig aussehen können, besonders bei seinen rosigen Wangen und Lippen, hätte er nicht diese entschiedene und selbstsichere Ausstrahlung besessen, die ihn viel älter als zweiundzwanzig erscheinen ließ.
»Müssen wir nicht los? Gleich kommen wir noch zu spät«, hörten sie Anne rufen.
Die beiden Freunde drehten sich um und sahen Anne die wenigen Stufen zur Straße herabkommen, während sie ihren Mantel anzog.
»Welchen Film wollen wir uns ansehen?«, fragte Anne kurz darauf. Sie gingen über den Kloveniersburgwal, vorbei an der langen Schlange vor dem Lebensmittelgeschäft, das nur samstags Fleisch gegen Bezugsscheine verkaufte, und dem Zeitungskiosk, vor dessen Auslagen sich Männer mit Filzhüten drängten.
Ohne sich umzudrehen, antwortete Pim: »The Wolf Man im Tuschinski*.«
Anne warf Kaat einen unglücklichen Blick zu. Kaat wusste, dass sie Horrorfilme hasste.
Zu dritt gingen sie Richtung Rembrandtplein und steuerten das imposante Jugendstilgebäude an. Pim kaufte die Karten. Er weigerte sich immer, Geld von ihnen anzunehmen, obwohl ihm die Kinobesuche ein Loch in den Beutel reißen mussten. Während sie warteten, fiel Kaats Auge auf das kleine Schild in dem Fenster an der Kasse. Einfach absurd, dass ausgerechnet das von Abraham Tuschinski erbaute Lichtspieltheater jetzt für Juden verboten war.
»Schnell, der Film fängt gleich an«, sagte Pim, während er schon vorauseilte.
Wenn Pim eine große Leidenschaft besaß, dann fürs Kino. Er wollte einfach jeden Streifen gesehen haben. Selbst die Moffenfilme ließ er nicht aus.
»Besser, man weiß Bescheid, was der Feind tut und sagt«, meinte er immer.
Kaat hasste es, sich deutsche Filme anzuschauen, auch weil es Pim immer in eine fürchterliche Stimmung versetzte. Nachdem sie Rembrandt van Rijn gesehen hatten, hatte Pim bei ihnen zu Hause einen Teller gegen die Wand geworfen. »Diese dreckigen Antisemiten!«, hatte er gebrüllt.
»Was stehst du da und träumst? Beeil dich!«, rief Pim. Er war mit Anne schon oben an der Treppe zum großen Saal. Kaat rannte hinauf und folgte Pim, der mit einem wohlwollenden Blick auf einen Polizisten den Saal betrat.
Kaat schaute sich um und entdeckte drei Männer in schwarzer WA*-Uniform in der ersten Reihe. Das Kino füllte sich mit Zuschauern. Ganz zuletzt kam der Polizist herein und blieb oben am Eingang stehen. Schallende Trompeten läuteten die Polygoon-Wochenschau* ein. Irgendwo hinten im Saal erklang ein kurzes Gejohle und einige Leute lachten. »Es lebe die Königin!«, rief jemand. Einer der WA-Männer erhob sich halb von seinem Sitz und suchte mit den Augen nach den Unruhestiftern.
»Nur gut, dass der Polizist da ist«, flüsterte Kaat Anne zu. »Gleich gibt es noch Krawall.« Sie schaute an Anne vorbei zu Pim und bemerkte, dass er die Hinterköpfe der Schwarzhemden* unentwegt im Auge behielt.
Nachrichtenbilder flimmerten vorbei. Organisierte Aufmärsche, Hakenkreuzfahnen und Horden marschierender Militärs. Pim knurrte etwas Unverständliches. Bilder der Elfstädtetour* im vergangenen Winter zogen vorbei, gefolgt von einem Auftritt der Ramblers vor einem Publikum aus deutschen Offizieren. Kaat erkannte Reichskommissar Arthur Seyß-Inquart*. Ein halb aufgegessener Apfel flog durch den Saal und traf die Leinwand genau in dem Moment, als die Kamera Seyß-Inquarts Gesicht näher heranholte. Modelle defilierten in den neuesten Entwürfen eines deutschen Modehauses über den Laufsteg einer Modenschau in Den Haag. Pim flüsterte heftig gestikulierend mit Anne.
Kaat beugte sich über Anne und stieß ihn in die Seite. »Der Film hat begonnen«, flüsterte sie.
Anne sank stöhnend etwas tiefer in ihren Sitz und Kaat tätschelte ihr Knie: »Wenn es zu schlimm für dich wird, mach einfach die Augen zu.«
»Und wohin wollt ihr jetzt?«, fragte Kaat, während sie auf der Treppe zum Eingang des Theaters stehen blieb und die Augen angesichts des grellen Sonnenlichts zukniff.
»Nach Hause, denke ich«, sagte Anne. »Was bleibt uns anderes?«
»Ich dachte, wir könnten vielleicht kurz bei Clara vorbeischauen. Alle treffen sich dort …«
»Wer ist ›alle‹?«, fiel ihr Anne ins Wort.
»Ach, Anton und einige andere«, sagte Kaat leichthin. »Ist das ein Problem?«
»Ich weiß es nicht, Kaat …« Annes Blick ging rasch zu Pim, der nachdenklich die Geschäftigkeit in der Reguliersbreestraat betrachtete.
»Pim kann doch mitkommen?«
Pim schnaubte. »Glaubst du, sie dulden einen Judenfreund wie mich in ihrer Mitte? Ich kapiere eigentlich nicht, warum du noch mit diesen Hampelmännern befreundet bist …«
»Ich sage ja nicht, dass sie meine Freunde sind. Aber Clara und Lucy sind Kommilitoninnen von uns«, erwiderte Kaat.
»Ist wirklich nicht so schlimm, wenn man sich auseinanderlebt«, sagte Anne. »Der Krieg hat alle verändert …«
»Ich vermisse unser altes Studentenleben. Die Feiern … Das Segeln auf den Loosdrechtschen Plassen … Wäre unser Klubhaus noch geöffnet, dann könnten wir wenigstens …«
»Könnten wir wenigstens was?«, unterbrach Pim sie. »Bier trinken, während Saartje und die anderen zu Hause hocken müssen? Und Louis verhaftet ist?«
»Ich meine davor. Bevor die Juden …« Kaat schwieg. »Du bist nicht der Einzige, der das schlimm findet. Warum, glaubst du, wurde die Verbindung aufgelöst?«
»Weißt du, was mit dir ist, Kaat?«, sagte Pim streng. »Du lebst nicht in der Realität. Es hat keinen Sinn, darüber nachzugrübeln, wie schön es früher war. Diese Zeiten sind vorbei.«
»Aber der Krieg kann doch unmöglich noch lange dauern …«
»Man hat uns unserem Schicksal überlassen, als diese Feiglinge von der Regierung sich mit eingezogenem Schwanz nach England abgesetzt haben«, sagte Pim abwesend, während er die Treppe hinunterging und in die gegenüberliegende Gasse einbog.
»Pim, jetzt warte doch! – Kommst du?«, fragte Anne Kaat über die Schulter, während sie Pim folgte.
»Ja, gleich«, sagte Kaat. »Ich vertrete mir nur noch etwas die Beine.«
»Bis nachher!«, rief Anne und verschwand ebenfalls in der Gasse.
Einen Moment lang überlegte Kaat, ob sie nicht doch noch zu Clara und den anderen gehen sollte, aber dann lenkte sie ihre Schritte zum Muntplein.
Während sie durch die Innenstadt irrte, dachte sie an den unwirtlichen Sonntag im Februar vorigen Jahres, als Pim vor ihrer Tür gestanden hatte.
»Sie haben das ganze Wochenende junge jüdische Männer verhaftet«, hatte Pim geflüstert. »Louis ist auch dabei.«
»Nicht doch!«, hatte Anne gerufen.
Pims Gesicht war aschgrau gewesen. Kaat sträubten sich immer noch die Nackenhaare, wenn sie daran zurückdachte.
Sie überquerte die kleine Brücke und bog in die Raamgracht ein. Auf der anderen Kanalseite schleppten zwei Frauen ihre schweren Einkaufstaschen. Ein Pferdegespann wollte sie überholen und sie sprangen beiseite. Das Hufgetrappel hallte noch nach, als das Gefährt bereits um die Ecke gebogen war. Die Frauen setzten ihren Weg fort, als sei nichts geschehen. Gefühle von Neid beschlichen Kaat. Wenn sie auch nur vorübergehend so hätte tun können, als ob ihr Land nicht seit zwei Jahren besetzt wäre!
Mit einem Seufzer setzte sie sich auf die unterste Treppenstufe vor ihrem Haus. Sie dachte an Louis. Ein hochgewachsener, kräftiger Bursche mit braunem Haar. Immer nett und höflich zu allen. Pims bester Freund und auch sie war mit ihm befreundet gewesen. Ums Leben gekommen in einem der Lager im Osten. Unter unklaren Umständen.
Seit diesem Augenblick war Pim entschiedener denn je. Er war davon überzeugt, dass Louis’ Schicksal alle Juden erwarten würde. Unwillkürlich ging Kaats Blick zu dem weißen Haus auf der anderen Seite der Gracht. Dem Haus, in dem man die Familie Schwartz kurz nach der Kapitulation* tot aufgefunden hatte. Der Gashahn in der Küche sei geöffnet gewesen, hatte die Polizei gesagt. Was für Schrecknisse hatten die Schwartzens für sich vorausgesehen? Was konnte schlimmer sein, als sich und seine Kinder zu ersticken?
2
Der Stern
Mai
Geräuschvoll fiel die Zeitschrift zu Boden. Rosie drehte sich auf den Bauch, um sie aufzuheben. Eine Weile blätterte sie gelangweilt darin herum und warf sie dann in einem hohen Bogen von sich. Sie ließ ihren Blick durch das Wohnzimmer schweifen. Zwei hohe Fenster mit Gardinen boten Aussicht auf die ruhige Plantage Muidergracht. Überall im Zimmer verteilt standen kleine Holztische. Früher hatte ihre Mutter die Kristallvasen darauf wöchentlich mit frischen Blumen gefüllt, aber die waren jetzt nirgendwo mehr zu bekommen.
In besseren Zeiten hatte Rosie Meijer es wunderbar gefunden, einen Tag freizuhaben. Aber jetzt langweilte sie sich dermaßen, dass Arbeit eine willkommene Ablenkung gewesen wäre. Sie gähnte. Langsam fielen ihr die Augen zu, bis das Schellen der Türglocke durchs Haus hallte. Sie sprang hoch.
»Ich gehe schon!«, rief sie und stolperte im Laufschritt aus dem Wohnzimmer. Schlitternd blieb sie vor dem Flurspiegel stehen, versuchte hastig, ihre Locken in Form zu bringen, und sauste zur Tür. Sie öffnete. Ein junger Bursche drehte sich um und schaute sie lächelnd an.
»Hallo Rosie, ist Izaak zu Hause?«, fragte er und huschte bereits an ihr vorbei nach drinnen.
»Hallo Ben«, murmelte Rosie.
In dem Moment kam Izaak die Treppe heruntergerannt. Er hatte die gleichen schwarzen Locken wie Rosie. Unten angekommen, schlug er Ben herzlich auf den Rücken.
»Ma rührt mal wieder irgendetwas zusammen«, sagte er.
Beide gingen sie in die Küche. Rosie warf noch einen letzten Blick in den Spiegel, bevor sie ihnen hinterherrannte.
In der Küche stand eine untersetzte Frau am Herd. Sie gab Ben einen Kuss auf die Stirn. »Na, hast du Hunger?«, fragte sie, während sie ihn auf einen Stuhl an dem großen Holztisch drückte. Sie stellte ihm eine dampfende Tasse Gemüsesuppe vor die Nase und wandte sich mit in die Hüften gestemmten Händen an Rosie. »Rosie Meijer, eines Tages zerspringt wegen deinem Geschrei noch einmal das Glas in den Fenstern.«
Izaak beugte sich an seiner Mutter vorbei vor, um sich eine Möhre zu nehmen. »Warum musst du immer gleich öffnen, wenn Ben vor der Tür steht? Du weißt doch, dass er nicht deinetwegen hierherkommt!«, meinte er, auf der Möhre herumkauend.
»Ich wusste nicht, dass es Ben war«, sagte Rosie mit einem eisigen Blick auf ihren Bruder.
»Lassen sie dich nicht zu hart arbeiten, da beim Joodsche Raad*?«, fragte ihre Mutter Ben, ihre Kinder ignorierend.
Der zuckte mit den Schultern. »Nicht mehr als alle anderen, Frau Meijer. Nicht mehr als alle anderen.«
Sie zwickte ihn kräftig, aber liebevoll in den Nacken. »Ich finde, du siehst müde aus. Gönnst du dir auch mal eine Pause? Immer nur auf diesem schweren Lastenrad durch die Gegend zu strampeln …«
»Ach, so bleibe ich wenigstens in Form«, sagte Ben mit einem Augenzwinkern.
»Ha!«, rief Izaak. »Und was ist das hier?« Er machte einen Satz nach vorn und versuchte, Ben in den Bauch zu kneifen, aber der schlug seinen Arm lachend beiseite.
Unterdessen hatte Rosie ihm gegenüber Platz genommen und lugte heimlich zu ihm hinüber. Während sie so tat, als würde sie dem Gespräch folgen, huschten ihre Augen über sein ausdrucksstarkes Gesicht. Sein braunes Haar fiel ihm schwungvoll über die grauen Augen. Er schaute zu ihrer Mutter und nickte munter. Als er lachte und zwei tiefe Grübchen in seinen Wangen erschienen, musste Rosie sich zusammenreißen, um sie nicht mit den Händen zu berühren.
Sie spürte, dass jemand sie beobachtete, und erschrak. Verstohlen blickte sie nach rechts, wo Izaak sie süffisant angrinste. Sie beschloss, ihn nicht weiter zu beachten, und hörte mit gespieltem Interesse ihrer Mutter zu.
»Hast du noch Neuigkeiten für uns?«, fragte diese Ben, während sie Izaak die Möhre aus der Hand zog.
»Nein, nicht wirklich …«, sagte Ben und fuhr nach kurzem Nachdenken fort: »Es gibt zwar einige Gerüchte, aber nichts Konkretes.«
»Wenn du uns nicht ab und zu auf dem Laufenden hieltest, wüssten wir überhaupt nicht, was alles geschieht.« Sie hielt kurz beim Gemüseschneiden inne und seufzte: »Ich bekomme allmählich das Gefühl, dass wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten sind.«
»Du musst dir nicht so viele Sorgen machen«, sagte Izaak, während er zu seiner Mutter ging und ihr einen Arm um die Schulter legte. »Am Ende wird alles gut.«
»Das hast du auch gesagt, nachdem sie Pa das Geschäft weggenommen hatten und wir von der Schule entfernt wurden«, sagte Rosie. »Und nachdem unser Radio beschlagnahmt wurde und … Was war es noch gewesen?« Rosie tat, als müsste sie nachdenken. »Ach ja! Als ich mit einer weinenden Esther ankam, weil wir nicht mehr im Schinkelbad schwimmen durften.«
»Du sollst nicht über Dinge reden, von denen du nichts verstehst«, herrschte Izaak sie an.
»Schluss jetzt!«, rief ihre Mutter, als Rosie ansetzte, ihm Kontra zu geben. »Ich will nichts mehr davon hören!«
»Ihr steckt den Kopf in den Sand, und zwar alle«, murmelte Rosie leise.
»Es ist mein Ernst, Rosie«, sagte ihre Mutter drohend. »Wenn euer Vater gleich nach Hause kommt, will ich nichts mehr von diesem Gerede hören. Er hat schon genug um die Ohren. Und wehe euch, wenn Esther das mitbekommt!« Sie zeigte mit einem Stück Möhre auf ihre Tochter.
Ben, der stumm seine Suppe gegessen hatte, stand auf. »Ich muss weiter, Frau Meijer. Ich habe noch einen Brief, den ich vor zwei Uhr beim Judenrat abgeben muss. Danke für die Suppe.«
Rosie sprang so schnell vom Tisch auf, dass sie ihren Stuhl dabei umwarf. »Ich kann dich ein Stück begleiten«, sagte sie und rannte hinter Ben her.
»Ein andermal vielleicht«, sagte Ben, der schon zur Tür eilte. »Ich bin mit dem Rad da.«
Bevor Rosie ihm widersprechen konnte, hatte er die Küchentür schon hinter sich zugezogen. In ihrem Rücken vernahm sie ein Kichern. Izaak schüttelte mit einem mitleidigen Blick den Kopf.
»Ach, du halt bloß den Mund!«, schimpfte sie.
Wie um seine Unschuld zu beteuern, hob er beide Hände in die Höhe. »Ich habe doch gar nichts gesagt!«
»Rosie, gehst du deine kleine Schwester holen? Das Essen ist fertig«, sagte ihre Mutter.
Rosie trat hinaus auf den Flur und schrie: »Esther, essen!«
»Und brüll nicht so!«, kreischte ihre Mutter ihr hinterher.
Im selben Augenblick steckte jemand den Schlüssel in die Haustür. Ein Mann mit einem grauen Schnauzbart und ebensolchen Locken wie Izaak und Rosie kam herein.
»Tag, Liebes«, sagte er seufzend und tätschelte abwesend Rosies Kopf. In der Hand hielt er ein braunes Päckchen, das er auf der Kommode unter dem Spiegel ablegte, damit er seinen Mantel ausziehen konnte.
»Pa«, fragte Rosie mit einem Blick auf das Päckchen, »ist das …«
»Ja, Liebes«, sagte ihr Vater und nahm es mit in die Küche. Aber bevor er diese erreichte, kam ein Mädchen die Treppe herabgerannt. In ihrem kurzen Haar trug sie eine große, weiße Schleife. Neugierig blickte sie von ihrer großen Schwester zu ihrem Vater.
»Wovon redet ihr?«
»Über nichts«, sagte Rosie leichthin. »Setz dich wieder an deine Hausaufgaben.«
»Aber gerade hast du noch gerufen, dass wir gleich essen.«
Rosie gab ihrer Schwester einen kleinen Schubs in Richtung Treppe. »Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Und jetzt los, beeil dich!«
»Ich darf auch nie etwas wissen«, murmelte Esther, sich wieder nach oben verziehend.
Erst als Esther außer Sichtweite war, ging Rosie in die Küche und schloss die Tür. Ihre Mutter und Izaak saßen am Tisch und blickten mit großen Augen auf die sternförmigen gelben Stofflappen, die vor ihnen ausgebreitet lagen. Izaak nahm einen Stern und betrachtete ihn. Er sagte nichts, aber Rosie sah, wie sich sein Kiefer anspannte.
»Solltest du nicht genug für die Kinder haben, kaufe ich mehr«, sagte ihr Vater und setzte sich neben seine Frau. Er nahm seine Brille ab und rieb sich die Augen.
»Ich denke, damit werden wir hinkommen.« Ihre Mutter nahm seine Hand und drückte sie fest. Dann schaute sie hoch zu Rosie, die immer noch in der Tür stand.
»Ich möchte, dass du die auf deine Kleidung nähst«, sagte sie und ging mit einem Stapel Sterne in der Hand zu ihrer Tochter. »Und vergiss nicht: Es wird allmählich wärmer. Also näh sie nicht bloß auf deinen Mantel.«
Rosie nahm die Sterne entgegen und schaute fassungslos zu ihrer Mutter, die ihrem Blick auswich und wieder am Tisch Platz nahm.
»Auf deinen Mantel, aber auch auf ein paar Kleider und die blaue Bluse, die du immer trägst. Und natürlich auf deine Schwesterntracht«, fuhr sie fort. Sie konnte ein Zittern in ihrer Stimme nicht ganz verbergen. »Auf die Vorderseite, links über deiner Brust. Und vergiss nicht: Sie müssen gut sichtbar sein.«
Rosie hielt die Stoffteile hoch. »Hier steht JOOD.«
»Was für eine intelligente Bemerkung«, sagte Izaak.
»Soll ich etwa mit dem Wort JUDE auf meiner Kleidung herumlaufen?«
»Hast du noch genug Garn in deinem Nähkasten oder möchtest du dir etwas von mir leihen?«, fragte ihre Mutter, als ob sie Rosie nicht gehört hätte.
»Sie wollen, dass wir alle mit einem Stern herumlaufen, und ihr findet das nicht verrückt?«, beharrte Rosie.
»Wage es nicht, wieder von vorn anzufangen«, sagte ihre Mutter.
»Aber …«
»Jetzt halt doch mal den Schnabel!«, unterbrach Izaak sie.
Rosie betrachtete die schlaff in ihrer Hand liegenden Sterne. Der Stoff besaß eine stumpfgelbe, fast ins Rötliche gehende Farbe. Die Linien des uralten Davidsterns waren mit dicken, schwarzen Farbstrichen gezogen. Die schwarzen Buchstaben des Wortes JOOD in der Mitte des Sterns schienen sie spöttisch anzugrinsen. »Und was kommt als Nächstes? Brandzeichen?«, rief sie mit sich überschlagender Stimme.
»Rosie, bitte …«, flehte ihr Vater.
»Bildet euch bloß nicht ein, dass ich so etwas trage!«, sagte sie und pfefferte die Sterne auf den Boden.
»Rosie Meijer, was soll ich nur mit dir anfangen?!«, rief ihre Mutter.
»Wir haben doch schon letzte Woche darüber gesprochen. Im Wochenblatt stand, dass es ab heute, dem 3. Mai, verboten ist, ohne einen solchen Stern auf die Straße zu gehen«, sagte ihr Vater ruhig. »Wir müssen uns alle an die Regeln halten.«
»Warum sollte ich?«
»Du bist fast achtzehn. Benimm dich doch nicht wie ein kleines Kind!«, herrschte ihre Mutter sie an.
»Wieso? Ihr behandelt mich ja noch wie ein Kind!«
Ihre Mutter presste die Lippen zusammen, bückte sich und las die Sterne auf. Dann nahm sie Rosies Hand und drückte sie hinein. »Ein Mädchen, das sich so stolz und dumm verhält und seine Mutter so anschreit, ist tatsächlich nicht mehr als ein Kind.«
Ratlos schaute Rosie von ihrer Mutter zu den flehenden Augen ihres Vaters. Dann zu Izaak, der mit verschränkten Armen dastand und fast unmerklich die Achseln zuckte. Jetzt tu es doch einfach, schienen sie alle auf ihre Art und Weise zu sagen. Fordernd … Flehend … Gereizt … Sie konnte ihre Niedergeschlagenheit nicht eine Sekunde länger ertragen und stürmte aus der Küche, während die Sterne abermals auf den Boden trudelten.
Erst bei der Magere Brug blieb Rosie stehen. Nachdenklich schaute sie in die Ferne. Wie wunderbar normal waren ihre Jugendjahre bisher gewesen, wie alltäglich ihre Sorgen … Murrend hatte sie sich früher an Feiertagen in die Synagoge mitschleppen lassen. Jetzt war jeder Jom Tow* eine zuckersüße Erinnerung. Sie vermisste die quälend langweiligen Theoriestunden in der Haushaltsschule, die nur durch die Gesellschaft ihrer Freundinnen erträglich gewesen waren.
Immer öfter kam es innerhalb der Familie Meijer zum Streit. Kein alltägliches Gezanke, sondern richtige, aus echten Sorgen heraus entstandene Auseinandersetzungen. Und wenn Rosie etwas überhaupt nicht leiden konnte, dann Sorgen. Sie war von Natur aus praktisch veranlagt und suchte gern nach Lösungen für Probleme. Und die derzeitige Situation, in der jeder jedem auch noch das Kleinste an Neuigkeiten oder hoffnungsvollen Gerüchten zu entlocken suchte, lag ihr so gar nicht.
Ihre kurzen Finger fuhren über das weiß gestrichene Brückengeländer. Sie trat dagegen und setzte dann ihren Weg fort. Als sie kurze Zeit später wieder hochschaute, sprangen ihr als Erstes die Worte JUDENVIERTEL und JOODSCHE WIJK auf dem Schild am Anfang der Jodenbreestraat entgegen. Unter dem Schild standen zwei deutsche Soldaten und unterhielten sich mit einem Polizisten.
Wie konnte ein Ort, der ihr so viele schöne Erinnerungen beschert hatte, sie jetzt so isolieren? Denn sie machte sich keine Illusionen: Ihre schöne Stadt glich zunehmend einem Gefängnis. Gefühle der Angst, Trauer und Ohnmacht begleiteten jetzt ihr Leben. Sie wurde mit Dingen konfrontiert, die sie nie für möglich gehalten hätte.
Den Laden ihrer Eltern hatte man ihnen weggenommen. Eines Tages hatte ganz unvermittelt die Polizei vor der Tür gestanden und ihr Vater musste den Beamten den Schlüssel aushändigen. Ein nicht-jüdischer Besitzer übernahm das Geschäft. Schon einen Tag später stand das Schild FÜR JUDEN VERBOTEN im Schaufenster und alles, wofür sich ihr Vater sein ganzes Erwachsenenleben hindurch abgerackert hatte, war dahin.
Und wenn sie an den Tag vor einem Jahr zurückdachte, als sie zur Direktorin der Haushaltsschule hatte kommen müssen, erschien ihr auch das wie ein schlechter Witz. Obwohl sie noch mindestens anderthalb Schuljahre vor sich gehabt hätte, hatte man ihr einfach ihr Abschlusszeugnis in die Hand gedrückt. Bitte sehr, und jetzt hopp, zieh Leine. Lieber ein unverdientes Abschlusszeugnis als eine Jüdin an der Schule.
Was sie allerdings am meisten verfolgte, waren die Selbstmorde. Vollkommen fassungslos war Esther mit der Nachricht nach Hause gekommen, dass ein Mädchen aus ihrer Klasse tot sei. Ihre Eltern hatten, einen Tag nachdem sie im Radio von der niederländischen Kapitulation gehört hatten, mit der gesamten Familie Selbstmord begangen. Sie waren nicht die Einzigen gewesen. Besonders Juden, die aus Deutschland geflüchtet waren, schienen ihr Los nicht abwarten zu wollen, nachdem die Nazis die Macht übernommen hatten. Rosie hatte gelernt, mit der Aggression, den höhnischen Bemerkungen auf der Straße und den verordneten Maßnahmen zu leben. Man gewöhnte sich verrückterweise daran und legte sich eine dickere Haut zu. Aber wenn sie an die Selbstmorde dachte, überlief es sie kalt. Wovor hatten die deutschen Juden eine solche Angst?
»Rosie, was tust du hier?«, klang eine bekannte Stimme direkt hinter ihr. Noch bevor er neben ihr stand, wusste sie schon, dass es Ben war. Ihr fiel ein, dass er gesagt hatte, er müsse noch zum Judenrat, und dessen Büro war hier um die Ecke. Wenn er nur nicht glaubte, sie würde ihm nachstellen.
Er folgte ihrem Blick. »Geht es dir nicht gut?«
»Meine Mutter möchte, dass ich mir solche Sterne auf die Kleidung nähe, und da ist mir überhaupt nicht danach.«
»Aha …«
»Ich verstehe nicht, warum sie so tun, als wenn nichts wäre. Gibt es denn niemanden, der einsieht, wie meschugge* das ist?«
»Ich weiß, ich weiß …« Ben warf einen Blick auf die Männer unter dem Schild. »Aber versuch doch bitte, jetzt ruhig …«
»Nein, ich bin nicht ruhig!«, schrie Rosie und stampfte mit den Füßen auf. »Ich hasse die Moffen! Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie! Ihr da«, sie zeigte auf die Soldaten, »ich hasse euch, ich hasse …«
Ben fasste Rosie am Arm. »Lass uns einen kleinen Spaziergang machen«, sagte er und zerrte sie weg, wobei er unruhig über seine Schulter blickte. Aber der Polizist und die Soldaten hatten nichts bemerkt.
»Ich kann schon selbst laufen«, fuhr sie ihn an und riss sich von ihm los.
»Dann mach bitte nicht solch einen Aufstand, ja? Ich verstehe, dass du außer dir bist, aber du musst dich wirklich ein bisschen zusammenreißen. Ich bringe dich jetzt nach Hause.«
»Ich bin nicht außer mir! Und ich habe keine Angst vor ihnen!«
»Izaak würde mich umbringen, wenn dir in meinem Beisein etwas zustieße, das weißt du genau.«
Rosie murmelte noch einige böse, unverständliche Dinge, während sie durch die Jodenbreestraat gingen. An Rosch ha-Schana* quoll die alte Straße immer über vor Ständen, die Karten und Kerzen feilboten. Sich das vorzustellen war angesichts der jetzt so leeren Straße nicht leicht. Die vereinzelten Leute, die sich doch auf die Straße gewagt hatten, warfen scheue Blicke um sich. Langsam ebbte Rosies Wut ab.
Sie bogen um die Ecke und kamen am Waterlooplein vorbei. Rosie dachte an das allsonntägliche Spektakel auf dem Markt zurück, an die schreienden Händler und den Taschenspieler mit dem kleinen Blechaffen auf der Schulter. Sie sah noch genau vor sich, wie ihre Mutter begeistert von Verkaufsstand zu Verkaufsstand ging und dabei haufenweise Wundermittelchen einkaufte, die sie alle unbedingt haben wollte, die aber nie irgendeine Wirkung zeigten.
»Ich kann immer noch nicht glauben, dass das alles hier wirklich geschieht«, sagte Rosie. »Freunde meiner Eltern, die neu aus Deutschland gekommen waren, sagten: ›Seht zu, dass ihr hier wegkommt. Deutschland ist nicht zu trauen.‹ Ein paar Monate später waren sie nach England weitergezogen.« Sie seufzte. »Und wir dachten immer, hier in Holland könnte uns das nicht passieren.«
»Die Deutschen spielen ein schlaues Spiel«, sagte Ben. »Sie geben uns möglichst wenig Informationen, die sich außerdem häufig ändern. Das habe ich durch meine Arbeit als Kurier für den Judenrat bemerkt. Ich denke …«, begann er, beendete seinen Satz aber nicht.
»Was? Was denkst du?«, drang sie in ihn.
Ben betrachtete sie nachdenklich und beschloss dann, fortzufahren. »Ich denke, das hier ist erst der Anfang. Es kommt noch viel schlimmer.«
Ein unangenehmer Schauder durchfuhr Rosie. Sie wusste nur zu gut, worauf er abzielte. Die Lager. Das Wort, das in so vielen Gesprächen auftauchte und mit einer Mischung aus Angst und Abscheu ausgesprochen wurde.
»Meinst du, sie schicken uns auch noch in diese Lager? So wie die Juden aus dem Osten?«, fragte sie.
»Ich weiß es nicht.« Und indem er sie direkt ansah, fuhr Ben fort: »Aber ich denke, wir sollten uns schon darauf vorbereiten.«
Seine Worte machten Rosie nachdenklich. Irgendwie hatte sie gehofft, er würde sie beruhigen und sagen, hier in den Niederlanden könnte das nicht geschehen. Dennoch erleichterte es sie, ihre Sorgen mit jemandem teilen zu können, der sie nicht gleich abwimmelte. Wenn das ihre Zukunft war, sollten sie sich besser darauf gefasst machen. Die Gerüchte über die Lager im Osten reichten vom Grotesken bis zum Undenkbaren, doch eines erschien ihr gewiss: Wer dorthin musste, hatte nur eine geringe Chance, wieder lebend zurückzukommen.
»Aber wie nur?«, fragte sie. »Wie soll ich mich auf etwas vorbereiten, wovon niemand weiß, ob es wirklich eintreten wird?«
»Das ist mir auch nicht ganz klar«, sagte Ben und fuhr nach kurzem Nachdenken fort: »Vertrau einzig auf deine eigene Intuition und auf nichts sonst. So denke ich darüber.«
»Ma ermahnt mich immer, erst besser nachzudenken, bevor ich etwas tue«, flüsterte Rosie.
»Manchmal soll man auf seine Eltern hören und manchmal nicht.«
Rosie wusste nicht recht, was sie darauf erwidern sollte. Nachdenklich betrachtete sie eine Haarlocke, die ihm vor die Augen fiel. Er strich sie achtlos weg und es war, als ob er mit dieser Bewegung ein Feuer in ihrem Bauch anfachte, das sich in ihrem gesamten Körper verbreitete. Plötzlich wurde ihr klar, dass sie Ben das erste Mal für sich allein hatte. Sie konnte ein Lächeln kaum unterdrücken.
»Das ist schön.«
»Was?«
»Mit dir über wichtige Dinge zu reden. Das tue ich nicht oft.«
»Ach … Ja, geht mir auch so«, sagte er und schien beinahe ein wenig aus dem Konzept gebracht.
Den restlichen Weg zu ihr nach Hause legten sie schweigend zurück.
Erst als sie bei ihrer Haustür ankamen, unterbrach Ben die Stille und legte ihr seine Hände auf die Schultern. »Sei bitte vorsichtig, ja? Du bist wie eine jüngere Schwester für mich und ich möchte nicht, dass du in Schwierigkeiten gerätst.«
Bei dem Wort »Schwester« verdüsterte sich Rosies Gesicht für einen Moment, aber dann nickte sie und sah ihn offen an. Noch nie war ihr aufgefallen, dass die Winkel seiner grauen Augen nach unten zeigten, genau wie seine Nasenspitze. Ihr Blick glitt tiefer von seinem einfachen Baumwollhemd zu seiner verschlissenen Hose. Aber selbst in einem Jutesack hätte sie ihn anziehend gefunden.
Mit Mühe wandte sie ihren Blick ab. »Ich gehe jetzt rein. Mich entschuldigen.«
Er nickte, ohne nach dem Weshalb zu fragen, so sehr war er das Gezänk im Hause Meijer gewohnt. »Bis bald, Rosie«, sagte er, hob grüßend die Hand, drehte sich um und ging.
Nach einem letzten Winken öffnete Rosie behutsam die Haustür. Es war still, was an sich schon eigenartig war in einem Haus, in dem alle immer brüllten. Auf Zehenspitzen schlich sie durch den Flur und ging leise die Treppe hinauf. Eigentlich wollte sie gleich in ihr Zimmer verschwinden, doch vor Esthers Zimmer blieb sie stehen. Ihre kleine Schwester saß mit gebeugtem Kopf auf dem Bett, in der Hand Nadel und Faden. Sie schaute hoch und erblickte Rosie. Das Licht, das durch die offene Tür fiel, spiegelte sich auf ihren nassen Wangen.
»Mein Garn ist fast alle.«
»Du darfst etwas von mir haben«, sagte Rosie.
»Aber ich darf deinen Nähkasten nie benutzen.«
»Heute machen wir eine Ausnahme.« Rosie trat ganz in Esthers Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Eine Weile schauten sie sich gegenseitig an, dann lächelte Rosie. Als sie das verwässerte Lächeln sah, mit dem Esther darauf reagierte, schwoll ihr das Herz. Sie setzte sich zu ihr aufs Bett, nahm ein Cape, auf das ihre kleine Schwester einen gelben Stern aufgenäht hatte, und betrachtete ihn gewissenhaft. »Das hast du gut gemacht.«
Esthers Miene erhellte sich. »Findest du?«
»Aber ja! Nur könnten die Stiche noch etwas kleiner sein. Komm, ich zeige es dir.« Sie nahm ein geblümtes Sommerkleid in die Hand. Stumm nähte sie den gelben Stern darauf, während Esther über ihre Schulter mitschaute.
»So«, sagte Rosie, als sie fertig war.
»Werden die Leute mich nicht auslachen?«, fragte Esther mit zitternder Stimme.
Rosie schaute ihre Schwester durchdringend an und dachte an ihren eigenen Gefühlsausbruch von vorhin. Und an ihr Gespräch mit Ben, an ihre Sorgen und Ängste für die Zukunft.
»Was immer geschieht, du trägst den Stern erhobenen Hauptes«, sagte sie ernst und umarmte ihre Schwester fest. »Was sie dir auch weismachen wollen, sei immer stolz darauf, wer du bist.«
3
Das Abendessen
Juni
»Wie steht es um deine Zwischenprüfung?«
»Sehr gut, Vater.«
Kaat setzte sich etwas anders hin und bewegte ihren Nacken und die steifen Schultern.
»Hast du noch irgendwelche Zensuren bekommen?«
»Dann hätte ich dir das schon erzählt.«
»Hast du keine Zensuren bekommen, weil keine Prüfungen stattgefunden haben oder weil du sie nicht gemacht hast?«
»Mir war gar nicht bewusst, dass das hier ein Kreuzverhör werden würde.«
»So spricht man nicht mit seinem Vater, Katherina«, sagte ihre Mutter. »Außerdem haben wir einen Gast«, fügte sie hinzu.
Kaat warf einen geringschätzigen Blick auf Cornelis Willemsen, einen glatzköpfigen Geschäftspartner ihres Vaters, dessen dicker Bauch beinahe aus seinem Dreiteiler platzte. Bei ihren Eltern verging kein Abendessen, ohne dass irgendwelche Gäste eingeladen wurden. Kaats Vater Gerard van Bronkhorst war ein stattlicher Mann. Alles an ihm atmete Erfolg und Reichtum. Die Anzüge ließ er sich in London schneidern, sein von Brillantine glänzendes schwarzes Haar war straff zurückgekämmt. Zu seinem einschüchternden Blick gesellte sich ein immer liebenswürdiges Lächeln, das seine Lippen umspielte.
Die Stille am Tisch wurde nur vom leisen Klappern des Bestecks unterbrochen. Kaats Mutter warf einen zufriedenen Blick in die Runde, in der Hand ein kristallenes Weinglas. Sie nippte achtlos daran und stellte es dann seufzend wieder ab.
Frida van Bronkhorst war bekannt für ihre Cocktailpartys und festlichen Diners. Und für ihre bezaubernde Schönheit, die sie im Gegensatz zu Kaat mit Hingabe einsetzte. Sie war von ausgewogener Anmut und besaß dazu ein strahlendes Lächeln. Es war, als würde sie mit den Jahren nur noch schöner. Sie strich sich leicht übers Haar, das in ihrem Nacken zu einem eleganten Knoten festgesteckt war. Ihr dunkelgraues Kleid war tief ausgeschnitten und goldene Ohrringe schmückten ihr Gesicht. Frida van Bronkhorst war nie düster und unhöflich, jedenfalls nicht vor anderen Leuten. Sie war das Musterbild der charmanten Gastgeberin und die perfekte rechte Hand eines reichen Ingenieurs aus gutem Hause. Genau wie Kaats Großmutter es sie gelehrt hatte und wie sie es sich auch von Kaat für später erhoffte.
Es war, als sähe Kaat ihr eigenes Spiegelbild in zwanzig Jahren. Und sie verabscheute dieses Zukunftsbild. Oberflächliche Schönheit ohne einen Funken von Tiefgang und Sinngebung: jeden Abend mit anderen Gästen tafeln und herzlich über Witze lachen, die überhaupt nicht lustig waren, Menschen schmeicheln, die kein Kompliment verdienten, und Diskussionen in dem Augenblick beenden, wenn sie zu hitzig wurden.
»Wie geht es eigentlich dem lieben Pim?«, fragte ihre Mutter.
»Gut, ja.«
»Kommt er denn noch über die Runden?«, fragte ihr Vater, während er sich seinen schwarzen Schnauzbart zwirbelte.
»Ich weiß es nicht. Und falls dem nicht so wäre, würde Pim es mir sicher nicht erzählen.«
Ihr Vater wandte sich an seinen Gast. »Pim ist der Sohn von Jonathan Roelofsen.«
»Ach ja, Roelofsen«, sagte Willemsen. »Hat er nicht alles in der Krise* verloren? Ein glückloser Bursche.« Seine Weste machte alarmierende Geräusche, als er sich vorbeugte, um einen Bissen zu nehmen.
»Recht glücklos, ja.«
»Pflegst du denn auch noch Kontakte mit anderen?«, fragte ihre Mutter. »Du bist immer so schweigsam, wenn es um junge Männer geht.«
»Ach, lass sie doch, Frida«, sagte ihr Vater.
»Die jungen Leute von heute tun, wozu sie Lust haben. Sie lassen sich nichts mehr von uns sagen«, versuchte ihre Mutter sie aus der Reserve zu locken.
»Es ist der Krieg, der alles verändert«, sagte Kaats Vater. »Die jungen Leute leben, als könnte jeder Tag der letzte sein.«
»Frau van Bronkhorst, dieses Pferdefleisch ist köstlich. Wo haben Sie das her?«, fragte Willemsen, der seine Mundwinkel mit einer Damastserviette abtupfte, die noch von Kaats Ururgroßmutter stammte.
Seine Frage wurde mit einem bildschönen Lächeln beantwortet. »Wir haben eine gute Adresse auf dem Lande. Über Christine Oldenbarneveld. Sie bezieht schon seit Kriegsbeginn ihre gesamten Lebensmittel von dort. Es gibt immer weniger, aber zum Glück kann ich immer noch dies und jenes besorgen.«
»Haben Sie die Schlangen vor den Geschäften gesehen? Die Leute stehen gegenwärtig schon lange vor den Ladenöffnungszeiten an«, sagte Willemsen.
Unwillkürlich dachte Kaat, eine Weile vor einem Geschäft anzustehen wäre gar nicht so verkehrt für einen Mann, der fast aus allen Nähten platzte.
»Ich darf gar nicht daran denken«, sagte ihr Vater.
»Und meistens sind sämtliche Vorräte in einer Stunde ausverkauft«, sagte Willemsen.
»Was sagst du zu dem Essen, Liebes?«, fragte ihre Mutter.
Kaat hatte gerade einen Bissen genommen und nickte beifällig.
»Mir kommt es vor, als wärst du etwas abgemagert«, sagte ihre Mutter mit einem kritischen Blick auf Kaat. »Ich würde mir wünschen, du könntest wieder hier bei uns einziehen. Dann bekämst du zumindest jeden Tag gut zu essen.«
Aber sämtliches gute Essen der Welt zusammengenommen würde Kaat nicht dazu bewegen, wieder mit ihren Eltern unter einem Dach zu wohnen. Mürrisch entgegnete sie ihrer Mutter: »Ihr wollt doch, dass ich meine Zwischenprüfung mache! Das würde schwierig, wenn ich wieder zu Hause wohnen würde, oder etwa nicht?«
»Unsinn«, sagte ihr Vater. »Du kannst prima hier lernen und zu den Prüfungen nach Amsterdam fahren, das weißt du doch.«
»Was studierst du?«, fragte Willemsen zu Kaat gewandt.
»Jura.«
»Soso, das ist keine Kleinigkeit«, sagte er höflich. »An der Gemeente Universiteit*, nehme ich an?«
Sie nickte.
»Die Universitäten sind ganz anders als früher, Willemsen«, sagte ihr Vater. »Mädchen und Jungs verkehren heutzutage ganz frei miteinander, ohne Anstandsdame.«
»Gewiss, gewiss … In Kriegszeiten geht alles.«
»Jedenfalls hoffen wir, dass Kaat ihre Zwischenprüfung möglichst rasch besteht. Wer weiß, wie lange die Universitäten noch geöffnet bleiben. Man sehe sich nur an, was in Leiden und Delft passiert ist.«
»Gerard, keine Politik bei Tisch, bitte«, sagte Kaats Mutter.
»Zum Glück liegen die letzten großen Unruhen schon wieder Monate zurück«, sagte Willemsen. »Die Frage ist nur, wie lange das noch so bleiben wird.« Er schnippte mit den Fingern und deutete auf sein Glas, woraufhin Greet, die Haushälterin, sofort nachschenkte. »Die ganzen jüdischen Männer wurden damals ja nach Mauthausen* deportiert. Das war doch im …?«
»… im Februar letzten Jahres«, ergänzte Kaats Vater.
»Ja, im Zusammenhang mit den Streiks in Amsterdam. Wie viele hat man da noch mal festgenommen?«
»Hunderte. Und wie es scheint, sind fast alle ums Leben gekommen.« Er schaute ernst zu Willemsen.
»Die armen, armen Familien«, flüsterte Kaats Mutter und nahm einen großen Schluck Wein.
»Es ist immer eine kleine Gruppe, die es für alle Übrigen verderben muss. Die aggressive Haltung der Kommunisten hat das Fass zum Überlaufen gebracht«, sagte Kaats Vater.
Kaat bedachte ihn mit einem grimmigen Blick. »Du meinst also, alle sollten ihr Leben ganz normal weiterführen, obwohl die Juden wie Tiere behandelt werden?«
»Ein weiser Mann weiß, wann er besiegt ist. Hätte dieses jüdische Gesindel sich nicht zusammen mit dem Amsterdamer Pöbel diese Prügeleien mit der WA geliefert, wären all die unschuldigen jüdischen Männer nicht verhaftet worden.«
»Immer diese Kommunisten«, sagte Willemsen kopfschüttelnd.
Kaats Vater schmatzte mit den Lippen und wischte sich den Mund ab. »Es ist eine Frage des rationalen Abwägens. Besser ein Arbeitslager als ein Straflager, will mir scheinen.«
»Der Krieg wird ohnehin nicht mehr lange dauern«, sagte Willemsen. »Erst recht nicht mit diesen neuen Flugapparaten.«
»Eine Frage von Monaten, in der Tat.«
»Du glaubst also, die Juden werden in deutsche Arbeitslager geschickt?«, fragte Kaat ihren Vater.
»Jeder weiß doch, dass die Deutschen einen kriegsbedingten Mangel an Arbeitskräften haben.«
»Lasst uns bitte von etwas anderem sprechen«, sagte Kaats Mutter mit einem gezwungenen kleinen Lächeln.
»Willemsen, wollen wir uns in die Bibliothek zurückziehen?«, fragte Herr van Bronkhorst, während er sich von der Tafel erhob und sein Jackett wieder zuknöpfte.
Kaats Mutter stand auf, ging zu ihrer Tochter und strich ihr übers Haar. »Bleibst du über Nacht, Liebes?«
Kaat zog den Kopf weg. »Ich muss fort. Ich will vor der Sperrstunde zu Hause sein.«
Ihre Mutter warf einen besorgten Blick auf die Standuhr in der Ecke. »Schaffst du das denn noch?«
»Übertreib nicht so, Frida, unsere Tochter kann hervorragend auf sich selbst achtgeben«, sagte ihr Vater.
»Ich bitte Greet, dir etwas zu essen einzupacken. Brauchst du auch Geld?«
Bevor Kaat reagieren konnte, legte ihr Vater ihr seine Hand auf die Schulter. »Bald gibt es alles ohnehin nur noch gegen Bezugsscheine. Außerdem willst du ja unbedingt eigenständig wohnen, dann musst du eben auch lernen, für dich selbst zu sorgen.« Er fasste sie unterm Kinn und schaute sie streng an. »Hab ich recht?«
Kaat rang sich ein Lächeln ab. »Ja, Vater.«
»Ausgezeichnet. Ich lasse Hans mit dem Wagen vorfahren, er bringt dich dann zum Bahnhof.«
Die Fenster der Villa standen offen und die Vorhänge wehten sanft im Wind. Draußen war das Auto schon vorgefahren. Hans hielt die Wagentür auf und Kaat nahm auf der Rückbank Platz. Langsam verschwand die Villa ihrer Eltern hinter den hohen Eichen, als Hans die Auffahrt hinabfuhr.
Am Bahnhof von Utrecht herrschte eine nervöse Geschäftigkeit. Menschen hasteten zu ihren Zügen. Obwohl Kaat das Angebot ausgeschlagen hatte, leistete ihr Hans Gesellschaft, während sie auf den Zug wartete. Sie vermutete, dass ihre Mutter ihn entsprechend instruiert hatte. Fünf Soldaten kamen an ihr vorbei und grüßten sie, indem sie ihre Mütze entweder abnahmen oder kurz darantippten. Etwas später fuhr der Zug kleine Dampfwolken ausstoßend in den Bahnhof ein. Als er mit quietschenden Bremsen zum Stehen kam, drängten sich die Reisenden vor den Türen. Kaat verabschiedete sich von Hans und stieg ein. Sie zwängte sich zwischen zwei Soldaten hindurch, die Personalausweise* kontrollierten, und entdeckte ein leeres Erste-Klasse-Abteil. Sie hatte ihr Hütchen und die Handschuhe noch nicht neben sich gelegt, da fragte sie der Schaffner bereits nach ihrer Fahrkarte.
»Sie sind die Tochter von Herrn van Bronkhorst?«, fragte der Mann, nachdem er den Fahrausweis eingehend gemustert hatte.
Sie nickte.
»Dann wünsche ich eine gute Fahrt, Fräulein van Bronkhorst«, sagte er und gab ihr den Fahrschein zurück.
Die untergehende Sonne färbte den Himmel in einer atemberaubend schönen Palette aus Blau, Rosa und Gelb, vor der sich die schmalen Giebel der Amsterdamer Häuser und der Kirche Sint Nicolaas als dunkle Silhouetten abzeichneten. Sie schaute auf die Uhr vorm Bahnhof und beschleunigte ihren Schritt, denn es war schon kurz vor acht.
Müde schlurfte sie die Treppe hinauf, als hätte die Stippvisite bei ihren Eltern ihr sämtliche Energie entzogen. Als sie Stimmen hinter der geschlossenen Küchentür vernahm, blieb sie stehen. Pim und Anne zuckten zusammen, als sie die Tür öffnete.
»Bist du jetzt schon von deinen Eltern zurück?«, fragte Anne erstaunt.
»Natürlich, ich musste mich sogar beeilen. Die Sperrstunde hat angefangen.«
»Ist es schon so spät?«, fragte Anne zerstreut und mit einem Lächeln für Kaat, nachdem sie zuvor einen flüchtigen Blick auf Pim geworfen hatte.
Der las aufmerksam in Het Parool*.
»Möchtet ihr noch etwas Gesellschaft?«, fragte Kaat.
»Äh …«, sagte Anne, während Pim sich, ohne von seiner Zeitung hochzusehen, laut in die Faust räusperte. Wieder bedachte sie Kaat mit einem Lächeln, sagte aber weiter nichts.
»Schon gut«, sagte Kaat. »Ich bin eigentlich auch recht müde.«
»Gute Nacht!«, erwiderten Pim und Anne gleichzeitig.
Sobald Kaat die Tür hinter sich geschlossen hatte, wurde das Gespräch in einem dringlichen Flüsterton fortgeführt. Verwirrt grübelte sie in ihrem Zimmer darüber nach, was für Geheimnisse ihre Freunde wohl vor ihr hatten.
4
Hinter verschlossenen Türen
Juni
»Bist du bereit, Judith?«, fragte Rosie, als sie die geräumige Eingangshalle mit der hohen, gewölbten Decke betrat. Ihre Absätze klapperten auf dem Marmorfußboden.
»Ich denke schon«, sagte Judith. »Was meinst du, geht das so?«
Rosie umkreiste ihre Freundin prüfend. Ihr Blick glitt von dem runden Brillengestell zu den dünnen Beinen, die unter der blauen Schwesterntracht hervorlugten. »Du hättest den Saum auslassen können«, sagte sie.
Judith wurde rot und zupfte an dem Kleid. »Das habe ich schon getan.«
»Ach«, sagte Rosie. »Ist jetzt ohnehin nicht mehr zu ändern. Also, wollen wir los?«
»Erst bringe ich die hier noch rasch zu Vater.« Judith hielt einen kleinen Stapel Briefe hoch und ging damit die breite Holztreppe hinauf. Nach einem kurzen Zögern folgte Rosie ihr. Sie hatte keine Lust, in dieser düsteren, verdunkelten Eingangshalle auf Judith zu warten.
»Ich glaube, er ist in einer Besprechung«, sagte Judith mit dem Ohr an der Tür.
»Tatsächlich?«, fragte Rosie neugierig und folgte Judiths Beispiel. Auf der anderen Seite der Tür waren zwei Männerstimmen zu hören. Sie schob Judith beiseite, damit sie besser horchen konnte.
»Also wirklich!«, flüsterte Judith tadelnd, aber Rosie beachtete sie nicht und lauschte konzentriert.
»Das heißt, die erste Gruppe muss schon in zwei Wochen fort?«, hörte sie die eine sagen.
»Sie wollen, dass wir alle schnellstmöglich informieren«, erwiderte die andere.
Es war still.
»Ich schlage vor, dass wir für heute Nachmittag eine Dringlichkeitssitzung einberufen.«
Rosie konnte gerade noch zurückspringen, als ein hochgewachsener Mann im tadellosen schwarzen Anzug die Tür öffnete und mit großen Schritten an ihnen vorbeieilte.
»Ach, guten Morgen, Judith«, sagte der Mann abwesend, als er die zwei Freundinnen bemerkte.
»Guten Morgen, Mijnheer«, sagte Judith leise, aber der Mann achtete schon nicht mehr auf sie.
Rosie zog ihre Freundin am Ärmel. »Was war das denn?«
»Ich weiß es nicht, aber es klang ernst.«
Ein unangenehmes Gefühl beschlich Rosie. »Ging es vielleicht um die Arbeitslager?«, flüsterte sie.
Judith dachte kurz nach. »Nein, bestimmt nicht. Ich habe meinen Vater überhaupt nicht davon reden hören. Außerdem glaube ich nicht, dass es so weit kommt. Nicht hier bei uns in Holland.«
Rosie nickte grübelnd.
»Judith?«, tönte es aus dem Zimmer. »Bist du das?«
Judith warf Rosie einen strengen Blick zu und hielt ihren Zeigefinger an die Lippen, bevor sie die Tür weiter öffnete.
Hinter einem Mahagonischreibtisch studierte ein Mann mittleren Alters einen Stapel Dokumente. Über den Rand seiner Brille hinweg betrachtete er die jungen Frauen.
»Noch mehr Briefe, Vater«, sagte Judith und hielt sie in die Höhe.
»Ich danke dir«, sagte er, während er seine Brille absetzte und sich die Augen rieb.
Judith trat näher und legte ihm die Briefe auf den Schreibtisch.
Ihr Vater nahm den obersten und schlitzte ihn mit einem silbernen Brieföffner auf.
»Ist heute nicht dein erster Tag in der Kinderkrippe?«, fragte er, ohne den Kopf zu heben.
»Ja, Vater.«
»Richtig … Genau … Wird auch langsam Zeit, dass du dich nützlich machst«, sagte er abwesend, während er aufstand und ans Fenster trat.
»Vater?«, fragte Judith vorsichtig, während ihr Vater bedrückt nach draußen blickte. »Ist alles in Ordnung?«
»Wie bitte? Aber ja doch, natürlich«, sagte er geistesabwesend. »Ich muss gleich ins Büro. Heute Abend musst du mir mehr von deinem Tag erzählen«, fuhr er fort, während er zu Hut und Spazierstock griff. »Gibst du gut auf meine Tochter acht, Rosie?«
»Gewiss doch, Herr Jacobs.«
»Dann schnell fort mit euch.«
»Tschüs, Vater.«
»Einen schönen Tag, Herr Jacobs.«
Rosie wollte schon die Treppe hinabsteigen, blieb jedoch stehen, als sie sah, dass Judith zu einer anderen Tür gegangen war und dort leise anklopfte.
»Mutter?«, flüsterte sie, bekam aber keine Antwort.
Rosie verspürte ein stechendes Mitleid. Sie dachte an das ewige Gezänk bei sich zu Hause, das sie der kühlen Atmosphäre hier hundertmal vorzog. Sie ging zu Judith und zog sie sanft an der Hand. »Komm, wir gehen.«
Auf dem Weg nach unten tat Rosie so, als hätte sie nicht bemerkt, dass Judith sich rasch eine Träne vom Gesicht wischte.
»Du vergisst dein Häubchen«, sagte Rosie und angelte es vom Garderobenständer. Sie musste sich auf die Zehenspitzen stellen, um es oben auf Judiths dunklem Haar festzustecken. »So«, sagte sie und zwickte sie fest in die Wange.
Schweigend überquerten sie die Amstel und bogen um die Ecke in die Nieuwe Kerkstraat ein. In groben weißen Krakeln war das Wort JOOD quer über ein Schaufenster gepinselt, umgeben von Hakenkreuzen, die aussahen wie ein Gewirr von Spinnen. Rosie wandte ihr Gesicht ab. Sie brauchte sich nicht auch noch selbst zu quälen.
An der Kreuzung von Plantage Kerklaan und Plantage Middenlaan kam Tram Nummer 9 mit viel Lärm angefahren. Judith wollte die Straßenbahn erst vorbeilassen, aber Rosie ergriff ihre Hand und im Laufschritt überquerten sie die Straße.
Auf der anderen Seite zwängte sie sich zwischen zwei Polizisten hindurch, die sich unterhielten. »Sehr praktisch, so ein Teekränzchen mitten auf der Straße«, brummte sie.
»Entschuldigung«, murmelte Judith den erstaunten Beamten zu und sah Rosie ermahnend an. »Benimm dich bitte ein wenig!«
»Warum? An deinem ersten Tag dürfen wir nicht zu spät kommen.«
»Du hast es immer eilig, auch wenn du nicht spät dran bist.«
Kurz darauf standen sie vor einem Gebäude mit hohen Fenstern und einem zierlichen, von zwei Säulen flankierten Torbogen. Die zweiflügelige Tür stand offen und bot Aussicht auf eine dahinterliegende Eingangshalle.
»Betje!«, rief Rosie einem hübschen Mädchen mit rosigen Wangen zu, die gerade den Fußboden wischte. Sie trug die gleiche Kleidung wie Rosie und Judith: ein knielanges blaues Kleid mit einer weißen Schürze und einem weißen Häubchen auf dem hellbraunen Haar. Das Mädchen näherte sich Rosie und Judith und setzte sich seufzend auf die Eingangsstufe.
»Ihr habt Glück«, sagte sie mit einer hohen, leisen Stimme, als würde sie flüstern. »Ihr habt gerade das Läuserechen verpasst.«
»Das Läuserechen?«, fragte Judith.
»Das Entlausen«, sagte Rosie. »Eine leidige Aufgabe.« Sie zeigte auf eine kleinere Tür neben dem Haupteingang, worüber der Schriftzug SÄUGLINGSANSTALT UND KINDERHEIM prangte. »Diese Tür da führt zum Empfangsraum, wo die Eltern ihre Kinder abgeben müssen. Dort kontrollieren wir sie auf Läuse und versorgen sie mit sauberer Kleidung. Und das ist auch gut so. Manche Kinder sind schmutziger als streunende Katzen.«
»Bist du nervös?«, wollte Betje von Judith wissen.
»Nein«, sagte Judith. »Ich wüsste auch nicht, weshalb.«
»Denk bloß nicht, du könntest in nächster Zeit auf der faulen Haut liegen«, erwiderte Rosie scharf. »Du kannst von Glück sagen, dass du hier arbeiten darfst.«
»Ich würde einfach so gern wieder zurück in die Krankenpflege«, sagte Judith leise.
»Bestimmt wird es dir hier gefallen. Die Kleinen sind sehr lieb«, sagte Betje zärtlich. »Es geht doch nichts über den Geruch von so einem Kindchen.«
»Geh schon hinein«, sagte Rosie und schob Judith zur Tür. »Gleich denkt die Direktorin noch, wir wären zu spät gekommen.«
Betje und Rosie sahen Judith hinterher, als diese durch die Tür verschwand.
»Sie braucht einfach etwas Zeit«, flüsterte Betje. »Das arme Ding in dem großen Haus, ohne eine Beschäftigung. Mit einer Mutter, die den ganzen Tag im Bett liegt, und einem Vater mit so einer … nun ja … schwierigen Funktion.«
»Sprich mir nicht von Herrn Jacobs«, zischte Rosie, während sie gemeinsam hineingingen.
Von der Haustür führte ein langer Flur mit Türen zu beiden Seiten bis ganz ans Ende des Gebäudes, wo zwei spiegelbildlich angeordnete Wendeltreppen nach oben führten. Irgendwo weinte ein Baby. Ein kleiner Jack Russell mit braunen Flecken wieselte laut kläffend durch den Flur und sprang an Rosie und Betje hoch.
»Das ist Bruni, der Hund der Direktorin«, sagte Betje zu Judith und kraulte ihn hinter den Ohren.
»Guten Morgen, Eva!«, rief Rosie, als eine Kinderschwester mit pechschwarzem Haar und einem großen Muttermal neben dem Mund sich ihnen näherte.
»Wie ich sehe, wirst du hier arbeiten«, stellte Eva mit einem Blick auf Judiths Schwesterntracht fest.
»Ja, heute ist ihr erster Tag«, bestätigte Betje.
Ein paar junge Frauen beugten sich über die Balustrade des Zwischengeschosses, um Judith, der es die Röte ins Gesicht trieb, neugierig in Augenschein zu nehmen.
»Heißt das, wir haben wieder eine Neue?«, fragte eine etwa dreißigjährige Frau, die ihnen entgegenkam.
»Das ist Mirjam Bergman. Sie ist die Spielleiterin hier«, stellte Rosie sie vor.
»Eine undankbare Aufgabe, wie du dir sicher vorstellen kannst«, meinte Mirjam augenzwinkernd.
»Du kannst gern mit mir tauschen, weißt du. Dann darfst du den ganzen Tag dreckige Windeln wechseln«, entgegnete Rosie.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















