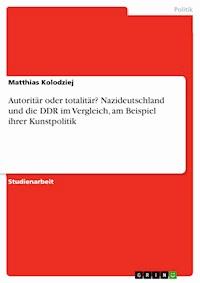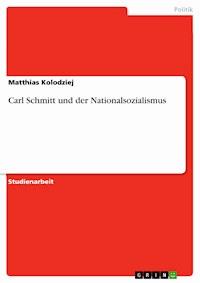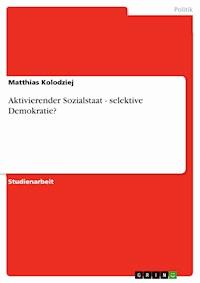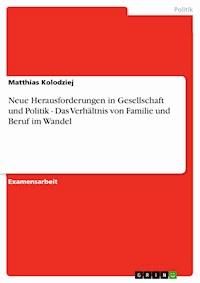
Neue Herausforderungen in Gesellschaft und Politik - Das Verhältnis von Familie und Beruf im Wandel E-Book
Matthias Kolodziej
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Politik - Sonstige Themen, Note: 2,0, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Sprache: Deutsch, Abstract: „Deutschland ist nicht familienfreundlich!“1, sagt Malte Ristau, Leiter der Abteilung Familienpolitik, Wohlfahrtspflege und bürgerschaftliches Engagement im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), und zeigt dabei vor allem auf die Ignoranz von Wirtschaft und Medien im Bezug auf Familienpolitik. Tatsächlich spielte die Familie noch zur Regierungszeit Gerhard Schröders eine nachgeordnete Rolle, was nicht zuletzt durch dessen bekannte, herabwürdigende Bezeichnung für das Bundesministerium als Ministerium für „Familie und das ganze Gedöns“ deutlich wurde. Das BMFSFJ ist heute das kleinste Ministerium, es hat ein geringes Budget, nur wenig Personal und vergleichsweise wenig gesetzliche Kompetenzen. Vielleicht ist es deswegen mit Ursula von der Leyen, einer streitbaren siebenfachen Mutter, prominent besetzt. Ihr gelang es, das Thema Familie vom Rand in das Zentrum der politischen Diskussion zu führen. Familie, Familienpolitik und nicht zuletzt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind in der Wissenschaft und in der Politik so präsent wie selten zuvor. Bei Politikern ist die Familie zu einem Kernthema geworden, Parteien des gesamten Spektrums bemühen sich um die Gunst von Familien. Dabei ist Familienpolitik auch immer ein ideologisch aufgeladenes Politikfeld, wie es zum Beispiel die Diskussionen um den Familiennachzug im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes zeigen2. Auch das Volksbegehren „Für ein kinder- und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt“ aus dem Jahr 20053 war ein deutliches Zeichen dafür. Selbst die Reaktion auf Eva Hermans Entgleisungen und ihre vehemente Verteidigung des selbst entwickelten „Eva-Prinzips“ zeigt die vielfältige Beachtung des Themas Familie in den Medien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2008
Ähnliche
Page 1
Page 4
Vorwort
Rosemarie Nave-Herz verweist in ihrem Buch „Familie heute“ auf die große Bedeutung eigener familiärer Erfahrung, welche Rezipienten der Beurteilung wissenschaftlicher Aussagen zu Familienproblemen stets einräumen. So stehen Arbeiten wie die Folgende oft vor dem Dilemma, dass die inhaltlichen Ausführungen mit eben diesen Erfahrungen intensiv verglichen werden. Stimmen beide Seiten überein, wird dem Leser nur Bekanntes präsentiert, im gegenteiligen Fall erwachsen ihm Zweifel. Der Ausweg aus dem Dilemma ist mir nicht bekannt, es bleibt zu hoffen, dass dem Leser ein stetiger Wechsel zwischen ohnehin Bekanntem und Zweifelhaftem erspart bleibt. Ich bin verheirateter Vater zweier Kinder. Meine Ehefrau und ich verfolgen zahlreiche Interessen. Vor allem wollen wir aber beruflich erfolgreich arbeiten und gleichzeitig ein glückliches Familienleben führen. Wir glauben, dass diese beiden Lebensbereiche einander bedingen und Voraussetzungen für eine erfüllte und glückliche Ehe sind. In unserer Familie ist es selbstverständlich, dass wir diese Herausforderung gemeinsam bewältigen wollen. Wir können uns dabei auf ein intaktes und über die Maßen nützliches Netzwerk aus Familienangehörigen, Freunden und Institutionen stützen. Wir haben uns daher sehr früh für Kinder entschieden, in dem Bewusstsein, dass es den „idealen Zeitpunkt“ nicht gibt. Wir glaubten, dass die Zeit des Studiums alle Rahmenbedingungen bietet, welche Elternschaft am ehesten möglich machen. Die Vorteile dieser Entscheidung, aber auch die Sorgen und Nöte auf dem beschrittenen Weg sowie die gesellschaftlichen Probleme um Familie, Ehe und Elternschaft haben mich inspiriert, diese Arbeit zu schreiben. Sie soll ein Plädoyer für die bewusst frühe Elternschaft sein.
So danke ich meiner Frau Angela und meinen Eltern Marlies und Rolf, dass sie mich bei der Fertigstellung dieser Arbeit so tatkräftig unterstützt haben, auf ihre Kritik und ihre nützlichen Hinweise sind manche Verbesserungen und Ergänzungen zurückzuführen. Meinen Kindern danke ich dafür, dass sie den gestressten Papa so tapfer ertragen haben.
Page 5
1. Einleitung
„Deutschland ist nicht familienfreundlich!“1,
sagt Malte Ristau, Leiter der Abteilung Familienpolitik, Wohlfahrtspflege und bürgerschaftliches Engagement im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), und zeigt dabei vor allem auf die Ignoranz von Wirtschaft und Medien im Bezug auf Familienpolitik. Tatsächlich spielte die Familie noch zur Regierungszeit Gerhard Schröders eine nachgeordnete Rolle, was nicht zuletzt durch dessen bekannte, herabwürdigende Bezeichnung für das Bundesministerium als Ministerium für „Familie und das ganze Gedöns“ deutlich wurde. Das BMFSFJ ist heute das kleinste Ministerium, es hat ein geringes Budget, nur wenig Personal und vergleichsweise wenig gesetzliche Kompetenzen. Vielleicht ist es deswegen mit Ursula von der Leyen, einer streitbaren siebenfachen Mutter, prominent besetzt. Ihr gelang es, das Thema Familie vom Rand in das Zentrum der politischen Diskussion zu führen. Familie, Familienpolitik und nicht zuletzt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind in der Wissenschaft und in der Politik so präsent wie selten zuvor. Bei Politikern ist die Familie zu einem Kernthema ge-worden, Parteien des gesamten Spektrums bemühen sich um die Gunst von Familien. Dabei ist Familienpolitik auch immer ein ideologisch aufgeladenes Politikfeld, wie es zum Beispiel die Diskussionen um den Familiennachzug im Rahmen des Zuwanderungsgesetzes zeigen2. Auch das Volksbegehren „Für ein kinder-und jugendfreundliches Sachsen-Anhalt“ aus dem Jahr 20053war ein deutliches Zeichen dafür. Selbst die Reaktion auf Eva Hermans Entgleisungen und ihre vehemente Verteidigung des selbst entwickelten „Eva-Prinzips“ zeigt die vielfältige Beachtung des Themas Familie in den Medien. So werden Familienbündnisse gegründet, Familiengipfel abgehalten und die Familienfreundlichkeit von Unter-
1Ristau,M.: Der ökonomische Charme der Familie, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, (2005)23-24, S. 16-23, S. 16.
2Vgl. Butterwegge, Chr.: Familie und Familienpolitik im Wandel, in: Butterwegge, Chr.; Klundt, M. (Hrsg.): Kinderarmut und Generationengerechtigkeit. Familien- und Sozialpolitik im demografischen Wandel, Opladen ²2003, S. 225-242, S. 225.
3Ziel war es, den Betreuungsanspruch von Kindern arbeitsloser Eltern auf 5 Stunden am Tag zu reduzieren, um auf diese Weise große Geldsummen einzusparen, dies ging einher, mit einer drastischen Erhöhung des Betreuungsschlüssels, womit eine deutliche Arbeitszeitreduktion der Kindergartenerzieherinnen und Erzieher verbunden war. In dessen Rahmen wurde mit viel Polemik seitens der Landesregierung gegen arbeitslose Mütter und Väter, die ihre Kinder angeblich nicht zuhause haben wollen, Stimmung gemacht. Auf sämtliche anderen Aspekte des neuen Gesetzes wurde in der öffentlichen Diskussion nicht eingegangen. Aktuell scheint sich die Lage dahin gehend zu verändern, dass die CDU/SPD Landesregierung die damals verringerten Betreuungszeiten, welche in dem ironischer Weise mit „Kinderförderungsgesetz“ betitelten Gesetz festgelegt wurden, wieder ausweiten möchte. Dabei wird gar ein kostenloses letztes Kindergartenjahr diskutiert, ein nicht ganz so leicht nachvollziehbarer Gedanke!
Page 6
nehmen und Institutionen festgestellt und bewertet. All dies geschieht unter stetig steigender Beachtung in der Medienlandschaft.
Die wissenschaftliche Literatur zum Thema ist kaum noch zu überschauen. Die Familie steht im Zentrum der Forschungen zahlreicher Wissenschaften, Soziologen, Psychologen, Wirtschaftswissenschaftler und nicht zuletzt die Politologen zeigen ein großes wissenschaftliches Interesse am Thema. Warum ist dies so? Zum einen werden immer wieder die wirtschaftlichen Herausforderungen des demografischen Wandels angeführt, demnach sei es ein großes Problem, dass immer weniger Kinder geboren werden. Zum anderen wird angeführt, dass der Geburtenrückgang auf einen Werteverlust im Bezug auf Ehe und Familie sowie auf einen Bedeutungsverlust und teilweisen Zerfall traditioneller Leitbilder zurückzuführen sein. Die einzelnen Wissenschaften versuchen nun, diesem Problem auf ihren jeweiligen Fachgebieten auf den Grund zu gehen. Als Faktum bleibt zumindest stehen, dass der demografische Wandel als ein Problem erkannt wurde, welches zahlreiche Folgewirkungen hat. Immer wieder wird dabei aus einer ökonomischen Sichtweise argumentiert, von Fachkräftemangel und volkswirtschaftlichem Schaden gesprochen, es werden ganze Familienwirtschaftstheorien entwickelt und Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften auf Familien übertragen. Dabei seien hier mit der Humankapitaltheorie4, der Theorie interfamilialer Zeitallokation5oder der endogenen Fertilitätstheorie6nur einige wenige genannt. Dieses Vorgehen kann indes als äußerst problematisch betrachtet werden. Eine Analyse familialen Verhaltens mithilfe ökonomischer Modelle unterstellt letztendlich, dass eben dieses das Ergebnis nutzenoptimierender Entscheidungen der Familienmitglieder ist7. Das würde zugespitzt bedeuten, dass sich Paare allein aufgrund einer Kos-
4LautFranz-Xaver Kaufmann wird unter Humankapital die Gesamtheit der Kompetenzen verstanden, welche die einer Gesellschaft zuzurechnenden Individuen in die verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhänge, wie Wirtschaft, Staat, Kultur, Familie, einbringen. Vgl. Kaufmann, F.X.: Keine Glückwünsche. Replik auf den Beitrag Max Wingens: Anmerkungen zu 50 Jahren Familienministerium in Rück- und Ausblick, in: Zeitschrift für Familienforschung, 15(2003)3, S. 299-302, S. 300.
5Laut Jörg Althammer versucht diese Theorie die Wirkung familienpolitischer Instrumente auf die Arbeitsverteilung innerhalb der Familie zu untersuchen. Darüber hinaus wird durch die Untersuchung der innerfamiliären Arbeitsteilung und des Rollenverständnisses von Mann und Frau versucht zu ermitteln, welche Produktivität die einzelnen Familienmitglieder haben. Aus den Ergebnissen sollen dann Handlungsanleitungen für die Familienpolitik abgeleitet werden. Vgl. Althammer, J.: Ökonomische Theorie der Familienpolitik. Theoretische und empirische Befunde zu ausgewählten Problemen staatlicher Familienpolitik, Heidelberg 2000, S. 55ff.
6Im ökonomischen Ansatz werden die Entscheidungen über Fertilität (Fruchtbarkeit), Erziehung und Ausbildung von Kindern als Konsumprozess der Elterngeneration verstanden, demnach träten nachfolgende Generationen nicht als Individuen sondern als ‚Argumente’ der elterlichen Nutzenfunktion auf. Vgl. Althammer, J.: Ökonomische Theorie, a.a.O., S. 3.
7Vgl. Althammer, J.: Ökonomische Theorie, a.a.O., S. 2.
Page 7
ten-Nutzen-Rechnung für oder gegen die Ehe, beziehungsweise für oder gegen Kinder entscheiden. Ein anderes Forschungsfeld zeigt auf, dass sich Familien-freundlichkeit zum Beispiel in mittelständischen Unternehmen wirtschaftlich rechnet, weil sich allein durch familienfreundliche Maßnahmen mehr Umsätze und damit höhere Gewinne erzielen lassen. Der „methodische Imperialismus der Wirtschaftswissenschaften“8verstellt dabei allzu oft den Blick auf die Familie als soziale Instanz. Liebe, Partnerschaft und Elternschaft können heute nicht in erster Linie ökonomisch begründet werden. Sicherlich ist es auch ein ökonomisches Problem, wenn sich immer mehr Paare gegen Kinder entscheiden. In erster Linie ist es jedoch ein soziales und gesellschaftliches Problem, denn nicht nur der daraus resultierende Arbeiter- und Fachkräftemangel ist höchst gefährlich, sondern vor allem das Fehlen neuen, jungen Lebens, welches eine Gesellschaft vital, innovativ und dynamisch hält. Eine Gesellschaft ohne Kinder ist insgesamt nicht zukunftsfähig. Ihre Zukunftsfähigkeit begrenzt sich, mathematisch leicht nachzuvollziehen, auf 30 bis 40 Jahre, nämlich auf die Zeit der aktiven Bevölkerung9. Die Familie ist wie kaum eine andere gesellschaftliche Institution grundlegenden Veränderungen unterworfen, eine fortschreitende Individualisierung, die Pluralisierung der Lebensformen und eine gewisse Enttraditionalisierung stellt sie vor eine existenzielle Herausforderung10. Im deutlichen Gegensatz zur allgemeinen Sozialpolitik, welche sich unter dem Leitbild des aktivierenden Sozialstaats und unter dem Motto „Sozial ist, was Arbeit schafft“ verstärkt auf dem Rückzug befindet, werden im Bereich der Familienpolitik die Leistungen nach Art und Umfang weiter ausgebaut. Eine Kindergelderhöhung, die Kinderfreibeträge und die neue Bewertung von Erziehungsleistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung sind familienpolitische Maßnahmen der Rot-Grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder, die Einführung des neuen Elterngeldes und der angestrebte Ausbau des Kinderbetreuungsangebots sind Wegmarken der großen Regierungskoalition unter Angela Merkel. Sie verdeutlichen einen gewissen familienpolitischen Paradigmenwechsel, auf den im Verlauf der Arbeit einzugehen ist. Diese Sonderstellung der Familienpolitik zeigt, dass über die prinzipielle Notwendigkeit staatlicher Sozialpolitik in diesem Bereich ein breiter Konsens herrscht und diese dabei auf
8Althammer, J.: Ökonomische Theorie, a.a.O., S. 2.
9Vgl. Bertram, H.; Rösler, W.; Ehlert, N.: Zeit, Infrastruktur und Geld: Familienpolitik als Zukunftspolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, (2005)23-24, S. 6-15, S.14.
10Vgl. Bertram, H.; Borrmann-Müller, R.: Individualisierung und Pluralisierung familialer Lebensformen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, (1988)13, S.14-23, S.14.
Page 8
eine breite gesellschaftliche Akzeptanz bauen kann. Deutschland soll sich bald zum familienfreundlichsten Land Europas entwickeln, Familienfreundlichkeit wird dabei seitens der Politik auch und vor allem als Standortfaktor der Zukunft begriffen.
Neben den demografischen und ökonomischen Problemkreisen haben wir es im Bereich der Familienpolitik auch mit gewissen Mentalitätsproblemen zu tun, die auf die deutsche Geschichte und den Untergang des Staatssozialismus zurückzuführen sind. Im vereinten Deutschland existieren immer noch verschiedene Grundmodelle familialen Zusammenlebens und verschiedene tradierte Geschlechterrollen. Während in den alten Bundesländern das Modell der Ernährerehe beziehungsweise das der Hausfrauenfamilie dominiert, haben wir es in den neuen Bundesländern vermehrt mit Familienmodellen zu tun, in denen beide Elternteile oder Partner erwerbstätig sind. Daher leiden Frauen in Ostdeutschland besonders unter dem Wegfall ihrer Arbeitsplätze und dem Abbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, was sie zu gleichberechtigten Partnerinnen ihrer Männer machte11. Es gehört zu den Leitbildern der so genannten nachhaltigen Familienpolitik, die Erwerbstätigkeit von Frauen zu steigern und gleichzeitig die Geburtenrate zu erhöhen. Konservative Familienpolitik verbindet jedoch die Erhöhung der Geburtenrate mit einer Reduktion der Erwerbsbeteiligung der Frau12. Nun scheint es so zu sein, dass die deutsche Familienpolitik die Reproduktion traditioneller Geschlechterrollen forciert13. Das Beispiel von Ländern wie Norwegen oder Irland zeigt indes auf, dass eine hohe Erwerbsbeteiligung der Frau nicht im Gegensatz zu einer hohen Geburtenrate stehen muss. Ungeachtet dessen kann heute darauf hingewiesen werden, dass sich die Bildungs- und Erwerbsbeteiligung von Frauen stark verbessert hat und die Abhängigkeiten von den Männern sinken. Die familienpolitischen Maßnahmen wie Elterngeld und der angestrebte Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes sind richtige Instrumente zur Verwirklichung dieses Ziels, leider haben diese Instrumente Herstellungsfehler, auf die im Laufe der Arbeit einzugehen ist. Die ungünstige demografische Entwicklung und der Geburtenrückgang, die wirtschaftlichen Herausforderungen, die durch den als Globalisierung bezeichneten Prozess entstehen und die verschiedenen gesellschaftlichen Mentalitäten und Auf-
11Vgl.Butterwegge, Chr.: Familie und Familienpolitik, a.a.O., S. 228.
12Vgl. Gruescu, S.; Rürup, B.: Nachhaltige Familienpolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, (2005)23-24, S. 3-6, S. 3.
13Vgl. Schmitt, C.: Familiengründung und Erwerbstätigkeit im Lebenslauf, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, (2007)7, S. 3-8, S. 6.
Page 9
fassungen zeigen die Probleme deutlich, denen hier nachzugehen ist. Deutsch-land ist nicht familienfreundlich, es steht vor großen Herausforderungen, um das Ziel einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erreichen. In der folgenden Arbeit sollen nun diese Probleme hinterfragt und diskutiert werden, im Vordergrund sollen dabei nicht ausschließlich ökonomische Denkansätze stehen. Die Problemfelder Familie und Familienpolitik, insbesondere die bestmögliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sind mit ökonomischen Erfordernissen eng verbunden, die hier auch zum Tragen kommen sollen. Darum soll das Verhältnis von Ökonomie und Familienfreundlichkeit untersucht werden. Es sollen Gründe für den Geburtenrückgang erörtert und der Frage nachgegangen werden, warum es heute für Frauen und Männer häufig ein Problem ist, Beruf und Familiengründung zu vereinen. Warum sind die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit beider Lebensbereiche so schlecht? Dabei soll auch gefragt werden, welcher Veränderungen es bedarf, um günstige Rahmenbedingungen zu schaffen14. Ein weiteres Problem zeigt der Zusammenhang zwischen dem Bildungsgrad der Frau und der erreichten beruflichen Position einerseits und der deutlichen Abnahme der Geburtenwahrscheinlichkeit andererseits. Circa 40% der Akademikerinnen entscheiden sich gegen Kinder, damit ist die Kinderlosigkeit gerade bei Akademikern sehr hoch. Daher soll der Vereinbarkeit von Familie und akademischer Berufslaufbahn ein besonderes Augenmerk gelten und hinterfragt werden, warum gerade für Akademikerinnen die Voraussetzungen zur Familiengründung so ungünstig sind. Dabei sollen Lösungsansätze aufgezeigt und kritisch beurteilt werden.
Zunächst wird es einen Grundlagenteil geben, in welchem geklärt werden soll, welches Gebilde sich hinter dem Wort Familie verbirgt. Des Weiteren soll hier dann auf den Wandel der Familie eingegangen werden, in dem die verschiedenen Modelle familialen Zusammenlebens dargestellt und diskutiert werden sollen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den bestehenden Unterschieden innerhalb
14Befragt man Paare, welche Faktoren ihrer Meinung nach zu einer besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen, treten drei Antworten am häufigsten auf. Demnach ist es auf der individuellen Ebene von großer Bedeutung, dass der Partner mit im Haushalt lebt und damit die Verantwortung und die Familienaufgaben geteilt werden können. Darüber hinaus sind für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf die Arbeitszeiten von großer Bedeutung. Neben einer flexiblen Arbeitszeit ist es Paaren sehr wichtig nicht am Wochenende und in der Nacht arbeiten zu müssen und eine Arbeit „auf Abruf“ vermeiden zu können. Als Drittes wird unter Familienfreundlichkeit verstanden, dass Mütter und Väter in ihren Familienpflichten undrechten durch ein entsprechendes Betriebsklima unterstützt werden. Geldleistungen spielen demnach eine sehr untergeordnete Rolle. Vgl. Klenner, C.; Schmidt, T.: Familienfreundlicher Betrieb - Einflussfaktoren aus Beschäftigtensicht, in: WSI-Mitteilungen. Monatszeitschrift des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung, 60(2007)9, S. 494-501, S. 494f.
Page 10
des vereinten Deutschlands. Im zweiten Hauptteil sollen die oben aufgerissenen Problemkreise um demografischen Wandel und ökonomische Betrachtungsmuster der Familie erörtert und die derzeitig geforderte nachhaltige Familienpolitik als Lösungsansatz diskutiert und bewertet werden. Hier soll dann auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eingegangen werden. In diesem Teil soll auch ein soziologischer Blick eröffnet werden und der Frage nachgegangen werden, ob die Familie heute überhaupt noch als ein Prinzip der sozialen Ordnung gelten kann. Im dritten Hauptteil soll, wie bereits angekündigt, besonders auf das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei Akademikern eingegangen werden. „Es ist Zeit für ein neues Leitbild: Mehr Kooperation für Kinder und Karriere!“15In diesem Sinne soll die Arbeit gesellschaftliche und politische Problemkonstellationen aufzeigen und so der Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter Vorschub leisten.
15Damme, N.; Dettling, D.: Kinder, Karriere und Kooperation. Familienpolitik nach dem Karlsruher Urteil, in: Neue Gesellschaft. Frankfurter Hefte (2001)6, S. 225-242, S. 328.
Page 11
Das Wort Familie, welches vom lateinischen Wortfamiliastammt und mit Hausgenossenschaft übersetzt werden kann, bezeichnet heute einen nicht mehr so einfach zu definierenden Begriff. In diesem Zusammenhang spielen Werte, gesellschaftliche Normen, Geschlechterverhältnisse, Rollenmuster und Emotionen wie Autoritäts- und Partnerschaftsmuster, subjektive Erfahrungen und Ideologien und nicht zuletzt die institutionelle Funktion der Familie in der Gesellschaft eine bestimmende Rolle. Da mit dem Begriff Familie kulturell sehr verschiedene Formen des Zusammenlebens beschrieben werden können, bedient sich die Soziologie zunächst des Terminus der „privaten Lebensform“, um die Struktur von privaten sozialen Beziehungen von Menschen zu bezeichnen. Die familiale Form ist demnacheinemögliche Form des privaten Zusammenlebens. Der Terminus wird darüber hinaus auch verwendet, um eine deutliche Scheidung vom oft negativ besetzten Begriff der „bürgerlichen Familie“ zu erwirken. Private Lebensformen werden dabei bevorzugt als relativ stabile Beziehungsmuster der Bevölkerung im privaten Bereich verstanden, die allgemein mit Formen des Alleinlebens oder Zusammenlebens mit Kindern beschrieben werden können16. Kriterien für die Abgrenzung verschiedener Lebensformen sind dabei das Vorhandensein eines Haushalts, eine gewisse Generationenzusammensetzung dieses Haushalts, die sozialrechtliche Stellung der Personen, die in diesem Haushalt leben, der Familienstand und die Kinderzahl17. Rosemarie Nave-Herz gibt als konstitutive Merkmale einer Familie Folgendes an:
„1. die biologisch-soziale Doppelnatur aufgrund der Übernahme der Reproduktions- und zumindest der Sozialisationsfunktion, neben anderen, die kulturell variabel sind, 2. ein besonderes Kooperations- und Solidaritätsverhältnis; denn über die üblichen Gruppenmerkmale hinaus [..] wird in allen Gesellschaften der Familie eine ganz spezifische Rollenstruktur mit nur für sie geltenden Rollendefinitionen und Bezeichnungen [..] zugewiesen, 3. die Generationendifferenzierung.“18.
16Vgl. Lauterbach, W.: Familie und private Lebensformen oder: Geht der Gesellschaft die Familie aus? in: Glatzer, W.; Ostner, I. (Hrsg.): Deutschland im Wandel. Sozialstrukturelle Analysen, Opladen 1999, S. 239-354, S. 239.
17Vgl. Zapf, W.: Individualisierung und Sicherheit - Untersuchungen zur Lebensqualität in der Bundesrepublik Deutschland, München 1987, S. 30.
18Nave-Herz, R.: Familie heute, Wandel der Familienstrukturen und Folgen für die Erziehung, Darmstadt ²2002, S. 15.
Page 12
Eine Familie wird demnach als „Verantwortungsgemeinschaft von mindestens zwei Generationen“19verstanden. Als deutsche „Normalfamilie“ gilt folglich ein verheiratetes Paar mit einem oder mehreren leiblichen Kindern20. Eben diese Gruppe von Eltern und Kindern wird dabei mit den Worten „Kernfamilie“ oder „Kleinfamilie“ bezeichnet und gilt als die für moderne Industriegesellschaften typische und adäquate Organisationsform21. Doch ist eben genau eine solche Normalfamilie begrifflich kaum fassbar, eine Abgrenzung zwischen Ehe, Familie und Verwandtschaft gibt es im sprachlichen Bereich nicht mehr. Singles, kinderlose Paare, nicht-eheliche Lebensgemeinschaften, alleinerziehende, Stieffamilien und gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften gelten im Sprachgebrauch ebenso als Familie wie Drei- beziehungsweise Vier-Generationen-Familien. Darüber hinaus umfasst die Bezeichnung Familie im Sprachgebrauch auch jene Personen, die zur Verwandtschaft zählen, also Onkel, Tanten oder Cousins22. Das Bundesfamilienministerium hat im Rahmen des vierten Familienberichts 1985 eine wissenschaftliche Definition von Familie veröffentlicht, demnach kann Familie „eine Gruppe von Menschen bezeichnen, die miteinander verwandt, verheiratet oder verschwägert sind, gleichgültig, ob sie zusammen oder getrennt leben, ob die einzelnen Mitglieder noch leben oder verstorben sind. Familie kann unabhängig von räumlicher oder zeitlicher Zusammengehörigkeit als Folge von Generationen angesehen werden, die biologisch oder rechtlich miteinander verbunden sind.“23Familie stellt zusammenfassend eine „Folge von Generationen“ dar, die „biologisch oder rechtlich“ miteinander verbunden sind. Die moderne Familie in Deutschland kann sich also als eine Form des Zusammenlebens darstellen, in der zunehmend ursprünglich verwandtschaftlich definierte Verhältnisse durch erworbene soziale Rechte ersetzt werden können24. Familie im rechtlichen Sinn ist also auch die Stieffamilie, die kinderlose Ehe oder die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare mit oder ohne Kinder. Soll Familie aus dem Blickwin-
19Ristau,M.: ökonomische Charme, a.a.O., S. 18.
20Vgl. Erler, M.: Die Dynamik der modernen Familie. Empirische Untersuchung zum Wandel der Familien-formen in Deutschland, Weinheim, München 1996, S. 11; Peuckert, R.: Familienformen im sozialen Wandel, Opladen ²2002, S. 20.
21Vgl. Meyer, T.: Private Lebensformen im Wandel, in: Geißler, R.: Die Sozialstruktur Deutschlands. Die gesellschaftliche Entwicklung nach der Vereinigung. Mt einem Beitrag von Thomas Meyer, Wiesbaden ³2002, S. 401-433, S. 402.
22Vgl. Schäfers, B.: Sozialstruktur und sozialer Wandel in Deutschland, Stuttgart82004, S. 114.
23BMFSFJ (Hrsg.): 7. Familienbericht, Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit. Perspektiven für eine lebenslaufbezogene Familienpolitik, CD-Rom Version, Berlin 2006, hier Archiv, 4. Familienbericht der Bundesregierung 1985, S. 14.
24Vgl. Erler, M.: Dynamik der modernen Familie, a.a.O., S. 12.
Page 13
kel des Politischen betrachtet werden, scheint es begründet zu sein, sich dem Bundesverfassungsgericht anzuschließen, welches Familie als diejenige umfassende Gemeinschaft von Eltern und Kindern auffasst, in der den Eltern vor allem Recht und Pflicht zur Pflege und Erziehung der Kinder erwachsen25. Zu diesen Kindern gehören auch eindeutig Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder. Die Frage der Geschlechterverhältnisse der Eltern ist hier im Bezug auf Familie und in Abgrenzung zur Ehe bewusst offen gelassen. Diesem weiten Familienbegriff wird sich die vorliegende Arbeit anschließen, jedoch nicht ohne darauf zu verweisen, dass das Mehrgenerationenmerkmal als das entscheidende Merkmal einer Familie betrachtet wird. Darüber hinaus wird darauf verwiesen, dass in den folgenden Ausführungen - der Kürze wegen - die oben beschriebene „Kernfamilie“ als Familie bezeichnet wird. Ist aufgrund inhaltlicher Darstellungen eine weitere Differenzierung notwendig, werden die genannten unterschiedlichen Familienbegriffe herangezogen. Darüber hinaus scheint es analytisch hilfreich zu sein, die Familie nicht nur als Einheit aus Vater, Mutter und Kindern zu betrachten, sondern als Kopplung von Partnerschaft beziehungsweise Ehe und Elternschaft.26Familienfreundlichkeit ist also immer ein Kriterium, welches auf die Lebensumstände einer Partnerschaft mit Kindern zielt, dabei ist es unwichtig, ob diese Partnerschaft amtlich bescheinigt ist oder nicht. Darüber hinaus gilt alleinerziehenden Eltern eine besondere Aufmerksamkeit, es wird die Auffassung vertreten, dass Aspekte der Familienfreundlichkeit hier im Besonderen Gültigkeit besitzen.