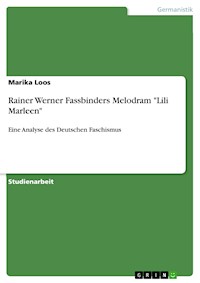36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Examensarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Didaktik - Spanisch, Note: 1,5, Technische Universität Dresden (Romanistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Informations- und Wissensgesellschaft, in der wir heute leben, ist Ergebnis des zweifellos revolutionären und bahnbrechenden technischen Fortschritts in den letzten zwanzig Jahren. Dabei hat vor allem das Internet mit seiner Entwicklung maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Kommunikations-, Lern- und Arbeitsgewohnheiten der Gesellschaft innerhalb relativ kurzer Zeit auf dramatische Weise veränderten. Das Bildungswesen wird durch „die zunehmende Internationalisierung aller Lebensbereiche und die wachsende Bedeutung der Immigration“ vor die Herausforderung gestellt, durch die Vermittlung adäquater kommunikativer, interkultureller und kooperativer Kompetenzen einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der internationalen Kommunikation in der Welt zu leisten, die für ein Miteinander und die Behauptung am Arbeitsmarkt von immer erheblicherer Bedeutung sind. In internetbasierten Kommunikationsdiensten sehen Fremdsprachendidaktiker die Chance, durch direkten Kontakt mit Muttersprachlern eine Optimierung des Fremdsprachenlernens zu erzielen. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, E-Mail-Projekte als eine Form des internetgestützten Fremdsprachenlernens im Spanischunterricht auf deren Potential und Grenzen hin zu untersuchen. (...)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Page 1
Page 5
1 Einleitung
Die Informations- und Wissensgesellschaft, in der wir heute leben, ist Ergebnis des zweifellos revolutionären und bahnbrechenden technischen Fortschritts in den letzten zwanzig Jahren.1Dabei hat vor allem das Internet mit seiner Entwicklung maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Kommunikations-, Lern- und Arbeitsgewohnheiten der Gesellschaft innerhalb relativ kurzer Zeit auf dramatische Weise veränderten.2Das Bildungswesen wird durch „die zunehmende Internationalisierung aller Lebensbereiche und die wachsende Bedeutung der Immigration“3vor die Herausforderung gestellt, durch die Vermittlung adäquater kommunikativer, interkultureller und kooperativer Kompetenzen einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der internationalen Kommunikation in der Welt zu leisten, die für ein Miteinander und die Behauptung am Arbeitsmarkt von immer erheblicherer Bedeutung sind.4In internetbasierten Kommunikationsdiensten sehen Fremdsprachendidaktiker die Chance, durch direkten Kontakt mit Muttersprachlern eine Optimierung des Fremdsprachenlernens zu erzielen.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, E-Mail-Projekte als eine Form des internetgestützten Fremdsprachenlernens im Spanischunterricht auf deren Potential und Grenzen hin zu untersuchen.
Zur Einführung in das Thema widmet sich Kapitel 2 nach einer kurzen Definition des Begriffes „Lernen“ im Kontext des Fremdsprachenunterrichts vor allem den konstruktivistischen Lerntheorien. Da das konstruktivistische Paradigma in der Fremdsprachendidaktik derzeit das vorherrschende ist, werden aus diesem die idealen Lernbedingungen und -methoden für den Unterricht abgeleitet und mit den Lehrplanrichtlinien des sächsischen Lehrplanes abgeglichen.
1Vgl. GRÜNEWALD, Andreas: Multimedia im Fremdsprachenunterricht. Motivationsverlauf und Selbsteinschätzung des Lernfortschritts im computergestützten Spanischunterricht (= Kolloquium Fremdsprachenunterricht; Bd. 24) (= zugl. Diss., Bremen, 2005), Frankfurt am Main (Lang) 2006, S. 13.
2Vgl. LÜNING, Marita / VENCES, Ursula (Hrsg.): „Neue Medien im Spanischunterricht“, in:Hispanorama94, 11/2001, S. 9.
3LÜSEBRINK, Hans-Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Interaktion, Fremdwahrnehmung, Kulturtransfer, Stuttgart (u.a.) (Metzler) 2005, S. 55.
4Vgl. MASSLER, Ute: "Computervermittelte Kommunikation und Kooperation - Vermittlung der benötigten Kompetenzen in Fremdsprachenunterricht und multinationalen Schreibprojekten ", in: BESCHERER, Christine (Hrsg.):Einfluss der neuen Medien auf die Fachdidaktiken. Erfahrungen aus den Projekt Virtualisierung im Bildungsbereich,Baltmannsweiler (Schneider Verlag Hohengehren) 2005, S. 129.
Page 6
Kapitel 3 gibt einen Überblick über die seit dem 19. Jahrhundert favorisierten Unterrichtsmedien im fremdsprachlichen Unterricht und versucht die heutige Medienlandschaft zu klassifizieren. Das Internet wird in seiner Entstehung, Funktionsweise und Besonderheit für den Fremdsprachenunterricht erläutert werden, da auf dieses multimediale Leitmedium große Hoffnungen gesetzt werden, um den Lernprozess gewinnbringender zu gestalten.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich speziell den E-Mail-Projekten. Kapitel 4 erklärt die Funktionsweise und Merkmale von E-Mails und untersucht die Etablierungsbedingungen dieser im Unterricht.
Die Begriffsklärung zuE-Mail-Projektund Zielformulierungen am Beispiel der Lehrplanvorgaben für die 10. Klasse mit Spanisch als zweiter Fremdsprache leiten Kapitel 5 ein. Im Anschluss sollen die wählbaren Parameter bzw. generell zu berücksichtigende Gesichtspunkte für die Realisierung eines E-Mail-Projektes beleuchtet werden. Dabei wird bezüglich der verschiedenen Projektphasen über Übereinstimmungen mit oder Annäherungen an die konstruktivistischen Lerntheorien reflektiert werden. Im Rückbezug darauf sollen schließlich das didaktische Potential und Grenzen derartiger Projekte gegeneinander abgewogen werden: Worin liegt der didaktische Mehrwert, der Lehrern5wie Schülern über konventionelle Methoden nicht offen steht? In wieweit können mit welchen Mitteln Problemsituationen vermieden oder ausgeglichen werden? Der Abgleich mit den Lehrzielvorgaben und den konstruktivistischen Forderungen soll das Kapitel abschließen.
Kapitel 6 gibt einen Ausblick über neuere, nahezu synchrone Kommunikationsformen des Internets, die die Arbeit nicht eingehender berücksichtigen konnte, die aber den Defiziten im Bereich des Hörverstehens und Sprechens Abhilfe leisten könnten.
Da es an didaktischen Studien mangelt, die Umsetzungsmöglichkeiten von E-Mail-Projekten im Spanischunterricht thematisieren und analysieren, war es nötig, Erkenntnisse u.a. aus englischsprachigen Projekten einzubeziehen.
5Aus Gründen der besseren Lesbarkeit werden in diesem Beitrag maskuline Formen im generischen Sinne verwendet. Die weiblichen Vertreterinnen sind immer eingeschlossen.
Page 7
2 Didaktische und lerntheoretische Grundlagen
2.1 Lernen im Fremdsprachenunterricht
Der BegriffLernentaucht in allerlei Kontexten der Didaktik, Pädagogik und Psychologie auf, doch bleibt dieser Schlüsselbegriff relativ vieldeutig. Ursache dafür ist, dass „sich die traditionellen Grenzen zwischen Lerntheorien, Pädagogik, Psychologie, kognitiver Psychologie, Motivationspsychologie und den Neurowissenschaften verwischt haben.“6
Doch wie beschreiben Wissenschaftler gemäß dem neuesten Stand der Erkenntnisse Lernprozesse?
Lerntheoretiker sind sich schon seit längerem einig darüber, dass die Wissensvermittlung im Sinne des ‚Nürnberger Trichters’7, das heißt ohne Rücksicht auf die kognitiven Voraussetzungen des Lerners, wenig Sinn ergibt.8Grundsätzlich herrschen zwei Tendenzen innerhalb der Erklärungsversuche vor. Einmal wird „Lernen als Verhaltensänderung beschrieben, also als Anpassung an spezifische Anforderungen der entsprechenden sozialen oder physikalischen Umwelt“9. Außerdem wird „Lernen als Wissenserwerb oder
Wissenskonstruktion“10begriffen.
Im folgenden Kapitel soll die Darstellung des konstruktivistischen Paradigmas im Vordergrund stehen, was der Entwicklung Rechung trägt, dass seit Mitte der 90er Jahre vor allem Konzepte, die sich auf die Wahrnehmungs- und Erkenntnistheorie des Konstruktivismus beziehen, den Lernbegriff in der Fremdsprachendidaktik bestimmen.
6GRÜNEWALD 2006, S. 21.
7Zurückgehend auf ein Modell des Wissenserwerbs von 1647 aus nach dem Buch Poetischer Trichter. Die Teutsche Dicht- und Reimkunst ohne Behuf der Lateinischen Sprache in VI Stunden einzugießen, in: GRÜNEWALD 2006, S. 21.
8Vgl. GRÜNEWALD 2006, S. 21.
9Ebd., S. 22.
10Vgl., zitiert nach STEINER, Gerhard:Lernen und Wissenserwerb,in: KRAPP / WEIDENMANN (Hrsg.) 2001, S. 139, in: GRÜNEWALD 2006, S. 22.
Page 8
2.2 Erklärungsversuche der konstruktivistischen Lerntheorien
Die konstruktivistische Lerntheorie sieht Lernen — wie schon der Terminus verrät — als Konstruieren sowie „Rekonstruieren oder Modifizieren von Wissensstrukturen verschiedener Art“11. Dabei beinhalten Wissensstrukturen deklaratives, metakognitives und prozedurales Wissen.12Bei diesem Konstruktionsprozess rückt der Lernende mit seinen Voraussetzungen in den Mittelpunkt13, zumal vor allem mentale Operationen und dessen individuelle Vorwissensbestände den Lernprozess bestimmen. Dabei geht man davon aus, dass jenes Wissen leichter erlernbar ist, was sich besser in bestehende kognitive Strukturen integrieren lässt.14
Natürlich gibt es auch Wissen, was nicht auf Anknüpfungspunkte im Vorwissen des Lerners trifft. In diesem Falle versucht sich der Lerner weitestgehend unbewusst durch bestimmte Strategien
ein kohärentes inneres Modell der Zielsprache zu konstruieren: Er
bildet Lernhypothesen, testet sie im Gebrauch und evaluiert sie
anhand der Rückmeldungen. Falsche Hypothesen werden
verworfen und durch andere ersetzt, teilrichtige Hypothesen führen
zu Änderungen des inneren Sprachmodells (Assimilation und
Akkomodation) und zu neuen, erweiterten Lernhypothesen, die im nächsten Schritt weiter getestet und evaluiert werden.15
Führen die Überprüfungen der Lernhypothesen schließlich nicht mehr zu Abänderungen des inneren Sprachmodells, ist der Konstruktionsprozess abgeschlossen. Im positiven Falle führt das zur Bildung von sogenanntenRoutinen,die den Lerner schneller und unter kognitiver Entlastung mit der Zielsprache umgehen lassen. Im Falle von Falschbildungen kann dies nachteilig
11GRÜNEWALD 2006, S. 22.
12Vgl., Ebd., S. 22.
13Vgl. SCHRADER, Heide:Medien im Französisch- und Spanischunterricht(= Romanische Sprachen und ihre Didaktik; Bd. 7), Stuttgart (ibidem) 2007, S. 13.
14Die Introspektion dient dabei als Methode, mit Hilfe derer normalerweise nicht beobachtbare Prozesse, die beim Lernenden während des Sprachverstehens und der Sprachproduktion ablaufen, verbalisiert und untersucht werden können. DieseTechnik des lauten Denkenskann beispielsweise im Unterricht als nachträgliche Befragungen durch den Lehrenden erfolgen, bei der die Schüler ihre Gedanken, Absichten und Gefühle hinsichtlich einer bestimmten Situation verbalisieren. Auch Lernertagebücher erweisen sich dabei als hilfreich. Vgl., zitiert nach COHEN, A. D.: “Verbal reports as a source of insights into second language learner strategies, in:Applied Language Learning,7/1996, S. 5-24, in: CASPARI, Daniela / HELBIG, Beate (u.a.): “Explorativ-interpretatives Forschen”, in: BAUSCH, Karl-Richard (u.a.) (Hrsg.):Handbuch des Fremdsprachenunterrichts,5. unveränd. Aufl., Tübingen (u.a.) (A. Francke) 2007, S. 501.
15VIELAU, Axel: „Die aktuelle Methodendiskussion“, in: BAUSCH, Karl-Richard (u.a.) (Hrsg.):Handbuch des Fremdsprachenunterrichts,5. unveränd. Aufl., Tübingen (u.a.) (A. Francke) 2007, S. 240.
Page 9
sein, da dann eineFossilisierungder Fehler eintritt, die von allein kaum behebbar ist.16
Für die Qualität der Lernleistung ist einerseits von großer Bedeutung, wie es um die Substanz17der Lernhypothesen bestellt ist, andererseits ob praktische Möglichkeiten bestehen, mittels derer der Lerner eigene Hypothesen überprüfen und revidieren kann. Sind diese möglichst bis ins letzte Detail ausgebessert, kann er diese fertigstellen, ohne dass eine vorschnelle Fossilisierung eintritt. Unabdingbar für qualitativ gute Lernhypothesen sind entsprechende sprachliche und kognitive Voraussetzungen. Erst dann ist der Lerner in der Lage, brauchbare Hypothesen zu bilden und explizite Belehrungen stoßen auf fruchtbaren Boden.18
Das bedeutet für ideale Lernresultate an Schulen, dass dem Lehrer der Spagat abgefordert wird, trotz der institutionell beschränkten Bedingungen im Gruppenunterricht die Lerninhalte und -methoden weitestgehend auf die unterschiedlichen Voraussetzungen seiner Lerngruppe abzustimmen.
Zu den entscheidenden Erkenntnissen des Konstruktivismus gehört, dass sich die Wahrnehmung von Mensch zu Mensch unterscheidet und dabei niemand das Recht auf Wahrheit für sich beanspruchen kann. Die Wissensaneignung, dieser ‚kreative[] Konstruktionsprozeß’19, kann demnach nur von jedem einzelnen Lerner individuell und autonom durchgeführt werden. Lernen wird folglich nicht als Reaktion auf das Lehren begriffen, sondern als individuelle Selbsttätigkeit. Im Fremdsprachenunterricht der Schule ist allerdings die Zielsetzung des autonomen Lernens begrenzt, da die Lehrplanvorgaben der Kultusministerien dem Lerner fremdbestimmte Ziele vorgeben. Da eine komplette Übertragung der Verantwortung und der Lernziele auf den Lerner im Unterricht kaum möglich wäre, sollte zumindest eine partielle Selbstorganisation durch den Lehrer zugelassen und gefördert werden.20
16Vgl. VIELAU 2007, S. 240.
17Dies ist vom persönlichen kognitiven Reifegrad oder vielmehr dem individuell zur Verfügung stehenden Wissen abhängig. Vgl., Ebd., S. 240.
18Vgl., Ebd., S. 240.
19Zitiert nach WOLFF, Dieter: „Lernstrategien. Ein Weg zu mehr Lernerautonomie“, 1997, in: http://www.ualberta.ca/~german/idv/wolff1.htm, in: ROTH, Eliane: „Kommunikation im Internet. Kritische Betrachtung eines Schülerprojekts aus fremdsprachendidaktischer Sicht“ (= Magisterarbeit, Greifswald, WS 2000/01), in: http://www.sprachen-interaktiv.de/magister/pdf/magisterarbeit.pdf, 12.06.2008, S. 19.
20Vgl. GRÜNEWALD 2006, S. 45.
Page 10
Der Vorrang des inneren Lehrplans der Lerner impliziert jedoch keineswegs, dass fremdgesteuertes Lernen überflüssig ist und sich sowohl die Lehrpläne als auch die Instruktionen des Lehrers erübrigen. VIELAU beschreibt den äußeren, fremdbestimmten Lehrplan in diesem Sinne als
ein Fenster für die subjektiven Konstruktionsprozesse [...] [, wobei
es] Aufgabe des Lehrers ist [...], dieses Fenster, die äußere
Lernanordnung, so zu modellieren und von den Anforderungen her
so abzustimmen, dass optimale Voraussetzungen für die subjektiven Lernbewegungen bestehen.21
2.3 Schlussfolgerungen für den Fremdsprachenunterricht
In welcher Form bereichern nun konstruktivistische Erkenntnisse, die der heute relevantesten Erwerbs-bzw. Lerntheorie entstammen, den
Fremdsprachenunterricht? Wie bereits in Kapitel 2.2 angedeutet, ist der Umsetzung idealer Lernbedingungen nach konstruktivistischen Grundsätzen für den schulischen Kontext Grenzen gesetzt. Die folgenden Integrations-vorschläge sind daher nur als Annäherung an ideale Lernbedingungen zu verstehen.
2.3.1 Authentische und komplexe Lernumgebungen
Um einen weitestmöglich qualitativ hochwertigen Wissenszuwachs bei den Schülern zu erzielen, sollten authentische Lernumgebung geschaffen werden, so dass dem Lernenden individuelle Konstruktionsprozesse erlaubt werden und dieser das Gelernte durch direkte Anwendung auswerten kann.22Das setzt einen bestimmten Wissensstand voraus.
Das Vorbereiten, Fördern und Auswerten von Sprach- und Kulturkontakten jenseits der Schulrealität, im idealen Falle in Form von Schüleraustausch-Initiativen, stellt eine Möglichkeit dar, durch die sich „Fremdsprachenunterricht [...] zur Viabilisierung an der Realität hin“23öffnen kann. Da aber reale Begegnungen mit Muttersprachlern aus zeitlichen oder finanziellen Gründen
21VIELAU 2007, S. 241.
22Vgl. SCHRADER 2007, S. 14.
23GRÜNEWALD 2006, S, 47f.