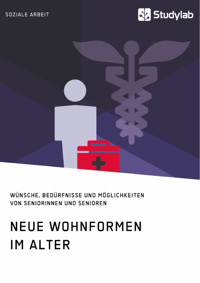
Neue Wohnformen im Alter. Wünsche, Bedürfnisse und Möglichkeiten von Seniorinnen und Senioren E-Book
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Studylab
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Aber die Ausprägungen des Alters können sehr verschieden sein. Seniorinnen und Senioren haben unterschiedliche Bedürfnisse und Ressourcen, die einen entscheidenden Faktor bei der Wahl des persönlichen Alterswohnsitzes darstellen. In der Vorstellung vieler älterer Menschen gibt es im Alter nur drei Wohnformen: Das Wohnen mit den eigenen Kindern, allein zuhause oder in einem Seniorenheim. Dabei gibt es bereits ein breites Spektrum an neuen, alternativen und altersgerechten Wohnformen. Diese Publikation stellt vor, welche Wohnformen Älteren generell zur Verfügung stehen und welche Teilhabechancen sich daraus ergeben. Eine empirische Erhebung, die zwischen der Stadt Neumarkt und der ländlichen Gemeinde Sengenthal vergleicht, zeigt zudem, welche Wohn- und Unterstützungsformen sich Seniorinnen und Senioren bei zunehmendem Hilfsbedarf vorstellen können. Aus dem Inhalt: - Wohnen im Alter; - Senioren; - Wohnen; - Wohnformen; - Pflegeheim
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Impressum:
Copyright © Studylab 2018
Ein Imprint der GRIN Publishing GmbH, München
Druck und Bindung: Books on Demand GmbH, Norderstedt, Germany
Coverbild: GRIN Publishing GmbH | Freepik.com | Flaticon.com | ei8htz
Inhaltsverzeichnis
Abstract / Zusammenfassung
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Gesellschaftlicher Wandel
3 Alter(n) im Wandel - Definitionsansätze
3.1 Heterogenität des Alter(n)s
3.2 Phasen des Alters
3.3 Kalendarisches Alter
3.4 Stufenmodell der Entwicklungsphasen nach Erikson
3.5 Alter(n) nach der Lebenslaufperspektive
3.6 Definition nach dem Defizitmodell
3.7 Lebensstil-Typen nach Moll
3.8 Probleme des Alterns
3.8.1 Persönliche Probleme
3.8.2 Gesamtgesellschaftliche Probleme
4 Wohnen – Begriffsdefinition
4.1 Räumliche Definition
4.2 Wohnen als Existenzsicherung
4.3 Wohnen als Teilhabe
5 Wohnformen für das Wohnen im Alter
5.1 Universal Design – Universelles Design
5.2 Anpassungsmöglichkeiten für das eigene Zuhause
5.2.1 Barrierefreiheit
5.2.2 Angepasste Wohnungen
5.3 Technische Unterstützung
5.4 Personelle Unterstützung
5.5 Mehrgenerationenhaus
5.6 Teilstationäre Einrichtungen
5.6.1 Tages- und Nachtpflege
5.6.2 Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege
5.7 Vollstationäre Einrichtungen
5.7.1 Betreutes Wohnen
5.7.2 Gemeinschaftliche Wohnformen
5.7.3 Alters-/Pflegeheim, Seniorenresidenzen oder Seniorenzentren
5.7.4 Seniorendörfer und Rentnerdörfer
5.7.5 Wohnquartiere
5.8 Beispiele aus anderen Ländern
6 Aktuelle Situation von SeniorInnen in Deutschland
6.1 Daten zum Wohnen von älteren Menschen
6.2 Inanspruchnahme von pflegerischer Unterstützung
6.3 Umzugsbereitschaft und Umzug im Bedarfsfall
6.4 Soziale Kontakte und Teilhabe älterer Menschen
6.5 Infrastruktur, Mobilität und Versorgungsanbindung
7 Umfrage zwischen der Stadt Neumarkt und der Gemeinde Sengenthal
7.1 Rahmenbedingungen in den Erhebungsorten
7.1.1 Daten der Gemeinde Sengenthal
7.1.2 Daten der großen Kreisstadt Neumarkt in der Oberpfalz
7.2 Methodisches Vorgehen
7.2.1 Zielsetzung der Erhebung
7.2.2 Auswahl der Stichprobe
7.2.3 Design des Erhebungsinstruments
7.2.4 Durchführung der Erhebung
7.2.5 Auswertung
7.3 Darstellung der Ergebnisse
7.3.1 Rücklauf und Ausschöpfungsquote der Befragung
7.3.2 Angaben zur Stichprobe
7.3.3 Aktuelle Wohnsituation
7.3.4 Wohnungszufriedenheit
7.3.5 Ausstattung der derzeitigen Wohnung/Haus
7.3.6 Freizeit und soziale Kontakte
7.3.7 Familiäre Situation
7.3.8 Finanzielle Ressourcen
7.3.9 Gesundheit
7.3.10 Künftige Wohnsituation
7.3.11 Verbesserungsvorschläge für das eigene Wohnumfeld
7.3.12 Lebenszufriedenheit
8 Schlussbetrachtung
9 Handlungsempfehlungen
9.1 Generelle Handlungsempfehlungen
9.2 Konkrete Handlungsempfehlungen für die Erhebungsorte
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang: Zeitplan der Befragung
Anhang: Fragebogen
Abstract / Zusammenfassung
In der Gesellschaft steigt die Zahl der älteren Menschen an. Ebenso ungleich wie die Menschen einander sind, so verschieden sind auch die Ausprägungen des Alters. Die eigenen Bedürfnisse und Ressourcen sind vor allem für den Bereich Wohnen von Relevanz, da sie einen entscheidenden Faktor für die Wahl des künftigen persönlichen Alterswohnsitzes darstellen. SeniorInnen steht derzeit bereits eine Vielzahl an Wohnformen zur Auswahl.
Diese Arbeit hat die Zielsetzung vorzustellen, welche Wohnformen Älteren generell zur Verfügung stehen und welche Teilhabechancen sich daraus ergeben. Des Weiteren klärt die empirische Erhebung, die zwischen der Stadt Neumarkt und der ländlichen Gemeinde Sengenthal vergleicht, welche Wohn- und Unterstützungsformen sich die SeniorInnen für sich selbst bei zunehmendem Hilfsbedarf vorstellen können. Dafür wurde ein quantitativer Fragebogen erstellt und an die BürgerInnen ab 65 Jahren ausgegeben.
Der Rücklauf der 172 SeniorInnen zeigte, dass der Großteil der SeniorInnen im Eigenheim und gemeinsam mit dem Partner wohnt. Neben dem Wunsch künftig weiterhin zuhause wohnen zu bleiben, erhalten vor allem Wohnformen Zuspruch, bei denen ein hohes Maß an Selbstbestimmung gewährt wird. Der Hauptgrund, der die SeniorInnen zu einem Umzug bewegen könnte ist der Verlust der Selbstständigkeit. Als verbesserungswürdig wurde in beiden Erhebungsorten die Verfügbarkeit von altersgerechten Wohnungen sowie die Optimierung der Infrastruktur genannt. Die Wohn- und Lebenszufriedenheit der Befragten fällt in beiden Wohnorten recht hoch aus.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Verschiebung der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung 1950-2060
Abbildung 2: Maslow’sche Bedürfnispyramide
Abbildung 3: Umwandlung von Pflegestufen in Pflegegrade
Abbildung 4: Veränderung der Einwohnerzahl der Gemeinde Sengenthal bis 2028 nach Altersgruppen in Prozent
Abbildung 5: Veränderung der Einwohnerzahl der Kreisstadt Neumarkt bis 2034 nach Altersgruppen in Prozent
Abbildung 6: Vergleich zwischen den Bevölkerungspyramiden der Gemeinde Sengenthal und der großen Kreisstadt Neumarkt
Abbildung 7: Ablauf der Erhebung
Abbildung 8: Die zehn Erhebungskategorien
Abbildung 9: Aktuelles Wohnverhältnis der Befragten nach Wohnorten
Abbildung 10: Vergleich zwischen den Wohnräumen hinsichtlich Altersgerechtigkeit
Abbildung 11: Ausstattungsmängel im Wohnraum nach Wohnorten
Abbildung 12: Einkommensverteilung der Befragten nach Geschlechtern
Abbildung 13: Beweggründe der Befragten für einen Umzug im Bedarfsfall
Abbildung 14: Anforderungen an das künftige Wohnen und das Wohnumfeld
Abbildung 15: Vorstellungen über die künftige Wohnsituation der Befragten im Bedarfsfall
Abbildung 16: Vorstellung über die Unterstützung für Zuhause der Befragten im Bedarfsfall
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Bevölkerungsentwicklung für Sengenthal bis 2028 nach Altersgruppen..70
Tabelle 2: Bevölkerungsentwicklung für Neumarkt bis 2034 nach Altersgruppen..72
Tabelle 3: Darstellung der Stichprobe nach Geschlecht, Orte und Altersgruppen..80
Tabelle 4: Vergleich zwischen den Wohnorten und der dortigen Wohndauer.84
Tabelle 5: Anzahl der Zimmer im aktuellen Wohnsitz der Befragten..91
Tabelle 6: Darstellung der Vereinsmitgliedschaft der Befragten..92
Tabelle 7: Angaben zur Kontakthäufigkeit der Befragten Bekannten nach Wohnorten..93
Tabelle 8: Angaben zum Wohnort der Kinder der Befragten SeniorInnen..95
Tabelle 9: Kosten für Miete und Wohnen der Befragten..99
Tabelle 10: Ergebnisse zur Frage nach dem eigenen Gesundheitszustand..100
Tabelle 11: Darstellung der Hilfsmittel der BewohnerInnen der Erhebungsorte.102
1 Einleitung
„Nur als ein Wohnender, […] nur in der Verfügung über einen […] von der Öffentlichkeit abgesonderten und privaten Bereich, kann der Mensch sein Wesen erfüllen und im vollem Umfang Mensch sein“ (Otto Friedrich Bollnow)
Mit seiner bekannten Redewendung „every man desires to live long; but no man would be old“ ahnte Jonathan Swift vielleicht bereits 1812 die aktuelle Situation voraus (Swift 1812, S.174). Denn tatsächlich wird die weltweite Bevölkerung nicht nur mobiler, gebildeter oder produktiver, sondern zugleich immer älter und morbider. Es droht eine Überalterung der Gesellschaft: Während im Jahr 1990 der deutsche Altenquotient, der die Relation der Bevölkerung im Rentenalter zur Bevölkerung im Erwerbsalter misst, noch bei 24 lag, ist der Wert 2015 bereits auf 35 angestiegen. Das bedeutet, dass statistisch gesehen 35 RentnerInnen 100 Erwerbstätige gegenüberstehen. Im Jahr 2060, so schätzt man, kommen bereits 61 SeniorInnen auf 100 Erwerbstätige (vgl. Statistisches Bundesamt 2017, S.55f.).
Diese Entwicklung wirft nicht nur bei den Vorsorgeleistungen der Sozialkassen ein Problem auf, sondern stellt die gesamte Bevölkerung vor enorme Schwierigkeiten: Der Generationenvertrag funktioniert nicht mehr und qualifizierte Fachkräfte fehlen an jeder Ecke. Vor allem im Bereich der Pflege kommt es bereits zu Problemen, denn die Zahl derer, die im Alter nicht mehr ohne Hilfspersonen zurechtkommen, erhöht sich zusehends. Der Bedarf an altersgerechten Wohnobjekten, die jedoch schon heute rar gesät sind, steigt ebenfalls weiter an.
„Damit das längere Leben lebenswerter wird“, ist ein Ausschnitt aus den Grundsätzen der Vereinten Nationen für ältere Menschen, die 1991 als Folge der demografischen Alterung verfasst wurden (United Nations 1991). Das Dokument zielt darauf ab, neben verschiedenen Rechten und der Würde vor allem auch Unabhängigkeit, Partizipation und Selbstverwirklichung älterer Personen zu wahren. Da sich der Radius der eigenen Lebenswelt mit steigendem Lebensalter aufgrund des körperlichen Abbaus verringert, gewinnt das persönliche Wohnumfeld zunehmend an Bedeutung. Daher ist das „Wohnen im Alter“ nach wie vor, oder besser gesagt mehr denn je, ein brisantes Thema und wird auch in Zukunft von enormer Aktualität und gesellschaftspolitischer Relevanz bleiben.
Verständlicherweise besteht bei SeniorInnen der Wunsch, so lange wie möglich zuhause und selbstbestimmt zu wohnen. Doch was geschieht, wenn dies nicht mehr möglich ist? In der Vorstellung vieler älterer Menschen gibt es im Alter nur drei Wohnformen: Das Wohnen bei, bzw. mit den eigenen Kindern, allein zuhause oder in einem Seniorenheim. Dabei löst bereits alleine das Wort „Altenheim“ bei dem Großteil der SeniorInnen Panik aus. Dementsprechend bedeutet die Entscheidung für diese Wohnform für Angehörige meist enorme Überzeugungsarbeit und hat letzten Endes stets den bitteren Beigeschmack des „Abschiebens“. Viele wissen nicht wie breit das Spektrum an neuen, alternativen und altersgerechten Wohnformen heute tatsächlich ist.
Aus diesem Grund werden in der vorliegenden Arbeit, nach einer Einführung in die Themengebiete Alter und Wohnen nicht nur Wohnungsanpassungsmaßnahmen vorgestellt, sondern auch klassische sowie alternative Wohnkonzepte näher beleuchtet. Da besonders im Alter die soziale Partizipation eine große Rolle spielt, geht der Trend mittlerweile dazu über, das eigene Leben und das künftige Wohnen vorausschauend zu planen, um im Alter nicht zu vereinsamen. Dementsprechend werden die im weiteren Verlauf genannten Wohnkonzepte einer Analyse hinsichtlich ihres jeweiligen Inklusionspotenzials unterzogen.
Im Anschluss an den theoretischen Teil folgt eine empirische Erhebung, die zwischen dem aktuellen Wohnen und den Wohnwünschen der EinwohnerInnen ab 65 Jahren der Stadt Neumarkt und der Gemeinde Sengenthal vergleicht. Nach Einbettung in den theoretischen Rahmen werden die methodische Durchführung und die wesentlichen qualitativen Fragebogenergebnisse erläutert und wiederum in Bezug auf die Basistheorien ausgewertet. In dieser Erhebung werden ebenfalls die konkreten Bedürfnisse des künftigen Wunsch-Wohnens dargestellt und die Unterschiede zwischen den Bedürfnissen der städtischen und den ländlichen BewohnerInnen aufgezeigt.
2 Gesellschaftlicher Wandel
Der demografische Wandel verändert die Bevölkerungsstrukturen und das Zusammenleben in unserer Gesellschaft nachhaltig. Vor allem in den Industrieländern ist die Überalterung der Bevölkerung bereits deutlich sicht- und spürbar. Neben dem Nachrücken der geburtenstarken Jahrgänge, der sogenannten „Baby-Boomer-Generation", in das Rentenalter ist die vergleichsweise geringe Geburtsrate bei gleichzeitiger Zunahme der Lebenserwartung als Ursache dafür zu nennen (vgl. Walter et al. 2006, S.19). Gründe für die steigende Lebenserwartung sind, neben den guten ökonomischen und sozialen Lebensverhältnissen, nicht zuletzt der enorme technische Fortschritt, der auch den medizinischen Bereich revolutioniert. Bereits bis 2015 stieg die Zahl der Menschen über 60 Jahre deutlich an und machte bis dahin etwa 25 Prozent der BundesbürgerInnen aus. Dieser Anstieg wird sich in den kommenden Jahren noch gravierend verstärken, sodass sich die Alterspyramide fortschreitend nach oben verschieben und sich immer mehr in die Form eines Pilzes wandeln wird. Für 2060 ist ein gesamtgesellschaftlicher Anteil älterer Personen von ca. 40 Prozent zu erwarten, Tendenz steigend (vgl. Abb. 1).
Abbildung 1: Verschiebung der Altersstruktur der deutschen Bevölkerung 1950-2060
Quelle: Demografie-Portal[1]
3 Alter(n) im Wandel - Definitionsansätze
Jede/r von uns altert. Es ist daher keine Überraschung, dass Älterwerden für uns ganz selbstverständlich ist. Versucht man „Alter“ allerdings zu definieren, stößt man schnell an seine Grenzen. Es gibt zahlreiche Ansätze, den Begriff „Alter“ zu umschreiben. Einige AutorInnen betrachten das Alter als ein soziales Ordnungskonzept, manche als soziale Leistung, wieder andere als Zeit der Verluste oder als soziale Konstitution. Macht man sich jedoch bewusst, dass das Leben der heute 65-Jährigen durchaus noch über ein viertel Jahrhundert umfassen kann, erscheint es nachvollziehbar, dass es „den“ alten Menschen nicht gibt (vgl. Wolter 2017, S.61). Aus diesem Grund versuchen zahlreiche AutorInnen den Begriff des Alters präzise zu fassen. Die verschiedenen Perspektiven, bestehen parallel zueinander und bedingen einander in gewisser Weise (vgl. Haefker & Tielking 2017, S.48).
3.1 Heterogenität des Alter(n)s
Wenn von einem älteren Menschen gesprochen wird, schießt den meisten von uns ein generalisiertes Altersbild in den Kopf, welches sich mit (zum Teil stereotypischen) negativ behafteten Attributen wie „gebrechlich“, „schwach“, „verwirrt“, „hilfsbedürftig“, „einsam“ oder „konservativ“ assoziieren lässt (vgl. Schenk, 2005, S.20). Ist ein älterer Mensch starrsinnig, so wird dies unmittelbar auf dessen Alter geschoben. Verhält sich hingegen ein jüngerer Mensch gleichermaßen, so wird das Verhalten anderen Gründen zugeschrieben (z.B. schlechter Tag, Stress) (vgl. Sittler 2017, S.3). Derartige Assoziationen, die aus dem Wechselspiel zwischen Individuum und Gesellschaft entstehen, sind allerdings nur selten gerechtfertigt.
Um das Alter in seiner ganzen Vielfalt darzustellen, muss eine Differenzierung des Altersbergriffs erfolgen. Durch die Pluralität der Lebensverläufe ist das Altern stets ein höchst individueller Prozess, der unaufhaltbar ist und dem sich keiner entziehen kann (vgl. Schenk 2005, S.32). Zentrale Faktoren ergeben sich dabei zwar immer höchstindividuell, nach der eigenen Biografie, sind zum Teil jedoch auch biologisch, kulturell, gesellschaftlich und politisch beeinflusst. Die Bedeutung des Alters ist folglich nicht nur physiologisch und psychologisch bestimmt, sondern auch sozial hergestellt, gesellschaftlich- und generationenabhängig (vgl. Eberle 2013, S.86).
Es bleibt festzuhalten, dass das Alter stets Ergebnis von individuell gesammelter Lebenserfahrung ist. Dementsprechend hat die Generation, die einen Krieg miterleben musste, deutlich andere Wert- und Lebensvorstellungen (z.B. Sparsamkeit, Fleiß) als die darauffolgende Generation, die Aufschwung und Wohlstand gewohnt ist (z.B. Freiheit, Selbstverwirklichung). Diese individuellen Wertesysteme beeinflussen auch die Vorstellung von der Lebensphase „Alter“.
Besonders deutlich wird der Heterogenitätsaspekt an folgender Aussage von Pincus: „Alte Menschen sind ja nicht alle gleich, wahrscheinlich sind sie das sogar noch weniger als irgendeine andere Altersgruppe: Denn ihr langes Leben hat sie zu Individualisten gemacht. Eines unserer augenblicklichen Probleme ist, dass die Gesellschaft sich weigert, das zu verstehen, und alle alten Leute ‚gleich‘ behandelt“ (Pincus 1992, S.56f.). Gewissermaßen impliziert die Aussage von Pincus auch, dass der individuelle Alterungsprozess von der Altersfreundlichkeit unserer Gesellschaft, beziehungsweise deren Akzeptanz gegenüber älteren Mitmenschen, abhängt. Diese Akzeptanz ist für SeniorInnen maßgebend, um zu entscheiden, ob sie ihre persönlichen Ressourcen aktivieren und einbringen können, bzw. wollen (vgl. Haefker & Tielking 2017, S.52). Das bedeutet, wenn die Gesellschaft ältere Personen als vollständigen Teil der Gesellschaft anerkennt und mit dementsprechenden Verhalten würdigt, können ebendiese ihre eigenen Kompetenzen optimaler einbringen und verwerten (z.B. Erfahrung, Werte).
3.2 Phasen des Alters
Mit der Heterogenität des Alters befassten sich auch die Autoren Schenk (2005, S.190ff.) und Eberle (2013, S.80ff.). Beide Autoren stellten fest, dass heute nicht mehr von einem pauschalen Altersbegriff gesprochen werden kann. Ihrer Ansicht nach definiert sich das Alter durch die Zuschreibung von bestimmten qualitativen Merkmalen, die sie zusätzlich nach weichenAltersgrenzen in drei Kategorien rubrizieren:
Gesundes Rentenalter (go-goes) oder Junge Alte umfassen die Lebensphase zwischen 60 und 65 Jahre. Bei der Mehrheit der Menschen liegen in diesen Lebensjahren noch keine wesentlichen körperlichen Einschränkungen vor. Im Gegenteil: Die betreffenden Personen sprühen meist vor Energie, Gesundheit und Aktivität. Da für diesen Lebensabschnitt insbesondere der Ausstieg aus dem Berufsleben kennzeichnend ist, können fast alle dieser sogenannten Jungen Alten eine solide wirtschaftliche Absicherung vorweisen (vgl. Schenk 2005, S.26f.). Das Ende des Berufslebens geht mit Freiheit von Erwerb und einem daraus resultierenden Rollenverlust einher. Dadurch kann es jedoch auch zu Problemen im Selbstbild kommen. Gerade in Deutschland definieren wir uns sehr durch unseren beruflichen Status. Sobald dieser wegfällt entsteht ein Gefühl der Leere, welche es neu zu besetzen gilt (vgl. ebd.). Durch diese „Entwurzelung“ kommt es zu Rollenunsicherheit und es entsteht, ähnlich wie in der Pubertät, die Chance zur Selbstverwirklichung auf. In Zusammenhang mit den, unter dem Abschnitt zur Lebenslaufperspektive bereits beschriebenen normativen Wertesystemen, müssen den Neu-RentnerInnen Optionen zur Verfügung gestellt werden, die ihnen kulturelle, soziale sowie politische Partizipation ermöglichen (vgl. Haefker & Tielking 2017, S.44). Um die entstandene Lücke zu füllen, arbeiten daher viele SeniorInnen bis über den Renteneintritt hinaus, obwohl dies aus finanzieller Sicht meist nicht nötig wäre. Einige der Jungen Alten widmen sich zudem einer ‘‘sinnhaften“ Tätigkeit, wie beispielsweise einem Ehrenamt (vgl. Schenk 2005, S.26ff.).
Hohes Alter mit verstärkter Fragilität (slow goes) oder Alte im Übergang kennzeichnen sich durch das Eintreten erster körperlicher Defizite. Sowohl Mängel in den Bereichen Sehen und Hören, als auch erste Mobilitätsproblematiken setzen häufig erst im hohen Lebensalter ein. Leichte, temporäre unterstützende Tätigkeiten von Angehörigen und Barrierefreiheit sind in dieser Phase oftmals entscheidend, um den Alltag in der eigenen Häuslichkeit weiterhin möglichst uneingeschränkt zu meistern. Die „Alten im Übergang“, wie Schenk sie bezeichnet, sind zwischen 80 und 85 Jahre alt (vgl. Schenk 2005, S.23). Aufgrund zunehmender physischer Einschränkungen kann gewohnten Aufgaben und Pflichten zum Teil, nicht mehr nachgegangen werden (vgl. Göckenjan 2010, S.408).
Abhängiges Alter und Lebensende (no-goes) oder Hochaltrige ist nach den AutorInnen die dritte und letzte Phase des Lebens. Nicht zwangsläufig geht Altern auch mit einem steigenden Pflegebedarf einher, jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit dafür an. Besonders in dieser Altersphase, die nicht zu Unrecht auch als abhängigesAlter bezeichnet wird, treten neben körperlichen auch vermehrt kognitive Defizite auf. Im Durchschnitt sind die Lebensjahre über 80 gekennzeichnet von Krankheit, kognitiv zunehmender Einschränkung und Multimorbidität (vgl. Feddersen & Lüdtke 2011, S.13). Die Biografien der sogenannten Hochaltrigen sind jedoch individuell und hängen nicht zuletzt von genetischen, gesellschaftlichen sowie kulturellen Faktoren, dem sozialen Umfeld oder auch dem bisherigen Lebenslauf, samt etwaigen einschneidenden Ereignissen (z.B. Tod des Lebenspartners oder eigene schwere Krankheit) zusammen (vgl. Schenk 2005, S.32ff.). Durch die sich stark unterscheidenden Lebensläufe ergibt sich eine hohe Diversität des Alters. Damit einhergehend ergeben sich auch verschiedene Ansprüche an das Wohnen im Alter (vgl. Eberle 2013, S.88).
Die Einteilung von Schenk und Eberle zeigt lediglich die groben Phasen des Älterwerdens. Amerikanische GerontologInnen fanden jedoch heraus, dass nicht das tatsächliche Alter, sondern das „subjektiv empfundene“ Alter als Indikator zur Alterseinteilung gewählt werden sollte. Dementsprechend seien der subjektiv empfundene Altersstand, samt körperlichen und seelischen Zustand, zur Einteilung treffender als das tatsächliche Alter (vgl. Schenk 2005, S.18). Demzufolge sind Personen, die sich jünger fühlen, mit ihrem bisherigen Leben zufriedener und sehen die Zukunft allgemein positiver.
3.3 Kalendarisches Alter
Anders als die vorherige Definition orientiert sich beispielsweise die World Health Organization (WHO 2004) nicht am biologischen Alter, sondern definiert rein anhand kalendarischer Altersgrenzen:
Alternde Menschen: 50-60 Jahre
Ältere Menschen: 61-75 Jahre
Alte Menschen: 76-90 Jahre
Sehr alte Menschen: 91-100 Jahre
Langlebige Menschen: Über 100 Jahre





























