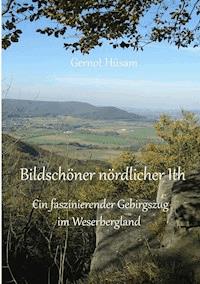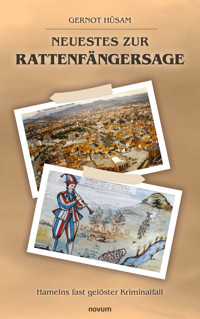
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Rattenfänger von Hameln" ist wohl eine der bekanntesten Sagen im deutschsprachigen Raum. Der Begriff des "Rattenfängers" ist dabei schon länger als geflügeltes Wort in die deutsche Sprache eingezogen. Aber was genau ist der historische Hintergrund dieser Sage, was der wahre Kern? Darüber streiten sich die Gelehrten schon seit Jahrhunderten, wie uns das Buch "Neuestes zur Rattenfängersage" von Gernot Hüsam zeigt. Akribisch zeichnet der Autor nach, welche Interpretationen es wann gegeben hat, sei es die kollektive Auswanderung junger Menschen, eine Krankheit oder die Schlacht bei Sedemünder. Hüsam findet diese Pfade aber nicht restlos überzeugend, sondern stellt eine Verbindung zu den heidnischen Kultstätten in der Umgebung und dem Beibehalten heidnischer Feste im Mittelalter her.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-491-3
ISBN e-book: 978-3-99130-492-0
Lektorat: Tobias Keil
Umschlagfotos: Museum Hameln; Bias Helge, Fotograf, Hamburg, Luftbilder Landkreis Hameln-Pyrmont; Yshevchuk0206 | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
Innenabbildungen: siehe Bildquellennachweis
www.novumverlag.com
Vorwort
Die Pandemie des Jahres 2020 mit ihren Einschränkungen hat den Anstoß für dieses Buch über die Sage vom Rattenfänger von Hameln gegeben. Meine nähere Beschäftigung mit diesem stark emotional beladenen Thema wurde nicht über die literarische Schiene initiiert, sondern über eine seltsame Entdeckung im Herbst des Jahres 1987 an den Felsklippen des nördlichen Iths bei Coppenbrügge, 15 Kilometer östlich von Hameln. In dieser Zeit war ich mit dem Aufbau eines neu zu gestaltenden Museums in der Burg der Grafen von Spiegelberg in Coppenbrügge beschäftigt. Bei den schriftlichen Unterlagen aus der Sammlung von Irmgard Netter für das neu geplante Museum befand sich auch eine von der Autorin Waltraud Woeller signierte Arbeit über die Sage vom Rattenfänger von Hameln, die sie im Jahr 1957 verfasst hatte. Mit dieser Habilitationsschrift bewarb sich die damals junge Autorin für den Lehrstuhl der Völkerkunde an der Humboldt Universität Berlin.
Irmgard Netter, Philologin und Besitzerin des Sanatoriums Lindenbrunn bei Coppenbrügge, hatte selbst viel schriftliches Material zur Rattenfängersage gesammelt. Dieses wurde später für meine Forschung sehr hilfreich. Sie hat vor allem die immer wieder zur Sage erschienenen vielen Artikel in der Hamelner Lokalzeitung DEWEZET aufgehoben.
Erst mit der Entdeckung der Felsgesichter im Ith war mein Interesse an der Theorie von Waltraud Woeller geweckt worden. Sie kannte damals 1956 die Felsgesichter noch nicht und der Bürgermeister von Coppenbrügge Fritz Beckmann auch nicht. Der nämlich hatte sie für ihre Recherche auf den Ith zur Teufelsküche verwiesen, denn ihre heiße Spur auf der Suche nach dem Sagenort „Koppen“hatte sie nach Coppenbrügge geführt. Für mich erhielt ihre Theorie jetzt erst einen ganz anderen, einen höchst brisanten Hintergrund, wenn sich zeigen sollte, dass zwischen den Felsköpfen, der Teufelsküche und der Sage ein Zusammenhang besteht.
Dieser Vermutung über einzelne Aspekte der Sage bin ich dann in neun eigenen Aufsätzen in der Wochenendausgabe der Lokalzeitung unter der Rubrik „Feierabend“genauer nachgegangen. Einige der Ergebnisse aus den Untersuchungen der alten Quellen konnte ich in drei ausführlicheren Aufsätzen im Jahrbuch des Museumsvereins Hameln veröffentlichen. Das Echo darauf war zwar vorhanden, doch mit der Akzeptanz der Felsköpfe tat man sich in wissenschaftlich aufgeklärten Kreisen noch schwer. So hat der damalige Leiter des Landesmuseums in Hannover, Günter Wegner, in einer Stellungnahme zur Sendereihe„Bilderbuch Deutschland“im Beitrag über das Weserbergland die Felsgesichter im Ith als ideologisches Erbe aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft bezeichnet, wo es diese unhaltbaren Behauptungen schon einmal gegeben habe. Wohlmeinender gestimmte Wissenschaftler der Archäologie halten die Gesichter an den Felsen für zufällige Ergebnisse der natürlichen Verwitterung.
Das Neue über die Sage besteht darin, dass die von Waltraud Woeller entwickelte Theorie zum Ith bei Coppenbrügge durch meine intensive Beschäftigung mit dem Berg eine zusätzliche Bestätigung nach Korrektur einiger verhängnisvoller geographischer Fehler erfährt, aber auch eine Verschiebung und Erweiterung, ja sogar eine Dramatisierung, die bereits von Erich Heinicke aus Magdeburg erkannt wurde, bei ihm jedoch mangels Ortskenntnis in Vermutungen steckenblieb.
Der Berg steht für eine alte Weltanschauung, die durch eine neue, die christliche, verdrängt wurde. Beide, der heilige Berg und der alte Glaube, sind in Vergessenheit geraten, nur in der Sage schwingt etwas von diesem verbotenen Ort „Koppen“nach, umrankt von „Calvarie“, diesem ungeklärten, dunklen Geheimnis. In der Gestalt des Rattenfängers hat sich jener weltanschauliche Konflikt gebündelt und ist in seiner ganzen Dynamik noch heute zu spüren. Vielleicht liegt darin der Grund für die Faszination und die weltweite Verbreitung der Sage.
Die große Zahl an Bildern im Buch dient nicht der Illustrierung, sondern der Veranschaulichung, aber auch als Beleg für die gefundenen Fakten sowie der Erleichterung des eigenen Suchens und Nachschlagens im lateinischen Wörterbuch. Bild und Text sollen nun alle meine Forschungsbemühungen zusammenfassen, nicht als Roman, sondern als ein spannendes Sachbuch.
Gernot Hüsam
Um den Plagiatsjägern zuvorzukommen, habe ich mich entschlossen, alle wörtlichen Zitate kursiv zu setzen, ebenso die Bildunterschriften, um sie vom laufenden Text stärker abzusetzen und stehende Begriffe besser hervorzuheben.
1
Warum dieses Buch?
Die Sage vom Rattenfänger von Hameln hat durch ihre Faszination über alle Zeiten und Länder hinweg sehr viele Menschen immer wieder in ihren Bann gezogen. So wie sie heute erzählt wird, geht sie auf die Fassung der Brüder Grimm aus dem Jahre 1816 zurück. Danach leidet die mittelalterliche Stadt unter einer Rattenplage, von der sie ein bunt gekleideter fremder Pfeifer durch sein zauberisches Flötenspiel befreit. Da er von den Stadtvätern um den ausgemachten Lohn geprellt wird, sinnt er auf Rache und kommt ein zweites Mal. Diesmal lockt er 130 Hamelner Kinder und Jugendliche zu Johannis und Pauli am 26. Juni des Jahres 1284 mit seinem verführerischen Flötenspiel aus der Stadt und verschwindet mit ihnen in einer Höhle auf dem Koppenberg, östlich von Hameln. So weit informieren uns die wesentlichen Überlieferungen, zu denen im Laufe der Zeit noch weitere Einzelheiten hinzukommen wie etwa die verzweifelte Suche der Eltern oder der Zeitpunkt der Entführung während des Gottesdienstes oder auch die Tradition, dass zur Erinnerung an die schlimme Untat in der Bungelosenstraße keine Musik mehr erklingen darf.
Die immer wieder erfolgte Beschäftigung mit der Sage hat zu einer Flut von Schriften, Büchern, Kunstwerken und Forschungen über sie geführt. Dabei hat sie bis heute nichts von ihrer Anziehung verloren. „Warum dann noch ein Buch?“, wird sich der Leser fragen, der dieses Buch aber dennoch aufgeschlagen hat, weil der Mensch eben von Natur aus neugierig ist. Dieses Buch soll durchaus neugierig machen, denn noch immer lassen sich neue Erkenntnisse über die Sage und ihre dunklen Hintergründe entdecken, so lange dieser Kriminalfall aus dem Mittelalter nicht gelöst ist.
a. Ein Blick auf die vielen Schriften und Kunstwerke
An dieser Stelle soll keine reine Aufzählung der ins schier Unermessliche ausufernden Schriften erfolgen, sondern die zeitbedingten Hintergründe sollen beleuchtet werden, die für das immer wieder aufflammende Interesse an der Sage verantwortlich zu sein scheinen. Die ersten zweihundertsiebzig Jahre nach dem Katastrophenjahr 1284 herrschte unter den Hamelnern ein fast eisernes Schweigen, weil keine Chronik darüber berichtet1, wenn da nicht ein paar kirchliche Texte wären wie das noch im gleichen Jahr entstandene Reimgebet in lateinischer Abfassung, das in einem Messbuch, dem „Passionale Sanctorum“des Hamelner St. Bonifatiusstifts, überliefert ist (Näheres unter 3d), oder auch das ehemalige gotische Glasfenster in der Marktkirche (der Bürgerkirche) mit seiner deutschen Textumschrift fällt in diese Zeit der Stille, ebenso der Spruchbalken hoch oben am Rattenfängerhaus an der Längsseite zur Bungelosenstraße. Dessen Text ist fast identisch mit dem des Glasbildes in der Marktkirche (Näheres unter 3c).
Ein weiterer Hinweis auf das Geschehen am 26. Juni 1284 ist ein Eintrag der Sage in der Lüneburger Handschrift2um 1440/50, ein lateinischer Text aus kirchlicher Feder, in dem die ersten Einzelheiten zur mirakulösen Geschichte in Hameln auftauchen wie etwa eine Augenzeugin des Auszugs der Kinder. Ins Mittelalter gehören auch bildliche Darstellungen nicht nur in der Marktkirche, sondern auch an Bürgerhäusern, wo das Geschehen in kostbaren Glasfenstern festgehalten worden war. (Näheres unter 3e) Die Sache mit der eigenen Hamelner Zeitrechnung3soll auf einen Neubeginn in der Stadtgeschichte hinweisen, da die Schwere des Ereignisses für die Hamelner als einschneidende Zäsur erlebt worden sein muss. Sie hat aber für die inhaltliche Forschung über die Sage nichts beizutragen.
Dem angeblich stillen Zeitraum im Mittelalter folgt dann mit der allmählichen Entfaltung einer neuen Epoche, angekündigt durch die Reformation Martin Luthers und noch stärker vorangetrieben durch die Erfindung des Buchdrucks und die damit ausgelöste neue vielfältige Verbreitungsmöglichkeit von Informationen, eine intensive Beschäftigung mit der Vergangenheit. Dieser so ausgelöste allgemeine Wissensdurst hat ab Mitte des 16. Jahrhunderts auch zu einer großen und weit über hundert Jahre anhaltenden Beschäftigung mit Hamelns Sage und dem unerklärlichen Verlust von 130 Kindern geführt. Jetzt beginnen sich die gebildeten Menschen ihr eigenes Bild über die bis dahin sehr dürftige Überlieferung zu machen, die vor allem von den wenigen lateinischen, kirchlichen Aufzeichnungen geprägt war. Man hörte jetzt auf die Leute in Hameln und auf das, was sie über das Schicksal ihrer Kinder damals zu berichten wussten. Über die bisherige Decke des Schweigens setzte man sich jetzt bewusst hinweg. Sie mag aus kollektiver Verdrängung entstanden sein, weil das zutiefst erschütternde und unfassbare Ereignis ein bis dahin unbewältigtes Schockerlebnis für die Bürger war.
So schreibt der damalige Bürgermeister von Bamberg, Hans Zeitlos, in der Chronik seiner Stadt4im Jahre 1557 über die Sage von Hameln, wie sie ihm bei seinem unfreiwilligen Aufenthalt 1553 im Zuge der Verschleppung als Geisel während der Bauernkriege dort erzählt wurde.
Jobus Fincelius, ein Pastor aus Pommern, nimmt die Hamelner Sage 1556 in seine Sammlung „Wunderzeichen,Teil I“von „schröcklichen Wunderzeichen und Geschichten“auf. Er beginnt so: „Von des Teuffels gewalt unnd boßheyt wil ich hie ein warhafftige Historiam melden.“5Der Verweis auf die „wahre Geschichte“verrät seine gut gemeinte Absicht, dem Leser berechtigte Furcht vor den Verführungskünsten des Teufels zu machen, weil er in der Sage ein überzeugendes Beispiel für eine wirklich geschehene Höllenfahrt sieht. Ähnliche Wunderberichte tauchen in dieser Zeit mehrfach auf wie etwa die 1571 vom Lüneburger Lateinschulrektor Lucas Lossius lateinisch verfassten Warnungen vor dem zerstörerischen Werk Satans am Beispiel des Hamelner Geschehens.
Dazu gehört wohl auch der wegen seiner eigenwilligen Erweiterung der Sage zu nennende Graf Froben Christoph von Zimmern6, der in seiner Chronik von 1565 zum ersten Mal die Ratten ins Spiel bringt. Woher er dieses neue Element bezogen hat, bleibt unklar. Möglicherweise hat er aus der Darstellung von Ratten auf den Glasfenstern in Bürgerhäusern seine eigenen Schlüsse gezogen, weil nun erst das Motiv des um seinen Lohn geprellten Pfeifers den eigentlichen Grund für die Entführung der Kinder liefert.
Das erwachte große historische Interesse an der Vergangenheit schlägt sich jetzt in zahlreichen Chroniken nieder, weil dahinter ein neues Bedürfnis sichtbar wird, geschichtliche Fakten zu bewahren und sie als Leitfaden für künftiges Handeln zu gebrauchen. In solche Chroniken werden Ereignisse wie die Sage von Hameln liebend gern aufgenommen. Manche dieser Chronisten haben sich deshalb selbst ein Bild vor Ort machen wollen, und sie recherchierten, modern gesprochen, bei den Hamelner Bürgern, Ratsherrn und kirchlichen Vertretern. Einige seien hier genannt: Heinrich Bünting7in seiner Braunschweig-Lüneburgischen Chronik von 1584 oder der Verfasser der Thüringischen Chronik Adelar Erich und der viel fabulierende Johannes Letzner8in seiner Hildesheimischen und Corbeyischen Chronica. Diese vielen Spuren der Sage aufgespürt und gesammelt zu haben, ist das Verdienst des Hamelner Gymnasialrektors Heinrich Spanuth, der in hohem Alter in seiner Dissertation (summa cum laude) von 1951 die Ergebnisse seiner umfangreichen Forschung zur Sage vorstellte.
Neben den ursprünglichen Berichten einer Kinderentführung übernehmen jetzt vermehrt Schreiber auch die Rattenplage in ihre Darstellungen der Sage auf. Für die Hamelner Bürger und vor allem die Stadtväter wurde diese neue Version ihrer Sage, die bisher so großes Aufsehen erregt hatte und als Lehrbeispiel zur Ermahnung für gottesfürchtiges Handeln genutzt wurde, zu einem großen Ärgernis. Jetzt fällt auf die Stadt ein dunkler Schatten, denn die Bürger und ihre Stadtoberen geraten in ein falsches Licht und die Schuld am Unglück ihrer Kinder fällt auf sie zurück.
In den Streitschriften des beginnenden 17. Jahrhunderts werden immer neue Behauptungen aufgestellt, andere Jahreszahlen tauchen auf und auch der Tag des Geschehens wird anderen Heiligen zugeordnet. Schließlich versucht der Hamelner Ratsherr und Jurist Sebastian Spilker9in einem Gegenbericht zu den Aussagen des Hamelner Lateinschulrektors Samuel Erich 1654, die ganze Erzählung als eine Erfindung der Erwachsenen und Eltern abzutun, mit der sie ihre Kinder zu Gehorsam und Gottesfurcht erziehen wollten. Samuel Erich hatte das alte Reimgebet im Messbuch des Stifts als Beweis für ein tatsächliches Geschehen angeführt.10 Spilkers Gegenbeweis stützt sich auf die Tatsache der nicht mehr vorhandenen Originaltexte, da von ihnen nur noch lauter Kopien existieren. Das trifft auch auf die älteste Quelle, das Reimgebet, zu. Für ihn ist das Schweigen in der Hamelner Kirchenchronik aus dem Jahre 1384 über das erst hundert Jahre zurückliegende verhängnisvolle Unglück der schlagende Beweis dafür, dass der „Kinderauszug“nicht geschehen sein kann. Damit konnte er aber nicht die Zugkraft der um das Rattenmotiv erweiterten und jetzt noch viel einprägsameren Rattenfängersage schwächen, geschweige denn auslöschen.
Auch der Hamelner Bürgermeister Gerhard Reiche11versuchte in seinem „Bericht nach Hofe“an den Merian-Verlag in Frankfurt a. M. aus dem Jahre 1653 Einfluss auf die Beschreibung der Stadt Hameln in den Merian’schen Städtedarstellungen zu nehmen, indem er mit dem Hinweis argumentierte, dass die Chroniken um die Zeit des angeblichen Unglücks nichts vermelden. Merian verzichtete zwar nicht auf die Sage, jedoch auf die Vorgeschichte mit der Rattenplage.
Um die Mitte des 17. Jahrhunderts tauchen nun auch erste Erzählungen in England auf. Dafür verblasst in Deutschland die Zugkraft der Sage, weil die unrealistischen Ausschmückungen über das Verschwinden im Berg und das Zauberhafte der Pfeiferfigur immer mehr angezweifelt werden. Ein Beispiel dafür bietet die Meinung des großen Gelehrten Wilhelm Leibnitz12, der 1692 an ein historisches Ereignis als Erklärung glaubte. Er sah im Kern der Sage eine Verbindung zu den Kinderkreuzzügen, die allerdings viel früher im Jahre 1212 stattfanden.
Mit der beginnenden Zeit der Aufklärung im 18. Jahrhundert sind die Erwähnungen der Hamelner Sage nur noch kurzgefasste Einlassungen, da man von den nicht mehr geglaubten unrealistischen Behauptungen in der Sage Abstand nimmt. Um 1750 forscht der Hamelner Garnisonsprediger Christoph Friedrich Fein13nach einem neuen Ansatz über den historischen Hintergrund der Entführungssage. Er kombiniert die drei Zahlen auf einem Gedenkstein am Neuen Tor so, dass die Sage ins Jahr 1259 vorrückt und zeitlich in die Nähe der Schlacht von Sedemünder kommt, bei der viele Hamelner Jungmänner gefallen sind (Näheres unter 2c). Diese Deutung der Sage hat danach sehr lange als die wahrscheinlichste gegolten. Erst als der Hamelner Historiker Otto Meinardus14das genaue Datum der Schlacht am 28. Juli 1261 ermittelte, verlor sie ihre Überzeugungskraft dann im beginnenden 20. Jahrhundert.
Ihren Abschluss, die endgültige Fassung, erhielt die Sage durch die Arbeit der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm15im Jahre 1816. In der Zeit der Romantik verbreitete sie sich jetzt in ganz Deutschland. Sie wurde zum Gegenstand der Kunst. Zwar gab es auch weit früher schon gereimte Fassungen, doch erst als sich Johann Wolfgang von Goethe 1803 anschickte, sein bekanntes Gedicht über den verführerischen Rattenfänger zu schreiben, wurde die Sage Quelle für immer wieder neue literarische Werke. Die Romantik überzieht die Sage mit einem mythologischen Schleier, bei dem germanische Urbilder wie etwa das der Ratten als Sinnbilder der Seelen erkannt werden. Später im Jahre 1883 hat der Schriftsteller Julius Wolff mit seiner Versdichtung „Der Rattenfänger von Hameln“ein nachhaltiges Echo in der Stadt ausgelöst. Ihm wurde deshalb auch die Ehrenbürgerschaft verliehen. Dieser Dichtung verdankte Hameln sogar einen Brunnen, der heute aber wieder verschwunden ist. Die eigens von ihm in die Sage aufgenommene süßliche Liebesgeschichte hat bald wieder zur Abkehr von seinem Werk geführt.
Auch die Malerei entdeckt jetzt die Sage. Vor allem reizt die schillernde Figur des Rattenfängers mit ihrer zauberhaften Wirkung auf die Menschen, sowohl in seiner dämonischen als auch in seiner verführerischen Wirkung. Bald nach Goethes Rattenfängerlied entstehen jetzt Illustrationen dazu. In der ersten Sammlung deutscher Volkslieder von 1806 durch Achim von Arnim und Clemens Brentano in „Des Knaben Wunderhorn“ist die Sage in Liedform aufgenommen und mit einer Federzeichnung illustriert. Der junge Historienmaler Gustav Adolf Spangenberg hat die Rattenfängersage um 1860 in einem Ölgemälde als fröhlichen Auszug der Kinderschar gemalt. Die Kinder verschiedenen Alters werden von einem Dudelsack spielenden Pfeifer gerade in den Wald geführt.
Gustav Adolf Spangenberg um 1860, Der Rattenfänger von Hameln
Pompöse künstlerische Bearbeitungen historischer Themen werden nun zu Wegbereitern des aufkommenden Historismus. Das geschärfte historische Bewusstsein führt dazu, dass die Stadt Hameln im Jahre 1884 ein erstes großes Fest veranstaltet, um der 600-jährigen Wiederkehr des Schicksalsjahres 1284 zu gedenken. In der Geschichtswissenschaft werden die Archive nach kritischen Methoden neu ausgewertet, auch die des Stadtarchivs in Hameln und die kirchlichen Archive.
Durch die neue Wertschätzung der Historie kommt es 1912 zur Einrichtung eines Stadtmuseums, in dem neben Exponaten zur Stadtgeschichte auch Zeugnisse über die Stadtsage aufgenommen werden. Große Verdienste hat sich dabei Heinrich Spanuth erworben, der mit seiner akribischen Forschung viele neue Spuren über die Sage aufgedeckt hat, die dann zur Grundlage für neuere Forschungsansätze wurden, wie etwa seine Wiederauffindung der Lüneburger Handschrift oder das Aquarellbild von 1592 in der Reisechronik des Augustin von Mörsperg.
Am Ende des katastrophal ausgehenden Ersten Weltkriegs zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt der damals schon pensionierte Geheime Justizrat Freydanck aus Hameln, auch ein glühender Forscher, Interpret und Anhänger der Rattenfängersage, ein Pergament mit einem mundartlichen Gedicht über die Sage, als er bei Testamentssachen einen Bauern im „Schaumburgischen“aufsuchte. Der Bauer hat ihn lediglich eine Abschrift davon machen lassen, die uns erhalten ist, doch das Original ist nicht mehr aufgefunden worden, weil dem Finder der Ort und der Name des Bauern entfallen waren. Auf Freydanck geht auch ein Ölbild zurück, das er zur Sage gemalt hat. Die Entdeckung eines martialischen männlichen Kopfes mit einer seltsamen Kopfbedeckung auf dem Innenblatt eines alten Folianten im Amtsgericht Hameln geht ebenfalls auf ihn zurück. Seine Schrift von 1929 über die Ortsnamen des Kreises Hameln-Pyrmont hat mancherlei Verwirrung über die Sage gestiftet.16
Zum zweiten Mal wird 1934 bei der 650sten Wiederkehr des Sagendatums ein großes Fest ausgerichtet mit einem so prächtigen, glanzvollen Umzug, dass davon später immer wieder berichtet wird. Dazu erscheint in der örtlichen Zeitung eine ausführliche Beilage17mit verschiedenen Aufsätzen zur Rattenfängersage. Große Beachtung fand darin eine Abhandlung über das Schriftstück, von dessen Fund bei einem Bauern nur eine Bleistiftkopie existiert. Der Aufruf zur Suche nach dem Original blieb erfolglos (Näheres in 4b). Als bleibende Erinnerung an dieses Fest wird am Rathaus eine Kunstuhr mit dem Rattenfängerspiel eingerichtet, die aber wieder im Zweiten Weltkrieg mit der Zerstörung des Rathauses verloren geht. Ein neues Figuren- und Glockenspiel wird nach dem Krieg am Giebel des Hochzeitshauses angebracht, das die Sage in ihren beiden Teilen nachspielt.
Jetzt erscheinen immer wieder Artikel in der Presse zum Thema Sage und mit dem aufkommenden Tourismus wird ein sonntägliches Laienspiel im Sommer aufgeführt, ein amtlicher „Rattenfänger“in bunter Kleidung führt die Schar an und erfreut Gäste durch seine Stadtführungen. Brotratten und Plüschratten sind die neuen Mitbringsel für die Touristen, Bilderbücher und Malbücher für die Kinder.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beginnen auch die Menschen aus dem Ausland, sich für die Stadt und ihre jetzt weltbekannte Sage zu interessieren und sie zu besuchen. Neue Forschungen setzen jetzt ein. Wolfgang Wann, der Würzburger Archivar18, veröffentlicht 1949 seine Theorie über den Verbleib der 130 Hamelner Kinder. Er glaubte, die Spur führe nach Böhmen und Mähren und ein Ort namens Hamlikov erinnere an die Stadt Hameln. Zusammen mit Heinrich Spanuths Dissertation19setzt sich nun die Auswanderungsthese als Erklärung für den Ausgang der Sage durch. Gleichzeitig wird sie aber wieder relativiert durch die detailreichen Untersuchungen des Realschullehrers Hans Dobbertin20, der durch Namensforschung in Pommern an ein Schiffsunglück in der Ostsee bei Rügenwalde glaubte, bei dem die jungen Auswanderer untergingen (Näheres in 2a). Die Auswanderungsthese passt damit in ein damals aktuelles Geschehen, die Rückkehr der Ostflüchtlinge nach dem Ende des Krieges. Eine weitere, vom Ansatz her völlig andere These erschien 1957 mit der Arbeit von Waltraud Woeller.21Damit habilitierte sie sich für den Lehrstuhl der Völkerkunde an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie glaubte, den Ort des Verschwindens gefunden zu haben, und vermutete ein Unglück in der Teufelsküche im Ith bei Coppenbrügge (Näheres in 2d).
Als das Hamelner Museum 1971 einen hauptamtlichen Museumsleiter erhielt, entstand unter seiner Federführung ein längst überfälliges informatives und ästhetisch anspruchsvolles Buch über die Rattenfängersage, das als schöne Erinnerung bleibenden Wert besitzt.22Norbert Humburg, der Autor des Buches, regte zur 700-jährigen Wiederkehr des Sagendatums 1984 ein wissenschaftliches Symposium, eine Erzählforschertagung, an, dessen Ergebnisse in einem Band „Geschichte und Geschichten“23veröffentlicht wurden. Darin beleuchteten einige der teilnehmenden Fachleute einzelne Aspekte aus der Sage, aus denen sich aber keine neuen Forschungsansätze ableiten ließen, außer dass eine frühere Theorie im Zusammenhang mit der Pest neuen Auftrieb erhielt.
Bei der Einrichtung eines neuen Museums in der Burg Coppenbrügge, das 1986 eröffnet werden konnte, tauchte unter den umfangreichen Archivalien die Habilitationsschrift von Waltraud Woeller über die Rattenfängersage wieder auf. Als dann ein Jahr später die Felsgesichter im Ith von mir entdeckt wurden und die historischen Dokumente über den Ort einen „Cobbanberg“24nennen, genau wie er auch in der Sage „Koppenberg“heißt, wurde diese Theorie ganz aktuell. Meine Versuche, die neuen Entdeckungen im Ith und über Coppenbrügge im Zusammenhang mit der Sage in der Lokalzeitung zu veröffentlichen, hatten zwar ein allgemeines Interesse gefunden, blieben aber mit Skepsis behaftet. Immerhin zeigte der NDR Interesse daran, für seine Produktion in der Reihe „Bilderbuch Deutschland“als Beitrag über das Weserbergland, die Felsgesichter am Wackelstein im Ith und den von mir zum Wackeln gebrachten riesigen Felsbrocken in die Sendung aufzunehmen, allerdings mit leicht belächelndem Kommentar.
In den 1990er Jahren entsteht viel Neues zur Sage. Das Theater Dortmund bringt am 26. September 1993 die Uraufführung der Oper „Der Rattenfänger, ein Hamelner Totentanz“auf die Bühne. Das Libretto25dazu schrieb Michael Ende und die Musik stammt aus der Feder des Komponisten Wilfried Hiller. Als Spieler des Rattenfängers konnte der weltbekannte Klarinettist Giora Feidmann für die Uraufführung gewonnen werden. In seinem Libretto hatte Michael Ende die Sage in ein stark zeitkritisches Werk verwandelt, in das er den weltweiten Kapitalismus, die globale ökologische Krise und deren soziologisch-psychologische Wurzeln hineinprojizierte. Das Plakat für die Uraufführung hat der bekannte Zeichner und Karikaturist Horst Haitzinger geschaffen.
Das apokalyptische Plakat von Horst Haitzinger
zur Rattenfängeroper auf dem Programmheft
zur Uraufführung 1993 in Dortmund
Darauf ist der allmächtige, Geld scheißende, Gesetz und Recht bestimmende Rattenkönig abgebildet. Am Boden die ruinierten Hinterlassenschaften seiner gefräßigen Brut und hoch erhoben, eingeringelt von seinem Rattenschwanz, die sich köstlich amüsierenden Vertreter aus Kirche, Politik, Wirtschaft und Sexvergnügen. Diese für das Theaterpublikum schwere Kost dürfte der Grund dafür gewesen sein, warum das Werk bald wieder vom Spielplan abgesetzt wurde.
In den Jahren danach werden gleich zwei neue Theorien über die Sage vorgestellt. Einen völlig neuen Denkansatz über die Sage von Hameln hat 1995 Fanny Rostek Lühmann26vorgelegt. Vom Faszinosum der Sage ausgehend verfolgt sie einen ausschließlich tiefenpsychologischen Ansatz streng nach Freud’scher Schule (Näheres in 2e). Der Namensforscher Jürgen Udolph27findet 1997 Ortsnamen aus dem Weserbergland in der Prignitz und Uckermark nördlich von Berlin wieder und glaubt an eine Auswanderung im Zusammenhang mit der Rattenfängersage, wie schon bei Wolfgang Wann und Hans Dobbertin (Näheres in 2a).
Das 21. Jahrhundert beginnt mit der weltweiten filmischen Vermarktung der Rattenfängersage. Vom ZDF wird eine 45-minütige Sendung produziert, in der Experimente mit Ratten und Flötenmusik gezeigt werden. Darin ist deutlich die Tendenz zu erkennen, eine wissenschaftlich fundierte Studie zu erstellen. Mit ähnlich ausgerichtetem Ziel folgen darauf aus den USA der Discovery Channel und ebenfalls der gleichnamige Discovery Channel aus England. Die Engländer brachten sogar eine Person mit, die als Medium eingesetzt wurde und die sich in der Teufelsküche auf dem Ith mental in die Zeit 1284 zurückversetzen sollte. Der junge Mann sah in seiner Rückschau einen Gefangenentransport in die Sklaverei, der hier festgehalten wurde. Danach folgen noch eine französische und eine japanische TV-Untersuchung, die alle das Interesse haben, an der Teufelsküche im Ith die Aufnahmen zu erhalten, um in ihrer Sendung den möglichen Ort des spurlosen Verschwindens der Hamelner Kinder präsentieren zu können. Von den vielen sich häufenden Anfragen der Filmteams aus aller Welt zeigte sich der zuständige Förster mehr und mehr genervt, weil er die Filmarbeiten im Naturschutzgebiet begleiten und beaufsichtigen musste und weil er befürchtete, dass durch das weltweite Bekanntwerden ein unkontrollierbarer Zulauf ausgelöst werden könnte. Das besserte sich erst, als das Drehen im Wald für die ausländischen Filmteams kostenpflichtig wurde.
Einen interessanten neuen Ansatz für die Klärung des historischen Hintergrundes der Rattenfängersage bringt der Gießener Psychiater28und Forensiker Stephan Joost 2016 in die Diskussion. Er untersucht die Aussagen in den Sagenquellen mit den Mitteln der Forensik auf ihre Glaubwürdigkeit und stellt fest, dass die zeitlich und örtlich fernsten Quellen am glaubwürdigsten sind. Dabei schneiden die kirchlichen Texte aus Hameln besonders schlecht ab. Er will die Rolle der Kirche beim Sagengeschehen damals genauer beleuchten und hinterfragen. Wir dürfen gespannt sein.
b. Der Umgang mit den Quellen
Um zu verstehen, wie die vielen verschiedenen Sagenforscher mit den überlieferten Dokumenten umgegangen sind, muss man den Hintergrund, den Anlass für das entstandene brennende Interesse an der Aufklärung des immer noch nicht gelösten Kriminalfalls aus dem Mittelalter untersuchen.
Bei den Vertretern der Kolonisationstheorien (Hannibal Nullejus, nach Neu Sachsen, Siebenbürgen 1589; Wolfgang Wann, nach Böhmen/Mähren 1949; Heinrich Spanuth, nicht festgelegt 1951; Hans Dobbertin, Pommern 1955; Jürgen Udolph, Prignitz/Uckermark 1997) sind vor allem zwei treibende Merkmale hinter dem vermeintlichen Erkenntnisgewinn über die Sage festzustellen. Alle stützen sich auf historisch gesicherte Ereignisse der Auswanderung in neue Siedlungsräume. Das allein würde nicht ausreichen, um damit einen überzeugenden Zusammenhang mit der Sage zu erhalten. Aber auch ihr zweites argumentatives Standbein, die Sprache, kann diese Verbindung zur Sage nicht herstellen. Durch die Übertragung von Orts- und Familiennamen in die neue Heimat glaubten sie, eine heiße Spur der Hamelner Nachkommen entdeckt zu haben. Dieses trifft vor allem auf Prignitz und Uckermark zu, wo z. B. häufig der Familienname Spiegelberg und sogar ein Ortsname Spiegelberg zu finden sind.29Die genealogische Rückverfolgung dieses Namens in die Zeit der Ostkolonisation im 13. Jahrhundert führt tatsächlich zu den Grafen von Spiegelberg aus dem Weserbergland. Sie hatten 1281 in Coppenbrügge ihre Grafschaft gegründet.
Weil man sich ausschließlich auf das Wegführen der Kinder stützt, müssen deshalb alle anders lautenden Elemente in der Sage zurechtgebogen oder uminterpretiert werden. Damit wird zwar Neues über die Geschichte der Kolonisationswanderung entdeckt, aber die Verbindung zur Sage bleibt eine willkürliche Konstruktion. Es entstehen daraus dann völlig unnötige Streitereien zwischen den genannten Vertretern, wie sich in den Zeitungsartikeln der Lokalpresse aus den 1960er und 1970er-Jahren verfolgen lässt. Kann man, darf man so wissenschaftlich arbeiten?
Eine andere Gruppe von Sagenexperten hält die Geschichte für nicht real geschehen. Für sie ist es eine ausgedachte Geschichte, allerdings zu einem bestimmten Zweck: Ratsherr Sebastian Spilker, 1654; Fanny Rostek Lühmann, 1995; und alle Menschen, die die Sage für eine erfundene Legende halten. Die meisten Menschen vermuten einen pädagogischen Zweck hinter der Sage. Es gibt aber auch Menschen, die einen Werbezweck für die Stadt unterstellen. Einen psychologischen Zweck vermutet Fanny Rostek Lühmann, die nach dem Ursprung für die über Jahrhunderte fortwährende Faszination der Sage auf Generationen von Menschen sucht.30 Wie kommen alle diese Leute dazu, dass der Sage kein historisches Geschehen zugrunde liegt? Auffällig ist dabei, wie gerade diese Menschen die Quellen genau kennen und studiert haben. Sie stoßen sich daran, dass keine Originale der ältesten Aufzeichnungen mehr existieren, sondern nur Kopien davon. Mit wissenschaftlichem Scharfsinn werden diese Kopien wegen möglicher Verfälschungen und Manipulationen abgelehnt. Darf man so leichtfertig den Stab über diese Kopien brechen?
Die Anhänger der Schlacht von Sedemünder (Christoph Friedrich Fein, 1749; W. Streitberg, 1899; General von Poten, 1934) haben ihre Theorie aus der Vertauschung von Jahreszahlen am Gedenkstein abgeleitet oder aus vernichtender Kritik an den Verfassern der Quellentexte. Es verwundert, mit welcher Großzügigkeit manche Äußerungen über die Sage gemacht werden und wie wenig widersprochen wird. Dabei fällt auf, wie wenig sich die Kritiker um ein angemessenes Verständnis jener Zeit und ihres damals herrschenden Weltbildes bemühen. Deshalb wirken solche Aussagen überheblich und hochmütig.
Zwei Vertreter einer lokalen Tanzwut-Theorie seien hier genannt: Johann Letzner, 1590; Otto Meinardus, 1882. Für sie ist der Spielmann mit seiner Musik und das Datum um die Zeit der Sommersonnwende am 26. Juni der Anlass für das sagenhafte Ereignis. Die beiden Forscher, der erste durch seine chronistische Sammelleidenschaft und der zweite durch seine umfangreichen Hamelner Archivkenntnisse, verweisen auf die aus dem Mittelalter überlieferten Ausbrüche von Tanzwut, die eine größere Gruppe von Menschen wie eine suchtartige, unerklärliche, bis zur Raserei sich aufschaukelnde Besessenheit überkam. Auslöser dafür waren Festtage und auftretende Spielleute, die mit ihrer Musik die Menschen dazu aufheizen konnten. Dieses Ereignis in Hameln hat zur Hervorbringung der Sage geführt. Eine weitergehende Frage nach dem Verbleib der verlorenen Kinder stellen beide nicht.
Zu Vertretern eines lokalen Geschehens als Ursache für die Rattenfängersage gehören: Waltraud Woeller 1956; Bernd Ulrich Hucker 1984 und ich selbst 1990. Wie lässt sich bei diesen Autoren der Umgang mit den Quellen bewerten? Bei Waltraud Woeller31zählt als wesentliches Motiv für ihren Forschungsansatz der Begriff „Koppen“, wie er in den eher bürgerlichen Sagentexten vorkommt. Sie wollte diese markante Ortsangabe im Umkreis von 15 Kilometern um Hameln suchen und stieß dabei auf Coppenbrügge (vor 1934 „Koppenbrügge“geschrieben). Die 15 Kilometer Entfernung um Hameln nahm sie an, weil eine ähnliche Tanzsage in Thüringen aus dem gleichen Jahrhundert existiert, bei der Jugendliche von Erfurt nach Arnstadt tanzten, die aber am Leben blieben.
Bernd Ulrich Hucker32hat sich mit den überlieferten volkstümlichen Reimversen zur Sage beschäftigt, die er „Merkverse“nennt. Es geht ihm dabei um deren Funktion für die Erinnerung und Bewahrung eines darin geschilderten Ereignisses von schwerwiegender Bedeutung. Er sieht in der Reimform ein Mittel, mit dem man die zu bewahrende Information durch die feste Form von Reim und Versmaß vor Verfälschung schützen wollte und zugleich eine bessere Merkfähigkeit erreichte. Er glaubt aus diesen Überlieferungen auf ein lokal begrenztes Ereignis hinter der Sage schließen zu können, weil diese nur im begrenzten lokalen Umfeld existieren und nicht auf historisch belegte Ereignisse hinweisen.
Bei meiner eigenen Herangehensweise an die Sage war ausschlaggebend, dass ich nur die ältesten Quellen berücksichtigen wollte, um spätere wunderhafte Zusätze und Ausschmückungen auszuschließen. Diese Neubewertung der alten Texte konnte aber nur mit Hilfe anderer Wissenschaften gelingen. Dazu zählt die Kunstgeschichte, die Kirchengeschichte, die Lokalgeschichte, die Geologie, die Etymologie, die Archäologie, sogar die Psychologie. Ziel meiner Forschung33war von Anfang an, das Geschehen in der Sage unter keinen Umständen abzuändern, sondern die Fakten in der Sage ausschließlich durch Fakten in der heutigen Realität zu belegen und nachprüfbar zu machen. Dabei muss auch der Wahrheitsgehalt in der Sage geprüft werden.
Der eigentliche Auslöser für mein Interesse an der Hamelner Sage war im Herbst 1987 die Entdeckung von Gesichtern an den Felsklippen im Ith über Coppenbrügge. Das sogenannte „Denkmal aus dem Heidenthum“, nach dem der Coppenbrügger Pastor Jacobi34schon 1771 vergeblich gesucht hatte, war wiederentdeckt und der Bergname „Cobbanberg“ (Koppenberg) aus dem Jahre 1013 für den Ith bei Coppenbrügge ist der Beleg für die Existenz dieser Felsköpfe. Die Siedlung am Fuße des Berges hat den Namen übernommen und als „Coppenbrügge“bis heute bewahrt. Für mich erhielt damit die Theorie von Waltraud Woeller einen neuen Schub, allerdings in eine andere Richtung, bei der ein religiöser Konflikt in den Fokus rückt.
c. Wissenschaft als Annäherung an die Wahrheit
Am Anfang meiner Ausarbeitung zum Sagenstoff möchte ich vorausschicken, was für mich eine wissenschaftliche Vorgehensweise ausmacht. Mir sind die skeptischen Bemerkungen und schnellen Ablehnungen gerade aus Kreisen der Wissenschaft noch genau im Bilde, wenn es um Beobachtungen geht, die sich nicht so passgenau in das bisherige Weltbild einfügen. Gemeint ist die Anerkennung jener Entdeckung von Gesichtern an den Felsklippen auf dem Ith, aber auch an anderen Orten wie beispielsweise an den Externsteinen oder den Bruchhäuser Steinen im Sauerland und vielen weiteren Plätzen in ganz Europa. Die Forschung darüber geht auf Elisabeth Neumann-Gundrum zurück. Ihre Ergebnisse hat sie in einem Bildband mit dem Titel „Europas Kultur der Großskulpturen“1981 vorgestellt.35Im Lippischen Landesmuseum in Detmold wurde ihr 1988 eine Ausstellung mit den von ihr fotografierten Felsen an den Externsteinen genehmigt. Nach ihren Ausführungen zur Eröffnung der Ausstellung wurde ihr vom damaligen Oberkustos aus Bielefeld vor der Öffentlichkeit „geistiger Überbau“vorgehalten, den er nicht „glauben“könne, womit ihre Arbeit als Fantasterei abgetan wurde.36
Wer ihren Namen im Internet sucht, erfährt bei Wikipedia Folgendes37: „Von Fachwissenschaftlern wird diese Deutung, die nur in rechten und germanophilen Kreisen auf fruchtbaren Boden gefallen ist, durchweg abgelehnt und die entsprechenden ‚Forschungen‘ als Pseudowissenschaft erachtet.“Unter dem Abschnitt „Kritik“wird ausgeführt: „Von Seiten der akademischen Wissenschaft werden die betreffenden Felsformationen als rein natürlichen Ursprungs und die Ähnlichkeiten mit Gesichtern oder Tieren einhellig als natürliche Zufallsbildungen angesehen. Die Fotos in Neumann-Gundrums Bildband zeigen bei unvoreingenommener Betrachtung, dass ihre Deutung kaum nachvollziehbar ist.“Das bei Wikipedia beigefügte Bildmaterial ist allerdings vollkommen ungeeignet, weil sich damit der Leser nicht selbst von der behaupteten „kaum nachvollziehbaren“Deutung überzeugen kann.
Deshalb habe ich aus dem Buch über „Arbeitsspuren an megalithischen Groß-Steinskulpturen“ein Beispiel ausgewählt: den Rufer an den Externsteinen.
Die durch Nachzeichnung verdeutlichten
Darstellungen am Ruferfelsen bei den
Externsteinen, wie sie Elisabeth
Neumann-Gundrum erarbeitet hat
Wer sich der vergleichenden Betrachtung zwischen Foto und Zeichnung nicht von vornherein entzieht, wird gar nicht umhinkönnen, die Ehrlichkeit zwischen beiden Darstellungen zu registrieren und ihre Deckungsgleichheit anzuerkennen. Wo ist hier etwas „nicht nachvollziehbar“?Ja, es ist frappierend ungewöhnlich, weil wir normalerweise nicht gewohnt sind, so genau hinzusehen. Das aber macht gerade Wissenschaft aus, dass sie dem neuen Unbekannten nicht ausweicht, sondern erst recht noch weiter an der Sache „unvoreingenommen“und aus reiner Neugier weiter in die Tiefe vorstößt, also noch intensiver bei der Sache bleibt. Genau das aber hat Frau Neumann-Gundrum getan, wie an der Detailaufnahme des Ruferkopfes zu erkennen ist. Sie hat sogar ausdrücklich für die Zweifler eine Beilage mit herausnehmbarem Transparentpapier erarbeitet, auf dem die Zeichnungen der Felsen gedruckt sind. So kann auch der Skeptiker durch Auflage der Transparenzzeichnung über das jeweilige Foto die Identität selbst leicht überprüfen.
Bei diesen Details (die Echse im
unteren Gesichtsabschnitt) fällt die
Anerkennung schwer, lässt sich aber im
ehrlichen Vergleich nicht abstreiten
Die Überprüfbarkeit ist die Grundlage echter Wissenschaft. Ich gebe zu, auch mir ist es schwergefallen, beim ersten Mal der Begegnung mit diesen Bildern und Zeichnungen das „Hineingesehene“nicht gleich als reines Fantasieprodukt abzutun, wie es viele „akademische Wissenschaftler“vorschnell praktizieren. Der bequeme Ausweg ist dann die Behauptung, alles sei bloß aus natürlicher Verwitterung entstanden. Selbst schon bei einem aufgeweckten Grundschüler habe ich während einer Führung durch das Museum in Coppenbrügge die skeptische Äußerung beim Anblick der Felsgesichter gehört, „dazu gehört aber viel Fantasie“. Wenn mit Fantasie ein starkes Vorstellungsvermögen, gepaart mit Intuition, gemeint ist oder, wie Konrad Lorenz beschreibt, dass er sich bei seinen Tierbeobachtungen auf die menschliche Fähigkeit der Gestaltwahrnehmung als wissenschaftliche Quelle verlässt, dann ist nichts einzuwenden. Wenn aber Fantasie im Sinne von Fantasy, also als reines Hirngespinst ohne realen Bezug, gemeint ist, dann hat das freilich nichts mit Wissenschaft zu tun.
Um das Thema Großsteinskulpturen als pseudowissenschaftlich zu entlarven, wird bei Wikipedia im nächsten Absatz die politische Einstufung klar genannt: „Eine gewisse Akzeptanz fanden die umstrittenen Thesen in esoterisch geprägten Zirkeln der rechtsextremen Szene, der die Mehrzahl der Autoren, die sich mit dem Thema Groß-Steinskulpturen befasst haben, auch zuzuordnen ist.“Diese Zuschreibung auf die rechtsextreme Szene wirkt auf unsere Gesellschaft als ein Tabu. So soll es auch wirken, denn selbst die Medien greifen das höchst interessante Thema der Felsgesichter nur als Nebenbeitrag zu anderen Themen auf wie z. B. in Sendungen über die Rattenfängersage.
Wenn wir davon ausgehen, dass diese Bildmotive auf den Felsen mit den Zeichnungen übereinstimmen und sie dadurch erst richtig sichtbarer gemacht werden, bleibt die Frage nach ihrer Bedeutung, ihrem Sinn nicht aus. Frau Neumann-Gundrum hat zwei der immer wiederkehrenden Motive an den Felsgesichtern hervorgehoben: die „Atemgeburt“, weil aus Mund und Nase der großen Gesichter kleinere Köpfe von Menschen oder Tieren hervorkommen, und die „Zwiesicht“, weil die Augen unterschiedlich gestaltet sind. Ihre Deutung dieser Motive wird bei Wikipedia als „von schwer verständlicher Mystik durchsetzt“beschrieben. Das liegt aber nicht an einer geheimnisvollen Gedankenwelt bei ihr, sondern an ihrem von ständigen Einschüben und Nebensätzen so verschachtelten Sprachstil, der es dem Leser dadurch unnötig schwermacht, ihre Erklärungen zu verstehen. An dieser Stelle soll aber nicht näher auf diese Deutungen eingegangen werden (Näheres in 5c).
Zum Thema Wissenschaft und Wahrheit ist hier noch etwas Grundsätzliches zu sagen. Wissenschaft, die nicht nach Erkenntnis, nach Wahrheit sucht, ist keine Wissenschaft. Wenn sie neues „Wissen schafft“, braucht sie dafür eine offene und ehrliche Haltung dem Forschungsziel gegenüber. Menschliche Eitelkeiten wie Gelehrtendünkel, Rechthaberei, Rivalitätsdenken oder auch Großmannssucht behindern die reine Wissenschaft. Über den Werdegang wissenschaftlich gewonnener Erkenntnisse hat Konrad Lorenz38, jener bahnbrechende Tierverhaltensforscher, 1959 eine Abhandlung zum Thema Gestaltwahrnehmung veröffentlicht, in der er auf die grundlegende Bedeutung dieser Fähigkeit des Menschen bei aller Forschung eingeht. In seiner Einleitung schreibt er: „All unser Wissen um die Gesetzlichkeiten der uns umgebenden Wirklichkeit gründet sich auf die Meldungen jenes wundervollen, aber recht gut erforschbaren neuralen Apparates, der aus Sinnesdaten Wahrnehmungen formt. Ohne ihn, vor allem aber ohne die im wahrsten Sinne des Wortes objektivierende Leistung der sog. Konstanzmechanismen, die wir noch genauer erörtern werden, wüssten wir nichts von der über kürzere oder längere Zeiträume sich erstreckenden Existenz jener natürlichen Einheiten, die wir Gegenstände nennen.“39Konrad Lorenz gilt heute als „Einstein der Biologie“.
Auch der Begriff „Wahrheit“bedarf einer genaueren Definition. Im Lexikon ist Wahrheit „die Übereinstimmung der Erkenntnis mit ihrem Gegenstand“40. Wenn sich aber durch genauere Betrachtung des Gegenstandes neue Einsichten und Erkenntnisse auftun, wird die bisherige Wahrheit über den realen Gegenstand relativiert. Wahrheit ist also niemals absolut, sondern unsere Wahrnehmung und ihre daraus gewonnene „Wahrheit“bleibt vorläufig. Die Erforschung neuer Erscheinungen in der realen Umwelt bleibt daher immer im Bereich von Hypothesen, die aber durch weitere Forschung zu neuen Hypothesen führen, die den Sachverhalt stimmiger erklären als die vorherigen. Das ist die naturwissenschaftliche Vorgehensweise, mit der das bisherige Weltbild, die für wahr gehaltene Realität, verändert, korrigiert und erweitert wird. Das Währende, die Wahrheit also, hat für das wahrnehmende Individuum durch die heute damit gemeinten Konstanzleistungen wie Richtungs-, Farb- und Formkonstanz eine wichtige arterhaltende Funktion.
Es gibt aber auch Wahrnehmungstäuschungen, zu denen die bekannte „Optische Täuschung“oder auch die eidetische Fähigkeit bei vielen Menschen zählt. Von eidetischen inneren Bildern spricht man, wenn jemand in Wolkengebilden oder in natürlichen Strukturen in Steinen oder anderen Stoffen Gestalten erkennt, die sein eigener Wahrnehmungsapparat erzeugt, die aber rein zufällig zustande kommen. Hier setzt die Kritik der „akademischen Wissenschaftler“an den Forschungen von Frau Neumann-Gundrum an. Die Beobachtungen an den von ihr untersuchten Felsen hat sie durch ihre Fotos und die daraus entstandenen Zeichnungen für alle und jedermann nachprüfbar gemacht. Diese gründliche Nachprüfung aber wird von der Wissenschaft bisher verweigert, weil vorschnell alles der natürlichen Verwitterung zugeschrieben wird. Ist das vielleicht eine wissenschaftliche Methode, mit der vermeintliche Falschmeldungen abgewehrt werden sollen? Die Geschichte ist voller Beispiele, die zeigen, wie schwer sich die Häupter des bestehenden Weltbildes damit tun, wenn neue Erscheinungen auftreten und neue Entdeckungen gemacht werden. Das war schon zu Galileis Zeiten so, bei Giordano Bruno oder auch bei der Entdeckung von Höhlenmalereien, sodass ihre Anerkennung zuerst verweigert wurde.