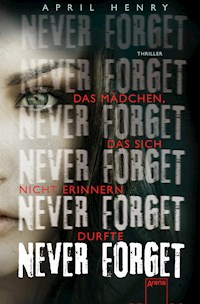
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arena
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Als Cady aufwacht, kann sie sich an nichts erinnern. Nicht woher sie kommt, warum sie auf einem Holzboden liegt und ihr alles wehtut - und auch nicht an ihren Namen. Dann hört sie, wie sich zwei Männer über sie unterhalten, dass sie sie "loswerden" müssen. Doch Cady gelingt die Flucht. Mit jedem Schritt kommt sie der Wahrheit näher und bald muss sie sich fragen: Wie gefährlich ist es, sich zu erinnern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
April Henry
NEVER FORGET
DAS MÄDCHEN, DAS SICH NICHT ERINNERN DURFTE
Aus dem Amerikanischen von Sonja Häußler
Zur Erinnerung an Bridget Zinn (1977–2011) – Schriftstellerin, Bibliothekarin, Ehefrau, Freundin – eine vor Leben sprühende Frau, die aus einem ganz normalen Tag etwas ganz Besonderes machte
1. Auflage 2014 Copyright © 2013 by April Henry Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem TitelThe Girl Who Was Supposed To Die bei Henry Holt and Company, LLC. All rights reserved. Deutschsprachige Ausgabe © Arena Verlag, Würzburg Alle Rechte vorbehalten Aus dem Amerikanischen von Sonja Häußler Umschlaggestaltung: Frauke Schneider, unter Verwendung eines Fotos von © Paul Matthew, shutterstock ISBN 978-3-401-80332-6
www.arena-verlag.deMitreden unter forum.arena-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
1 TAG 1, 16:51 UHR
2 TAG 1, 16:54 UHR
3 TAG 1, 16:58 UHR
4 TAG 1, 17:09 UHR
5 TAG 1, 17:23 UHR
6 TAG 1, 17:34 UHR
7 TAG 1, 18:27 UHR
8 TAG 1, 18:49 UHR
9 TAG 1, 19:02 UHR
10 TAG 1, 19:56 UHR
11 TAG 1, 21:20 UHR
12 TAG 1, 21:36 UHR
13 TAG 1, 21:49 UHR
14 TAG 1, 22:11 UHR
15 TAG 1, 22:53 UHR
16 TAG 2, 7:05 UHR
17 TAG 2, 7:50 UHR
18 TAG 2, 7:58 UHR
19 TAG 2, 8:07 UHR
20 TAG 2, 8:40 UHR
21 TAG 2, 8:43 UHR
22 TAG 2, 9:32 UHR
23 TAG 2, 10:33 UHR
24 TAG 2, 10:39 UHR
25 TAG 2, 10:51 UHR
26 TAG 2, 11:34 UHR
27 TAG 2, 13:14 UHR
28 TAG 2, 15:44 UHR
29 TAG 2, 17:08 UHR
30 TAG 2, 17:22 UHR
31 TAG 2, 17:52 UHR
32 TAG 2, 18:21 UHR
33 ACHT WOCHEN ZUVOR
34 TAG 1, 8:12 UHR
35 TAG 2, 18:48 UHR
36 TAG 2, 19:02 UHR
37 TAG 2, 19:41 UHR
38 TAG 2, 20:54 UHR
39 TAG 2, 21:22 UHR
40 TAG 3, 5:07 UHR
41 DREI MONATE SPÄTER
Dank
1 TAG 1, 16:51 UHR
Ich wache auf.
Aber aufwachen ist nicht das richtige Wort. Das würde ja bedeuten, dass ich geschlafen hätte. Ein Bett. Ein Kissen.
Langsam komme ich zu mir.
Anstatt auf einem Kissen liege ich mit meiner rechten Wange auf etwas Hartem, Rauem, Grobem. Einem abgewetzten Holzboden.
Ich habe den Geschmack von alten Münzen im Mund. Blut. Ich halte die Augen geschlossen und fahre vorsichtig mit meiner Zunge über meine Zähne. Einer von ihnen ist locker. Das Innere meines Mundes fühlt sich verletzt und wund an. Mein Kopf tut weh und in meinen Ohren summt es leise.
Irgendetwas stimmt auch nicht mit meiner linken Hand. Die Spitzen meines kleinen Fingers und meines Ringfingers pochen mit jedem Herzschlag. Der Schmerz ist scharf und glühend.
Stimmen dringen zu mir, zwei Männer, die sich unterhalten, ihr Gespräch nur ein leises Murmeln. Irgendetwas darüber, dass niemand kommen würde, um jemanden zu holen. Dass es zu spät sei.
Ich beschließe, die Augen geschlossen zu halten. Mich nicht zu rühren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dazu überhaupt in der Lage wäre. Es ist nicht nur mein Zahn und meine Hand, die sich irgendwie falsch anfühlen.
Schritte nähern sich. Ein Schuh trifft mich in die Rippen. Nicht besonders hart. Eher ein Stupsen. Eine Reaktion erlaube ich mir trotzdem nicht. Ich öffne meine Augen einen winzigen Spalt und sehe zwei Paar Männerschuhe neben mir stehen. Ein Paar brauner Stiefel und ein Paar rotbrauner Lederschuhe, die zu den Zehen hin ins Schwarze spielen. Ein ferner Teil von mir denkt, dass diese Farbe »Ochsenblut« genannt wird.
»Sie weiß nichts«, sagt einer der Männer. Er klingt nicht böse, nicht einmal aufgeregt. Es ist die bloße Feststellung einer Tatsache.
Ich merke, dass er recht hat. Ich weiß nichts. Gar nichts. Was mit mir passiert ist, wo ich bin, wer sie sind. Und dann versuche ich, darüber nachzudenken, wer ich bin, aber alles, was mir dazu einfällt ist: nichts. Ein großes schwarzes Loch. Das Einzige, was ich mit Sicherheit weiß, ist, dass ich in Schwierigkeiten stecke.
»Ich muss zurück nach Portland und den Hinweisen dort nachgehen«, sagt der andere Mann. »Du wirst dich hier um alles kümmern. Schaff sie hier raus und mach sie kalt.«
»Aber sie ist doch noch ein Kind«, sagt der erste Mann. Sein Tonfall ist jetzt nicht mehr ganz so neutral.
»Ein Kind?« Die Stimme des zweiten Mannes wird hart. »Wenn sie mit den Cops redet, kann sie uns beide in die Todeszelle bringen. Entweder sie oder wir. So einfach ist das.« Seine Schritte entfernen sich von mir. »Ruf mich an, wenn du fertig bist.«
Der andere Mann stupst mich wieder mit dem Fuß an. Dieses Mal etwas fester.
Ich höre, wie sich hinter mir eine Tür öffnet und wieder schließt.
»Komm. Steh auf.« Mit einem Seufzer beugt er sich über mich und packt mich unter den Armen. Grunzend hievt er mich von hinten hoch. Sein Atem riecht bitter, wie Kaffee. Ich versuche, meinen Körper ganz schlaff zu machen, doch als meine linke Hand über den Boden streift, jagt der Schmerz wie ein elektrischer Schlag durch meine Finger. Meine Beine werden steif und er zieht mich auf die Füße.
»So ist es gut«, sagt er und schubst mich vorwärts, während er mich noch immer aufrecht hält. »Wir machen einen kleinen Spaziergang.«
Da er jetzt weiß, dass ich bei Bewusstsein bin, kann ich genauso gut meine Augen halb öffnen. Wir sind in einer Art Hütte mit Wänden aus astigem Kiefernholz und einem schwarzen Holzofen. Gelbes Füllmaterial quillt aus aufgeschlitzten Kissen, die auf einem alten karierten Sofa und einem grünen Sessel mit hoher Rückenlehne verteilt sind. Bücher liegen verstreut unter einem leeren Regal. Offensichtlich hat hier jemand etwas gesucht, aber ich weiß nicht, was, und auch nicht, ob derjenige es gefunden hat. Draußen vor den rot-weiß karierten Vorhängen ist außer Tannenbäumen nichts zu sehen.
Der Typ umklammert meine Schultern und ich stolpere an einem Tisch mit vier Stühlen vorbei. Einer von ihnen ist vom Tisch abgewandt. Um seine Lehnen winden sich locker Seile. Eine blutige Zange liegt auf dem Tisch, daneben silbrigweiße Plättchen, die großteils rosa angemalt sind.
Ich blicke auf meine schlaffe linke Hand hinunter. Rosa Nagellack an drei der Fingernägel. Die Spitzen der letzten beiden Finger sind dort, wo mal Nägel waren, nass und rot.
Ich glaube, ich weiß jetzt zumindest, wo ich war, bevor ich auf dem Boden gelandet bin.
Ich mache kleine, stolpernde Schritte, damit er mich halb tragen muss. Das fällt ihm nicht leicht, denn er ist kaum größer als ich, einen Meter achtzig vielleicht. Der Typ murmelt irgendetwas vor sich hin, das ist alles. Vielleicht will er genauso wenig an den Ort, zu dem wir hingehen, wie ich. Bis zur Hintertür sind es noch etwa sechs Meter.
Draußen wird ein Motor angelassen und ein Auto fährt weg. Die einzigen anderen Geräusche sind der Wind in den Bäumen draußen und ab und zu das Grunzen des Mannes bei dem Versuch, meinen Körper dazu zu bringen, geradeaus zu gehen.
Wo immer wir auch sind – ich glaube, wir sind allein. Nur ich und dieser Kerl. Und sobald er es geschafft hat, mich durch diese Tür zu bugsieren, wird er seine Anweisungen befolgen.
Er wird mich kaltmachen.
Töten.
2 TAG 1, 16:54 UHR
Wir gehen weiter auf die Hintertür der Hütte zu. Allerdings übernimmt das Gehen vor allem der Typ, der mich mehr oder weniger aufrecht hält. Mein linkes Knie knallt gegen einen Stuhl. Ich hebe meine Füße nicht, sondern lasse sie über den Boden schleifen. Ich versuche, Zeit zu gewinnen, und überlege fieberhaft, wie ich mich retten könnte. Meine halb geschlossenen Augen zucken hin und her, auf der Suche nach einer Waffe, nach irgendetwas, das mir helfen könnte. Aber neben dem Holzofen steht kein eiserner Schürhaken, auf der Arbeitsplatte liegen keine Messer, an der Wand hängt kein altmodisches schwarzes Telefon. Nur offene Schubladen, leere Schränke und ein Riesenchaos auf dem Fußboden – Kekspackungen, Geschirrtücher, Cornflakes- und Crackerpackungen, die ausgeschüttet worden sind und nun wahllos herumliegen.
Er muss mich mit einer Hand loslassen, um die Tür zu öffnen. Schauspielere nicht. Fühle es, flüstert eine Stimme in meinem Kopf. Ich stelle mir vor, wie mein Bewusstsein schwindet, lasse meinen Körper schlaff werden und entgleite seinem Griff. Es ist schwer, locker und regungslos zu bleiben, als meine Fingerspitzen auf dem Holzboden aufschlagen. Der Schmerz durchzuckt meinen Arm, als hätte ich meine Finger in eine Steckdose gehalten. Trotzdem lasse ich mich einfach zu Boden fallen, als wäre ich vollkommen bewusstlos.
Ich stelle mich tot. In der Hoffnung, dass ich nicht bald tot bin. Vielleicht wird er unvorsichtig, wenn er glaubt, ich wäre ohnmächtig.
Mit einem Seufzer steigt der Mann über mich, tritt mit dem Fuß die Tür auf und lässt einen Schwall kalter Luft herein. Er beugt sich zu mir herunter und dreht mich um, sodass ich wieder mit dem Gesicht nach oben liege. Es ist so schwer, sich nicht anzuspannen, vor allem weil jeder Zentimeter meines Körpers empfindlich und lädiert zu sein scheint, doch ich beiße mir auf die Zunge und versuche, ganz locker zu bleiben. Dann packt er mich wieder unter den Armen und zieht mich rückwärts weiter, wobei er bei jedem Schritt ächzt. Sein Kinn streift mich oben am Kopf.
Er kann mein Gesicht nicht sehen. Ich frage mich, ob das ein Fehler ist. Es wird leichter für ihn sein, mich umzubringen, wenn er dabei nicht in meine flehenden Augen schauen muss. Wenn er nicht sehen muss, wie meine Lippen beben, während ich um mein Leben bettle.
Meine Füße holpern über die Türschwelle. Ich schlage die Augen wieder auf und sehe einen ausgetretenen Trampelpfad, der zur Hütte führt, meine Füße in blauen Nike-Laufschuhen und meine Beine in engen Jeans. Auf den Oberschenkeln rötlich braune Flecken. Ich frage mich, ob das Blut nur von meinen Fingern stammt.
Ich lasse meine Hände – auch die verletzte – über den Boden schleifen. Unter meinen Fingerspitzen spüre ich kalte Erde, zerfurcht von Fußabdrücken, an manchen Stellen matschig, dann einen Ast, etwa so dick wie einer meiner Finger. Aber schließlich bekommt meine gute Hand einen Stein zu fassen, der klein genug ist, um in meine Handfläche zu passen. An einer Seite ist er abgerundet, an der anderen scharfkantig.
Wenn dieser Mann eine Waffe hat – was mehr als wahrscheinlich ist –, wird mir der Stein nicht viel nützen. Selbst David hatte eine Schleuder, um Goliath mit einem Stein zu erledigen.
Wir kommen jetzt leichter voran. Kiefern umgeben uns und meine Fersen gleiten über kupferfarbene Nadeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kerl, der jetzt schon schwer atmet, mich noch meilenweit schleppen kann. Bald wird er mich fallen lassen, seine mehr als wahrscheinliche Waffe zücken und mir in den Kopf schießen. Oder ins Herz. Oder beides.
Ich werde sterben und nicht wissen, warum.
Ich weiß nicht einmal, wer ich bin.
Womöglich wird er sich nicht einmal die Mühe machen, mich zu begraben. Vielleicht wird er meinen toten Körper dem überlassen, was auch immer in diesen Wäldern kreucht und fleucht.
Nein! Der Gedanke ist so heftig, dass ich meine Lippen zusammenpressen muss, um ihn nicht hinauszuschreien. Ich kann es nicht ihm überlassen zu entscheiden, was mit mir geschieht. Ich kann nicht einfach abwarten, bis er mich umbringt.
Er zieht mich an einem kleinen Baum vorbei. Ich strecke ein Bein aus und hake meinen Fuß an seinem Stamm ein. Ruckartig kommen wir zum Stehen.
»Komm schon.« Er seufzt. »Mach es uns nicht noch schwerer als nötig.«
Er hebt mich an, um mich besser greifen zu können. Ich schaffe es, die Füße unter mich zu ziehen. Er ist so nah, dass sein Atem die Härchen in meinem Nacken bewegt.
Ich weiß selbst nicht, was ich jetzt tun soll, bis ich es plötzlich tue. Mein rechter Ellbogen stößt wie ein Kolben nach hinten und trifft ihn direkt in den Bauch. Er ächzt, als ihm explosionsartig die Luft entweicht, und klappt zusammen. Meine rechte Faust holt aus und schlägt ihm wie ein Hammer in die Leistengegend. Dann reiße ich meine Hand nach oben, drehe sie und ramme ihm den Rücken meiner Faust direkt ins Gesicht. Hart. Noch härter durch den Stein in meiner Hand. Ich spüre, wie sein Nasenrücken unter meinen Knöcheln bricht.
Ich wirble herum, um ihn anzuschauen. Seine Augen sind vor Schmerz halb geschlossen. Blut läuft ihm aus der Nase, so rot wie Farbe. Seine rechte Hand schießt nach vorne, um nach mir zu greifen, aber meine linke Hand fährt schon nach oben, am Handgelenk im rechten Winkel abgeknickt, und schlägt seine Hand weg. Dann schnappt meine Hand zurück und formt mit ausgestreckten Fingern eine Kralle. Meine noch verbliebenen Fingernägel graben sich in seine Wange und hinterlassen Furchen, die sich sofort mit Blut füllen. Er schreit auf, fasst sich mit den Händen ans Gesicht – und lässt seinen Hals ohne Deckung. Ich ziehe die Hand zurück, die Finger dicht zusammen und am zweiten Knöchel gekrümmt. Ich ramme sie, so fest ich kann, in seine Kehle.
Dann fällt er flach auf den Rücken und rührt sich nicht mehr.
Ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt noch atmet.
Alle meine Bewegungen verliefen vollkommen automatisch. Ich brauchte gar nicht darüber nachzudenken. Mich an nichts zu erinnern.
Wer immer ich bin – ich weiß genau, wie man so etwas macht.
3 TAG 1, 16:58 UHR
Der Kerl, der mich umbringen wollte, liegt still und reglos auf dem Boden.
Was mache ich jetzt?
Mein erster Impuls ist wegzulaufen.
Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er eine Waffe bei sich hat. Was, wenn er aufwacht? Er könnte mich erschießen, noch bevor ich es zurück zur Hütte schaffe.
Ich stoße ihn mit dem Fuß gegen die Schulter, bereit, einen Satz nach hinten zu machen, falls er sich bewegt. Tut er aber nicht.
Der Mann ist weiß, etwa dreißig oder etwas älter, schlank und nicht besonders groß. Sein dickes schwarzes Haar ist sehr kurz geschnitten. Er trägt dunkle Jeans und eine schwarze Softshell-Jacke mit Kapuze. Seine Augen sind halb geöffnet, seine Lippen schlaff.
Ist er tot?
Ich trete ihm in die Seite, etwa so, wie er es bei mir getan hatte; nicht besonders nachdrücklich.
Er rührt sich immer noch nicht, aber er atmet eindeutig. Vielleicht ist atmen allerdings nicht das richtige Wort, er schnappt eigentlich eher nach Luft. Abgehackt und ungleichmäßig.
Doch wenigstens ist er nicht tot.
Ich beuge mich mit klopfendem Herzen über ihn. Ich kann jeden Herzschlag in den Ohren, der Halsgrube und meinen geschundenen Fingerspitzen spüren. Ich habe eine Riesenangst, er könnte sich aufsetzen und mich packen.
Ich muss seine Waffe finden. Aber was, wenn ich mich irre in Bezug auf das, was er vorhatte? Was, wenn er nicht mal eine Waffe bei sich hat? Ich glaube nämlich, ich habe ihm ernsthaften Schaden zugefügt. Vielleicht habe ich nicht richtig verstanden, was ich gehört habe? Vielleicht habe ich nicht richtig gedeutet, was ich gesehen habe? Vielleicht gibt es eine ganz andere Erklärung für das, was passiert ist, und ich sollte gar nicht umgebracht werden.
Vielleicht.
Ich lasse den Stein fallen und ziehe seine Jacke am Bund hoch, schaudernd, weil ich immer noch fürchte, er könnte hochschnellen und mich packen.
Und da ist sie – in einem Lederholster an seinem Gürtel. Die Pistole scheint aus schwarzem Plastik zu bestehen, sieht aber absolut nicht wie ein Spielzeug aus.
Ich will sie nicht an mich nehmen. Doch ich weiß, dass ich das tun muss, damit ich ihn erschießen kann, falls es notwendig wird. Ich mache mir klar, dass dies zweifellos das ist, was er mit mir vorgehabt hatte.
Aber was ist, wenn ich nicht treffe? Ist sie geladen? Ist sie gesichert? Mit zitternden Händen ziehe ich sie aus dem Holster. Die ganze Zeit rechne ich damit, dass sich seine Hand um mein Handgelenk schließt, aber er rührt sich nicht.
Die Waffe ist viel schwerer, als ich erwartet hatte. Sie wiegt sicher ein paar Pfund. Ich betrachte sie von allen Seiten, kann aber nicht herausfinden, ob sie gesichert ist. Ich habe gar keine Tasche, in die ich sie packen könnte. Obwohl die Temperatur nicht weit über dem Gefrierpunkt liegen kann, trage ich keinen Mantel, nur Nikes, Jeans und einen dicken roten Pullover ohne Taschen. Ich stecke mir die Pistole hinten in den Hosenbund und hoffe, dass das nicht damit endet, dass ich mir selbst in den Hintern schieße.
Ich muss mir überlegen, wie ich ihn aufhalte, falls er wieder zu sich kommt. Denn egal wie sein Atem jetzt klingt – früher oder später wacht er auf, oder? Vielleicht kann ich ihn mit seinem Gürtel fesseln? Mit zittrigen Fingern öffne ich die Schnalle seines braunen Gürtels und fange an, ihn aus den Schlaufen zu ziehen. Sein Körper bewegt sich dabei vor und zurück, aber er reagiert überhaupt nicht. Ich bin hin- und hergerissen zwischen der Angst, dass er sich bewegen könnte, und der Angst, dass er ganz aufhört zu atmen. Endlich rutscht der Gürtel durch die letzte Gürtelschlaufe. Sein Pistolenholster fällt zu Boden.
Nichts passiert. Sein Körper ist noch immer schlaff. Sein Atem geht noch immer stoßweise, seine Augen noch immer halb geöffnet. Erst jetzt sehe ich, worauf er mit dem Kopf gelandet ist, als er stürzte. Direkt auf einen Stein. Er ist nicht viel größer als der, den ich in der Hand hatte, aber er ist blutverschmiert.
Bittere Säure füllt meinen Mund. Hat er sich den Schädel gebrochen? Wird er sterben? Habe ich ihn umgebracht?
Aber ich musste doch tun, was ich getan habe! Ich musste.
Und ich muss dafür sorgen, dass er mich nicht angreifen kann, wenn er wieder zu sich kommt. Ächzend wälze ich ihn auf die Seite. Dafür brauche ich all meine Kraft. Jetzt verstehe ich auch endlich, was mit dem Begriff »totes Gewicht« gemeint ist.
Auf seiner hinteren Hosentasche zeichnet sich der quadratische Umriss eines Geldbeutels ab. Ich ziehe ihn heraus und stecke ihn in meine eigene hintere Hosentasche. Dann biege ich den Gürtel zu einer Schlaufe. Eine seiner Hände steckt unter seinem Körper fest und ich ziehe sie heraus. Sein Atem setzt kurz aus, aber er spannt sich dabei nicht an – er stöhnt nicht einmal. Ich lasse die Schlaufe um seine Handgelenke gleiten, ziehe sie an und wickle den Gürtel dann zu einer Art Knoten zusammen. Ich glaube allerdings nicht, dass der besonders lange hält, falls er versucht, sich zu befreien.
Ich drehe ihn wieder auf den Rücken, auf seine gefesselten Hände, und hoffe, dass ihn das zumindest ein wenig beschäftigen wird. In seiner vorderen Hosentasche spüre ich etwas, eine rechteckige Form, vermutlich ein Handy.
Vorsichtig angle ich das Handy und einen Schlüsselbund heraus, an dessen Ring ein flaches schwarzes Plastikdreieck mit zwei Knöpfen baumelt. Ein Autoschlüssel. So viel ist mir klar. Was nicht klar ist: Ob ich Auto fahren kann und ob bei der Hütte überhaupt ein Auto steht, das ich fahren könnte.
Ich habe das Gefühl, dass ich das in ein paar Minuten herausfinden werde.
Und natürlich hoffe ich, dass die Antwort auf beide Fragen Ja lautet.
4 TAG 1, 17:09 UHR
Ich folge dem Trampelpfad und den beiden schwachen Furchen, die meine Fersen hinterlassen haben, und renne zurück zur Hütte. Die Pistole jetzt in der Hand. Ich hoffe nur, dass ich den Abzug drücken kann, wenn es darauf ankommt.
Die Tür der Hütte steht immer noch offen. Ich höre und sehe niemanden und trete über die Schwelle. Drinnen ist es genauso kalt wie draußen.
Nachdem ich ein paar Schritte weiter hinein gegangen bin, entdecke ich ein Gesicht. Es starrt mich an.
Abrupt bleibe ich stehen, mein Herz droht, mir aus der Brust zu springen.
Es ist ein Mädchen. Ihr klappt der Mund auf, als wollte sie Alarm schlagen, weil ich mich befreit habe. Weil ich am Leben bin. Obwohl ich keines von beidem sein sollte. Ich schreie und reiße die Pistole hoch, umklammere sie mit beiden Händen.
Das Mädchen tut dasselbe.
Es ist natürlich ein Spiegel. Ein Spiegel, über dem Kleiderhaken angebracht sind. An einem davon hängt eine Jacke, die den Großteil des Rahmens verdeckt. Ich kicke das Durcheinander auf dem Boden beiseite, schiebe die Jacke weg und starre mich an. Mich selbst. Die, die ich wohl sein muss.
Aber es ist ein Gesicht, das ich nicht wiedererkenne.
Strähniges blondes Haar, das bis auf die Schultern fällt. Auf meine Schultern. Fünfzehn, sechzehn, siebzehn? Große blaue Augen. Eine gerade Nase mit einem leichten Höcker, darunter Lippen, die geschwollen aussehen. So blasse Haut, dass die Sommersprossen auf den Wangen hervorstechen, als wären es mit Paintbrush aufgetragene Spritzer. Bin ich immer so blass oder kommt das vom Schock und vom Blutverlust? Auf meinem Kiefer zeichnet sich ein Schatten ab, der sich wahrscheinlich zu einem Bluterguss entwickelt. Mir klopft das Herz bis zum Hals und bis in die blutigen Fingerspitzen. Am liebsten würde ich mich übergeben.
Stattdessen öffne ich meinen Mund und schaue mir meine Zähne an. Ebenmäßig und weiß. Ich stecke mir den Zeigefinger in den Mund und berühre den Zahn, der sich vorhin lose angefühlt hatte. Es ist der untere linke Eckzahn. Er wackelt. Ich ziehe die Hand zurück, aus Angst, er könnte herausfallen. Ich habe schon so viel verloren: meine Fingernägel, meinen Namen, meine Identität. Ich brauche jetzt nicht auch noch einen Zahn zu verlieren.
Ich spähe durch die rot-weiß karierten Vorhänge neben der Vordertür und ziehe sie beiseite, als ich nichts und niemanden sehe, abgesehen von einem verlassenen dunkelblauen Geländewagen, Bäumen und einer matschigen Straße. Ich stecke die Pistole in den Bund meiner Jeans, hole die Schlüssel aus meiner Hosentasche und drücke auf den Autoschlüssel. Die Rücklichter des Geländewagens leuchten auf und etwas in mir entspannt sich. Ich werde von hier wegkommen.
Ich brauche Hilfe und muss mich in Sicherheit bringen. Aber bevor ich gehe, schaue ich mich rasch um, ob ich etwas Nützliches entdecke, das ich mitnehmen kann. Irgendwelche Hinweise darauf, was hier geschehen ist, wer ich bin, warum mich jemand umbringen will.
Der schwarze Ofen ist nicht an. Darüber befindet sich ein Kamin aus Flusskieselsteinen, anscheinend das Einzige, was der Suchen-und-Zerstören-Mission nicht zum Opfer gefallen ist. Die beiden Männer hatten wohl keinen Sinn darin gesehen, die Gegenstände, die darauf stehen, herunterzuwerfen: eine lange, gescheckte Feder, ein zu einem weißen Skelett zerfallenes Laubblatt, eine halbe himmelblaue Eierschale, die über meinen kleinen Finger passen würde. Und in der Mitte ein gerahmtes Foto. Darauf ist ein Mann zu sehen, der seinen Arm um die Schultern einer Frau gelegt hat. Die Frau hält einen kleinen Jungen an der Hand. Neben ihnen steht ein Mädchen und grinst. Es zeigt mit den Händen einen Abstand an, als würde es etwas messen.
Das Mädchen bin ich. Ich schaue noch einmal in den Spiegel und dann wieder hinunter auf das Foto. Ich bin inzwischen wohl ein wenig älter als auf dem Bild, aber das bin eindeutig ich. Wer die anderen sind, weiß ich nicht. Ich erkenne sie nicht wieder.
Ich nehme die Jacke vom Haken. Es ist eine schwere braune Wachsjacke mit grün kariertem Futter. Ich glaube, es ist eine Männerjacke, vielleicht gehört sie dem Mann auf dem Foto. Ich ziehe sie an, rolle meine verletzten Finger ein, als ich sie durch den Ärmel schiebe, damit sie den Stoff nicht berühren. Die Bündchen enden knapp über meinen Fingerspitzen. Ich lasse das Foto in eine der aufgesetzten Taschen vorne an der Jacke gleiten.
Rasch überprüfe ich die beiden kleinen Schlafzimmer. In einem davon steht ein Doppelbett, im anderen stehen zwei Stockbetten. Die Laken sind heruntergerissen, die Matratzen hängen halb aus den Betten – sie sind aufgeschlitzt. Unten in den Schränken liegen jeweils ein kleiner Haufen Kleider und Kleiderbügel; dazu ein Durcheinander aus Stiefeln, Skiern, Snowboards, Angelruten, alten Spielen, nicht zusammenpassenden Betttüchern und ausgebleichten Decken. Kommodenschubladen stehen offen, aber sie sind so gut wie leer. Ich entdecke Wollsocken, ein blaues Halstuch, eine Haarbürste mit ein paar blonden Haaren in den Borsten. Ich bin zu nervös, um mich weiter umzuschauen. In meinem Nacken prickelt es und immer wieder fährt mein Kopf ruckartig herum, weil ich damit rechne, dass der Typ, den ich gefesselt habe, im Türrahmen steht.
Aber nie ist jemand da.
Im Badezimmer wurden Shampoo, Haarspülung und Sonnencreme aus ihren inzwischen leeren Flaschen gedrückt. Ich habe Glück und finde ein paar trockene Wundpflaster, die neben einem Haufen aus ruinierten liegen. Ich beklebe damit meine pochenden Finger und lasse die Papierstreifen einfach auf den Boden fallen. Ich mache mich auf den Weg zur Haustür, noch ehe ich das zweite Pflaster richtig befestigt habe.
Zwanzig Sekunden später sitze ich im Wagen des Fremden, in der Jacke eines Fremden und mit dem Bild von weiteren Fremden in meiner Tasche.
Und dann ist da noch die Waffe auf dem Sitz neben mir.
Ich stecke den Schlüssel ins Zündschloss, drehe ihn herum und löse die Handbremse. All das geschieht automatisch.
Also weiß ich wohl, wie das geht. Ich korrigiere mein Alter nach oben. Vermutlich bin ich mindestens sechzehn. Meine Hände liegen routiniert auf dem Lenkrad, während ich in einem weiten Bogen auf die Straße zusteuere.
5 TAG 1, 17:23 UHR
Ich fahre über ein paar Schotterwege mit schlammigen Pfützen. Sie schlängeln sich durch hohe Tannenbäume und plötzlich taucht vor mir eine Straße auf. Ich halte an. Es ist eine schmale, unbefestigte Straße, gerade breit genug für zwei Autos. Nicht einmal einen Mittelstreifen gibt es. Keine Verkehrszeichen. Nichts, was mir verraten könnte, wo ich bin. Oder wohin ich fahren soll.
Ich warte ein paar Sekunden, doch es kommen keine Autos vorbei. Es gibt keine Straßenlampen, keine Telefonmasten und erst da merke ich, dass es allmählich dunkel wird. Die Uhr auf dem Armaturenbrett zeigt 17:23 Uhr an. Es muss Spätherbst oder Frühlingsbeginn sein. Ich sehe keine Reste von altem Schnee, deshalb tippe ich auf Herbst.
In welche Richtung soll ich fahren? Nach links oder rechts? Die Straße fällt von links nach rechts ab. Ich bin wohl irgendwo oben in den Bergen. Wenn ich links abbiege, fahre ich noch weiter nach oben und entferne mich womöglich von der Zivilisation.
Deshalb biege ich rechts ab, meine feuchten Handflächen rutschen über das Lenkrad. Und erst als ich das tick-tick-tick höre, wird mir bewusst, dass ich den Blinker eingeschaltet habe – als wäre jemand hier, der es sehen könnte.
Während ich die Straße entlangfahre, halte ich Ausschau nach anderen Hütten, anderen Straßen, Schildern, irgendwelchen Hinweisen auf Menschen, einem Ort, an dem ich Hilfe bekommen kann, aber da ist nichts. Nur Bäume, die dicht am Straßenrand stehen. Der Tacho zeigt gerade mal fünfzig Stundenkilometer an, aber ich traue mich nicht, schneller zu fahren. Habe ich das Licht an? Ich blicke auf die Straße und sehe sie – zwei bleiche Lichtkegel, die sich vor mir herbewegen. Es wird eindeutig dunkler. Die Sonne geht rechts von mir hinter den Bäumen unter. Das heißt, dass ich Richtung Süden fahre.
Warum sammle ich dauernd Informationsschnipsel? Was macht es schon aus, ob Tag oder Nacht ist? Winter oder Sommer? Was macht es für einen Unterschied, in welche Richtung ich fahre?
Entscheidend ist jetzt doch nur, dass ich nicht weiß, wer ich bin.
Und dass zwei Männer mich umbringen wollen.
Als ich um eine Kurve fahre, taucht plötzlich ein blauer Subaru auf und fährt an mir vorbei. Er ist verschwunden, bevor ich entscheiden konnte, was ich tun soll. Sollte ich nächstes Mal, wenn ich ein Auto sehe, hupen und aufblenden, aus dem Fenster rufen, dass ich in Schwierigkeiten stecke? Aber in dem Auto, das soeben vorbeigefahren ist, saß ein Mann. Und ich habe den Kerl, der den Befehl gegeben hat, mich zu töten, nie gesehen. Was, wenn ich jemanden zum Anhalten bringe und sich herausstellt, dass es die Person ist, die meine Ermordung angeordnet hat? Was, wenn er zurückkommt, um herauszufinden, wieso sich sein Freund nicht meldet?
Es ist nicht sicher, hier draußen jemanden um Hilfe zu bitten. Nicht, wenn keine Zeugen dabei sind. Ich werde weiterfahren, bis ich eine Ortschaft erreiche. Dort suche ich dann die Polizeistation. Die werden wissen, was zu tun ist, wie sie mir helfen können.
Dann fällt mir das Handy des Mannes wieder ein, das in meiner Tasche steckt. Ich könnte jetzt gleich den Notruf wählen!
Ohne zu überlegen, lasse ich die Hand durch meine offene Jacke gleiten und versuche, meine Finger in die linke Tasche meiner Jeans zu zwängen. Au! Tränen schießen mir in die Augen und ich ziehe meine armen, verletzten Finger zurück, als hätte mich etwas gebissen.
Der Schmerz lässt mich mein Vorhaben noch einmal neu überdenken. Was sollte ich denen am Telefon erzählen? Alles, was ich weiß, ist, dass ich auf einer Straße oben in den Bergen bin. Punkt. Das reicht nicht, um mich zu finden. Mobilfunkmasten sind hier draußen wahrscheinlich eher spärlich gesät. Und ich will nicht dasitzen und abwarten, bis sie herausgefunden haben, wo ich bin.
Denn was ist, wenn mich vorher jemand anderes findet?
Nein. Ich fahre einfach weiter. Ich werde niemanden anhalten und um Hilfe bitten und ich werde auch nicht versuchen, jemanden anzurufen.
Doch dieser Entschluss hindert jemanden nicht daran, mich anzurufen. Oder eher den Kerl, den ich – gefesselt und nur noch schwach atmend – im Wald zurückgelassen habe. Denn an meiner linken Hüfte summt es.
Was wird die Person, die anruft, tun, wenn der Typ nicht an sein Handy geht? Wird sie wissen, dass etwas nicht stimmt? Wird sie ihn finden – und sich dann auf die Suche nach mir machen?
Ich drücke das Gaspedal durch.
6 TAG 1, 17:34 UHR
Endlich hört das Handy auf zu vibrieren. Meine Hände tun weh, weil ich so fest das Lenkrad umklammere. Mir klappern die Zähne, obwohl ich inzwischen herausgefunden habe, wie man die Heizung anstellt. Wellenartige Schauer durchlaufen meinen Körper.
Ich bin in einem Albtraum gefangen, doch ich brauche mich nicht zu kneifen, um zu wissen, dass alles real ist. Meine Finger tun zu sehr weh, als dass es nur ein Traum sein könnte. Wer bin ich? Wer sind diese Menschen auf dem Foto? Sie sahen wie eine Familie aus. Wie eine Mutter und ein Vater, eine Tochter und ein Sohn. Und diese Tochter war ich. Bin ich. Wenn ich sie finde, können sie mir sagen, wer ich bin. Vielleicht helfen sie mir dabei, meine Erinnerungen wieder abzuspielen, wie ein DVD-Player eine DVD.
Die Straße, auf der ich fahre, mündet in eine andere. Da die andere größer aussieht, biege ich auf sie ab. Ich entscheide mich für links und hoffe, dass das richtig ist.
Mich beschäftigt etwas anderes. Wer würde ein Foto wie das in meiner Tasche einrahmen und sich auf den Kaminsims stellen? Es ist ja kein Kunstwerk, sondern nur ein schräger Schnappschuss. Die einzigen Menschen, die sich so was aufstellen würden, sind die Leute auf dem Bild oder jemand, der mit ihnen verwandt ist. War das also die Hütte meiner Familie? Meiner Großeltern? Wahrscheinlich.
Aber hätte ich sie dann nicht erkennen sollen? Nichts an der Hütte war mir vertraut vorgekommen.
Da ist noch etwas. Wenn das Mädchen auf dem Foto ich bin, wo ist dann meine Familie? Stecken sie auch in Schwierigkeiten?
Sind sie vielleicht sogar tot?
Während ich nachdenke, fahre ich immer weiter. Zweimal muss ich mich entscheiden, welche Straße ich nehmen soll. Beide Male entscheide ich mich für die breitere oder für die, auf der mehr Autos unterwegs sind. Und jedes Mal schaue ich in den Rückspiegel, ob hinter mir jemand dieselben Entscheidungen trifft. Doch beide Male ist die Straße frei. Immer wenn ein Auto auf mich zukommt, hüpft etwas in meiner Brust. Angst und Sehnsucht. Ich möchte gerettet werden, aber ich habe auch eine Riesenangst. Die falsche Entscheidung könnte mich umbringen.
Nachdem ich etwa eine halbe Stunde gefahren bin, wird die Straße zu einer Art Highway. Alle zwei oder drei Minuten kommt ein Auto vorbei. Offensichtlich habe ich bisher die richtigen Entscheidungen getroffen.
Doch die vielen Autos machen mich nur noch nervöser. Ständig schaue ich in den Rückspiegel, weil ich denke, dass mir jemand folgt, wodurch ich fast einen Unfall baue. Als ein Auto vor mir links abbiegt, sehe ich sein gelbes Blinklicht und das rote Aufleuchten der Bremslichter nicht mehr rechtzeitig und dann ist es fast zu spät. Ich steige auf die Bremse, aber ich merke, dass das nicht ausreichen wird.
Deshalb reiße ich das Lenkrad nach rechts. Hinter mir brüllt eine Hupe auf und ich schaffe es gerade noch, mich vorbeizudrängen.
Vor mir liegt ein kleiner Lebensmittelladen, aber er ist dunkel und bereits geschlossen. Trotzdem fahre ich auf den Parkplatz. Ich zittere so heftig, dass ich kaum den Zündschlüssel drehen kann.
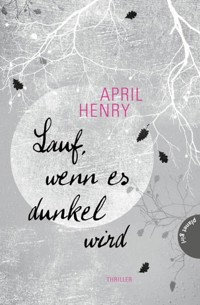













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














