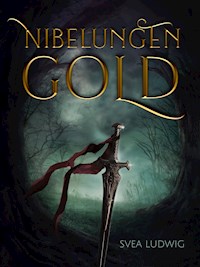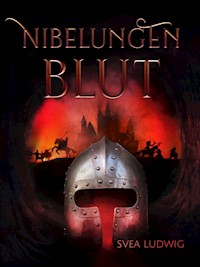
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Auch als Königin der Hunnen hat Kriemhild den Mord an ihrem Geliebten Siegfried nicht vergeben. Doch trotz aller Warnungen Hagens von Tronje folgen die Burgunden König Etzels Ruf. Widerwillig kehrt Hagen an der Seite seiner Könige in das Land zurück, aus dem er einst fliehen musste, während Brynhilde beschließt, nach Hause zu gehen. Auch Dietrich versucht, sein verlorenes Königreich zurückzuerobern. Im Finale der Nibelungen-Trilogie steht ein alles entscheidender Kampf bevor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 913
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nibelungen Blut
Nibelungen BlutProlog1. Kriemhild2. Dietleib3. Gunther4. Dietrich5. Hagen6. Giselher7. Rüdiger8. Hagen9. Brynhilde10. Gunther11. Eckehart12. Dietleib13. Hagen14. Kriemhild15. Rüdiger16. Giselher17. Dietleib18. Brynhilde19. Dietrich20. Kriemhild21. Hagen22. Brynhilde23. Hagen24. Giselher25. Gunther26. Kriemhild27. Hagen28. Dietrich29. Brynhilde30. Gunther31. Kriemhild32. Giselher33. Hildebrand34. Rüdiger35. Dietleib36. Gunther37. Hagen38. Kriemhild39. Dietrich40. BrynhildeImpressumNibelungen Blut
Prolog
Seine Finger krampfen sich um das breite, glatte Heft des Schwertes. Das Leder unter seinen Händen ist warm und glitschig. Widga bemüht sich darum, mit den Füßen Halt zu finden, stemmt die Fersen in den Boden, während er versucht, sich langsam aufzurichten. Er hat sein ganzes Gewicht noch immer auf den Mimung gestützt, der vor ihm aus der Erde ragt. Sein eigener Atem dröhnt laut und fremd in seinen Ohren, seine Sicht ist verschwommen. Den Blick hat er auf seine Hände gerichtet, rot und zitternd.
Er merkt, wie er laut aufstöhnt, unbeabsichtigt, während er hochkommt. Quälend langsam richtet er sich in eine stehende Position auf.Der Schmerz ist ihm vertraut, scharf und sauber und es kann nicht allzu schlimm sein, wenn er noch die Kraft findet, gerade zu stehen. Das redet er sich ein und deswegen muss es ihm gelingen. Er will die Wunde nicht berühren, also hält er weiterhin den Griff des Mimung umklammert. Andernfalls würden seine Hände sofort zum Riss seines zerfetzten Ringpanzers fahren, zu seinem offenen Bauch, um Blut und rohes Fleisch zu ertasten. Doch so schlimm ist es nicht. Einen Moment lang steht er nur schwer keuchend aufrecht da, bei jedem Atemzug fährt der Schmerz heftig durch seinen Leib. Dabei können seine Innereien nicht verletzt worden sein, er würde es doch merken.
Als er über dem Mimung zusammengebrochen ist, hat er ihn tief in die Erde gerammt und jetzt gelingt es seinen schwachen, steifen Fingern kaum, ihn wieder herauszuziehen. Er zerrt heftig am Heft seines Langschwertes. Der Schmerz schwillt so stark an, dass ihm einen Moment lang schwarz vor Augen wird. Seine Knie drohen, nachzugeben und er ist kurz davor, erneut zu stürzen. Er hält inne, die Hände noch immer um den Schwertgriff gekrallt, als sei dieser alles, was ihn aufrechterhält. Zum ersten Mal lässt er seinen Blick zu dem Körper des Mannes wandern, der vor ihm am Boden liegt. Der Kopf ist etwas weiter fortgerollt und er muss kurz um sich schauen, bis er ihn ein Stück zu seiner Linken erblickt. Der Helm ist noch immer fest auf den Schädel des jungen Mannes gebunden. Auch der Schild ist noch ganz, er liegt einige Schritte neben dem Körper. Widga hat ihn dem Ritter aus der Hand geschlagen, ein schöner, eiserner Schild mit Einlegearbeiten aus Lapislazuli. Sein Gegner muss adelig gewesen sein, vielleicht sogar ein Fürst. Widga flucht stumm darüber, dass er sich von ihm hat verletzen lassen.
Um ihn herum ist das Lager verlassen. Zelte und Feuerstellen sind niedergetrampelt, Gliedmaßen von Männern und Pferden bedecken wie eine unheilvolle Saat den Boden. Rasch sieht er sich nach Schimming um und erblickt den Hengst in einiger Entfernung. Stoisch und ungerührt steht er inmitten der Zerstörung, ein weißer Fleck zwischen all dem Rot. Er ist nicht weit fortgelaufen, nachdem sein Gegner Widga in der Seite getroffen und ihn aus dem Sattel gestürzt hat.
Sie haben zu lange gekämpft, er hätte es schneller beenden sollen. Um ihn herum stehen kaum noch Männer aufrecht. Die Schlacht findet hinter ihm statt, er hört den Kampflärm, die menschlichen und tierischen Schreie. Dort muss er hin, sofort, um zu versuchen, ein paar seiner verstreuten Männer zu finden und vielleicht sogar etwas wie einen Angriff zu führen, oder sich einfach mit all den anderen ins Gewühl zu stürzen, wie es wahrscheinlicher geschehen wird. Sie waren an den Toren, sie haben ihnen keine Wahl gelassen, außer zu kämpfen, sagt er sich wieder. Natürlich hätte er sich auch ergeben und auf die Gnade seiner Gegner hoffen können, doch für Gnade ist es wohl zu spät. Wenigstens wird er seine Stadt nicht wehrlos aufgeben.
Erneut versucht Widga, Mimung aus dem Boden zu ziehen. Er stemmt die Fersen in die Erde und beißt die Zähne heftig zusammen, in dem Bemühen, den Schmerz zu ignorieren, der durch die Kraftanstrengung nun auch hinter seiner Stirn pocht. Mit einem plötzlichen Ruck löst sich der Widerstand und mit der gewaltigen Klinge in Händen taumelt Widga nach hinten. Er stürzt unter dem Gewicht des Schwertes um ein Haar erneut, doch mit Not gelingt es ihm, sich rechtzeitig zu fangen. Er darf nicht mehr hinfallen, er ist nicht sicher, ob er wieder hochkommen würde.
Widga dreht sich kurz um die eigene Achse. Die Gegner, die seine Kämpfer nicht getötet haben, sind aus ihrem dem Lager vor den Toren Rabens geflohen. Dort hat ein Teil des gegnerischen Heeres darauf gewartet, in die Stadt einzudringen, nachdem die Vorhut ihnen den Weg freigeräumt hat. Die Feinde haben die Stadt rings umzingelt, der Kampf tobt an allen vier Toren. Widga sieht, wie die Gegner über die hohen Stadtmauern klettern, die hohen Mauern vor sich, dunkle Flecken nicht größer als Käfer, die sich aus dem Gewimmel vor den Toren lösen. Raben als riesiges Insektennest voller Gewürm, das übereinander herfällt und sich gegenseitig zerfetzt. Er hat sich zu weit entfernt, es muss aussehen wie eine Flucht.
Widga läuft wankend zu Schimming hinüber, jeder Schritt bereitet ihm Schmerzen, aber es ist nichts. Dennoch stöhnt er laut auf, als er das Bein hebt, um einen Fuß in den Steigbügel zu stellen und sich mit großer Mühe in den Sattel zu hieven. Das Gewicht des Mimung zieht seinen Arm hinunter, schief hängt er auf Schimmings breitem Rücken. Dieser läuft bereits los, bevor es Widga gelungen ist, sich gerade aufzurichten. Der Hengst bewegt sich auf das Schlachtfeld zu, ohne dass Widga ihn lenken müsste.
Normalerweise kann Widga den Mimung auch mit einer Hand schwingen, doch nun gelingt es ihm kaum, das schwere Langschwert zu halten. Er lehnt es gegen den Sattelknauf und bemüht sich, es mit einer Hand festzuhalten, während er mit der anderen die Zügel greift. Als ihm auffällt, dass er es bisher unterlassen hat, stößt er einen lauten Fluch aus. Er sollte mit hoch erhobener Waffe zurück zum Schlachtfeld galoppieren, aber er wagt es kaum, Schimming zum Trab anzutreiben, zu sehr fürchtet er den grimmigen Schmerz, wenn er im Sattel durchgeschüttelt wird. Er tröstet sich mit dem Gedanken, dass es nun ohnehin kein Zurück mehr gibt, dass er alles getan hat, was er nur vermochte. Seit Tagen hat er ebenso verzweifelt wie vergeblich auf Hilfe aus Bern gewartet, dabei war es ohnehin eine unsinnige Hoffnung. Unmöglich hätte Ermenrich ihm schnell genug Unterstützung senden können, bevor die Hunnen Raben erreicht haben. Jetzt, wo alles zu spät ist, wo die Feinde seine Stadt überrennen und seine Männer niedermetzeln, muss er sich wenigstens nicht mehr sorgen. Zumindest sind Bolfriana und die Kinder in Sicherheit, auch wenn er sie wohl nicht wiedersehen wird. Er hat sie rechtzeitig fortgeschickt, bevor das feindliche Heer Raben erreicht hat und sie angewiesen, zu Gerbod zu gehen, Bolfrianas Vetter, der sich um sie kümmern wird.
Der Himmel lastet schwer über den Mauern Rabens. Tiefgraue Wolken hängen dunkelrot am Horizont. Nachdem die Hitze des Kampfes abgeklungen ist, die seinen Körper ergriffen hatte, spürt Widga angenehm den kühlen Wind auf seinem Gesicht und seinen Händen, der vom Meer herüberweht. Vor ihm scheinen die Feinde noch nicht durch das Tor gebrochen zu sein, seine Männer verteidigen es weiterhin verbissen, doch er weiß nicht, wie es vor den anderen Stadttoren aussieht. Von den Gegnern, die über die Mauern klettern, werden viele zurückgeschlagen, aber bei weitem nicht genug. Er sollte dort vorne bei seinen Kämpfern sein und er treibt Schimming an, beißt die Zähne zusammen, um nicht zu schreien, als der Hengst in einen raschen Trab fällt und sein Rumpf bei jedem Tritt des Pferdes peinvoll erschüttert wird.
Er lässt das zerstörte Lager hinter sich, über das er mit einer kleinen Schar Reiter gekommen ist, vor allem, um dem vergeblichen Kampf vor den Toren zu entfliehen. Einige Männer um ihn herum kämpfen noch immer. Bei den Hunnen ist es einfach, doch bei den Christen kann er die eigenen Männer kaum von den Feinden unterscheiden. Sie versuchen, die Gegner aufzuhalten, bevor sie näher zur Stadt vordringen und ihren Leuten im Sturm auf die Tore zu Hilfe kommen können, allerdings ändert es kaum etwas, es sind ohnehin zu viele, die vor den Mauern stehen und die Verteidiger attackieren. Natürlich werden sie Raben verlieren, es kommt einem kleinen Wunder gleich, dass sie überhaupt so lange standgehalten haben.
Trotzdem stemmt Widga den Mimung wieder nach oben, und als er nahe vor sich ein paar zu Fuß Kämpfende sieht, bricht er hindurch und schlägt zwei der Hunnen, die in seine Reichweite geraten, mit raschen Schlägen die Köpfe ab, reitet weiter, ohne zurückzublicken. Es sollte ihn nicht so sehr anstrengen, sein Schwert zu schwingen, er fühlt sich schwindelig und klammert sich an den Zügeln fest, während er sich bemüht, das Heft des Mimung weiter fest in der Hand zu halten. Er will sich nicht wieder in das Kampfgewühl stürzen, will nicht, dass seine Feinde oder seine eigenen Männer, die er doch eigentlich befehlen sollte, ihn so sehen, geschwächt und blutend.
Er hat die kleine Senke vor dem Nordtor, wo der Kampf auf dieser Seite der Stadt hauptsächlich wütet, noch nicht erreicht, als er vor sich ein paar reitende Gestalten bemerkt, augenscheinlich auf der Flucht vor der Schlacht. Sie halten direkt auf ihn zu, nähern sich über die weite Heidelandschaft. Widga galoppiert los, es ist etwas angenehmer als der harte Trab, der Mimung hängt schwer an seinem lang gestreckten Arm hinab. Es sind keine Hunnen. Die Männer sind in der Art von Rittern gerüstet und ihre Pferde sind große Schlachtrösser, doch als er nahe genug ist, sieht er den lampartischen Löwen, rot und golden, den einer der drei Reiter in seinem Schild führt. Sie sehen Widga auf sich zu halten, doch sie wenden ihre Pferde nicht, um zu fliehen, sondern galoppieren ihm entgegen, als seien sie auf einen Kampf aus, obwohl sie doch gerade dem Schlachtfeld den Rücken gekehrt haben. Dann hört er einen von ihnen seinen Namen brüllen, es ist die hohe Tonlage eines Jünglings, nicht die eines Mannes.
„Verräter!“ Ein wilder Schwertstreich in seine Richtung, mit überraschender Kraft geführt, doch ungenau, er muss sich kaum zur Seite wegducken. Aus der Nähe erkennt er, dass zwei der jungen Männer doch hunnischer Abstammung sind, trotz ihrer Rüstungen. Die Gesichter unter den Helmen sind in ihren Zügen unverkennbar.
„König Dietrich!“, schreit der dritte Jüngling, bevor er ihn erneut vom Pferderücken aus angreift. Widga sieht den Schlag kommen und wehrt ihn mit dem Mimung ab, die breite Klinge stark wie ein Schild.
Sie greifen ihn zu dritt an und Widga lässt den Mimung in weitem Bogen um sich herum durch die Luft fahren. Die Klinge besitzt eine größere Reichweite als gewöhnliche Schwerter und es gelingt den jungen Angreifern nicht, nahe genug an ihn heran zu kommen. Widga brüllt, um sie zu erschrecken und fernzuhalten und tatsächlich scheinen sie zu zögern. Es steht drei Männer gegen einen, doch sie sind jung und unsicher und offensichtlich wissen sie, wer er ist. Widga will durch sie hindurchreiten und sie alle ringsum fällen, aber einer der Hunnen hebt sein Schwert zuerst. Widga lässt den Mimung auf die Klinge donnern, doch einen Herzschlag zu spät. Sein zerfetztes Panzerhemd ist nur noch ein dürftiger Schutz, die Klinge streift ihn zwar lediglich am Bauch, doch sie fährt über sein offenes, rohes Fleisch und er schreit laut auf, lässt Schimming einen Satz auf den Hunnen zumachen, der sich von der Seite an ihn herangemacht hat, und haut auf ihn ein.
Er ist zu zornig und fahrig, um ihn mit einem glatten Hieb zu köpfen, wie er es sonst tut, stattdessen zerschlägt er ihm das Gesicht unter dem Helm und danach den Rumpf. Der Mimung schneidet durch eiserne Ringe, Fleisch und Knochen gleichermaßen. Die Schreie klingen in seinen Ohren, er sieht kaum hin und sobald der Hunne aus dem Sattel gestürzt ist, fährt er wieder herum zu den anderen Gegnern. Sie starren hinüber zu dem zerschlagenen Körper des Toten. Obwohl sie ihren Gegner doch angreifen sollten, sie sind so ungeschickt in ihrem Entsetzen, dass auch Widga kurz innehält. Das schmerzhafte Pochen in seiner Seite ist wieder angeschwollen, er hat Glück mit diesen jungen Gegnern, wo er sich doch selbst kaum im Sattel halten kann. Drei andere Männer hätten ihm ernsthaft zusetzen können.
Er wartet, bis der Ritter mit dem rotgoldenen Schild ihn erneut angreift, seltsamerweise will er nicht selbst den ersten Schlag tun. Fast ist es, als würde er gegen Kinder kämpfen, ein beschämender Gedanke. Er sollte es schnell zu Ende bringen, damit es nicht wirkt, als könnten diese grünen Jünglinge ihm einen ernsthaften Kampf liefern oder ihn gar in Bedrängnis bringen, auch wenn niemand sie beobachtet. Er wehrt den Gegner ab und schlägt ihm das Schwert aus der Hand. An seinem Schrei hört Widga, dass er ihm mit der Wucht seines Schlages den Arm gebrochen hat.
Der Ritter hebt seinen Schild, um sich zu verteidigen und auch der andere versucht, ihm zu Hilfe zu kommen und lässt sein Schwert in Widgas Richtung fahren. Mit einem weiteren Hieb spaltet Widga den Schild, den sein Gegner schützend vor sich hält. Er durchtrennt den lampartischen Löwen in der Mitte und dann auch den Mann selbst, treibt mit aller Kraft, die ihm geblieben ist, den Mimung durch das Panzerhemd in dessen Schulter. Er beugt sich tief über Schimmings Rücken, als er die Klinge weiter hinabfahren lässt, den Rumpf des Jünglings spaltet, weitermacht, auch nachdem er bereits tot sein muss, bis die Körperhälften zu beiden Seiten der Klinge zu Boden fallen. Das Pferd des Toten scheut laut wiehernd zurück, bevor es einen Satz zur Seite macht, doch Schimming lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen.
„Diether!“
Widga fährt zu dem jungen hunnischen Ritter herum, der in seinem Entsetzen vergessen hat, ihn anzugreifen, das Gesicht vor Grauen und Furcht verzerrt, die schmalen Schlitzaugen weit aufgerissen. Bei dem Klang des Namens fühlt sich Widga plötzlich von erschrockenem, hilflosem Zorn überwältigt, er gräbt Schimming die Fersen in den Bauch, lässt ihn aus dem Stand nach vorne preschen und holt im Vorbeireiten weit aus. Diesmal köpft er seinen Gegner mit einem einzigen glatten Hieb, er spürt es, ohne hinsehen zu müssen. Widga will davon galoppieren, ohne sich umzusehen, fort von dem Schlachtfeld und dem Kampf, er will Raben im Stich lassen und seinen Gegnern ausliefern, es ist ihm ganz gleichgültig.
Doch es ist, als würde Schimming sein Zögern spüren. Der Hengst fällt wieder in den Schritt, sobald Widga den Schenkeldruck etwas lockert, und er wirft den Mimung von sich, bevor er umständlich vom Pferderücken gleitet. Seine eigene Verletzung spürt er kaum noch, und doch fühlt er sich zu schwach, um sich einen Moment länger im Sattel zu halten. Er bückt sich nach seinem Schwert, kommt taumelnd wieder auf die Füße und schleift den Mimung hinter sich her, die Klinge kratzt über die Erde.
Widga sinkt neben den Leichnamen seiner Gegner zu Boden, streckt die Hand nach dem lampartischen Jüngling aus, seiner oberen Körperhälfte. Er hat seinen Rumpf schräg zerteilt, von der Schulter bis zur Hüfte, er wird gestorben sein, als er das Herz durchschnitten hat. Das zerfetzte Panzerhemd hängt rotglänzend an dem Torso herunter. Das Lederwams darunter mit Blut vollgesogen. Von der unteren Körperhälfte sind die Reste des Panzerhemdes beim Sturz fortgerutscht, dort sieht er den bloßen Bauch über den ledernen Beinkleidern des jungen Mannes. Seine Beine sind in einem merkwürdigen Winkel auf den Boden aufgeschlagen, unnatürlich verdreht, der Oberkörper ist mit dem Gesicht nach unten gefallen.
Widga greift die Schultern des Toten und dreht ihn herum. Es bereitet ihm mehr Mühe, als es sollte, dabei ist der Rumpf nicht schwer. Nachdem er ihn mit dem Gesicht nach oben gerollt hat, bindet Widga ihm mit schwachen Fingern den Helm vom Kinn. Als er ihn dem Toten abnimmt, rollt dessen Kopf sofort zur Seite. Er fasst sein Gesicht, zieht es wieder nach oben, hält es fest. Seine Finger schmieren blutige Spuren auf die Wangen des Jünglings.
Das Gesicht ist noch im Schmerz verzerrt, der Mund halb geöffnet, zu einem letzten Schrei, der nicht mehr hinausdringen wollte, die Zähne ebenfalls hellrot, dunkles Blut in der Mundhöhle dahinter. Er muss sich die Zunge zerbissen haben, eine dünne Blutspur, ist aus dem Mundwinkel sein bartloses Kinn hinunter geronnen. Widga sucht den gebrochenen Blick seiner verdrehten Augen, doch er findet ihn nicht. Es ist schwierig, dieses Gesicht in Verbindung zu bringen mit dem Jungen, den er schon damals immer nur so flüchtig gemustert hat. Seiner Gegenwart war er sich immer bewusst und auch seiner Stellung, und doch hat er kaum je ihn selbst betrachtet, unabhängig von seinem Bruder, dessen Anwesenheit ihn unwillkürlich zu einem kleinen, unbedeutenden Kind herabgesetzte. Es ist bald drei Jahre her, dass er ihn zuletzt gesehen hat, und auch damals nur kurz. Unmöglich, sich sicher zu sein und doch zweifelt er nicht. Das Alter stimmt, ein Jüngling von vierzehn oder fünfzehn Sommern, damals noch ein Knabe, mit seinem gebräunten, länglichen Gesicht, das dem seines Bruders ähnelt, und den kräftigen schwarzen Brauen, so markant im Kontrast zu dem helleren Haar. Er ist es, natürlich ist er es. Er war es.
Widga schüttelt den Kopf, fassungslos, als könnte das etwas ändern. Es gelingt ihm nicht, sich von dem Anblick des Jünglings loszureißen. Er sollte ihm wohl die Augen schließen, doch nicht einmal dazu fühlt er sich imstande. Was hätte es für einen Sinn, in der Mitte durchgeteilt, in zwei Hälften zerschnitten, wem sollten da geschlossene Augenlider einen friedlichen Schlaf vorgaukeln können? Diether von Bern, dieser Junge, der einst sein König war.
Fast abwesend fragt sich Widga, wer wohl die anderen jungen Männer waren, die Hunnen, seine Kampfgefährten vom Hof König Etzels. Er wünschte, der verfluchte Heide hätte niemals Diethers Namen gerufen, dann wäre er fortgeritten, ohne zurückzublicken, befände sich nun längst fern des Schlachtfeldes, anstatt hier zu knien und sich fragen zu müssen, ob er ihn auch getötet hätte, hätte er es zuvor gewusst. Er kann es beim besten Willen nicht sagen. Vielleicht hätte er Skrupel gehabt, zumindest ein paar, aber schließlich haben sie ihn angegriffen, drei gegen einen, und wenn sie weiterhin auf ihn losgegangen wären, hätte er ohnehin keine Wahl gehabt, außer sich zu verteidigen. Drei bartlose Jünglinge, die er in Stücke gehauen hat, was für eine Ruhmestat, welch schrecklicher Kämpfer er doch ist. Er verspürt den absurden Drang, laut zu lachen, ist jedoch zu erschöpft, ihm nachzugeben. Er sollte zurückreiten zum Kampf oder aber die Flucht ergreifen, wohin auch immer, wenn er seinen Körper nur dazu bringen könnte, sich zu rühren.
Er presst sich erneut die Hand auf den Bauch, spürt das Blut, das noch immer aus der Wunde sickert, bei jedem Pulsschlag aufwallen, feucht und warm zwischen seinen Fingern, seltsam tröstlich. Er reißt den Anblick von Diethers Leichnam fort, starrt stattdessen einfach auf seine Knie und den mit fedrigem Kraut bedeckten Boden, blassgrün und rot. Doch noch immer kann er sich nicht aufraffen. E fürchtet sich davor, dass sein Körper ihm nicht gehorchen könnte, daher versucht er erst gar nicht, sich zu erheben.
Irgendwann hörte er Schimming in seiner Nähe schnauben. Der Hengst kommt auf ihn zu getrottet, er ist unruhig, weiß, dass sie fort müssen, so viel klüger als sein Reiter. Widga blickt zu Schimming auf, der über ihm steht und den Hals zu ihm hinunter neigt. ER streckt die Hand aus und schiebt sein Maul weg, bevor der Hengst ihm einen unsanften Stoß gegen die Schulter verpassen kann.
„Du hast Recht.“
Wieder stützt er sich auf den Mimung, um hochzukommen, Waffe und Krücke zugleich. Als er sich schließlich mühsam aufgerichtet hat, quälend langsam, keucht er laut. Als er sich zu Schimming umwendet, fällt sein Blick auf das andere Pferd, das sich ihm von den Mauern der Stadt her nähert, und sein erster Gedanke ist, dass er einen weiteren Gegner nicht überstehen wird. Der Reiter galoppiert heran, hält direkt auf ihn zu. So rasch er es vermag klettert Widga auf Schimmings Rücken, bemüht, sich aufrecht im Sattel zu halten. Es ist ein mächtiges Pferd, das ihm entgegenläuft, fast so groß und kräftig wie Schimming selbst. Das weiße Fell des Tieres ist mit tiefgrauen Flecken gesprenkelt. Er erkennt das Pferd vor dem Reiter und der Winkel seines Kopfes, in dem er sich etwas Vernunft bewahrt hat, denkt, dass es unmöglich ist, dass Ermenrich ihm Falke vor Jahren abgenommen hat. Er hat ihn irgendeinem anderen Ritter gegeben, wem auch immer, Widga kann sich nun nicht einmal an den Namen erinnern. Dennoch zweifelt er keinen Moment daran, wer der Mann ist, der nun auf Falke auf ihn zureitet.
Kurz blickt Widga hinter sich, er steht vor den Leichnamen der Jungen und verdeckt dem Ankömmling den Blick auf sie, vorerst zumindest. Einen Kampf gegen ihn wird er nicht bestehen.
Dietrich zügelt Falke, als er bei Widga angekommen ist. Sein Gesicht und seine Rüstung sind mit feinen Blutspritzern bedeckt, doch er scheint unverletzt zu sein. Er hat sein Schwert bereits erhoben, aber er greift nicht sofort an, sondern zögert kurz, als er Widga gegenübersteht.
„Wir haben die Stadt genommen“, sagt Dietrich. Es ist kein triumphierender Ausruf, sondern eine schlichte, nüchterne Feststellung, die auf Widgas Reaktion wartet.
Er bleibt stumm. Es ist das erste Mal, dass er Dietrich so nahe gegenübersteht, von Angesicht zu Angesicht, seitdem er ihn vor Jahren verraten und Raben in Ermenrichs Gewalt gegeben hat. Ein Teil von ihm hat immer damit gerechnet, dass Dietrich eines Tages zurückkehren würde. Er war kaum überrascht, als er von dem herannahenden hunnischen Heer erfuhr. Es ist seine eigene Schuld, dass er bereitwillig den Zorn des Berners auf sich gezogen hat. Er kann sich sagen, dass er es getan hat, um seine Familie zu schützen, aber das macht es nicht besser. Dietrich muss ihn hassen, mehr noch als Ermenrich selbst, schon jetzt, und wenn er sieht, was er getan hat, wenn er endlich die Augen von Widgas Gesicht wendet und den durchtrennten Leichnam seines Bruders erblickt, wird er ihn augenblicklich erschlagen. Doch Dietrich tut es nicht, sieht ihn nur weiterhin unverwandt an.
„Was machst du hier? Warum bist du nicht bei deinen Männern?“ Er spricht, als könnte er Widga noch immer Befehle erteilen, als sei er nur einer seiner Ritter, den er zurechtweist.
Raben ist verloren, es ist ohnehin zu spät, warum sollte er jetzt noch an seinem Leben hängen? Wenigstens wird es Dietrich von Bern selbst sein, der ihm den Todesstoß versetzt. Mehr kann er sich wohl nicht mehr erhoffen.
„Ich wusste es nicht.“
Widga schlägt Schimming die Fersen in die Seiten und lässt ihn vorwärtspreschen. Kaum ist er ein paar Sätze weit galoppiert, hört er Dietrich brüllen wie ein todwundes Tier, von Sinnen vor Schmerz und Leid. Er blickt kurz über die Schulter zurück und sieht, dass Dietrich von Falkes Rücken gesprungen ist, über dem Leichnam seines Bruders kniet und zum Himmel hinaufschreit. Dann bilden sich Worte aus dem unartikulierten Geschrei und er hört seinen Namen, immer wieder.
Er muss nicht länger zurückblicken, er weiß, dass Dietrich aufspringt und sich auf Falkes Rücken schwingt, zu seiner Verfolgung ansetzt, und er treibt Schimming weiter an, beugt sich tief über den Hals des Hengstes, die Zähne zusammengebissen, um den Schmerz in seinem Bauch zu ertragen, den Mimung noch immer umklammert. Er bemerkt, dass er nach Osten reitet, auf das Meer zu, und es ist keine gute Richtung, doch es spielt keine Rolle, so weit wird er ohnehin nicht mehr kommen.
Dietrichs Schreie laut und deutlich hinter ihm, näher, als sie sein dürften, doch als Widga sich umdreht, verdeckt ihm sein eigenes Haar die Sicht, das lang und hell um seinen Kopf weht. Noch immer brüllt Dietrich seinen Namen, als hätte er alle anderen Worte vergessen, sei keiner klaren Sprache mehr mächtig, es klingt in seinen Ohren, dröhnt in seinem Kopf, fährt durch seinen ganzen Körper, lässt ihn erbeben, seine Eingeweide sich in schmerzhafter Furcht zusammenziehen. Widga!
1. Kriemhild
Sie lässt sich hinunter sinken, bis ihr Gesicht gänzlich von dem warmen Wasser umspült wird, es ihre geschlossenen Augenlider bedeckt, ihren Mund, ihre Nasenspitze. Sie spürt ihr Haar sanft in ihrem Nacken schweben, ein leichtes Kitzeln auf der Haut. Die Wärme dringt in ihren Kopf ein. Ihr ganzer Körper wird wohlig vom Wasser umschlossen und sie möchte ewig so verharren. Warum sollte sie atmen? Doch es ist ein unnötiges Übel und nach einem langen Moment öffnet sie den Mund, lässt Wasser hineindringen, bevor sie wieder auftaucht und kurz Luft holt, die Augen noch immer geschlossen. Sie presst sich die Handballen auf die Lider, spürt, wie ihre Augäpfel unter dem Druck leicht nachgeben. Sie blinzelt.
Als sie ihre Finger vor ihr Gesicht hebt, stellt sie fest, dass die Haut an ihren Fingerspitzen weiß und rissig geworden ist, aufgedunsen. Sie sitzt schon zu lange in dem Becken. Trotzdem will sie noch nicht hinaussteigen, der Gedanke an die kühle Luft schreckt sie ab, die ihr entgegenschlagen wird, wenn sie sich einmal aus dem warmen Wasser erhoben hat. Stattdessen lehnt sie den Kopf zurück an den Rand des Beckens, in den ein Vorsprung eingelassen ist, auf dem sie bequem sitzen kann, gerade so tief, dass ihr Körper bis zur Brust vom Wasser bedeckt wird. In dem grauen Dämmerlicht steigt der Dampf zart und träge um sie herum auf. Sie spürt, wie ein Tropfen schräg über ihre Stirn rinnt, an ihrer Schläfe vorbei, und kann nicht sagen, ob es Wasser oder Schweiß ist.
Sie will sich noch einen Moment lang treiben lassen und schließt erneut die Augen. Ihre Daumen fahren langsam über die sanfte Schwellung ihrer Brüste, kreisen um ihre rechte Brustwarze, weich und flach. Sie sind nun lange wieder kleiner geworden, doch so ist es ihr lieber, sie hat sich behindert gefühlt durch die ungewohnte Größe ihrer milchschweren Brüste, wie die Euter einer Kuh. Etzel hat sie tatsächlich gefragt, ob sie Ortlieb selbst säugen wollte. Es sind Barbaren in ihrem Inneren, selbst er, so sehr es auch zu verbergen versucht. Sie hat damals überlegt, ob Helche ihre Söhne auch gesäugt hat. Sie wird es wohl getan haben, Etzel wirkte so erstaunt, als sie eine Amme verlangte, auch wenn er sich nichts anmerken lassen wollte. Zwillinge, kaum vorstellbar, sie müssen Helche völlig ausgesaugt haben, bis sie schlaff und kraftlos war. Kein Wunder, dass sie nach ihnen keine Kinder mehr geboren hat.
Kriemhild selbst liegt nichts daran, erneut schwanger zu werden, das ist es nicht, es ging vielmehr um einen Grundsatz. Eine hochgeborene Frau, eine Königin, die dem eigenen Kind die Brust gibt, es wäre beschämend. Etzel hat ihr eine gute Amme gefunden, eine Hunnin zwar, aber mit geradezu absurd großen, weichen Brüsten voller Milch, die bei weitem für Ortlieb und ihren eigenen Sohn genügte.
Obwohl Aleke leise ist, hört Kriemhild ihre Schritte hinter sich und öffnet unwillig die Augen. Sie dreht sich um und blickt zu der Zofe hinauf, die am Rand des steinernen Beckens steht.
„Ihr solltet nicht zu lange im Wasser bleiben. Es ist nun bereits über eine Stunde.“
Ihre Miene ist höflich und nichtssagend, so wie immer. In der ersten Zeit hat Kriemhild die Gesichter der Hunnen als maskenhaft empfunden, doch inzwischen weiß sie recht gut, wie sie ihr Mienenspiel lesen kann. Doch obwohl Alekes hunnische Züge nicht einmal stark ausgeprägt sind, ihre Augen zwar schwarz, aber groß und mit Lidern und langen Wimpern versehen, fällt es Kriemhild bei ihr besonders schwer, zu erkennen, was in ihr vorgeht. Ebenso wie bei Etzel, was noch weitaus ärgerlicher ist. Aleke ist nur eine Magd und ihre Gedankengänge interessieren Kriemhild ohnehin nicht, bei ihrem Ehemann ist es freilich etwas anderes.
„Dann wasch mir den Rücken“, sagt sie und gibt damit Alekes Aufforderung nach. Das Mädchen kniet sich hinter sie an den Rand des Beckens und Kriemhild fasst ihr nasses Haar zusammen und zieht es über ihre Schulter. Aleke wäscht ihre Schultern und ihren Rücken mit einem feuchten Tuch und einem Stück der duftenden Seife, die Etzel in seinem Palast herstellen lässt. Dem Talg wird ein Blumenöl beigemischt, von Rosen, Lavendel oder Veilchen. Als sie einmal danach gefragt hat, hat Etzel ihr erzählt, dass einige Völker weit im Osten diese Duftöle schon seit Jahrhunderten herstellen. Kriemhild gefällt der Geruch und sie hat es anerkennend erwähnt, zu Beginn, als sie noch nach positiven Dingen gesucht hat, die sie dem Leben in Etzels Palast abgewinnen konnte und für die sie ihm Komplimente gemacht hat, darum bemüht, sich gut mit ihm zu stellen. Mittlerweile verspürt sie solche Anflüge nur noch selten.
Aleke wäscht ihr mit der Seife auch das Haar, massiert mit den Fingerkuppen mit sanftem Druck ihre Kopfhaut, wie es keine andere Zofe so gut kann. Sie hat Kriemhilds Kleider bereits auf der schmalen hölzernen Bank bei der Tür des Badehauses bereitgelegt. Kriemhilds lässt sich von Aleke mit einem weichen, wollenen Tuch abtrocknen und beim Ankleiden helfen, ein einfaches Hauskleid, sie hat nicht vor, ihre Gemächer an diesem Tag noch einmal zu verlassen. Es wird ohnehin bereits Abend sein. Sie hat so lange im Wasser gesessen, wer weiß, vielleicht ist es sogar schon dunkel. Sie tritt aus dem Badehaus hinaus, Aleke folgt dicht hinter ihr. Sofort schlägt ihr die kühle Abendluft entgegen, lässt sie frösteln mit ihrem nassen Haar. Es ist noch nicht Nacht, doch die Dämmerung hat bereits eingesetzt.
„Du hättest mir eine Kapuze mitbringen sollen“, sagt sie, erwartet aber keine Antwort und erhält auch keine.
Das Badehaus ist ein kleiner ebenerdiger Bau, der an die königlichen Gemächer angebaut wurde. Über eine Treppe ist von dort aus direkt das flache Dach zu erreichen, das zugleich als Terrasse vor Kriemhilds und Etzels Räumen dient. Etzel hat das Badehaus vor gut zehn Jahren errichten lassen. Der Fußboden und das Wasser in dem großen, rechteckigen Becken werden durch eine unterirdische, mit Holz befeuerte Heizkammer beheizt. Kriemhild hat gestaunt, als sie es zum ersten Mal betreten hat, mittlerweile besucht sie es nahezu täglich. Gerade in diesem Winter, als die Gärten kahl und kalt waren und sie dort nicht herumstreifen wollte, ist es ihr zu einer festen Gewohnheit geworden. Das Badehaus und die Kapelle sind ihre Ankerorte, die dem Tag einen Sinn abringen. Dort hält sie sich weit öfter auf als in Ortliebs Kinderstube. Auch am heutigen Tag hat sie ihren Sohn noch nicht gesehen, ebenso wenig wie am Vortag. Er wird von seiner Amme und seinen Kindermädchen umsorgt, sie sieht keinen Sinn darin, ihn zu stören. Etzel hat nie etwas dazu gesagt, dass sie sich so selten mit ihrem Sohn befasst.
Als Kriemhild den Eingang zu ihren Gemächern betritt, ist er nicht zu sehen. Er befindet sich auch nicht im Schlafgemach, sie ist dankbar dafür. Sicherlich sitzt er wieder in dem kleinen Gesellschaftsraum über seinem albernen Spielbrett, wo er so viel Zeit verbringt. Er hat seine Versuche glücklicherweise aufgegeben, Kriemhild das Spiel beizubringen, dessen Namen sie sich nicht einmal so recht merken kann. Wenn sie sich Mühe gegeben hätte, hätte sie es wohl erlernen können, im Mühlespiel war sie als Mädchen immer gut, doch es interessiert sie nicht. Ohnehin, noch immer erscheint es ihr befremdlich, dass Etzel darauf bestanden hat, dass sie sich seine Gemächer teilen, jede Nacht gemeinsam in einem Bett schlafen, und sie fragt sich, was er davon hat. Sicher, Helche hat ebenso mit ihm zusammengelebt, natürlich, und unter den Hunnen, bei denen Männer und Frauen, meist ganze Familien, sich auf engstem Raum ein Zelt teilen, mag es üblich sein, aber Kriemhild findet es dennoch absonderlich. Wie bei armen Leuten, die nicht ausreichend Platz haben, dabei gibt es im Palast weiß Gott genug Raum. Eine Kemenate in den Frauengemächern wäre ihr lieber, aber merkwürdigerweise ist dies eine Sache, auf die Etzel beharrt, obwohl sie kaum glauben kann, dass er ihre Gesellschaft besonders schätzt.
Und dann erst die Einrichtung, all die gefärbten Felle und Lederhäute an den Wänden und auf dem Fußboden, die geflochtenen Schemel, Tischchen und Sitzbänke, in manchen Räumen liegen sogar nur gewebte Kissen als Sitzgelegenheiten auf dem Boden. Ganz, als befänden sie sich tatsächlich in einem hunnischen Zelt. Wenigstens besteht das große Bett im Schlafgemach aus gutem Walnussholz.
Kriemhild setzt sich vor ihren Waschtisch und lässt sich von Aleke das nasse Haar mit einem beinernen Kamm mit langen Zinken kämmen. Sie weist sie an, es nicht zu flechten, damit es schneller trocknet. Sie ist nicht sicher, ob Etzel bereits ohne sie gegessen hat, sie sollte im Speiseraum nachsehen, ob dort das Abendmahl noch bereitsteht. Falls Etzel noch nicht gegessen hat, bedeutet das, er hat auf sie gewartet, um mit ihr gemeinsam zu speisen. Sie verspürt zwar Hunger, aber nicht das Bedürfnis nach Gesellschaft und nachdem sie Aleke entlassen hat, bleibt sie auf ihrem Schemel sitzen und begutachtet ihr Gesicht nachdenklich in dem Handspiegel, der auf ihrem Waschtisch liegt. Sie hat sich darüber gebeugt, sodass ihr nasses Haar auf das Spiegelglas fällt und eine feuchte Spur darauf hinterlässt. Ihre Wangen sind noch immer gerötet von dem langen Bad, sie sieht jünger aus.
In dem warmen Wasser muss sie kurz eingedöst sein, vermutlich nur wenige Minuten, doch lange genug, um das Bild ihres Bruders aus der weichen Schwärze ihres Kopfes aufsteigen zu sehen. Wie merkwürdig, wenn schon, dann träumt sie von Siegfried. Dies geschieht noch immer häufig, doch sie spürt, wie selbst in ihren Träumen seine Gegenwart weiter verblasst, sein Gesicht, das Gefühl seines Körpers unter ihren Händen. Dabei bemüht sie sich so sehr, ringt um jede Einzelheit, an die sie sich von ihm erinnern kann, dieses kleine, abgehackte Lachen, das er zu den verschiedensten Anlässen ausgestoßen hat, überraschend laut, das Gefühl seiner kurzen Barthaare an ihrer Wange, das Geräusch, das er jedes Mal gemacht hat, bevor er sich in sie ergoss, ein scharfes Luftausstoßen und dahinter ein dunkler, rauer Laut, der tief in seiner Kehle entstanden sein musste. Sein Blick, mit dem er sie angesehen hat, während er in ihr war. Sein Geruch, den sie noch immer nicht benennen kann, auch nach all den Jahren nicht, der einfach nach Siegfried roch, unverkennbar und doch ohne sie bewusst an andere Düfte zu erinnern. Ganz anders als Etzels parfümierte Seifen.
Sie darf ihn nicht vergessen. Es ist ihr tägliches Gebet, das sie unzählige Male in ihrem Kopf wiederholt, wenn sie auf dem steinernen Boden der Kapelle kniet. Er ist der Ihre und sie ist die Seine und sie darf ihn nicht vergessen. Ihr Leben, ihr Tod, ihr Körper, ihre Seele, alles, was sie hat nur für ihn, bis zu ihrem letzten Atemzug. Und doch war es nicht Siegfried, den sie gesehen hat, als sie im warmen Badehaus weggedämmert ist, sondern Giselher. Sein Gesicht, wie es die beiden Male aussah, als sie Worms verlassen hat, der fröhliche Junge und der junge Mann, zurückhaltend und vorsichtig. Die Bilder sind miteinander verschwommen, bis sie sie nicht mehr auseinanderhalten konnte, zu einem neuen Gesicht, kindlich und jugendlich zugleich. Ihr kleiner Bruder, so nahe und eindringlich, wie sie sowohl seine Gegenwart als auch seine Abwesenheit selten gespürt hat. Neben Siegfried ist er verblasst. Nach dessen Tod hat sie seine Anwesenheit und seinen Trost als selbstverständlich hingenommen, zu tief in ihrem Leid versunken, um auf Giselher zu achten. Dennoch konnte sie ihn nun so deutlich sehen, wie es ihr bei Siegfried mitunter schwerfällt. Ob es daran liegt, dass er noch am Leben ist? Als müsste Siegfried sich unweigerlich von ihr entfernen, langsam aber unaufhaltsam, egal wie heftig sie sich dagegen wehrt, sich an ihm festhält, einfach, weil er nicht mehr in dieser Welt weilt, während Giselher atmet und lebt, als junger König neben seinen Brüdern in Worms.
Sofort ist es wieder da, Giselher, Worms, Gunther, Hagen. Sie schreckt zurück vor dem Gedanken, noch immer, und sie redet sich ein, dass es keine Furcht ist, die sie empfindet, sondern bloße Abscheu, Hass, so stark, dass sie glaubt, sich selbst davor schützen zu müssen. Vielleicht ist es an der Zeit. Es ist kein Tag vergangen, an dem sie nicht daran gedacht hat, es ist wie ein Fluch, solange sie Siegfried in ihrem Inneren bewahrt, ihn sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, kann sie auch Hagen nicht vergessen. Der dunkle Schatten ihres Mannes, des goldenen, strahlenden Helden. Das ist es, was sie ihm nicht verzeiht, ebenso wenig wie den Mord selbst, die Tatsache, dass er ihr Gedächtnis an Siegfried trüben muss, der ewige quälende Makel, der jeden Gedanken an ihren geliebten Mann verfolgt. Und jetzt Giselher.
Sie hat es sich schon lange vorgenommen, etwas muss geschehen. Im Vorjahr war sie durch ihre Schwangerschaft und Ortliebs Geburt gelähmt, doch nun, da Dietrich fort ist, wird sie wohl keine bessere Gelegenheit finden. Der Winter ist vorüber, das neue Jahr ist angebrochen, noch ein Jahr in der Verbannung an Etzels Hof, in die ihre eigenen Brüder sie gestoßen haben. Nachdem sie ihr alles genommen haben, was sie besaß, nicht nur ihren Mann, sondern auch noch sein Erbe, alles, was ihr von ihm geblieben war, haben sie sie diesen Heiden überlassen, um sich ihrer endgültig zu entledigen, sie, ihre einzige Schwester. Natürlich war es Hagen, der hinter all dem stand, der hinter jeder ihrer Erinnerungen lauert, ein abscheuliches Schreckensbild. Sie hat Etzel nicht grundlos geheiratet. Sie muss fest daran glauben, dass es einen Sinn hatte, dass es noch einen Sinn haben wird, oder sie könnte sich sogleich in ihre Verzweiflung ergeben. Sie muss mit ihrem Gemahl sprechen.
Als sie den Speiseraum betritt, stellt sie fest, dass Etzel bereits gegessen hat. Ein angeschnittener Schinken und Käselaib, mittlerweile sicherlich erkaltete Bratenscheiben und Eintopf aus den kleinen weißen Rüben, die hier wachsen. Auch der Weinkrug ist halb leer, wie sie feststellt, nachdem sie ihn kurz angehoben hat. Obwohl sie meist nicht erpicht ist auf Etzels Gesellschaft, stört es sie, wenn er ohne sie speist, als würde er ihr nur die Reste übriglassen, mit denen sie sich begnügen muss. Sie könnte sich frische Speisen bringen lassen, aber das ist es ihr auch wieder nicht wert. Ein unberührter Teller und ein Messer stehen für sie bereit, also isst sie rasch einige Bissen und trinkt einen Becher Wein. Sie verzieht das Gesicht, sie hat sich inzwischen an den sauren Wein der Hunnen gewöhnt, trotzdem bemerkt sie vor Etzel hin und wieder, wenn sie in streitbarer Laune ist, wie schwach er im Vergleich zu dem süßen, vollmundigen Rheinwein schmeckt, den sie so sehr liebt.
Etzels Gesellschaftsraum, in dem er sich nun sicherlich aufhält, grenzt an den großzügigen Speiseraum an. Kriemhild steht schon vor der Tür und hebt ihre Hand, um zu klopfen, zögert dann aber. Seltsamerweise erscheint es ihr, als müsste es sie in ihrem Stolz kränken, wenn sie jetzt zu ihm ginge, um ihn zu bitten, ins Bett zu kommen. Kurz starrt sie mit gerunzelter Stirn auf die geschlossene Tür, bevor sie sich umdreht und zurückkehrt in ihr Schlafgemach.
Sie verspürt einen seltsamen Widerwillen, Zorn geradezu, wie er manchmal scheinbar aus dem Nichts in ihr aufwallt, sodass sie am liebsten schreien möchte. Dabei hat Etzel ihr keinen Grund gegeben, ihm zu grollen, sie haben an diesem Tag ohnehin noch nicht miteinander gesprochen. Etzel steht meist noch vor dem Morgengrauen auf, wohingegen Kriemhild es sich angewöhnt hat, länger zu schlafen. Hier gibt es keine Frühmesse, zu der sie aufstehen, keine Kirchenglocken, die sie wecken könnten, und sie sagt sich, je länger sie im Bett bleibt, desto schneller wird der Tag vergehen. An einigen Tagen will sie sich am liebsten überhaupt nicht aufraffen, einfach liegen bleiben, den Kopf in den Kissen vergraben, bis es wieder dunkel wird. Allein die Tatsache, dass sie ein Bett mit Etzel teilt, macht es ihr unmöglich. Noch ein Grund, vielleicht gar der wichtigste, aus dem sie sich nach ihren eigenen Gemächern sehnt. Selbst Herrat hat ihre eigene Kemenate in den Frauengemächern. Dietrich hat nie darauf bestanden, dass sie mit ihm gemeinsam lebt, aber schließlich ist er auch ein Christ.
Kriemhild ist die Königin des Hunnenreiches, Gemahlin des mächtigsten Mannes zwischen den Meeren, und doch besitzt sie nicht einmal ihr eigenes Schlafgemach, es ist ebenso absurd wie traurig. Während ihrer Schwangerschaft und in den Wochen nach Ortliebs Geburt hat Etzel nichts dazu gesagt, dass sie den ganzen Tag im Bett verbracht hat, es war das einzig Gute, das sie ihren Umständen abgewinnen konnte. Doch nun hat sie keine Ausrede mehr. Also die Kapelle und das Badehaus, und manchmal das Beisammensein mit Herrat oder ihrem Sohn. Sie hat geglaubt, sie würde besser gestimmt sein, nachdem Dietrich fort ist, doch im Wesentlichen hat es nicht viel geändert.
Sie ruft sich wieder ihren Entschluss in Erinnerung, den sie zum unzähligen Mal gefasst hat. Bisher hat sie immer gezögert, eine Ausrede gefunden, um länger zu warten. Diesmal nicht. Sie hat von Giselher geträumt, allein das ist Grund genug. Während sie sein Bild vor sich sah, hat sie gemerkt, wie sehr sie sich nach ihm sehnt, trotz allem. Er ist ihr wie ein Überbleibsel aus der Zeit, in der Worms noch ihre Heimat und ihre Brüder noch ihre Familie waren, bevor sie ihr Leben in Stücke geschlagen und anschließend die Scherben unter ihren Füßen zermalmt haben. Hagen, immer nur Hagen.
Kriemhild entkleidet sich und legt sich ins Bett unter die aus Zobel- und Hermelinpelz genähten Decken, fein, weich und angenehm wärmend, vor allem, da ihr Haar ist noch immer feucht ist. Die Kerzen lässt sie brennen, bis Etzel kommen wird. Wie so viele Male zuvor legt sie sich die Worte zurecht, die sie zu ihm sagen wird. Sie muss überzeugend sein. Sie ist nie sicher, wie viel Etzel ahnt von dem, was in ihr vorgeht, ob er sie seit dem Tag ihrer Hochzeit durchschaut hat oder ob er völlig ignorant ist. Es macht sie schier wahnsinnig.
Ihre Ungeduld wächst, je länger sie auf ihn warten muss. Brütend starrt sie auf den weinroten Baldachin über ihrem Kopf, bis er schließlich kommt. Sie setzt sich auf, sobald er eintritt, macht sich nicht die Mühe, ihre Brüste zu bedecken.
„Ich hoffe, ich habe dich nicht geweckt“, sagt er, als würde er die brennenden Kerzen nicht bemerken.
„Ich habe auf dich gewartet. Hete habe ich dich noch gar nicht gesehen.“
Er hebt kurz die Brauen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie sich an einem Tag kaum sehen oder sprechen, oft legt Kriemhild es darauf an. Doch jetzt lächelt sie Etzel freundlich zu, während er neben das Bett tritt.
„Ich habe heute die Berichte gelesen, die Gotlind und Hugbald mir gesendet haben. Es ist nicht gut, dass gleich zwei Fürstentümer von Stellvertretern verwaltet werden müssen, obwohl die beiden zu wissen scheinen, was sie tun. Dabei muss sich Gotlind nun sowohl um die Länder ihres Mannes als auch um die ihres Sohnes kümmern. Gemessen an dieser Tatsache hat sie einen erstaunlich guten Überblick. Rüdiger hat ganz Recht gehabt, ihr die Donaumarken anzuvertrauen, sie ist eine kluge Frau. Würdest du es schaffen, ein Fürstentum ganz allein zu regieren?“
Es ist eine harmlose, beiläufige Frage, aber sofort verspürt Kriemhild einen ärgerlichen Stich. Nur weil sie sich nicht für Etzels politische und wirtschaftliche Angelegenheiten interessiert, bedeutet es nicht, dass sie unfähig ist.
„Es kann nicht allzu schwierig sein, wenn Rüdiger diese Aufgaben seiner Frau überlässt.“
Etzel lächelt kurz, sie kann nicht sagen, ob es wohlwollend gemeint ist oder ob er sich über sie lustig macht. Er kehrt ihr den Rücken zu, während er sich entkleidet. Sie sieht zu, wie er seinen Gürtel ablegt und den seidenen Rock über seinen Kopf zieht. Seine Armreifen und Fingerringe nimmt er zuletzt ab. Er trägt immer viel Schmuck, meist mehr als sie selbst. Es erscheint ihr noch immer falsch, sich mit Geschmeide zu schmücken und sie tut es nur auf Etzels ausdrückliche Bitte hin. Dass sie auf die schwarzen Kleider verzichten musste, hat sie allerdings eingesehen, auch wenn sie nur noch gedeckte Farben trägt, dunkle Rot- und Blautöne.
„Ich denke viel an Dietrich. Ich frage mich, wie der Kampf für ihn verläuft“, sagt Etzel, während er neben ihr ins Bett steigt. „Mittlerweile sollten sie Raben erreicht haben, womöglich ist die Schlacht gerade jetzt in vollem Gange. Das Heer, das ich ihm mitgegeben habe, sollte groß genug sein, um die Stadt zu überrennen, außer natürlich, Widga hat Verstärkung aus Romaburg erhalten. Aber das sollte unwahrscheinlich sein. Ich hoffe, dass Dietrich zumindest Rüdiger und Helfrich zurückschicken wird, nachdem er Raben erobert hat. Er war recht zuversichtlich, dass ihm ein erneutes Bündnis mit Mailand gelingen könnte. Ich bin gespannt, wann wir ihn wiedersehen werden.“
„Hoffentlich nicht allzu bald“, sagt Kriemhild aus vollem Herzen, doch Etzel muss die Worte so auffassen, dass sie Dietrich lediglich wünscht, Raben halten und von dort weitere Eroberungszüge unternehmen zu können.
Sie hat den Kopf auf ihre Hand gestützt und sich seitlich zu Etzel gelegt, um ihn ansehen zu können. Ihre Pelzdecke hat sie noch immer nur bis zur Taille hochgezogen, obwohl es kühl ist in der Kemenate. Er sieht sie ruhig aus seinen schmalen, schwarzen Augen an, doch sein Blick wandert kein einziges Mal zu ihren Brüsten, sie achtet darauf.
„Ich hoffe, du kümmerst dich gut um Herrat. Sie ist einsam ohne ihren Mann, sie wird sich über deine Gesellschaft freuen. Schließlich ist auch ihr Vater nicht hier.“
Kriemhild möchte aufhören, über Dietrich oder Herrat zu reden, es interessiert sie nicht und hält sie nur davon ab, auf ihr eigenes Anliegen zu sprechen zu kommen. Sie will zu einer Antwort ansetzen, als Etzel die Hand ausstreckt und auf ihren Arm legt, bevor er näher zu ihr rückt. Sie ist ein wenig überrascht, schließlich haben sie gerade über etwas völlig anderes gesprochen, doch so ist er immer, im einen Moment plaudert er unverfänglich und sieht sie kaum an und im nächsten will er sie besteigen. Wie er möchte, es wird ihrem Anliegen nicht abträglich sein.
Noch immer nimmt Etzel sie häufig, oft mehrmals wöchentlich, außer wenn sie sich ihm hin und wieder entschieden verweigert. Es liegt wohl nur daran, dass sie das Bett teilen. Es ist einfach und eine Gewohnheit für ihn, und sie fragt sich, was er in den anderen Nächten tut. Er kann sich keine Dienstmägde ins Bett holen, während sie neben ihm schläft, doch zugleich bezweifelt sie stark, dass sie die einzige Frau sein sollte, mit der er liegt. Sie ist sich nie sicher, ob sie ihm Freude bereitet, sie gibt sich meist auch nicht allzu viel Mühe, liegt nur da und wartet, bis er fertig ist. Nun bereut sie es, dass sie die Kerzen nicht gelöscht hat. Das Licht stört sie, sie kann ihm kaum je ins Gesicht sehen, während er in sie dringt. Doch nicht etwa, weil sie sich vorstellen würde, dass es Siegfried sei, selbst mit geschlossenen Augen kann sie sich das nicht vormachen. Etzels Körper und das Gefühl seiner Berührungen sind so ganz anders als Siegfrieds. Es wäre zu schmerzhaft, an ihn zu denken, es kommt ihr ohnehin jedes Mal aufs Neue vor, als würde sie ihn betrügen und hintergehen.
Sie hält den Blick auf Etzels gebräunte Schulter gerichtet, muskulös, aber längst nicht so kräftig wie die Siegfrieds, und als sie zu ihrem Entsetzen merkt, dass sie schon wieder zu ihrem Mann schweift, denkt sie rasch wieder an das, was sie tun wird, sobald Etzel fertig ist.
Er wird brennen, er wird leiden, sie selbst wird zusehen, wie er stirbt, mehr noch, sie wird ihm eigenhändig die Klinge ins Herz stoßen, ihm die Kehle durchschneiden, ihm den Kopf abschlagen. Ganz zu Anfang hat sie davon geträumt, ihn von hinten zu erstechen, seinen Rumpf zu durchbohren und aufzuspießen auf einem Speer oder Schwert, so wie er es mit Siegfried getan hat, doch es genügt nicht, sie will es in seinem Blick sehen, wenn er stirbt.
Etzel atmet in ihr Ohr, heiß und laut, im Takt seiner Stöße. Die Hände hat er neben ihrem Gesicht aufgestützt, auf ihrem feuchten Haar, sodass sie den Kopf nicht bewegen kann. Sie wird ihn auf dem Scheiterhaufen brennen lassen, wie die Hunnen es so gerne tun, wird ihm mit einem glühenden Messer die Haut abziehen, angefangen bei seinen Fingern und Händen, dann den Rest seines Körpers, Fingerbreit für Fingerbreit, wird ihm die Zunge herausschneiden und das verbliebene Auge ausstechen. Sie will die Furcht in seinem Gesicht sehen, will, dass er schreit und bettelt, sie anfleht, ihn zu töten, bevor sie ihn schließlich gnädig erhört.
Sie merkt, wie auch ihr eigener Atem sich beschleunigt, ihr Körper von einer fiebrigen Hitze ergriffen wird. Etzel macht jedes Mal ein anderes Geräusch, bevor er sich ergießt, und keines so bemerkenswert wie Siegfrieds Laut. Sie spürt, wie er erschlafft, doch bevor er sich aus ihr zurückzieht, küsst er sie. Sie ist etwas überrascht, das tut er nicht oft. Dennoch erwidert sie den Kuss, die Lider geschlossen, Hagens Bild vor Augen, verstümmelt und blutend, seine Schreie in ihren Ohren. Sie wird ihm Todesqualen bereiten, Schmerzen, die ihn um den Verstand bringen und das Ende herbeisehnen lassen, so wie er sie ihr zugefügt hat. Es ist nur recht und billig.
Etzel rollt sich von ihr herunter, atmet schwer aus und bleibt einen Moment lang liegen, Arme und Beine halb von sich gestreckt. Schließlich greift er wieder nach seiner Decke, um sich zuzudecken. Kriemhild rückt nahe an ihn heran, sie spürt seinen Samen feucht an den Innenseiten ihrer Schenkel kleben und wie jedes Mal hat sie ein Stoßgebet zur Jungfrau Maria gesandt, als er sich in sie ergossen hat. Bitte, lass mich nicht empfangen. Sie legt ihre Hand auf Etzels Brust, die glatt ist, trotz seines dichten schwarzen Haupthaares. Unter ihren Fingern spürt sie, dass sein Herzschlag noch immer schnell geht.
„Ich möchte, dass du meine Familie nach Gran einlädst.“
Sofort legt er seine Hand auf die ihre und zieht sie fort. Er dreht den Kopf zu ihr, die Stirn gerunzelt. „Woher der plötzliche Sinneswandel?“
„Es ist nicht plötzlich, und auch kein Sinneswandel. Ich habe sie all die Zeit über vermisst. Es sind mehr als zwei Jahre vergangen, seitdem ich sie verlassen habe, darf ich keine Sehnsucht nach meinem eigenen Blut haben? Ich habe heute von meinem Bruder Giselher geträumt“, fügt sie hinzu, ein Körnchen Wahrheit, das sie vielleicht glaubwürdiger machen wird.
Etzel sieht noch immer skeptisch aus, doch zumindest winkt er nicht von Vornherein ab, tut ihre Bitte als Nichtigkeit ab. „Mir war nicht klar, dass dir so viel an deinen Brüdern liegt. Ich bin davon ausgegangen, dass du dich nicht im Guten von ihnen getrennt hast. Nach allem, was sie dir angetan haben, willst du sie jetzt auf einmal wiedersehen?“
Er ist misstrauisch, natürlich, und sie verflucht ihn stumm dafür, dass er ihr niemals einfach zustimmen kann, ohne nachzubohren.
„Ich habe Gunther verziehen, bevor ich fortgegangen bin. Gernot und Giselher habe ich ohnehin nie gezürnt, sie konnten nichts für all das, was geschehen ist. Es sind meine Brüder, was auch immer sie getan haben mögen. Bei euch Hunnen mag das anders sein, aber mir liegt meine Familie am Herzen, mehr als alles andere.“
„Mehr als dein Ehemann?“, fragt Etzel mit einem leichten Lächeln. Es ist scherzhaft gemeint, doch innerlich zuckt sie kurz zusammen, bevor ihr klar wird, dass er von sich selbst spricht. Sofort stört sie sich daran, dass er sie nicht ernst nimmt. Trotzdem erwidert sie sein Lächeln, versucht, sich nichts anmerken zu lassen.
„Fast ebenso sehr“, räumt sie ein, „Gerade deswegen wäre es mir so lieb, wenn du sie hier als Gäste begrüßen würdest. Möchtest du sie nicht kennen lernen? Ich will, dass sie ihren Neffen sehen, sie werden sich freuen.“
Es ist eine kühne Bemerkung, wo sie selbst sich doch so wenig um Ortlieb kümmert, und Etzels Miene bleibt undurchdringlich. „Es ist ein sehr weiter Weg von Worms nach Gran. Meinst du wirklich, sie werden bereit sein, ihn auf sich zu nehmen, nur um ein kleines Kind zu Gesicht zu bekommen? Es überrascht mich, dass du gerade jetzt davon sprichst, wo die Hälfte meiner Fürsten und Sippenführer sich auf einem Kriegszug im Lampartenland befindet. Glaubst du nicht, dass ich gerade genügend andere Sorgen haben?“
Er klingt, als sei er ihres Gespräches müde und überdrüssig, aber er darf sich jetzt nicht einfach von ihr abwenden, nachdem sie endlich gewagt hat, es auszusprechen.
„Das glaube ich gerne, aber auch ich habe meine Sorgen, hast du schon einmal daran gedacht? Ich lebe seit zwei Jahren hier und noch immer gibt es kaum jemanden, mit dem ich sprechen kann, außer dir und Herrat. Deine Hunnen mögen mich nicht, ich merke doch, wie sie mich ansehen, sie verachten mich, weil ich eine Fremde bin. Rüdiger hat mir damals geschworen, dass ich immer Christen um mich haben würde, nur deswegen habe ich in die Heirat eingewilligt, aber stattdessen bin ich ständig allein. Nicht einmal die anderen Frauen wollen mit mir zu tun haben, sie reden hinter meinem Rücken, ich merke es doch. Sogar Aleke benimmt sich unverschämt mir gegenüber. Muss ich mich tatsächlich von den Dienstboten herablassend behandeln lassen? Ich bin unglücklich, Etzel, ich sehne mich danach, meine Brüder und all meine Freunde aus der Heimat wiederzusehen, wenigstens für ein paar Wochen.“
Sie hat sich in die Worte hineingesteigert, hat mehr gejammert, als sie es eigentlich vorhatte, und nun sieht sie ihn mit vorgeschobener Unterlippe vorwurfsvoll an, vielleicht wird es helfen. Etzel dreht den Kopf zur Raumdecke und beginnt zu lachen, so laut und plötzlich, dass sie zusammenzuckt.
„Was ist so lustig?“
„Oh, Kriemhild.“ Seine Stimme ist weich und nachsichtig. Er lacht sie aus, hat es all die Zeit über getan, nie hat er ihre Sorgen ernst genommen. Sie will ihn ärgerlich anfahren, aber er lässt die Luft zischend zwischen seinen aufgeworfenen Lippen entweichen, bedeutet ihr, still zu sein, und streicht ihr sanft über das Haar. Sie beißt sich auf die Unterlippe.
„Du hasst deine Verwandten“, stellt Etzel fest. Er versucht nicht einmal, zu verbergen, wie sehr es ihn amüsiert. „Du hast ihnen Siegfrieds Tod nie vergeben. Ich weiß, dass du immer noch um deinen ersten Mann trauerst und ich kann kaum glauben, dass du deine Familie nun aus reiner Sehnsucht und Zuneigung wiedersehen möchtest. Was führst du im Schilde, meine Liebe?“
Sie ist etwas überrascht, weiß nicht recht, was sie antworten soll. Es scheint Etzel nicht zu stören, dass sie noch immer Siegfried in ihrem Herzen trägt. Sie fragt sich, warum er zuvor nie etwas gesagt hat, wenn ihre Liebe und Treue zu ihrem Mann tatsächlich so offensichtlich für ihn ist. Nicht zum ersten Mal überlegt sie, was Etzel von ihr erwartet. Manchmal behandelt er sie ganz, als sei sie seine liebe Ehefrau, dann wieder scheint sie ihm völlig gleichgültig zu sein, kaum eines Blickes würdig, gerade gut genug für ein paar knappe Anweisungen und Befehle. Sie versteht ihn nicht, nach über zwei Jahren ebenso wenig wie am Tag ihrer Hochzeit, und die Tatsache, dass sie seinen Sohn zur Welt gebracht hat, hat nichts daran geändert. Es bereitet ihr Unbehagen, dass er sie so leicht zu durchschauen scheint, wohingegen sie aus ihm niemals schlau werden kann, so sehr sie sich auch bemüht.
Sie hat nicht erwartet, dass er so offen zu ihr sein würde, trotzdem musste sie damit rechnen, dass er sich allein von dem Argument, sie habe Sehnsucht nach ihren Verwandten, nicht würde überzeugen lassen. Er hat sie kurz unvorbereitet getroffen, dennoch, sie hat sich dieses Gespräch so oft in Gedanken ausgemalt, dass sie sich davon nicht verunsichern lässt. Sie wird gewiss nicht so schnell aufgeben. Sie greift nach seiner Hand, die noch immer auf ihrem Kopf liegt, fährt über seinen Handrücken und verflicht ihre Finger mit seinen. Er lässt es bereitwillig geschehen.
„Sag du es mir. Da du mich so genau zu kennen scheinst, solltest du es dir denken können.“
Etzel lächelt. „Ich weiß nicht, was in Worms vorgefallen ist, ich war schließlich nicht dort. Aber ich glaube gerne, dass du Rache willst für das, was dir angetan wurde. Es ist wohl dein gutes Recht. Du hast Siegfried verloren und keine deiner Taten kann ihn dir zurückbringen. Allerdings ist da immer noch der Hort, das Gold der Nibelungen. Ich kenne nur Gerüchte. Was ist tatsächlich damit geschehen?“
Sie hat mit Etzel nie viel über sich selbst gesprochen, schon gar nicht über ihre Vergangenheit, es ist zu schmerzhaft. Jede noch so beiläufige Frage, die er im Laufe der Zeit zu ihren Brüder oder zu Siegfried gestellt hat, hat sie getroffen wie ein Messerschnitt. Aber wenn sie ihn überzeugen will, wird sie sich ihm offenbaren müssen, oder zumindest vorgeben, sie täte es.
„Hagen und Gunther haben mir den Hort gestohlen. Nicht nur die beiden, alle meine Brüder waren eingeweiht und haben mich hintergangen, sogar Giselher. Er hat Hagen den Schlüssel gegeben und dieser hat bei Nacht und Regen den Hort aus der Burg fortgeschafft, während ich ahnungslos schlief. Ich hatte ein Haus in der Stadt, ich habe von den Geschehnissen auf der Burg erst erfahren, als es zu spät war. Hagen hat den Hort auf ein Schiff geladen, doch ich weiß nicht, wohin er ihn gebracht hat, irgendein Versteck entlang des Rheines, ich hätte es niemals allein finden können. Ich bin nicht einmal sicher, ob meine Brüder wissen, wo es sich befindet, oder ob Hagen es auch ihnen verheimlicht. All das nur aus Bosheit, um mir mein rechtmäßiges Erbe zu nehmen, weil er es nicht ertragen konnte, dass ich reicher sein sollte als seine Könige. Und Brynhilde hat ihm geholfen, Gunthers Gemahlin, ich zweifle nicht daran. Sie war so voller Neid und Missgunst. Sie steckte hinter allem und Hagen hat bereitwillig ihren Willen ausgeführt, ebenso, wie sie gemeinsam Siegfrieds Ermordung geplant haben. Sie haben mir das Liebste genommen, wieder und wieder, mich um alles betrogen, was ich hatte. Bis heute weiß ich nicht, was aus dem Hort geworden ist, wo er verborgen liegt.“
Ihr entgeht nicht der Ausdruck in Etzels schwarzen Augen und es lässt sie triumphieren. Sie muss sich zusammennehmen, um nicht zu lächeln, sondern angemessen betrübt zu blicken. Wenn schon nicht um ihretwillen, dann zumindest für den Hort, darauf hat sie gehofft.
„Ich nehme an, du möchtest den Hort wiederbekommen“, meint er.
Sie wagt einen weiteren Vorstoß. „Ich weiß, dass das der Grund war, aus dem du mich heiraten wolltest. Es tut mir leid, dass ich dich enttäuschen musste. Ich würde dir gerne deine verlorene Mitgift geben können, nachdem du mich so reich beschenkt hast.“
Sie ist nicht sicher, ob er ihr das abnimmt, aber das braucht es ohnehin nicht mehr, sie sieht es ihm an. Wenn es um Gold geht, sind die Männer alle gleich. Schon damals hat Etzel seine Habgier bewiesen, als er sich die reichste Witwe weit und breit ausgesucht hat, um sie zu seiner Gemahlin zu machen. Er konnte nicht ahnen, dass ihre Reichtümer ihr bereits entrissen worden waren und ihre Peiniger sie mit nichts zurückgelassen hatten, arm und mittellos, ihre eigene Schwester, Königstochter Burgunds. Es war ihr nur ein schwacher Trost, dass Siegfried sie so nicht mehr sehen musste. Noch immer sind es mehr noch als hilfloser Zorn und Hass die Schuldgefühle, die sie bei dem Gedanken an den Hortraub plagen. Siegfrieds hat seine Schätze so sorgsam gehütet, wie waren ihm so wichtig wie sonst nichts auf der Welt, und sie hat zugelassen, dass ausgerechnet Hagen sie an sich reißen konnte. Ebenso, wie sie zugelassen hat, dass er ihn getötet hat. Undenkbar, dass je der Tag kommen sollte, an dem sie hinreichend für ihre Sünden gesühnt haben könnte.
„Ich möchte dir deinen Hort gerne wieder beschaffen, soweit es nur in meiner Macht steht“, sagt Etzel sanft, „Doch selbst wenn wir deine Verwandten zu uns einladen sollten, werden sie uns das Versteck wohl kaum freiwillig verraten, vor allem nicht Hagen, wie ich ihn kenne. Und deinen Schilderungen entnehme ich, dass er sich nicht zum Guten gewandelt hat.“
Noch immer vergisst Kriemhild bisweilen, dass Etzel Hagen einst gekannt hat. Es erscheint ihr zu seltsam. Doch wann immer sie es sich in Erinnerung ruft, erfüllt sie der Gedanke mit Genugtuung, dass ihr Todfeind, einst ein Gefangener ihres Gemahls war. Wie schade, dass ihm je die Flucht vom Hunnenhof gelungen ist. Wenn er nun zurückkehrt, wird sie ihn sicher nicht so einfach gehen lassen.
„Freiwillig werden sie es uns nicht verraten“, stimmt sie Etzel zu und als er sie küsst, denkt sie sich, dass sie sich ihm wohl nie näher gefühlt hat als in diesem Moment.
Es ist der größte Liebesbeweis, den ihr Ehemann ihr je erbringen könnte, dass er ihre Feinde zu den seinen macht.
2. Dietleib
Dietleib hält Walthers Armstumpf umschlossen. Die Holzhand, die er sich für gewöhnlich an seinem Handgelenk festbindet, wurde ihm im Kampf abgeschlagen. Mit der verbliebenen Hand klammert Walther sich an seine Schulter, stützt sich mit seinem ganzen Gewicht auf ihn. Dietleib hat sich seinen Arm um die Schultern gezogen und so taumeln sie langsam in den Palas hinein. Dietleibs Beine zittern unter dem Gewicht des anderen Mannes.
Walther hat sich geweigert, sich mit den anderen Verletzten auf einem Pferdewagen oder wenigstens einer Bahre von dem Schlachtfeld fortbringen zu lassen. Er meinte, er könne laufen, und mittlerweile verflucht Dietleib seine Sturheit, dass er nun derjenige ist, der sich allein mit ihm abmühen muss. Dabei würde er selbst dringend etwas Ruhe und Erholung benötigen. Die Erschöpfung steckt tief in seinen Gliedern und er fürchtet jeden Moment, dass seine Beine unter ihm nachgeben könnten und sie beide zu Boden stürzen. Dennoch ist es wohl Walther, der zuerst zusammenbrechen würde. Er blutet aus mehreren Wunden, ein paar geringfügige Kratzer, wie sie auch Dietleib selbst davongetragen hat, doch auch eine Stichwunde in seinem unteren Rücken und ein langer, klaffender Schnitt, der sich unter den Fetzen von zerschnittenem Leder und Stahlringen schräg über seinen Bauch zieht, vom Brustbein bis zur Lendengegend. Es hat Dietleib erstaunt, dass er sich überhaupt aufrecht halten kann, und lange wird es ihm wohl nicht mehr gelingen.
Die Dämmerung ist hereingebrochen, während er noch draußen auf dem Schlachtfeld war, um nach Verwundeten zu suchen. Mittlerweile ist es fast dunkel. Sein Gang mit Walther durch die Stadt, zwischen all den anderen verwundeten Kämpfern, den Karren und Bahrenträgern, hat gewiss eine halbe Stunde gedauert, bis sie endlich die Feste erreicht haben.
Die Feste von Raben liegt nicht wie andere Burgen außerhalb der Stadt, die ihr Herrschaftssitz ist, sondern in deren Zentrum. Ein großer, rechteckiger Klotz aus massivem Stein, mit einem Innenhof, der zu allen Seiten von dem Gebäude umschlossen wird, anstelle eines richtigen Burghofes. Dafür ist Raben selbst besser gesichert als jede andere Stadt, die Dietleib kennt. Ringsum ist sie von hohen Mauern umgeben und alle Tore werden scharf bewacht, als sei die ganze Stadt eine riesige Burganlage, mit der Feste als Palas in ihrem Zentrum.
Niemand achtet auf Dietleib und Walther, während sie durch die kleine, düstere Eingangshalle des Palas‘ wanken, alle Männer sind zu beschäftigt mit den eigenen Verletzungen oder denen ihrer Kampfgefährten. Das Krankenlager wurde in dem großen Rittersaal aufgeschlagen, der direkt gegenüber dem Eingangstor liegt. Zum Glück müssen sie keine Treppen erklimmen, um ihn zu erreichen. Sofort schlägt Dietleib der starke, süßliche Geruch nach Blut entgegen, mit dem die Luft durchdrungen ist und ihm wird leicht übel. Alle Tische wurden fortgeräumt, die Verletzten liegen dicht an dicht auf dem steinernen Boden des langen, von hastig entzündeten Kerzenständern erhellten Saales, auf dünnen wollenen Decken oder auf dem nackten Steinboden. Dietleib sieht sich rasch nach einer freien Stelle um, Walthers lauter Atem an seinem Ohr. Er hat all die Zeit über nicht gesprochen und Dietleib ist nicht einmal ganz sicher, ob er noch bei Bewusstsein ist.
Er muss Walther einige weitere quälende Schritte entlang der am Boden liegenden Verletzten mit sich ziehen, bis er das Ende der vordersten Reihe erreicht und erleichtert auf die Knie sinkt. Er legt Walther neben einem Hunnen mit einem zerschmetterten Bein auf den Boden, der die Augen geschlossen hat und sie nicht wahrzunehmen scheint. Walther stöhnt auf, als Dietleib seinen Oberkörper nach hinten beugt, auch auf dem Rücken zu liegen muss ihm starke Schmerzen bereiten, aber Dietleib fehlt die Energie, seine Position zu ändern, ihn auf die Seite zu legen, wo er sich aus eigener Kraft wohl ohnehin nicht halten könnte. Er beugt sich über ihn, hält seinen Kopf fest, um ihn zu beruhigen. Walthers bleiches Gesicht ist kalt unter dem Schweißfilm. Er will ihm ein Kissen unter den Kopf schieben, ein zusammengeballtes Stück Stoff, irgendetwas, damit er nicht auf dem bloßen, harten Boden liegt, doch er hat nichts, und um seinen eigenen schweren, an einigen Stellen gerissenen und blutverschmierten Ringpanzer und das Lederwams ohne Hilfe abzulegen, um ihn mit seinem leinenen Untergewand zu polstern, fehlt ihm die Kraft. Walther sieht ihn an, doch Dietleib ist nicht sicher, ob er ihn erkennen kann. Sein Gesicht ist verzerrt und er zittert, Dietleib weiß nicht, ob vor Kälte, Furcht oder beidem.
„Es ist alles gut“, redet er auf ihn ein. „Man wird sich um dich kümmern. Der Kampf ist vorbei, wir haben gesiegt. Bald wird es dir wieder gut gehen.“
Er will sich aufrichten, er weiß selbst nicht genau, wohin er gehen soll, erst einmal nur fort von hier, von der blutgeschwängerten Luft und all den Verletzten, doch als er die Hände von Walthers Gesicht nimmt, runzelt dieser die Stirn und bewegt seine Lippen. Dietleib kann nicht verstehen, was er sagt, dennoch zögert er.
„Sie werden deine Wunden versorgen. Du wirst dich wieder erholen, bald geht es dir besser.“
Er sieht sich rasch um, bemerkt ein paar Gestalten, meist Frauen, die mit Verbandszeug in den Armen zwischen den Reihen der Verletzten entlang gehen, Verbandszeug in den Armen. Doch keine von ihnen befindet sich in ihrer Nähe. Dietleib streicht Walther noch einmal kurz über die Stirn, bevor er sich erhebt. Es fällt ihm erschreckend schwer, sich aufzurichten und er muss sich mit den Händen an seinen Knien abstützen, um hochzukommen. Als es ihm schließlich gelungen ist, läuft er auf den Ausgang des Rittersaales zu, so schnell er es vermag. In der Nähe der Tür kommt er an einer der Heilerinnen vorüber, die gerade über einen sitzenden Mann gebeugt ist und seinen Armstumpf mit einer dicken Schicht leinener Binden umwickelt. Dietleib unterbricht sie in ihrer Arbeit.