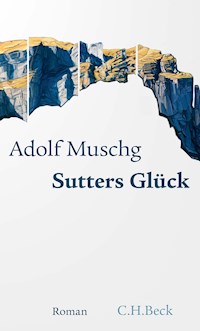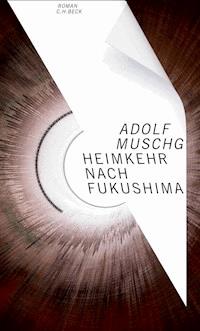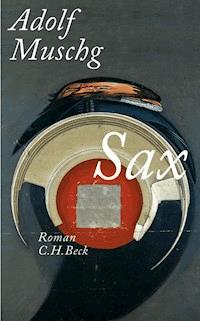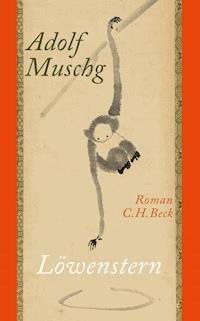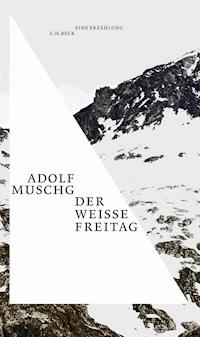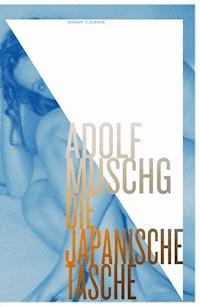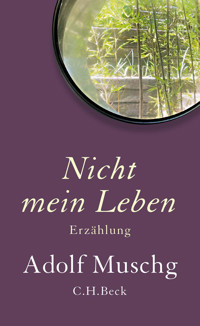
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Voller Trauer und Schönheit – "Nicht mein Leben" ist eine dichte, bewegende Erzählung über Wahrheit und Lüge im Leben und Lieben des August Mormann, das vielleicht persönlichste Buch des Büchner-Preisträgers Adolf Muschg. August Mormann, achtzigjähriger, zunehmend fragiler ehemaliger Schweizer Gymnasialprofessor für Alte Sprachen und Autor leidenschaftlicher Essays über Europa, sucht sich eine Grabstätte auf einem Zürcher Friedhof. Seine viel jüngere, aus Japan stammende dritte Ehefrau Akiko Kanda möchte einmal mit ihm in seinem Grab liegen. Ein anrührender Liebesbeweis in einer komplizierten Ehe. Das und die Entdeckung, dass sein Grab-Nachbar sein ehemaliger Mitschüler Robin ist, der ihm, dem verwaisten und von seinen Halbgeschwistern allein gelassenen Jungen, einst sein geistiges Überleben ermöglicht hat, bringt Mormann dazu, sein Leben und dessen Spielregeln zu überdenken. Als er von einer nicht nur wegen des Überfalls Russlands auf die Ukraine überschatteten Europa-Konferenz in Triest nach Hause kommt, ist seine Frau verschwunden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Titel
Adolf Muschg
Nicht mein Leben
Erzählung
C.H.Beck
Übersicht
Cover
Inhalt
Textbeginn
Inhalt
Titel
Inhalt
Widmung
1: Nachtgang
2: Fortgehende Noten
3: Grabmiete
4: Nach Triest
5: Excelsior
6: Europa
7: Allein
8: Gänge vor die Tür
9: Entdeckung
10: Robin
11: Hitsch
12: Bauer
13: Dies Bildnis
Zum Buch
Vita
Impressum
Widmung
Meiner Frau Atsuko gewidmet
1
Nachtgang
Darf ich mit dir in ein Grab? fragte Aki, nachdem sie mit August, ihrem Mann, auf beider Wohl angestoßen hatte. Sie hatten eine Weile wortlos in den ergrauten Garten geblickt, über den Teich, der sich nicht rührte, und auf die Palisade dahinter, welche die kleine Felsenlandschaft mit der Zwergföhre am Ufer zum Bild zusammenfaßte.
Es war Februar, halb drei Uhr früh, im zweiten Jahr der Covid-19-Pandemie. Die Behörden hatten den Verkehr zwischen Menschen aufs Nötigste beschränkt, Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen verboten und, wo sie unvermeidlich waren, der Maskenpflicht unterstellt. Das alleinlebende Paar hatte seinen Nachtlauf absolviert, dann geduscht und sich im Mantel, wie jedesmal, auf die fast ebenerdige Terrasse ihres Atelierhauses gesetzt, um die Mühsal ausklingen zu lassen. Solange der schneereiche Winter dauerte, hatten sie mit ihren Stöcken wie Langläufer ohne Skier ausgesehen, die staken müssen, statt zu gleiten. Inzwischen war der Schnee, außer der schmutzige am Straßenrand, fast überall weggeschmolzen, und ihr Marsch über nasse Felder begann dem Freizeitsport der Senioren ähnlicher zu sehen, die sie waren – August in Übereinstimmung mit seinem Jahrgang, Aki aus kameradschaftlicher Rücksicht. «Sportlich» hätte sie sich nicht mehr genannt, aber sie verausgabte sich auch nicht, während sie Augusts schweren Atem nicht überhören konnte. Drei Kilometer bergauf und bergab waren für den bald achtzigjährigen Pfeifenraucher kein Pappenstiel, aber er war auch über die Jahre hinaus, wo sich einer in guter Form sehen lassen muß – was nach Mitternacht, wenn sie das Haus verließen, auch vergebliche Mühe gewesen wäre. Meist begegneten sie schon im Dorfbild, erst recht in der Höhe oder am Waldrand, keiner Menschenseele mehr, und vielleicht war ebendies der Reiz der Wanderung. Dabei war die nächtliche Siedlung keineswegs ruhig – sie ließ sich Töne entschlüpfen, welche man zum ersten Mal zu hören glaubte. Motorengeräusch war selten, da sich die Nachtwanderer an Nebenwege hielten, die, je höher sie stiegen, statt von Hägen und Hecken nur noch von kleinen Bachläufen begleitet und oft so dunkel waren, daß sie einander gegenseitig die Stirnleuchten anknipsten, die dann die nächsten Schritte bläulich aufhellten. Erst wenn die Häuser und Gärten ganz zurückblieben, genügte, auch in bedeckten Nächten, das schwache Licht des großen Ganzen, so daß sie auf ihr eigenes gerne verzichteten, obwohl die verbreitete Helligkeit selten genug von einem offenen Himmel ausging, sondern die unauslöschliche Zivilisation in der Tiefe reflektierte, eine Erscheinung, die als Lichtverschmutzung bekannt ist. Doch erlaubte sie, Weite und Ferne zu erkennen, in der Tiefe den von Lichtgirlanden geränderten See, am Horizont die vertraute Reihe der Gipfel, die ein geisterhaftes Weiß zeigten.
Selbst in klaren Nächten war die künstliche Grundhelligkeit ausreichend, die Sternbilder unscharf zu machen. Immerhin ließen sich die Figuren von Kassiopeia, Orion, des Kleinen und des Großen Wagens erkennen, die Aki in der App ihres Handys andächtig nachbuchstabierte, wobei sie stehenblieb und dem vorausgehenden August damit eine zum Aufatmen willkommene Pause gönnte. Dann lauschte er den Nachtgeräuschen nach, die ihre Umgebung zu melden hatte, und sie zeigte sich anhaltend, oft rätselhaft belebt. Einmal bellte ein Hund so lange, bis ihm ein anderer, aus weiter Ferne, antwortete; ihre Stimmen klangen angestrengt, gar hoffnungslos. Doch brauchte man im schweizerischen Mittelland noch keine Rückkehr der Wölfe zu fürchten. Hatte Aki ihren Ausflug in die Sternbilder beendet, holte sie ihren Mann fast hastig ein, und er wartete auf ihre – zur Redensart gewordene – Bitte: shinanai, was sagen wollte: bitte noch nicht sterben! So viel Japanisch traute sie ihm zu, und wieder zu Atem gekommen, verneinte er in gebotener Heiterkeit.
Näherten sie sich dem Waldrand, so hatten sie keine Hoffnung mehr, das Käuzchen zu hören, das seinen klagenden Ruf, aus welchem Grund immer, lieber in der Nähe ihres Hauses ertönen ließ. Die Waldkulisse erhob sich finster schweigend hinter der letzten Gebäudegruppe, die eine Kolonie schwer erziehbarer Jugendlicher beherbergte und um diese Stunde nicht minder schweigend war. Nur ein einziges Mal war aus den Häusern ein gedehnter, fast tierhafter Schrei gedrungen, dem, als sie stehenblieben, eine ebenso durchdringende Stille folgte. Ein Mensch mußte im Schlaf geschrien haben, die Wanderer konnten ihm nicht helfen und stahlen sich schweigend auf ihrem Aussichtsweg weiter, ohne einer Abzweigung in den Wald zu folgen. Aus seinen Tiefen war hie und da ein verträumtes Zwitschern zu hören, das weder alarmiert noch bedrohlich klang. Von seinem Vater wußte August, daß in den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts von Münsterburg nach Ottersdorf Extrazüge gefahren waren, nur um einmal eine Nachtigall singen zu hören. Augusts Pfadfindername war «Famu» gewesen, der sich seit seiner Pensionierung wie von selbst zurückgemeldet hatte. Die Nachtübung, mit der er sich damals eine Lilie am Hut verdiente, hatte durch ähnliches Gelände geführt, aber seither war es nicht wiederzuerkennen, als habe sich das Solide daran ausgedünnt. Aus den Dörfern der Jugend waren Agglomerationen geworden, aus den Wäldern Erholungsgebiete oder Fitness-Parcours. In den Corona-Nächten hatten sie etwas von ihrer Fremde wiederhergestellt, und im beginnenden Frühling begann ihre schattenhafte Leere undurchsichtig zu werden. Das Paar wechselte hie und da leise ein Wort, oder Famu sagte ein Gedicht vor sich hin, das ihn in seiner Schulzeit befremdet hatte. «Wie scheint doch alles Werdende so krank», mit dem scheinbar tröstlichen Schluß: «Wahrlich! Ich werde immer bei euch sein». Doch ließ der Dichter, ein Apotheker, der sich im Ersten Weltkrieg vergiftet hatte, diese Worte von keinem Erlöser sagen, sondern von einem «alten Stein».
Inzwischen verband sich die Entgeisterung des Alltags unwillkürlich mit der «außerordentlichen Lage», die nicht nur die übrige Welt im Griff hatte, sondern – was immer noch überraschend war – auch das eigene Land. August Mormann, alias Famu, nannte es «Swasiland», ein Scherz, der sich aufgrund einer irrtümlichen Briefadresse aus Amerika in seinem Kopf befestigt hatte, aber er verfehlte nie beizufügen, daß die Schweizer Post den Brief trotzdem an die richtige Adresse geliefert habe. Denn August war ein Patriot, obwohl dieser Punkt bei den Vorträgen, die er zugunsten des Beitritts zur Europäischen Union hielt, erklärungsbedürftig war. Darauf hatte er es ja angelegt und tat auch privat sein Bestes, mit den Widersprüchen der beinahe noch realen Existenz zu leben. Diese Sicht hatte er aus dem klassischen Athen geschöpft; der abgedankte Lehrer für Altgriechisch wollte brauchen, was er gelernt hatte. Damals war aus dem pfadfinderischen «Famu» ein «Outis» geworden; seine erste Frau, die von einem ehemaligen Schüler zu ihm übergelaufen war, hatte ihn auf den irrenden Odysseus umgetauft. Die Ehe dauerte nur zwei Jahre; auch seine nächste hatte die gemeinsamen Wanderjahre nach Amerika nicht überstanden. Er war allein weitergekommen, bis nach Japan, wo er Akiko als Dolmetscherin seiner Vortragsreise, damals schon über das Thema «Europa», kennengelernt hatte. Da war sie noch mit einem Lektor Florian Förster verheiratet, über den sie nicht gesprochen hatte. Viele Jahre später, als sie einem bekannten Japanologen nach Münsterburg gefolgt war, um dort einen Kurs für Anfänger anzunehmen, lebte sie allein in einer kleinen japanischen Kolonie und folgte, als ihr Visum auszulaufen drohte, schließlich dem Rat ihrer besten Freundin Naomi, einer namhaften Pianistin, durch Heirat einen Schweizer Paß zu erhalten: Der richtige Schweizer war dann der inzwischen als Gymnasialprofessor etablierte Famu oder Outis, der bei ihr wieder zum August werden durfte. Sie hatten sich, schon, als sie für ihn dolmetschte, näher kennengelernt, aber ihr Altersabstand verbot damals jede Fortsetzung. Als sie vierzig geworden und er schon der Pensionierung nahe war, fanden sie sich wieder, und da sprang eins in die Lücken des andern, ohne sie beim Namen zu nennen.
Sie hatten viele Jahre zuvor zusammen in Tokyo ein Noh-Spiel besucht, das eine gemeinsame Spur hinterlassen hatte. Der Dichter Zeami hatte bei seiner Kunst zweierlei «Blüte» beschrieben: diejenige, die dem Anfänger durch seine Jugend zuwächst, und die seltene, die erst an einem alten Stamm ihre prekäre Schönheit entfaltet. Sie zeigt die Sterblichkeit in ihrer delikaten Vollendung, und in diesem Zeichen schien sich die Ehe von August und Akiko über zwei Jahrzehnte immer natürlicher zu befestigen.
Er hatte seine Frau pro forma zur Schweizerin gemacht; sie schien ihm japanischer denn je, obwohl oder weil er kein Japanisch sprach. Es hätte ihn wundern dürfen, daß er die Schweiz, wie in seiner keineswegs unbeschwerten Kinderzeit, immer noch als Maß aller Dinge betrachtete, obwohl er, angefragt, ebendies mit allem Nachdruck als unmöglich darstellte. Dennoch behielt er die Heimatliebe seiner Ahnen gewissermaßen in der Hinterhand und hütete sich, an einem Wort wie Normalität, das zur Corona-Zeit in aller Munde war, zu verzweifeln. Was immer er von seinem Land halten mochte, dessen wohlkalkulierte Rechtmäßigkeit ihn genierte, in einem Zustand erlebte er es zum ersten Mal: ratlos. Angesichts der Krisen, welche die humane Spezies nach langer, gewinnbringender, aber offensichtlich scheinhafter Friedenszeit erschütterten, hatte die Schweiz, als Gemeinwesen, nichts mehr zu melden, und in schwachen Stunden hatte er sich den ahnungslosen und selbstgefälligen Lärm der Kalten Krieger beinahe zurückgewünscht. Das Land war verstummt, wie die vertraute See- und Waldgegend vor ihren Augen, und die regelmäßige Wanderung nach Mitternacht hatte etwas von Wiedergängerei.
Nun aber, morgens um halb drei, nach getaner Arbeit, gönnte er sich, mit Aki und bei einem Glas Veltliner, eine halbe Stunde wohlverdienter Selbstzufriedenheit. Er war bald achtzig, aber seine Übernamen gingen ihm immer noch nach, das heißt, von Jugendfreunden ließ er sie sich gefallen. Aber wo waren diese geblieben? Einige hatten sich schon, wie es in den Anzeigen hieß, «zu früh» für immer verabschiedet; mit den andern kam man, der «außerordentlichen Lage» wegen, kaum noch zusammen. Es zeigte sich, daß man sich am Telefon immer weniger zu sagen hatte, und Briefe blieben, mit wenigen Ausnahmen, unbeantwortet; zu sehr hatten sich auch Menschen seines Alters an den digitalen Verkehr gewöhnt. Inzwischen lief auch das obligatorische Nachrichtenwesen über den Rechner seiner Frau, obwohl sie immer wieder protestierte: Ich kann kein Deutsch!
Famus PC war einer alten Schreibmaschine so ähnlich wie möglich, auch wenn er einige seiner Eigenschaften zu schätzen wußte, wie etwa die Verbindung mit einem Drucker oder die Verwandlung des Bildschirms in einen Schauplatz für Spiele, von denen er nur die einfältigsten beherrschte («Space Cadet», «Minesweeper»), wenn er von einem eigenen Text einmal wegsehen mußte. Sie verschafften ihm den Genuß des Flüssigen, den seine Handschrift nicht mehr hergab. Er konnte sie selbst kaum noch lesen, und über seinen eigenen Krakeln zu brüten war ihm denn doch zu dumm geworden – und zu kränkend. Er war ein Gelehrter, und bei seinen – zur Zeit ausgesetzten – Vorträgen wollte er bleiben und keine Form künstlicher Intelligenz dafür nötig haben. Aki aber, die das digitale Gerät beherrschte, hatte sich an einer anderen Tastatur professionelles Niveau erworben. Schon vor und nach seinem ersten Vortrag in Japan in Kanazawa hatte sie im Musikzimmer ihres Hotels Klavier gespielt, wenn es leer war und sie ihren Professor abwesend glaubte – einen Walzer von Chopin, dem er seinerseits versteckt hinter der Tür gelauscht hatte, nachdem er seine Dolmetscherin unbemerkt identifiziert hatte. Er glaubte eine werdende Meisterin zu hören.
Du bist unmusikalisch, getraute sie sich inzwischen zu sagen, wenn er sie nebenan spielen gehört hatte. Sie liebte es nicht, daß er sie belauschte, als täte sie etwas Verbotenes, oder sie gar dazu beglückwünschte. Nur bei ihren vierhändigen Konzerten mit ihrer Freundin Naomi ließ sie sich Publikum gefallen. Sie kann es, sagte sie, dann ist es für mich keine Kunst.
Beim heutigen Lauf war etwas Seltsames vorgekommen. Sie hatten sich dem Waldrand entlang bewegt, mit offenem, wenn auch getrübtem Seeblick, als Aki plötzlich stehen blieb und ihn, immer noch die Stockschleife am Handgelenk, beim Ellbogen faßte.
Pst! flüsterte sie. – Da vorn ist etwas.
Er hielt inne, überflog mit den Blicken das nächste Wegstück. Was hatte sie gesehen?
Jetzt steht er still, raunte sie in sein Ohr.
Vor ihnen krümmte sich der Weg einem niederen Gehölz entgegen, um darin zu verschwinden, vorübergehend, wie sie aus Erfahrung wußten. Es war eine Falle: jemand konnte sie benützen. Wenn er harmlos war, würde er sich jetzt zeigen. Hatte sich im Dunkel etwas gerührt, war es eine versteckte Bewegung? Dann war sie nicht geheuer. Oder täuschten sich ihre Augen? Alles war möglich.
Zu spät fiel ihm ein, daß der fremde Mensch, wenn es denn einer war, über ihren Auftritt nicht weniger erschrocken sein konnte als sie von seinem. Aki hatte August schon am Ärmel zurückgezogen, wie sich zeigte, mit gutem Grund; denn jetzt glaubten sie in der Tat gedämpfte Schritte zu hören.
Komm, flüsterte sie, wir kehren um.
Dann sehen wir ihn, hatte er sagen wollen, aber er folgte ja doch Aki, die ihn zerrte und sich dabei so behutsam bewegte, daß der Laut der Stöcke nicht zu hören war. Einmal noch wandte er den Kopf und glaubte zu erkennen, daß eine Silhouette drüben sich wirklich bewegte, doch wenn nicht alles täuschte, entfernte sie sich ihrerseits. Dann klang aus der Tiefe ein Glockenschlag hinauf, einmal, und dann, mit Abstand, noch einmal, tiefer und leiser.
Ein Uhr.
Und mit einem Schlag erloschen die Lichter unten im Dorf. Eine Sparmaßnahme. Famu dachte an die Verdunkelungspflicht in den Kriegsjahren, von der ihm sein Vater erzählt hatte. Die Schweiz machte sich unsichtbar für fremde Angriffe, denen sie doch nicht ganz entging. Schaffhausen wurde bombardiert, irrtümlich, wie es hieß.
Sie waren den Weg zurück gestakt, auf dem sie hergekommen waren, der Gebäudegruppe entgegen, aus welcher der Schrei gedrungen war, dann bogen sie vom Waldrand ab auf die lichtlose Straße, die bergab und über mehrere Schleifen in bewohntes Gebiet zurückführte. Allmählich nahm der Anschlag der Stöcke wieder den gewohnten Takt an.
Endlich saßen sie sicher, wie Passagiere auf einem Schiff, in Liegestühlen vor ihrem rundum geschlossenen Garten und dem Teich, in dem sich drei Lampions am Terrassendach fast bewegungslos spiegelten, während die Nachtluft unentwegt zu rieseln schien.
Es nieselt, sagte er, und sie hätte nach der Bedeutung des Wortes fragen können. Statt dessen sagte sie: Darf ich mit dir in ein Grab?
In diesem Augenblick schlug es vom Kirchturm nebenan die halbe Stunde, in naher Ferne war ein Motorfahrzeug zu hören: danach der Schritt eines einzelnen Menschen auf der eigenen Straße, gleich hinter dem Haus. Plötzlich verstummte der Schritt.
Er ist uns doch gefolgt, flüsterte Aki.
August stand auf, ging entschlossen zur Haustür und öffnete sie, nach kurzem Lauschen, einen Spalt, fast lautlos. Trotzdem fiel einer der Stöcke um, die im Türwinkel lehnten.
Die Straßenbeleuchtung war ausgeschaltet. Aber die Nachbarhäuser waren auch im Halbdunkel zu erkennen und die Büsche, die sie umstanden, durchsichtig. Kein Mensch und kein Laut, bis auf das ferne Brummen eines Ventilators.
August blieb eine Weile an der Tür stehen, mit angehaltenem Atem. Dann verschloß er sie und hob den Stock wieder auf. Zwei Paar Walking Sticks, sauber angelehnt.
Niemand, sagte er, als er sich wieder auf der Terrasse niederließ.
Aki lachte. – Das ist dein Paßwort, sagte sie. – Natürlich auf Griechisch.
Plötzlich schien sie ganz unbeschwert. – Der Mond, sagte sie.
Da hing er klar und mit leichter Schlagseite im Geäst der Föhre, dem ein großer Schneefall im vorvergangenen Januar die Krone gebrochen hatte. Er war das Bild von einem Mond; wie konnte es sein, daß er ihnen nicht schon auf ihrem Nachtgang erschienen war? Für Famu war er das japanische Gestirn, auch weil er es in Japan ohne Aki gesehen hatte; sie war, nach einigen bewegten Tagen, unerreichbar geworden, und er hatte nicht gewußt, ob er sie jemals wiedersehen würde.
Er hob das Glas. – Auf den Mond, sagte er, und sie stießen an.
Nach einer Weile sagte sie: Gehen wir schlafen. Du hättest die Föhre damals fällen sollen.
Ich habe sie für uns stehen lassen.
Du hättest sie fällen sollen, wiederholte sie.
Warum?
Siehst du nicht, daß sie ein Krüppel geworden ist?
Ich weiß, was du jetzt am liebsten tätest, sagte er nach einer Pause. – Die Mondschein-Sonate spielen.
Um diese Zeit? erwiderte sie. – Um zehn ist hier Schluß. Wir sind in der Schweiz. Und jetzt müssen wir schlafen. Morgen haben wir Gäste.
Heute abend, meinst du. Wer kommt denn?
Caduffs.
Was übt ihr denn heute?
Gar nicht, sie kommen zum Nachtessen.
Ja, da sollten wir ausgeschlafen sein, sagte August Mormann.
Nachher können wir immer noch wandern, erwiderte sie.
Übermorgen suchen wir uns ein Grab, sagte er, versprochen.
Weißt du, wo?
Ich habe eine Idee.
2
Fortgehende Noten
Wir kommen immer erst lange nach Mitternacht ins Bett. Fast regelmäßig weckt mich der Verdacht, daß sich Aki von ihrer Decke freigestrampelt hat, und immer ist er begründet. Aber nicht immer gelingt es mir, sie wieder ordentlich zuzudecken, obwohl sie jeden Versuch mit einem wohligen Laut begleitet. Meist ist es noch dunkel, und oft sind von der Straße her die ersten Menschenlaute zu hören. Aki soll nicht wach werden, aber noch weniger darf sie sich erkälten. Eines der drei hochgelegenen Atelierfenster muß gekippt bleiben, damit die ständige Zufuhr von Frischluft auf unserem Schlafboden gewährleistet ist. Er bildet eine zurückgenommene Etage über Küche und Wohnzimmer, aber da sie an den zwei offenen Seiten durch einen Paravent abgeschirmt ist, vermuten uneingeweihte Gäste da oben eher einen Arbeitsraum oder eine versteckte Bibliothek. Die sichtbare ist unten, zwischen Küche und Eßtisch, in einem über mannshohen Turm aus Regalen untergebracht, die sich nach oben verjüngen und in einer Plattform enden, wo die gebauchten Edelstahl-Stützen des Kunstwerks zusammenlaufen. Sie hätte einer Galionsfigur einen exponierten Hochstand zu bieten, aber da steht nur eine alte Schiffslaterne. Der Schöpfer des Objekts, ein glückloser Bildhauer wie mein Halbbruder H., hat sein Werk «Das Ei» genannt, mit obligatorischem Artikel, und damit seine letzte Operation bezahlt. Es ist das Conversation Piece für Gäste gewesen, als wir noch solche hatten, seit Aki in mein Atelierhaus eingezogen ist. Bezahlt hat es der Verkauf des Elternhauses in Überseen, mit dem ich die Scheidung meiner vorigen Ehe finanzieren mußte. Daß Aki nicht der Anlaß dafür sein konnte, entlastet sie; dazwischen war das einstöckige Haus fast zehn Jahre meine Eremitage gewesen, das Refugium eines ausgedienten Lehrers Alter Sprachen. Und von den Büchern, welche meine Schiffbrüche überlebten, wußten die Gäste nur zu bemerken, was sie sehen konnten: daß die Konstruktion Des Eis nicht praktisch war. Sie spreizte die Rücken der Bände auseinander und preßte dafür den Schnitt so fest, daß man sie fast mit Gewalt herausziehen muß. Aber wozu soll ein Homer, ein Platon, ein Thukydides leicht zu greifen sein? Hauptsache, ich hatte sie gerettet, und nach meinem Ableben wird sich wohl in der hinteren Slowakei eine Bibliothek finden, die sie übernimmt, sofern mein Testament auch für den Transport aufkommt.
Einstweilen war, was wir der griechischen Antike verdanken, in meinem Kopf immer noch für einen Vortrag gut, und Ende Februar stand ein solcher wieder bevor. «Europa eine Seele geben»: Eine deutsche Stiftung lud ein, nach Triest, wo ich noch nie gewesen war. Nun: solange ich meinen Homer intus habe, soll es mir an Seele nicht fehlen. Ich habe vor einem halben Jahrhundert ein Gymnasium besucht, wo der Griechischlehrer jedem Schüler zumutete, einen ganzen Gesang der Odyssee auswendig zu lernen, damit seine Klasse, wenn alle Quellen der Kultur endgültig versiegt waren, die Taten und Leiden des Odysseus buchstabengenau wiederherstellen konnte. Ich hieß nicht umsonst Outis – in der Zeit meines ersten Liebeskummers und mit Hilfe anderer Jugendkrankheiten hatte ich fast die ganze Odyssee auswendig gelernt.
Aki mag sie nicht, meine Griechen. «Wenn du high wirst, redest du von nichts anderem.» Bald achtzig Jahre und eine Prostata-Operation halten meine highness in Grenzen. Der versteckte Schlafboden über unserem Haushalt wird von zwei Stahlsäulen in der Mitte gestützt, und der kleine Raum ist fast lückenlos von unserem Ehebett eingenommen, wobei die Dachschräge bis zu den Kissen herunterreicht. Die Flecken auf dem weißen Putz sind Schleifspuren unserer Köpfe, die sich daran gestoßen haben. Wir vergessen immer wieder, daß wir nur geduckt ins Bett kommen. Hauptsache, wir schaffen es noch zu unserem Nest hinauf: elf Holzstufen. Aber sie sind so diskret einem dreieckigen Schrank aufgesetzt, daß man sie, wie Das Ei, für die Kaprize eines Designers halten kann. Man kann darauf immerhin abstürzen; das habe ich durch einen Spitalaufenthalt bewiesen, bei dem beide Knie und eine Schulter geflickt werden mußten.
Altersgerecht kann man unser Atelier also nicht nennen; auch der Gang ins Souterrain ist eine Begebenheit, die über dreizehn gezählte Stufen, mit Hilfe eines verloren wirkenden Geländers, in unsere Unterwelt führt, an alle Örtchen, wo wir täglichen Bedürfnissen nachgehen: Waschküche, Bad und Toilette auf der Süd- oder Seeseite, wohin immerhin noch etwas Tageslicht dringt, während die Bergseite, mit Garderobe, Heizung und einem Luftschutzkeller, nur künstlich zu erhellen ist. Geht man den talseitigen Korridor nach hinten, wird man linker Hand von drei Türen, rechts aber von einem die ganze lange Wand abdeckenden Stich der Ile de France begleitet, einem Meisterstück schraffierter Kartographie. Es muß noch vor der Revolution entstanden sein, denn der Plan zeigt die Geometrie des Schlosses von Versailles im Zentrum, die kompakte Stadt Paris eher am Rande. Aber die Karte registriert auf einer Fläche von real 20 x 30 Meilen auch die kleinste Siedlung, jedes Gütchen, jedes Wäldchen, jede Lichtung, jeden Jagdgrund für die hochmögende Gesellschaft und läßt die zarte Serpentine der Seine in ausladenden Bögen von rechts nach links durch das Bild mäandern. Wenn mir exakt zumute werden soll, kann ich lange, wie ein Satellit, über dieser exquisiten Welt tiefer Vergangenheit verharren. Ihre Beleuchtung genügt gerade, um jedes Strichlein darin leben zu lassen.