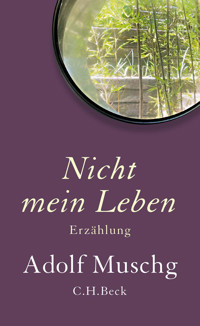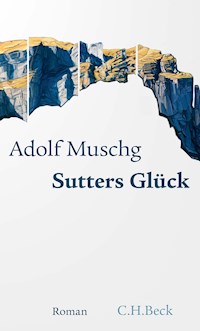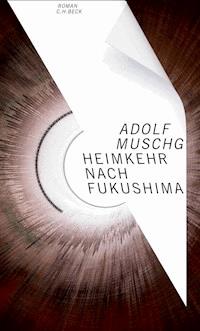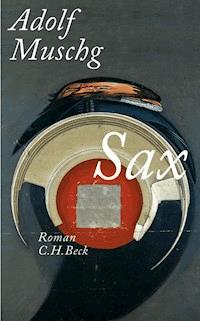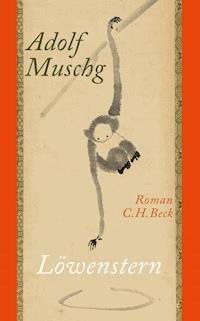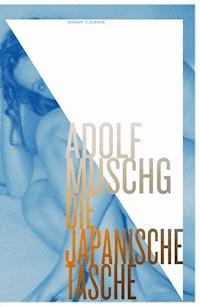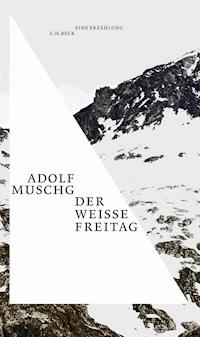
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Goethes zweite Schweizer Reise 1779 hätte gut die letzte des damals Dreißigjährigen sein können, und der "Werther" sein einziges bekanntes Werk. Denn das Risiko einer neunstündigen Fußwanderung über die Furka im November durch Neuschnee war unberechenbar. Aber der frisch ernannte Geheimrat hatte es auf den kürzesten Weg zu seinem heiligen Berg, dem Gotthard, abgesehen, seinen acht Jahre jüngeren Landesfürsten Carl August mitgenommen und alle Warnungen in den Wind geschlagen. Adolf Muschg liest diesen 12. November, den "weißen Freitag", die Wette Goethes mit seinem Schicksal, als Gegenstück zu Fausts Teufelswette und zugleich als Kommentar zum eigenen Fall eines gealterten Mannes, der mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist. Als Zeitgenosse weltweiter Flucht und Vertreibung und einer immer dichteren elektronischen Verwaltung des Lebens findet er gute Gründe, nach Vorhersagen, Warnungen und Versprechen in einer Geschichte zu suchen, die gar nicht vergangen ist. Sie handelt vom Umgang mit dem Risiko, dem auch der noch so zivilisierte Mensch ausgesetzt ist, weil er es als Naturgeschöpf mit Kräften zu tun hat, die er nicht beherrschen kann. Muschg hat mit dieser Doppelbelichtung zweier Reisen sein persönlichstes Buch geschrieben und sich ihrem bei aller Verschiedenheit gemeinsamen Grund genähert, den man nur im Erzählen ahnt – mit immer noch offenem Ende und doch im Wissen um die Endlichkeit, die nicht zu überschreiten ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Adolf Muschg
Der weiße Freitag
Erzählung vom Entgegenkommen
C.H.Beck
Zum Buch
Goethes zweite Schweizer Reise 1779 hätte gut die letzte des damals Dreißigjährigen sein können, und der «Werther» sein einziges bekanntes Werk. Denn das Risiko einer neunstündigen Fußwanderung über die Furka im November durch Neuschnee war unberechenbar. Aber der frisch ernannte Geheimrat hatte es auf den kürzesten Weg zu seinem heiligen Berg, dem Gotthard, abgesehen, seinen acht Jahre jüngeren Landesfürsten Carl August mitgenommen und alle Warnungen in den Wind geschlagen.
Adolf Muschg liest diesen 12. November, den «weißen Freitag», die Wette Goethes mit seinem Schicksal, als Gegenstück zu Fausts Teufelswette und zugleich als Kommentar zum eigenen Fall eines gealterten Mannes, der mit einer Krebsdiagnose konfrontiert ist. Als Zeitgenosse weltweiter Flucht und Vertreibung und einer immer dichteren elektronischen Verwaltung des Lebens findet er gute Gründe, nach Vorhersagen, Warnungen und Versprechen in einer Geschichte zu suchen, die gar nicht vergangen ist. Sie handelt vom Umgang mit dem Risiko, dem auch der noch so zivilisierte Mensch ausgesetzt ist, weil er es als Naturgeschöpf mit Kräften zu tun hat, die er nicht beherrschen kann.
Muschg hat mit dieser Doppelbelichtung zweier Reisen sein persönlichstes Buch geschrieben und sich ihrem bei aller Verschiedenheit gemeinsamem Grund genähert, den man nur im Erzählen ahnt – mit immer noch offenem Ende und doch im Wissen um die Endlichkeit, die nicht zu überschreiten ist.
Über den Autor
Adolf Muschg, geboren 1934 in Zürich, war u.a. von 1970–1999 Professor für deutsche Sprache und Literatur an der ETH in Zürich und von 2003–2006 Präsident der Akademie der Künste Berlin. Sein umfangreiches Werk, darunter die Romane «Im Sommer des Hasen» (1965), «Albissers Grund» (1977), «Das Licht und der Schlüssel» (1984), «Der Rote Ritter»(1993), «Sutters Glück» (2004), «Eikan, du bist spät» (2005) und «Kinderhochzeit» (2008) wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Hermann-Hesse-Preis, der Georg-Büchner-Preis, der Grimmelshausen-Preis und zuletzt der Grand Prix de Littérature der Schweiz. Im Verlag C.H.Beck erschienen Muschgs Reden «Was ist europäisch?» (2005), die Romane «Sax» (2010), «Löwenstern» (2012) und «Die Japanische Tasche» (2015) sowie die Essays und Reden «Im Erlebensfall» (2014). Außerdem erschien ein biographisches Porträt Adolf Muschgs von Manfred Dierks «Lebensrettende Phantasie» (2014).
Inhalt
Die Höhe
Unfall
Der eilfte Band
Fischotterdorf
Teich
Visite
Tour de Suisse
Engel
Paradiesvogel
Schwindel
Brocken
«Gnade Gottes»
Einzelkind
Fluchten
Künste
Berg und Tal
Windweben
Triptychon
Schwanken
Zum Geier
Experimentum crucis:
Der Gotthard
Umzug
Versuchsreihe
Lavater
Leichenfreund
Transposition
Der Nahe Osten
Kontrapunkt
Kleine Bergsicht
Carl August
Die Kinderzimmer-Geschichte
Der Parodist
Raumgewinn
Die regierende Herzogin
Eiersuchen
Und?
Faust und Auge
Bäume
Spieler
Mehr Bäume
Traum 1
Sicherheit
Der Bürger
Ein Bund
Genannt Blochberg
Und Frau von Stein?
Der Schatz
Seid Ihr nicht gar –?
Philipp
Man muß
Wenn man Forster hört,
In Jesberg
Erst vor den Toren Frankfurts
Spiegel am Teich:
Der Lauscher
Zur Erinnerung:
Und wie weiter?
Ein Misel
Nach dem Bilde
Kein Wort
Im Rabenhof
Schlapphut
Entfernt
Lesereise
Das Café Vetter
Theorie und Praxis
Nochmals Wedel
Wedel zum zweiten
Kinderliebe und Schuld
Wedel zum dritten
Dankbarkeit
Dialog
Über Wolken
Einholen
Leuker Bad
Du machst ja ein Gesicht
Ich aber glaube,
Warum verstellst du dich?
Europa-Meisterschaft:
Brig, Kaminfeuer
Mein Stoff
Doppel-Ehe
Aber 1779
Die sieben Siegel
Dämonisch
Dialog
Krebsangst
Traum 2
Mops
Traum 3
Die Aufklärung
Ins Reine
Kann man
Einkehr,
Alexis 1
Entgegenkommen
Croix d’Or
Promis
Nach Realp
Noch ein Goethe-Stübli
Hoch nach Tiefenbach
Schlitten fahren
In der Röhre
Selbstverständlich
Lafcadio 1
Lafcadio 2
Vogel Rock
Wohl möglich,
Vor allem eins
Fall Alexis
«Rein»
Schmetterling
Spiegelsturm
Die Katze
Zum letzten Mal
Stein 1
Stein 2
Und Dora
Goethe blickte
Nur einer
Für Thomas Sprecher
Bittet aber, daß eure Flucht nicht geschehe im Winter.
Matth. 24,20
… und mag als Spiel, dem es bitterer Ernst ist, gar wohl gelten.
Goethe, 24. Mai 1828 an Kanzler von Müller
Die Höhe Der Gletscher stürzte scheinbar unaufhaltsam von oben, die Klippen an seiner Stirn standen wie gefrorene Gischt, und aus Spalten und Klüften zündete ein unirdisches Vitriolblau. Aber der Strom war erstarrt, und gut ließ sich erkennen, wo wieder fester Boden begann. Hier hatte sich frischer Schnee auf ein Durcheinander rundgeschliffener Felsblöcke gesetzt, zwischen denen der Abfluß, den Augen verborgen, nur dem Ohr vernehmbar, seinen überstürzten Weg in die Tiefe suchte.
Nach dieser Seite lag das große Tal in stumpfem Grau. Da waren sie hergekommen und, ohne innezuhalten, auf dem Hang dem Gletscher gegenüber weitergestiegen. Sie waren ein kleiner Zug von Menschen, der sich so langsam entfernte, daß sie kaum von der Stelle zu rücken schienen. Bewegung war nur am wechselnden Abstand zwischen ihnen auszumachen und am anhaltenden Versuch, ihn wieder zu schließen. Dabei verschwanden ihre Körper immer wieder in den Schneeweben, die der beständige Wind über die ansteigende Fläche trieb, so daß sich ihre Ränder zum Himmel aufzulösen schienen. Erst gegen den Zenit wurde er hell wie Glas.
Es waren fünf. Sie rückten von der Stelle, als wären ihnen die Füße abgeschnitten, und der vorderste, breiter als die übrigen, schien immer wieder im Boden zu versinken, dennoch ging er regelmäßig wie ein Uhrwerk. Der nächste, der eine unförmige Last trug, blieb ihm dicht auf der Spur, nur daß er sich manchmal umwandte, um nach dem dritten zu sehen, der seinerseits bemüht schien, die Reihe nicht abreißen zu lassen. Denn der letzte der fünf wollte immer wieder zurückfallen, und der vierte, klein, aber stämmig, hatte ihn am Arm gefaßt, um ihn weiterzuziehen. Schließlich tauschten sie den Platz, und immer wieder hätte ein Betrachter den Kleinen den Größeren schieben sehen und sich wundern können, warum der Führer des Zugs den strengsten Weg gewählt hatte. Er hätte den Anstieg mit einem Bogen hie und da erträglicher machen können, aber der neue Schnee zeigte an, daß er locker saß und seine Unterlage jederzeit, durch Abrutschen breiter Lagen, freilegen konnte. Unter diesen Umständen war die steile Naht, welche die Berggänger geradewegs in die Fallinie zogen, die am wenigsten gefährliche Spur, dabei alles andere als gefahrlos, wie die rieselnden Schollen anzeigten, welche sie immer noch lostraten.
Ein Beobachter der Gruppe konnte nur hoffen, daß dies das heikelste Stück ihres Weges war, daß der Schnee weiter oben fester wurde, der Wind mäßiger, die Kälte erträglich; daß Stiefel und Gamaschen haltbar waren, eine gestrickte Halsbinde als Schutz für Gesicht und Ohren ausreichend, die Kräfte unerschöpflich.
Aber diesen Beobachter gab es nicht. Die Gruppe war allein mit dem Hochgebirge, am 12. November 1779, ihrem weißen Freitag, und gewarnt wäre sie genug gewesen. Noch unter dem Gletscher hätten sie umkehren können. Als sie aufbrachen, im letzten Dorf des Tals, war der Himmel noch klar gewesen, aber um diese Jahreszeit trügt das Wetter im Hochgebirge immer, gleich in welchem Jahrhundert. Aber da war einer in dieser Gesellschaft, der wollte über den Berg, auch bei Lawinengefahr, wollte nicht Gott versuchen, sondern sein Glück.
Waren jetzt auch die vorderen, die Führer, stillgestanden? Oder meinte man nur Stillstand zu sehen, wo bereits die weiße Einöde überhandgenommen hatte? In den Schleiern, die den Horizont unscharf machten, begann die Menschengruppe zu schwimmen und verflüchtigte sich im lichten Dunst. War sie immer noch unterwegs, wohin? Und würde sie dort je ankommen?
Geht’s wieder Männe?
Es muß, Durchlaucht.
Letztes Jahr um diese Zeit, hinter Stützerbach, lag auch viel Schnee, da haben wir immer noch gejagt.
Aber das nahm auch mal ein Ende. Dieser Berg ist ein Scheißer.
Laß das Herrn Weber nicht hören.
Dem ist sein Leben egal.
Was fällt dir ein!
Ich hab sein Buch gelesen.
Unfall Immer mehr gehöre ich zur Generation Tölpel.
Es begann vergangenen Juli mit einem Sturz über elf Stufen, die volle Länge von unserem Schlafboden hinunter, bis zur Terrassentür. Ich lag neben meinem Arbeitsplatz am Fuß des Stehpults und erwachte vom eigenen Schrei. Mein erster Gedanke: Das hätte schlimm ausgehen können. Dann erst meldete sich, vom Schock zurückgehalten, der Schmerz, und ich war gar nicht mehr sicher, ob es gutgegangen sei. Eigentlich ist die Treppe eine Hühnerleiter, Buchenbretter auf einem Metallgerüst, Grauguß, wie das Geländer; zum Aufstieg benötige ich es nie. Diesmal, auf dem Abstieg zur Toilette, mußte ich es verfehlt haben und war bäuchlings in die Tiefe gefahren, mit reflexartig vorgestreckten Armen, bis es nicht weiterging. Es waren die Finger, die als erste zu schmerzen begannen, dann folgte, dumpfer, die ganze linke Körperseite, Schulter und Knie. Zum Glück war dem Kopf nichts passiert.
Draußen begann es zu dämmern.
Der Lärm hatte A. aus dem Bett geschreckt, und im nächsten Augenblick kauerte sie an meiner Seite und versuchte, mich aufzurichten. Ich konnte mich rühren, von der Stelle humpeln; im Lampenlicht stellte A. am linken Knie einen Riß fest, aus dem es mäßig blutete. Das war der ganze sichtbare Schaden, außer daß meine Finger unnatürlich abgewinkelt waren, zwei an der linken Hand, auch der Ringfinger der rechten. Da um fünf Uhr früh der Hausarzt noch nicht verfügbar war, zog sich A. an, legte mir einen Morgenmantel um und packte mich ins Auto, um mich zur Notfallstation des nahen Spitals zu fahren.
Diese befand sich im Umbau, die Klingel funktionierte nicht; doch eine junge Frau, die zur Frühschicht eintraf, ließ uns mit ihrer Chip-Karte ein, und wir erreichten im Lift den Oberstock, wo wir ungnädig empfangen und in einem toten Räumchen sitzengelassen wurden, bis ein junger Arzt mich schließlich auf eine Liege komplimentierte. Als erstes zog er kräftig an meinen Fingern, die hörbar wieder in ihre Gelenke schnappten. Dann begann er mich abzutasten. Das Knie erklärte er für operationsbedürftig. Es blutete nicht mehr, war aber stark geschwollen. Ich bestand, nachdem das Knie gepflastert war, auf sofortiger Entlassung. Ärgerlich genug, daß ich die Finger kaum bewegen konnte. Das Schreiben hatte einstweilen gute Ruh; um so besser. Der letzte Teil meiner Wiedergänger-Trilogie war an ein totes Ende gelangt – entgegen meiner Absicht, den abgedankten Helden von «Sutters Glück» nochmals zum Leben zu erwecken, um ihn dann endgültig zu entlassen. Den Schauplatz hatte ich im Herbst zuvor recherchiert: die Insel Samothraki, wo ich bei den Eltern meines Übersetzers nach der Lesetour durch krisengebeutelte griechische Städte ein paar Tage Luft geschöpft hatte. Aus Samothraki waren die geheimnisvollen Kabiren übers Meer in Goethes «Klassische Walpurgisnacht» eingezogen.
Die Flüchtlinge aus dem syrischen Kriegsgebiet stauten sich einstweilen weiter südlich in der Ägäis, auf Lesbos und Kos.
Schellings Kabiren-Aufsatz, beim Zentralen Verzeichnis antiquarischer Bücher bestellt, erwartete mich im Briefkasten; lesen würde ich ja noch können, auch wenn ich die Buchseiten, wie Eulenspiegels kluger Esel, mit dem Maul umblättern mußte.
Der Tod zweier nahestehender Frauen hatte uns gelehrt, Stürze im Alter nicht leicht zu nehmen. Beide waren von Junkies «geschupft» und beraubt worden und hatten sich etwas gebrochen, die eine die Hüfte, die andere ein Bein. Der körperliche Schaden schien begrenzt, doch den starken Frauen ging die Verletzung ihrer Würde zu tief; für die Rechte von Menschen wie denjenigen, die sie zu Boden gestoßen hatten, waren sie ihr Leben lang eingetreten.
Bei meinem vergleichsweise harmlosen Absturz ließ A. einstweilen meinen Vorsatz gelten, ich wolle auf keinen Fall bettlägerig werden. Dabei konnte ich die Wunde unterm Knie nicht einmal sehen. Erst als A. einen Spiegel davorhielt, glaubte ich selbst, daß der klaffende Riß sich nicht von selbst schließen werde. Schon der Notarzt hatte festgestellt, es sei auch mit Nähen nicht getan. Der lädierte Schleimbeutel müsse, um sich nicht unheilbringend zu entzünden, entfernt werden.
Nun waren mir schon ganz andere Dinge entfernt worden, eine steinhaltige Gallenblase, ein Stück Dickdarm, eine verkrebste Prostata. Und auch wenn «Schleimbeutel» unappetitlich klang: Er mußte eine Bagatelle sein. Nur daß der Spitalaufenthalt doch noch fällig wurde. Für höchstens drei Tage, eine Vollnarkose inbegriffen. Sie war mir nicht ganz unwillkommen.
Der eilfte Band Das Buch, das ich ins Krankenhaus mitnahm, hatte ich noch nie geöffnet. Sepiabraun marmoriert, stand der Band mit zwölf seinesgleichen in einer Reihe, und das zinnoberrote Etikett zeigte in Goldprägung «Goethe’s Werke» an – nicht mehr «Göthe», aber mit Idioten-Apostroph, wie «Seppli’s Bar».
Die Ausgabe ist das Abschiedsgeschenk eines verlorenen Freundes, mit dem ich nach der Wende unseren DDR-Verlag «Volk und Welt» zu retten versuchte. Der «eilfte» Band, 1808 zu Tübingen in der Cotta’schen Buchhandlung erschienen, glänzt, als käme er frisch vom Buchbinder. Nun bin ich kein Bibliophiler; wenn ich mit Goethe arbeite, dienen mir nur Ausgaben, in denen ich Spuren hinterlassen darf. Aber als ich die Schweizer Reise suchte und fand, begegnete ich einem weniger zimperlichen Vorgänger. Volle 60 Seiten waren mit spitzer Feder annotiert, in alter deutscher Schrift, deren Hand den Druck mit «den Originalen aus dem Steinschen Briefwechsel, durch Dr. W. Tielitz mir mitgeteilt am 21. April 1881», verglichen und korrigiert haben wollte. Mit einer Spur Eifersucht sah ich, daß schon vor 135 Jahren ein anonymer Leser dieses besondere Stück nicht hatte ruhen lassen können.
Der Band behielt, mit seinem zugleich mürben und faserfesten Papier, alle Reize des Originals, und wenn er 1808 erschienen war, kam er ja auch unmittelbar aus Meisters Hand, damals einem Mann von 59 Jahren. Dabei konnte ihm der seit Thomas Manns «Lotte in Weimar» unvergeßliche Doktor Riemer assistiert haben. Dieses Buch brauchte ich, um in einer klinischen Umgebung auf vertrautem Boden zu stehen. Und gerade auf diesem war ich Goethe schon einmal nachgegangen und hatte seine Schweizer Reise 1779 als «Versuch, leben zu lernen», gedeutet. Das Büchlein erschien zwischen Nine-eleven und der ersten Weltwirtschaftskrise, ein Jahrzehnt nach dem «Ende der Geschichte». Damals glaubte ich noch, kein Tölpel zu sein, der imstande war, von der eigenen Treppe zu fallen.
Die Passage über die verschneite Furka zum Gotthard hatte ich schon damals als Zäsur betrachtet, als «eine sich ereignete unerhörte Begebenheit». Sie war nur darum nicht ganz beispiellos, weil es zwei Jahre zuvor eine Art Probelauf gegeben hatte, die Winterreise in den Harz, zu der Goethe ganz allein aufgebrochen war. Davon berichtete er nur Frau von Stein, aber auch sie brauchte nicht zu wissen, daß es um Tod und Leben ging. Der Wanderer hatte gerade die einzige Schwester verloren.
Dem Geier gleich,
Der auf schweren Morgenwolken
Mit sanftem Fittich ruhend
Nach Beute schaut,
Schwebe mein Lied.
Denn ein Gott hat
Jedem seine Bahn
Vorgezeichnet,
Die der Glückliche
Rasch zum freudigen
Ziele rennt:
Wem aber Unglück
Das Herz zusammenzog,
Er sträubt vergebens
Sich gegen die Schranken
Des ehernen Fadens,
Den die doch bittre Schere
Nur einmal löst.
Die Harzreise war der Gang zu einem Orakel, das die «doch bittre Schere» noch einmal anzuhalten versprach. Es war die Hauptprobe zur Uraufführung zwei Jahre später, in den Schweizer Alpen, wo er nicht mehr allein war, aber wieder unter dem Pseudonym «Weber» reiste, nur daß er im Harz noch einen «Maler aus Gotha» gespielt hatte. Wieder sieben Jahre später, auf der italienischen Reise, sollte der «pittore» noch einmal zu Ehren kommen, diesmal als «Filippo Miller». «Weber» ging auf der Furka verloren und ward nicht wiedergesehen.
Dabei hatte die Maske schon auf der Harzreise therapeutische Dienste geleistet. Denn in ihrem Schutz hatte er in Wernigerode einen schwermütigen Altersgenossen heimgesucht, den Studiosus der Philosophie Friedrich Plessing, der Goethe zwei dringliche Briefe geschrieben hatte, ohne Antwort zu erhalten. Nun mußte sich «Weber» die wohlbekannten Schriftstücke nochmals anhören, die gewissermaßen Werther-Geist atmeten, und sollte dem Schreiber die Rechtmäßigkeit seiner düsteren Weltansicht ausreden. Es war eine Strafe, der sich der Dichter nur durch Flucht entziehen konnte, ohne danach den Kläger, als ihn dieser in Weimar heimsuchte und das Inkognito gelüftet war, seiner Not zu überlassen. Er verschaffte ihm ein Darlehen und begleitete seinen akademischen Weg mit Teilnahme, vom Studium bei Kant in Königsberg bis zur Philosophie-Professur in Duisburg, wo er ihn 1792 noch einmal wiedersah. In der «Campagne in Frankreich» rekapituliert er den merkwürdigen Anfang dieser Bekanntschaft aus gelassenem Abstand. Nichts läßt darauf schließen, daß er, nach dem Tod seiner Schwester, fünfzehn Jahre zuvor, selbst Rat nötig gehabt hatte, wie er seine Existenz in Weimar von Tag zu Tag gewältigen könne, ohne daß er sich dabei selbst abhanden kam.
Fischotterdorf Im Spitalzimmer genoß ich volle Seesicht, die in unserem halben Bauernhaus streng rationiert war. Nur vom obersten Dachfenster aus ließen sich durch den Eisenwinkel des alten Güteraufzugs See und Berge ahnen. Es grenzt an Snobismus, in der «schönen Fischottergemeinde» keine Seesicht zu genießen.
So nennt sich unser Dorf, weil es das selten gewordene Tier im Wappen führt, schwarz auf gelb, mit einem Fisch im Maul. Heraldisch ein Spätzünder, vielleicht im 19. Jahrhundert dem Zeichentisch eines sinnigen Gemeindeschreibers entsprungen. Unser Dorf führte zwischen alten Weindörfern ein eher obskures Dasein, auch wenn im 19. Jahrhundert durch einen Schub schwäbischer Frömmigkeit nachgeholfen wurde. «Jerusalem am Pfannenstiel» hat mein Vater, der in Sachen Christentum gewiß nicht zum Spott neigte, Männedorf genannt. Denn in dieser Lücke alteingesessenen Wohlstands hatten sich, um die «Zellersche Anstalt», Stille im Lande angesiedelt, um allmählich wohlhabend zu werden, aber immer mit einem Geruch des Schamhaften, der einen selbst aus dem Gemeindewappen anweht; neben Adler, Löw und Greif ist ein Fischotter doch nicht recht ansehnlich. Man hat mit dem Tierchen auch immer seine Mühe, wenn man es real ansiedeln will. Das Fischottergehege, neben dem Hallenbad hinter einem Parkplatz versteckt, ist nicht eben ein Publikumsmagnet. Dafür pflegen seine Insassen immer wieder auszureißen und werden dann nie wieder aufgebracht. Man kann nur hoffen, daß sie das gesuchte Weite in der schönen Fischottergemeinde auch gefunden haben.
Da ist meine familiäre Verbindung mit unserem Dorf solider. Mein Vater, der Kleinbauernsohn, stieg jeden Tag über den Berg, um hier die Sekundarschule zu besuchen – ein Fußweg von einer guten Stunde. Er muß um 1885 jeden Werktag zweimal an unserem Haus vorbeigekommen sein, und gerne stelle ich mir vor, daß ihm die damaligen Bewohner eine Suppe gereicht haben.
Aber auch meine Mutter hätte, in den Jahren ihrer Gemütskrankheit, einen Platz in Männedorf finden können, wo die Zellersche Anstalt sich gerade solcher Frauen annahm. Finanziert wurde sie von der wohlhabenden Betsy Meyer, die sich von ihrem Bruder, dem Dichter, nach seiner Eheschließung hatte trennen und zusehen müssen, wie er auf der anderen Seeseite selbst der Umnachtung anheimfiel. Aus dem «Felsengrund», wo sie als weltliche Nonne residierte, hat sie die damals neue Eisenbahn vertrieben. Sie zog in den Aargau um, die Bibelgemeinde aber auf die Höhe über dem Dorf, wo das Bethaus (mit Altersheim) als «Stadt auf dem Berge» Jerusalem am Pfannenstiel einen Touch des amerikanischen Mittelwestens verleiht, während sich die übrigen Kraftorte des HErrn mit der säkularen Nachbarschaft arrangiert haben: die Methodistengemeinde mit der EMS-Chemie, das evangelische Tagungszentrum Boldern mit der Herausforderung eines kostendeckenden Hotelbetriebs. In Betsy Meyers «Felsengrund» ist seither die politische Gemeinde eingezogen, aber da sie sich um viele Pendler auf über zehntausend Einwohner vergrößert hat, die «Seelen» zu nennen kurios wäre, faßt sie einen Neubau ins Auge und darf das einstige Zentrum der Nächstenliebe bald dem Denkmalschutz überlassen.
Meine Mutter durfte für ihre letzten Jahre in unserer Bürgergemeinde weiter unten am See das damals brandneue Altersheim beziehen. Da es nicht als Pflegeheim eingerichtet war, mußte sie zum Sterben wieder mehrfach umziehen. Die Altersschwäche hatte die Lehrerwitwe vom Gott ihres Mannes entfernt, mit dem sie mir, in aller Mutterliebe, pflichtschuldig die Hölle heiß gemacht hatte. So mußte ich es als Gnade betrachten, daß Er sie, in ihrem letzten Asyl, gerade in einem Gottesdienst entschlafen ließ. Das stattliche Altersheim ist inzwischen zum Abriß vorgemerkt und soll bis dahin als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. 1983, als ich meine Mutter im Totenbett zeichnete, stand mir die erste größere Operation bevor, und ich ahnte noch nicht, daß ich von Kilchberg, dem Ort meiner zweiten Ehe, für den Versuch einer dritten ans angestammte rechte Ufer, die sogenannte Sonnenseite, zurückkehren sollte.
Jetzt, 2015, an der Schwelle zu einer kleinen Operation, hätte ich mit breiter Seesicht nicht besser liegen können. Noch stehe ich auf, gehe ein paar Schritte auf den durchlaufenden, aber menschenleeren Balkon, von dem der Blick in alle Richtungen schweift. Kilchberg zwar bleibt verborgen, wo ich meine Familie zurückgelassen habe. Um so klarer liegt der Pfannenstiel vor Augen, «ein Grat von schlichtem Verlauf», an dessen Rand die Hohenegg im Abendschein leuchtet: ein Hochsitz privatisierter Psychiatrie, der heute nicht mehr zu bezahlen wäre. Dort habe ich bei Heimatbesuchen aus dem frommen Bündner Internat meine hartnäckig leidende Mutter besucht. Stundenlang spazierten wir auf dem Höhenweg vor der Klinik hin und her, von dem aus man ebenfalls die schönste Aussicht auf den Zürichsee genießt, aber wir gingen mit niedergeschlagenen Augen.
«Ich habe nicht gelernt, mein Leben zu genießen, nur es zu rechtfertigen», habe ich kürzlich notiert; diese Einsicht kam vor dem Fall von der Schlafbodentreppe. Mein gedrucktes Lebenswerk betrachte ich als abgelegte Haut, aber der letzte Satz aus meinem ersten Roman ist mir geblieben: «Der Hase, heißt es, schläft mit offenen Augen. Es wird Zeit, daß er mit geschlossenen Augen zu wachen beginnt.»
Teich Was ich im Spital sogleich vermißte, war der Blick auf den kleinen Teich, der uns die Seesicht ersetzen muß. Wir haben seine Fischblasen-Form fast als erstes ausheben lassen und mit Sandsteinfelsen besetzt, als wir vor über zwei Jahrzehnten unser halbes Bauernhaus bezogen. Für unseren gemeinsamen Haushalt mußte A. 10.000 Kilometer zurücklegen, ich scheinbar nur die Seeseite wechseln. Danach wohnten wir mit A.s Kindern zu viert in engen, aber witzig verschachtelten Räumen auf vier Etagen, in die auch einige geöffnete Decken kaum Sonnenlicht lockten. Für das Bedürfnis, sich von diesem Heim, als es noch Baustelle war, ein paar Schritte abzusetzen, kam ein eisengeschmiedetes Gartenhaus auf, das ein Kunstspengler an der Seestraße ausgestellt hatte. Ein Kran hievte es, wie Gullivers Käfig, in das Wäldchen aus Birken und Lebensbäumen, das uns der Vorbesitzer – neben einem Ponystall mit Bänklein – hinterlassen hatte.
Anfang der neunziger Jahre entschlossen wir uns, diesen Platz mit einem Atelierhaus zu überbauen, das zwei größere Räume zu bieten hatte, einen für A.s Klavier, einen für meine Schreibarbeit, dazu ein Kellergeschoß für ein Badezimmer und den Luxus einer Sauna. Das gewünschte Flachdach bewilligte die Baubehörde nicht, wohl aber ein durch eine Zeile Oberlicht gestuftes Satteldach und die zum Teich hin geöffnete gedeckte Terrasse. Im Souterrain gab das abgeteufte und durch eine Wand aus Schienenschwellen befestigte Gelände einen kleinen Vorplatz her, in dem ein Treppchen zur Kellertür hinabführt. So gewannen wir Tageslicht für die Naßzelle und, im rechten Winkel dazu, einen Archivraum.
Damit war der Grundriß der kleinen Liegenschaft bis an die erlaubte Grenze ausgereizt, aber der Neubau brachte die gewünschte Nähe zum Teichgarten, eine kleine, durch Bambus und Palisadenwände geschützte Welt konzentrierter Freiheit. Der Neubau befriedigte uns durch seine fließende Verbindung von innen und außen und wohltuende Verhältnisse für meine Arbeit, sei es am Schreibtisch oder auf der Terrasse. Für A. bedeutete die Zweihäusigkeit aber auch Mehrarbeit, geteilte Anwesenheit und umständliche Transporte zwischen Küche und Tisch.
Visite Bei der Arztvisite stellte sich der Chirurg vor, ein nicht mehr ganz junger Mann aus Thüringen, der sogleich den Goethe-Band bemerkte. Er hatte Germanistik studiert, bevor er zur Medizin gewechselt war, aber von einer Schweizer Reise des illustren Landsmanns hörte er zum ersten Mal.
Es habe sogar ihrer drei gegeben, berichtete ich, und jede sei eine Flucht gewesen, auf ihre Art. Die erste vor einer Verlobung mit einer geliebten, aber nicht passenden Frau, weil sie ihn auch zu einer stadtbürgerlichen Existenz in den Fußstapfen des Vaters verpflichtet hätte. Die zweite vor der Last seiner Tätigkeit in Weimar; erst die dritte, 1793, habe er in einiger Ruhe angetreten und eigentlich nach Italien weiterreisen wollen, was die Kriegsläufte verhindert hätten. Dreimal habe er eine verschiedene Schweiz gesehen, gemeinsam sei den Reisen nur, daß er auf keiner weiter gekommen sei als bis zum Gotthard. Mich beschäftigte die mittlere mit seinem Landesherrn, weil ich in ihr einen Schlüssel für sein ganzes Leben vermute.
Die italienische sei die wichtigste, habe ich gelernt.
Sie war ein richtiger Aufenthalt. Da war er schon fast vierzig und hat zum ersten Mal mit einer Frau geschlafen.
Glauben Sie das?
Sein Psychoanalytiker behauptet es, ein Herr Eißler. Beweisen kann man’s nicht, aber ich finde es nicht ganz unwahrscheinlich.
Da staunte auch die Anästhesieärztin, die den Arzt mit deutlicher Zurückhaltung begleitet hatte. Er hatte sie als Dr.M. vorgestellt, sich selbst nur als B.
Und seine Liebesgeschichten? sagte sie. – Die gab es doch schon vorher.
Und er war keiner, der etwas anbrennen ließ, sekundierte B.
Es war ihm wohl wichtiger, es brennen zu lassen. Im Sex löscht es leicht ab.
Jetzt lachten beide; sie kannten meine Krankengeschichte, und mit einem Prostata-Operierten streitet man nicht über Sex. Wir redeten über meine Narkose. Eine lokale Betäubung hätte gereicht, aber ich wünschte, bei dem Eingriff lieber nicht dabeizusein.
Nachdem A. gekommen und wieder gegangen war, blieb ich allein mit dem endlosen Spitalabend. Zu essen bekam ich nichts mehr. Fernsehen mochte ich nicht, auch nicht lesen. Kein Zeitvertreib! Wie sagte ein kluger Freund? Wer sich langweilt, ist langweilig.
Was wußte ich noch von jener Schweizer Reise?
Tour de Suisse Damit hatte er gleich zwei Götter herausgefordert; «Genius» und «Terminus», was ebenso Grenze bedeuten kann wie Ende. Und als es überstanden war, wollte er beiden ein Denkmal setzen, ihr Bild auf zwei Seiten desselben Steins gemeißelt, und, mit Vermittlung seines Freundes Lavater, einen Künstler dafür gewinnen, Füßli, der für Darstellungen des Schauderhaften berühmt war. Goethes Denkmal-Sucht; dasjenige für Frau von Stein balanciert eine Kugel auf einem Kubus. Sein sichtbarstes Werk in Weimar war damals die Verwandlung der Flußlandschaft vor seinem Gartenhaus in einen englischen Park, in dem sich Denkmale verstecken ließen wie dasjenige für die ertrunkene Ophelia Christel von Laßberg. Der allgegenwärtige Tod wollte übergrünt sein, wie im Memento der «Italienischen Reise» («Et in Arcadia ego»). In der Nähe erhielt Herzog Carl August ein «Römisches Haus» statt seiner abgebrannten Residenz. Aus einem Denkmal für die Schweizer Reise wurde nichts; aber er hatte es sich mit Leib und Blut gesetzt und in Prosa jahrzehntelang nachbearbeitet; 1808 erschien es zum ersten Mal. Und jetzt hielt ich es in der Hand.
Diese Reise 1779 hat er nicht allein gemacht.
Gewiß hat der junge Herzog Carl August sie zuerst als Laune seines Günstlings betrachtet, der er nachzukommen geruhte, als Bildungsreise in ein vielgelobtes Land, die er bei seiner Kavalierstour nach Paris versäumt hatte. Mit den berühmten Alpen stellte es für den jungen Militaristen auch eine sportliche Herausforderung dar. Die Frau von Goethes Freund Merck (einem Modell Mephistos) war aus dem Genferseegebiet gebürtig, einer Landschaft, über die man leicht ins Schwärmen gerät. Da lag auch der Montblanc gleich vor der Tür, und obwohl die Jahreszeit schon vorgerückt war, konnte man bei gutem Wetter vorher auch das Berner Oberland mitnehmen, Gletscher, Jungfrau, Staubbach, Aareschlucht. Und wenn man schon im reichen Bern vorbeikam, konnte ein armer Fürst dort vielleicht einen Kredit lockermachen, damit sich die Reise lohnte (sie kostete fast 9000 Taler, aber es schauten 50.000 heraus). Und in der Nähe gab es doch dieses Grabmal, mit dem ein dänischer Bildhauer eine im Kindbett verstorbene Pfarrfrau verewigt hatte. Durch einen Spalt im Stein reckte sie ihr totes Kind gefühlvollen Pilgern aus ganz Europa entgegen. Im Vorbeigehen konnte man auch die Naturgelehrten abschöpfen, von denen es in der Schweiz zu wimmeln schien.
Und Lavater, der berühmte Pfarrer Lavater am St.Peter, nicht zu Rom, sondern im sittenstrengen Zürich? Auch er stand auf dem Programm, sogar an erster Stelle. Er war, seit Goethes zweiter Reise, sein «Bruder» und der menschlichste der Menschen, dessen «Physiognomischen Fragmenten» er zugearbeitet hatte. Dennoch erfuhr er vom Glück, daß ihm Goethe auch seinen Landesherrn brüderlich zuzuführen gedachte, erst, als die Herrschaften längst im Lande waren, im letzten möglichen Augenblick.