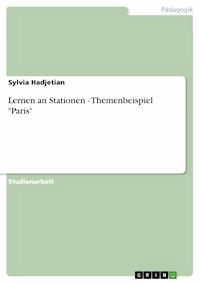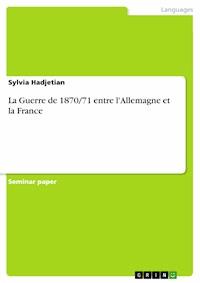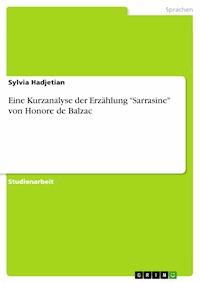15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich Französische Philologie - Literatur, Note: 1,0, Universität Regensburg (Romanistik-Französisch), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis 1. Biographie 2. L’Art poétique 2.1. Chant I 2.2. Chant II 2.3. Chant III 2.4. Chant IV 3. Analyse von Boileaus‘ Gedichten nach den Regeln der Art poétique 3.1. Ode de Sapho 3.2. Ode sur la prise de Namur 3.3. Épigramme XI 3.4. Épigramme XXXVIII: A messieurs Pradon, et Bonnecorse 3.5. Schlußfolgerung aus den Gedichtsanalysen über Boileaus‘ Einhaltung seiner eigenen Regeln aus der Art poétique 4. Boileaus‘ Bedeutung für die französische Lyrikgeschichte 4.1.“La Querelle des Anciens et des Modernes“ 4.2. Boileaus‘ Ansehen in den folgenden Jahrhunderten 5. Bibliographie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2005
Ähnliche
Page 1
Universität Regensburg
Französische Lyrik
Institut für Romanistik Sommersemester 2001 Verfasserin: Sylvia Hadjetian
Nicolas Boileau-Despréaux
Page 3
1. Biographie1
Nicolas Boileau-Despréaux wurde am 1. November 1636 in Paris als das 15. Kind eines Gerichtsschreibers des Pariser Parlaments geboren. Nach einem abgebrochenen Theologiestudium fing er an, Jura zu studieren und wurde 1656 Advokat. Durch den Tod seines Vaters kam er zu Wohlstand, übte seinen Beruf nicht mehr aus und hatte somit Zeit, sich seiner Leidenschaft, dem Schreiben, zu widmen. Durch den Einfluß der jungen Schriftsteller Racine, Molière und La Fontaine gewann er an Bedeutung, veröffentlichte seine Werke ab ca. 1660 und wurde dadurch berühmt. 1677 wurde er zusammen mit Racine geadelt und zum königlichen Historiographen ernannt. Dank Louis XIV wurde er in die Académie française aufgenommen, wo er von 1687-1694 eine wichtige Rolle in der “Querelle des Anciens et des Modernes“ spielte. Nach dem Tod seines Freundes Racine verbrachte er die letzten Jahre seines Lebens krank und einsam im Kloster Notre-Dame, wo er am 13. März 1711 als letzter Vertreter seiner Generation verstarb.
In seinenSatires(12 Bände), die zwischen 1665 und 1711 verfaßt wurden, kritisiert er mit Schärfe bestimmte Schwächen seiner Mitmenschen, ihn störende Zeiterscheinungen und zeitgenössische Schriftsteller in moralisierender Absicht. DieEpîtres(12 Bände), erschienen zwischen 1674 und 1698, sind in gemäßigterem Ton verfaßt, richten sich entweder an den König oder beinhalten moralische und literarische Themen.
BeiLe Lutrin(1674-1683) handelt es sich um ein heroisch-komisches Epos, in dem Advokaten und Kleriker satirisch dargestellt werden.
Des weiteren hat Boileau diverse Gedichte, Epigramme und Prosawerke verfaßt, wie z.B. dieLettres à Charles Perrault(1700).
2. L’Art poétique2
Die vier Chants derArt poétiquesind zwischen 1670 und 1674 verfaßt und 1684 veröffentlicht worden. Diese Versepistel, die sich an der klassischen Dichtung der Antike,
besonders an Horaz (“imitation d’Horace“3), orientiert, ist mit nicht mehr als 1100 Versen relativ kurz (“pas plus de 1100 vers, assez court“4). Jeder der vier Teile hat sein eigenes
1vgl. Internet S. 1-4; vgl. Pocock, 1980, S. 18-37
2vgl. Buck 1970, S. 135-151 vgl. Hervier 1949, S. 59-196 vgl. Pocock 1980, S. 83-119 vgl. White 1969, S. 135-151
3Hervier 1949, S. 97
4ibid., S. 59
Page 4
Thema (“son sujet bien déterminé“5) und enthält die Prinzipien, die die französische Dichtung weit über die Epoche der Klassik hinaus geprägt haben. DieArt poétiquegilt als das Handbuch der klassischen Theorie6.
2.1. Chant I
Im ersten Teil des Chant I (1-26)7läßt sich Boileau allgemein über die Verskunst aus, wobei besonders der Dichter François de Malherbe (1555-1628) als Vorbild diente. Jeder Dichter benötigt seiner Meinung nach Inspiration und Talent zum Dichten. Die Inspiration soll von der Vernunft kontrolliert werden (“la Raison n’est pas une inspiratrice: elle est seulement une
conseillère qui contrôle les inspirations“8). Dichten ist für ihn eine Kunst (“L’Art des Vers“9), die nicht jeder beherrscht. So auch seine Anspielung auf “Parnasse“10, dem Sitz Apollons. Das Talent dazu (“les talens“11) muß angeboren sein (“en naissant ne l’a formé Poëte“12), pure Lust am Dichten macht noch keinen berühmt (“Ni prendre pour genie une amour de rimer“13). Von Vers 27 bis Vers 38 beschäftigt sich Boileau mit dem Reim, der dem “bon sens“
entsprechen soll (“le Bon sens s’accorde avec la Rime“14). Er spricht sich gegen die “licence poétique“ aus. Ein Gedicht kann nur Erfolg erzielen, wenn es dem “bon sens“ entspricht und da der Reim als eines der wichtigsten Elemente eines Gedichtes betrachtet wird, so muß auch
dieser ihm unterworfen werden (“La Rime est une esclave, et ne doit qu’obeïr“15). Erst ein Reim, der der Vernunft unterliegt, kann Schönes schaffen und als Bereicherung dienen (“Au
joug de la Raison sans peine elle fléchit, Et loin de la gesner, la sert et l’enrichit“16). Nur Wörter, die sinngemäß zusammenpassen, sollen gereimt werden (“il ne faut [...] user de
formules banales, pour remplir le vers sans rien dire“17). Also rät Boileau: “Aimez donc la raison“18.
Im nächsten längeren Abschnitt (39-102) kritisiert Boileau hauptsächlich das Burleske. Er
richtet sich gegen das Außergewöhnliche (“loin du droit sens“19) und ist gegen
5Hervier 1949, S. 59
6vgl. White 1969, S. 135
7vgl. Buck 1970, S. 45-140
8Hervier 1949, S. 71
9Boileau 1674, S. 81-117, AP Chant I, V. 2
10AP V. 1
11AP V. 14
12AP V. 4
13AP V. 10
14AP V. 28
15AP V. 31
16AP V. 33 f.
17Hervier 1949, S. 68
18AP V. 37