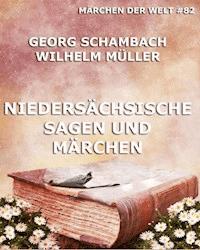
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Niedersächsische Sagen und Märchen
Georg Schambach / Wilhelm Müller
Inhalt:
Geschichte des Märchens
Bibliographie der Sage
Vorrede.
A. Sagen.
1. Die Bramburg.
2. Der Sensenstein und der Sichelstein.
3. Der Brackenberg.
4. Die Gleichen.
5. Die Burg Grone.
6. Die Plesse.
7. Weshalb die Herren von Hardenberg einen Schweinskopf im Wappen führen.
8. Das Fräulein von Bomeneburg.
9. Die Burg Brunstein.
10. Die Vogelsburg und das Dorf Vogelbeck.
11. Die Heldenburg.
12. Die Belagerung des Grubenhagen.
13. Burg Dassel.
14. Die Erichsburg.
15. Die Homburg und die Burg Eberstein.
16. Die Erbauung der Burg Greene.
17. Die Zerstörung der Burg bei Pöhlde.
18. Burg und Flecken Adelebsen.
19. Die Entstehung des Dorfes Evershausen.
20. Woher Parensen den Namen hat.
21. Die Erbauung von Höckelheim.
22. Woher das Dorf Kalefeld den Namen hat.
23. Die Stadt Einbeck.
24. Die Brücke bei Kuventhal.
25. Woher das Dorf Andershausen seinen Namen hat.
26. Die Hildesheimer Jungfer.
27. Die Bremker Kirche.
28. Das Heiligthum bei Adelebsen.
29. Die Kirche in Fredelsloh.
30. Die Leisenröder Kirche.
31. Die Steinkirche bei Scharzfeld.
32. Das Catharinenläuten in Münden.
33. Das Siebenläuten in Göttingen.
34. St. Alexander.
35. Der große liebe Gott in der St. Godehardi Kirche zu Hildesheim.
36. Die katholischen Pferde.
37. Kampf zwischen Todten.
38. Die Geister bei Tackmanns Graben.
39. Das Hundefeld bei Oldendorf.
40. Die Zerstörung von Sebexen.
41. Der verschworene Berg.
42. Der Göttinger Wald.
43. Die Besitznahme von Radolfshausen.
44. Die Feldmark von Roishausen.
45. Der Strahlenkamp bei Fredelsloh.
46. Die Ahlsburg.
47. Der Nonnenweg bei Odagsen.
48. Das Wendfeld bei Einbeck.
49. Der Rohrbeck.
50. Die beiden Mönche.
51. Die Koppelweide.
52. Das Fährhaus bei Lippoldsberge.
53. Die vier Linden auf der Hube bei Einbeck.
54. Der Stein bei Edemissen.
55. Die feindlichen Brüder.
56. Bestrafung des Felddiebstahls.
57. Der Kirchenräuber.
58. Das Denkmal auf dem Donnersberge.
59. Der Nonnenberg bei Wiebrechtshausen.
60. Der Kuhstein.
61. Während eines Gewitters soll man nicht essen.
62. Der Schäferstein.
63. Der Kellerstein.
64. Der Stein bei Sudheim.
65. Stein wird weich.
66. Der Räuber bei Oldershausen.
67. Der Seckelnborger.
68. Hans von Eisdorf.
69. Die Lippoldshöhle bei Brunkensen.
70. Die Entstehung des Seeburger Sees.
71. Der Güß bei Herzberg.
72. Das Erdloch bei Elvese.
73. Der Erdpfuhl bei Lüthorst.
74. Die Lüthorster Glocke.
75. Der Opferteich in Moringen.
76. Der Glockensumpf bei Grone.
77. Versunkene Glocken.
78. Die versunkene Kirche.
79. Der Salzbrunnen zu Salzderhelden.
80. Hungerquellen.
81. Kinderbrunnen.
82. Versunkene Wagen.
83. Die Jungfrau in der Leine.
84. Das Wasser will sein Opfer haben.
85. Vorzeichen des Ertrinkens.
86. Der einäugige Fisch.
87. Das Teufelsbad.
88. Tils Graben.
90. Der Hakemann.
91. Der Wassermann und der Bär.
92. Wasserjungfern.
93. Die Frau in der Sonne.
94. Der Mann im Monde.
95. Der ewige Fuhrmann.
96. Der Nachtrabe.
97. Hackelnberg.
98. Hackelbergs Grab.
99. Hackelberg jagt.
100. Die Teiche im Einbecker Walde.
101. Der Hastjäger.
102. Die Hubertushöhle bei Sillium.
103. Frau Holle.
104. Das Kornweib.
105. Das Fräulein von Bönnekehausen.
106. Die weiße Jungfrau auf der Vogelsburg.
107. Die weiße Jungfrau auf der Heldenburg.
108. Die weiße Jungfrau auf dem Grubenhagen.
109. Die weiße Jungfrau auf der Burg Hunnesrück.
110. Die weiße Jungfrau in Karlsruhe.
111. Die weiße Jungfrau auf der Homburg.
112. Die weiße Jungfrau auf der Burg Eberstein.
113. Die weiße Jungfrau bei Lauenberg.
114. Die weiße Jungfrau auf der Lisekenburg.
115. Die Erdbeeren.
116. Die Wunderblume.
117. Die weiße Jungfrau bei und in Einbeck.
118. Die weiße Jungfrau von Mark-Oldendorf.
119. Das Geldloch bei Hilwartshausen.
120. Die Neunkammer.
121. Der Frauenstein.
122. Die weiße Jungfrau bei Vardeilsen.
123. Die weiße Jungfrau auf der Schützenwiese.
124. Das Schlüsselmädchen.
125. Die weiße Jungfrau bei Echte.
126. Die weiße Jungfrau an der Quelle.
127. Das Holzfräulein.
128. Die drei Puppen.
129. Die zwölf weißen Jungfrauen auf dem Lichtenstein.
130. Die Jungfrau von Radolphshausen.
131. Die weiße Jungfrau in Rengershausen.
132. Die in eine Schlange verwandelte Jungfrau.
133. Die Jungfrau und der Schatz.
134. Die weiße Taube.
135. Hund zeigt einen Schatz.
136. Schatz gehoben.
137. Schätze zu heben.
138. Schätze bleiben unbeachtet.
139. Schätze nicht gehoben.
140. Zwerge.
141. Die Zwerge ziehen aus.
142. Zwerge in ihrer Wohnung gestört.
143. Zwerge backen.
144. Die gestohlenen Laken.
145. Zwerge begaben.
146. Die diebischen Zwerge.
147. Die Zwerge in den Erbsenfeldern.
148. Zwerge rauben Kinder.
149. Wechselbalg entdeckt.
150. Die kreißende Zwergin.
151. Zwerge bitten zu Gevatter.
152. Zwerge dienen.
153. Kobolde.
154. Die Hünenbetten auf der Sababurg.
155. Der Hüne und der Zwerg.
156. Der Hünengraben.
157. Riese Schaper.
158. Die Hünen und die Menschen.
159. Die Größe der Hünen.
160. Hünenschritte.
161. Hügel von Riesen hervorgebracht.
162. Hünensteine.
163. Riesenwürfe.
164. Riesen backen gemeinschaftlich.
165. Hünen tragen Kirchen fort.
166. Der Riese und der Teufel.
167. Der Teufel als Baumeister.
168. Herzog Erich und der Teufel.
169. Knabe dem Teufel entrissen.
170. Der Teufel betrogen.
171. Das Schauteufelskreuz.
172. Das Niphuhn.
174. Vom Teufel geholt.
175. Die Spieler und der Teufel.
176. Das seltsame Wirthshaus.
177. Der feurige Teufel.
178. Das blaue Licht.
179. Der Teufel bringt Erbsen.
180. Was der Teufel seinen Verehrern bringt.
181. Das Grab des Teufels.
182. Stöpke.
183. Die Nachthexe.
184. Die Butterkröte.
186. Der Teufel schmiedet Geld.
187. Der Alraun.
188. Der Heckethaler.
189. Das Heckemännchen.
190. Augen verblenden.
191. Liebeszauber.
192. Der Zauberspiegel.
193. Zauber und Gegenzauber.
194. Bekenntnis einer Hexe.
195. Die Walpurgisnacht.
196. Katzen sind Hexen.
197. Die schwere Gans.
198. Der Werwolf.
199. Das Schlangenei.
200. Die Schlangenkrone.
202. Die Unken.
203. Die gespenstische Glucke.
204. Geist in Gestalt eines Hundes.
205. Prinzessin in einen Esel verwandelt.
206. Das erlöste Reh.
207. Die drei Rehe.
208. Der dreibeinige Hase.
209. Die schwarze Katze.
211. Der Klimperhund.
212. Der schwarze Hund.
213. Der weiße Hund.
214. Andere Gespensterthiere.
215. Das schwarze Roß.
216. Der gespenstische Schimmel.
217. Der Schimmelreiter.
218. Der alte Major.
219. Der Amtmann von Erichsburg.
220. Der Mann ohne Kopf.
221. Der graue Mann.
222. Der Gerenkerl und der Kriebergskerl.
223. Der Landmesser.
224. Der Zaunklopfer.
225. Die gespenstische Leuchte.
226. Irrlichter.
227. Der Irrwächter.
228. Der umgehende Arzt.
229. Der gespenstische Wagen.
230. Das unsichtbare Gespann.
231. Der gespenstische Leichenzug.
232. Beraube die Todten nicht!
233. Beweine die Todten nicht zu sehr!
234. Laß die Todten ruhen!
235. Liebe nach dem Tode.
236. Feindschaft nach dem Tode.
237. Versöhnung nach dem Tode.
238. Der Todte denkt an sein Versprechen.
239. Erlöste Geister.
240. Gebannte Geister.
241. Die wunderbare Schrift.
242. Die Leichenpredigt.
243. Die Geisterkirche.
244. Die andere Welt.
245. Der Nachtalp.
246. Die wandernde Seele.
247. Erzähle keinen Traum.
248. Das Gesicht der Magd.
249. Vorherverkündigung einer Theuerung.
250. Die Kartoffelnkrankheit wird aufhören.
251. Die Pestfrau.
252. Eine Prophezeihung trifft nicht ein.
253. Der kostbare Stein.
254. Die unverweste Leiche.
255. Zeichen der Unschuld.
256. Der bestrafte Thierquäler.
257. Der ewige Jude.
258. Jühnder Streiche.
259. Der Wald bei den falschen Gleichen.
260. Die weiße Jungfrau.
261. Schätze.
B. Märchen.
1. Die Prinzessin hinter dem rothen, weißen und schwarzen Meere.
2. Die drei Federn des Drachen.
3. Sausewind.
4. Die Rose.
5. Das klingende und singende Blatt.
6. Der Mistkäfer.
7. Der dumme Hans.
8. Die Ziege.
9. Die weiße Katze.
10. Die grüne Gans.
11. Goldhähnchen und Pechhähnchen.
12. Hänschen Glasköpfchen.
13. Die sieben Soldaten.
14. Die zertanzten Schuhe.
15. Die drei Hunde.
16. Der Besenbinderjunge.
17. Der Affe.
18. Das Schiff, das ohne Wind und Wasser fährt.
19. Kio.
20. Der Riesengarten.
21. Der Schatz des Riesen.
22. Der Riese und der Zwerg.
23. Verlefränzchen.
24. Das Zwergloch.
25. Das Räuberhaus.
26. Die Prinzessin mit dem Horne.
27. Der gelernte Dieb.
28. Der einfältige Bauer.
29. Der Zaunkönig.
30. Die Katzen und die Hunde.
31. Weshalb der Esel ein Kreuz auf dem Rücken hat.
32. A. Wer wird selig?
32. B. Petrus und der Heiland.
33. Weshalb die Pfarrer keine Perücken mehr tragen.
C. Anmerkungen.
I. Zu den Sagen.
II. Zu den Märchen.
D. Abhandlungen.
I. Zur Symbolik der deutschen Volkssage.
II. Die Fahrt in den Osten.
III. Zur Sage von dem wilden Jäger.
Abkürzungen.
Niedersächsische Sagen und Märchen, Georg Schambach
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849603168
www.jazzybee-verlag.de
Frontcover: © Sweet Angel - Fotolia.com
Geschichte des Märchens
Ein Märchenist diejenige Art der erzählenden Dichtung, in der sich die Überlebnisse des mythologischen Denkens in einer der Bewußtseinsstufe des Kindes angepaßten Form erhalten haben. Wenn die primitiven Vorstellungen des Dämonenglaubens und des Naturmythus einer gereiftern Anschauung haben weichen müssen, kann sich doch das menschliche Gemüt noch nicht ganz von ihnen trennen; der alte Glaube ist erloschen, aber er übt doch noch eine starke ästhetische Gefühlswirkung aus. Sie wird ausgekostet von dem erwachsenen Erzähler, der sich mit Bewußtsein in das Dunkel phantastischer Vorstellungen zurückversetzt und sich, vielfach anknüpfend an altüberlieferte Mythen, an launenhafter Übertreibung des Wunderbaren ergötzt. So ist das Volksmärchen (und dieses ist das echte und eigentliche M.) das Produkt einer bestimmten Bewußtseinsstufe, das sich anlehnt an den Mythus und von Erwachsenen für das Kindergemüt mit übertreibender Betonung des Wunderbaren gepflegt und fortgebildet wird. Es ist dabei, wie in seinem Ursprung, so in seiner Weiterbildung durchaus ein Erzeugnis des Gesamtbewußtseins und ist nicht auf einzelne Schöpfer zurückzuführen: das M. gehört dem großen Kreis einer Volksgemeinschaft an, pflanzt sich von Mund zu Munde fort, wandert auch von Volk zu Volk und erfährt dabei mannigfache Veränderungen; aber es entspringt niemals der individuellen Erfindungskraft eines Einzelnen. Dies ist dagegen der Fall bei dem Kunstmärchen, das sich aber auch zumeist eben wegen dieses Ursprungs sowohl in den konkreten Zügen der Darstellung als auch durch allerlei abstrakte Nebengedanken nicht vorteilhaft von dem Volksmärchen unterscheidet. Das Wort M. stammt von dem altdeutschen maere, das zuerst die gewöhnlichste Benennung für erzählende Poesien überhaupt war, während der Begriff unsers Märchens im Mittelalter gewöhnlich mit dem Ausdruck spel bezeichnet wurde. Als die Heimat der M. kann man den Orient ansehen; Volkscharakter und Lebensweise der Völker im Osten bringen es mit sich, daß das M. bei ihnen noch heute besonders gepflegt wird. Irrtümlich hat man lange gemeint, ins Abendland sei das M. erst durch die Kreuzzüge gelangt; vielmehr treffen wir Spuren von ihm im Okzident in weit früherer Zeit. Das klassische Altertum besaß, was sich bei dem mythologischen Ursprung des Märchens von selbst versteht, Anklänge an das M. in Hülle und Fülle, aber noch nicht das M. selbst als Kunstgattung. Dagegen taucht in der Zeit des Neuplatonismus, der als ein Übergang des antiken Bewußtseins zur Romantik bezeichnet werden kann, eine Dichtung des Altertums auf, die technisch ein M. genannt werden kann, die reizvolle Episode von »Amor und Psyche« in Apulejus' »Goldenem Esel«. Gleicherweise hat sich auch an die deutsche Heldensage frühzeitig das M. angeschlossen. Gesammelt begegnen uns M. am frühesten in den »Tredeci piacevoli notti« des Straparola (Vened. 1550), im »Pentamerone« des Giambattista Basile (gest. um 1637 in Neapel), in den »Gesta Romanorum« (Mitte des 14. Jahrh.) etc. In Frankreich beginnen die eigentlichen Märchensammlungen erst zu Ende des 17. Jahrh.; Perrault eröffnete sie mit den als echte Volksmärchen zu betrachtenden »Contes de ma mère l'Oye«; 1704 folgte Gallands gute Übersetzung von »Tausendundeiner Nacht« (s. d.), jener berühmten, in der Mitte des 16. Jahrh. im Orient zusammengestellten Sammlung arabischer M. Besondern Märchenreichtum haben England, Schottland und Irland aufzuweisen, vorzüglich die dortigen Nachkommen der keltischen Urbewohner. Die M. der skandinavischen Reiche zeigen nahe Verwandtschaft mit den deutschen. Reiche Fülle von M. findet sich bei den Slawen. In Deutschland treten Sammlungen von M. seit der Mitte des 18. Jahrh. auf. Die »Volksmärchen« von Musäus (1782) und Benedikte Naubert sind allerdings nur novellistisch und romantisch verarbeitete Volkssagen. Die erste wahrhaft bedeutende, in Darstellung und Fassung vollkommen echte Sammlung deutscher M. sind die »Kinder- und Hausmärchen« der Brüder Grimm (zuerst 1812–13, 2 Bde.; ein 3. Band, 1822, enthält literarische Nachweise bezüglich der M.). Unter den sonstigen deutschen Sammlungen steht der Grimmschen am nächsten die von L. Bechstein (zuerst 1845); außerdem sind als die bessern zu nennen: die von E. M. Arndt (1818), Löhr (1818), J. W. Wolf (1845 u. 1851), Zingerle (1852–54), E. Meier (1852), H. Pröhle (1853) u. a. Mit M. des Auslandes machten uns durch Übertragungen bekannt: die Brüder Grimm (Irland, 1826), Graf Mailath (Ungarn, 1825), Vogl (Slawonien, 1837), Schott (Walachei, 1845), Asbjörnson (Norwegen), Bade (Bretagne, 1847), Iken (Persien, 1847), Gaal (Ungarn, 1858), Schleicher (Litauen, 1857), Waldau (Böhmen, 1860), Hahn (Griechenland u. Albanien, 1863), Schneller (Welschtirol, 1867), Kreutzwald (Esthland, 1869), Wenzig (Westslawen, 1869), Knortz (Indianermärchen, 1870, 1879, 1887), Gonzenbach (Sizilien, 1870), Österley (Orient, 1873), Carmen Sylva (Rumänien, 1882), Leskien und Brugman (Litauen, 1882), Goldschmidt (Rußland, 1882), Veckenstedt (Litauen, 1883), Krauß (Südslawen, 1883–84), Brauns (Japan, 1884), Poestion (Island, 1884; Lappland, 1885), Schreck (Finnland, 1887), Chalatanz (Armenien, 1887), Jannsen (Esthen, 1888), Mitsotakis (Griechenland, 1889), Kallas (Esthen, 1900) u. a. Unter den Kunstpoeten haben sich im M. mit dem meisten Glück versucht: Goethe, L. Tieck, Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Fouqué, Kl. Brentano, der Däne Andersen, R. Leander (Volkmann) u. a. Vgl. Maaß, Das deutsche M. (Hamb. 1887); Pauls »Grundriß der germanischen Philologie«, 2. Bd., 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901); Benfey, Kleinere Schriften zu Märchenforschung (Berl. 1890); Reinh. Köhler, Aufsätze über M. und Volkslieder (das. 1894) und Kleine Schriften, Bd. 1: Zur Märchenforschung (hrsg. von Bolte, das. 1898); R. Petsch, Formelhafte Schlüsse im Volksmärchen (das. 1900).
Bibliographie der Sage
Eine Sage istim allgemeinen alles, was gesagt und von Mund zu Mund weiter erzählt wird, also soviel wie Gerücht; im engeren Sinn eine im Volke mündlich fortgepflanzte Erzählung von irgendeiner Begebenheit. Knüpft sich die S. an geschichtliche Personen und Handlungen, indem sie die im Volke fortlebenden Erinnerungen an geschichtliche Zustände, Persönlichkeiten, dunkel gewordene Taten zu vollständigen Erzählungen ausbildet, so entsteht die geschichtliche S. und, sofern sie sich auf die alten Helden des Volkes erstreckt, die Heldensage; sind aber die Götter mit ihren Zuständen, Handlungen und Erlebnissen Gegenstand der S., so entsteht die Göttersage oder der Mythus (s. Mythologie) und auf dem Gebiet monotheistischer dogmatischer Religion die Legende (s. d.). Hastet die Erzählung an bestimmten Örtlichkeiten, so spricht man von örtlichen Sagen. Noch eine Sagengattung bildet endlich die Tiersage, die von dem Leben und Treiben der Tiere, und zwar fast ausschließlich der ungezähmten, berichtet, die man sich mit Sprache und Denkkraft ausgerüstet vorstellt. Ost hat sich um eine besonders bevorzugte Persönlichkeit, wie z. B. König Artus, Dietrich von Bern, Attila, Karl d. Gr. etc., und deren Umgebung eine ganze Menge von Sagen gelagert, die nach Ursprung und Inhalt sehr verschieden sein können, aber doch unter sich in Zusammenhang stehen, und es bilden sich dadurch Sagenkreise, wie deren im Mittelalter in germanischen wie romanischen Ländern mehrere bestanden und zahlreiche Epen hervorgerufen haben (vgl. Heldensage). Die echte S. erscheint somit als aus dem Drang des dichterischen Volksgeistes entsprungen. Wie alle Volkspoesie blüht sie am prächtigsten in der älteren Zeit, aber auch bei höherer Kultur verstummt sie nicht ganz; vielmehr ist der Volksgeist noch heute tätig, bedeutende Vorgänge und Persönlichkeiten mit dem Schmuck der S. zu umkleiden. Die Anknüpfung an ein gewisses Wirkliches ist hauptsächlich das Merkmal, das die S. vom Märchen (s. d.) unterscheidet. Wie das Märchen, liebt sie das Wunderbare und Übernatürliche, obwohl es ihr nicht unentbehrlich ist. Am häufigsten heftet sie sich an Burg- und Klosterruinen, an Quellen, Seen, an Klüfte, an Kreuzwege etc., und zwar findet sich ein und dieselbe S. nicht selten an mehreren Orten wieder. Um die Erhaltung der deutschen S. haben sich zuerst die Brüder Grimm verdient gemacht durch ihre reiche Sammlung: »Deutsche Sagen« (Berl. 1816–18, 2 Bde.; 3. Aufl. 1891). Nächst diesen sind die Sammlungen von A. Kuhn und Schwartz (»Norddeutsche Sagen«, Leipz. 1848), J. W. Wolf (»Deutsche Märchen und Sagen«, das. 1845), Panzer (»Bayrische Sagen«, Münch. 1848, 2 Bde.), Grässe (»Sagenbuch des preußischen Staats«, Glogau 1871) und Klee (Gütersloh 1885) als besonders reichhaltige Quellen zu nennen. Als Sammler von Sagen einzelner Länder, Gegenden und Örtlichkeiten waren außerdem zahlreiche Forscher tätig, so für Mecklenburg: Studemund (1851), Niederhöffer (1857) und Bartsch (1879); für Pommern und Rügen: U. Jahn (2. Aufl. 1890), Haas (Rügen 1899, Usedom u. Wollin 1903); für Schleswig-Holst ein: Müllenhoff (1845); für Niedersachsen: Harrys (1840), Schambach und Müller (1855); für Hamburg: Beneke (1854); für Lübeck: Deecke (1852); für Oldenburg: Strackerjan (1868); für den Harz: Pröhle (2. Aufl. 1886); für Mansfeld: Giebel hausen (1850); für Westfalen: Kuhn (1859) und Krüger (1845), Weddigen und Hartmann (1884); für die Altmark: Temme (1839); für Brandenburg: Kuhn (1843) und W. Schwartz (4. Aufl. 1903); für Sachsen: Grässe (1874) und A. Meiche (1903); für das Vogtland: Köhler (1867) und Eifel (1871); für das Erzgebirge: J. A. Köhler (1886); für die Lausitz: Haupt (1862) und Gander (1894); für Thüringen: Bechstein (1835, 1898), Börner (Orlagau, 1838), Sommer (1846), Wucke (Werragegend, 1864), Witzschel (1866), Richter (1877); für Schlesien. Kern (1867), Philo vom Walde (1333); für Ostpreußen etc.: Tettau (183f) und Reusch (Samland, 1863); für Posen: Knoop (1894); für den Rhein: Simrock (9. Aufl. 1883), Geib (3. Aufl. 1858), Kiefer (4. Aufl. 1876), Kurs (1881), Schell (Bergische S., 1897), Hessel (1904); für Luxemburg: Steffen (1853) und Warker (1894); für die Eifel: P. Stolz (1888); für Franken etc.: Bechstein (1842), Janssen (1852), Heerlein (Spessart, 2. Aufl. 1885), Enslin (Frankfurt 1856), Kaufmann (Mainz 1853); für Hessen: Kant (1846), Wolf (1853), Lynker (1854), Bindewald (1873), Hessler (1889); für Bayern: Maßmann (1831), Schöppner (1851–1853), v. Leoprechting (Lechrain, 1855), Schönwerth (Oberpfalz, 1858), Sepp (1876), Haushofer (1890); für Schwaben: Meier (1852) und Birlinger (1861–1862), Reiser (Algäu, 1895); für Baden: Baader (1851), Schönhut (1861–65), Waibel und Flamm (1899); für das Elsaß: August St ob er (1852, 1895), Lawert (1861), Hertz (1872); für die Niederlande: Wolf (1843), Welters (1875–76); für Rumänien: Schuller (1857); für die Schweiz: Rochholz (1856), Lütolf (1862), Herzog (1871, 1882); für Tirol. Meyer (2. Aufl. 1884), Zingerle (1859), Schneller (1867), Gleirscher (1878), Heyl (1897); für Vorarlberg: Vonbun (1847 u. 1890); für Österreich: Bechstein (1846), Gebhart (1862), Dreisauff (1879), Leed (Niederösterreich, 1892); für Mähren: Schüller (1888); für Kärnten: Rappold (1887); für Steiermark: Krainz (1880), Schlossar (1881); für Böhmen: Grohmann (1863), Gradl (Egerland, 1893); für die Alpen: Vernaleken (1858), Alpenburg (1861) und Zillner (Untersberg, 1861); für Siebenbürgen: Müller (2. Aufl. 1885), Haltrich (1885). Die Sagen Islands sammelten Maurer (1860) und Poestion (1884), der Norweger: Asbjörnson (deutsch 1881), der Südslawen: Krauß (1884), der Litauer: Langkusch (1879) und Veckenstedt (1883), der Esten: Jannsen (1888), der Lappländer: Poestion (1885), der Russen: Goldschmidt (1882), der Armenier: Chalatianz (1887), die der Indianer Amerikas: Amara George (1856), Knortz (1871), Boas (1895); indische Sagen Beyer (1871), japanische Brauns (1884), altfranzösische A. v. Keller (2. Aufl. 1876); deutsche Pflanzensagen Perger (1864), die deutschen Kaisersagen Falkenstein (1847), Nebelsagen Laistner (1879) etc. Die Sagen bilden mit den im Volk umlaufenden Märchen, Legenden, Sprichwörtern etc. den Inhalt der Volkskunde (s. d.), die seit neuerer Zeit Gegenstand reger wissenschaftlicher Forschung ist. Vgl. L. Bechstein, Mythe, S., Märe und Fabel im Leben und Bewußtsein des deutschen Volkes (Leipz. 1854, 3 Tle.); J. Braun, Die Naturgeschichte der S. (Münch. 1864–65, 2 Bde.); Uhland, Schriften zur Geschichte und S., Bd. 1 u. 7 (Stuttg. 1865–68); Henne am Rhyn, Die deutsche Volkssage im Verhältnis zu den Mythen aller Völker (2. Aufl., Wien 1879); v. Bayder, Die deutsche Philologie im Grundriß (Paderb. 1883); Paul, Grundriß der germanischen Philologie, Bd. 2, 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901) und die Bibliographie in der »Zeitschrift des Vereins für Volkskunde«; Grünbaum, Gesammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagenkunde (Berl. 1901).
Aus dem Munde des Volkes gesammelt und mit Anmerkungen und Abhandlungen herausgegeben
Vorrede.
Bei dem regen Eifer, mit welchem man jetzt bei uns alles sammelt, was in Sage und Sitte von dem Denken und Leben des deutschen Volkes Zeugnis ablegt, ehe es vor der sich immer weiter verbreitenden neuern Bildung ganz zurückweicht, bedürfen diese niedersächsischen Sagen und Märchen keiner besondern Rechtfertigung vor dem wissenschaftlichen Publikum. Jeder wird gern zugeben, daß Niedersachsen bei dem allgemeinen Werke um so weniger zurückbleiben darf, da der Sammler hier, wo das Heidenthum länger bestand, als in andern deutschen Ländern, wo sich meistens noch eine verhältnismäßig wenig gemischte Bevölkerung erhalten hat, auf eine besonders ergiebige Ausbeute rechnen kann. Zwar ist Norddeutschland im allgemeinen bereits durch mehrere sehr verdienstliche Sagensammlungen, wie die von Kuhn und Schwartz, Müllenhoff und anderen, vertreten, aber sie betreffen entweder ganz oder doch zum grösten Theile andere Gegenden, als unser Werk, und die Volkssagen Niedersachsens, welche Harrys herausgegeben hat, enthalten von dem noch vorhandenen Vorrathe nur einen sehr geringen Theil. So wird denn unser Buch hoffentlich nicht unerwünscht kommen.
Es war unsere Absicht und ist es auch noch, wo möglich, die Sagen Niedersachsens in einer gewissen Vollständigkeit herauszugeben. Da aber dieses Unternehmen nicht nur eine geraume Zeit, sondern auch einen Beistand erfordert, wie er uns noch nicht zu Theil geworden ist, so mag das, was wir bis jetzt zusammengebracht haben, vorläufig als ein selbständiges Werk erscheinen, und es muß von dem Erfolge unserer fortgesetzten Sammlungen abhängig gemacht werden, ob wir später noch einen zweiten und einen dritten Theil hinzufügen werden. Das Werk, so wie es vorliegt, enthält nur solche Sagen und Märchen, die wir selbst aus mündlicher Ueberlieferung geschöpft haben oder die uns nach Erzählungen des Volkes schriftlich mitgetheilt wurden. Alles, was wir nur aus gedruckten Quellen kannten, haben wir grundsätzlich ausgeschlossen. So kann denn unser Buch ein Bild von dem geben, was in einer abgegrenzten Gegend von Volksüberlieferungen noch lebt oder wenigstens durch lange fortgesetztes Sammeln und Aufmerken zu Tage kommt. Daß bei Werken dieser Art eine Vollständigkeit in jeder Hinsicht nicht erreicht werden kann, ist eine bekannte Sache.
Das Gebiet, auf dem wir gesammelt haben, umfaßt vorzugsweise die beiden Fürstenthümer Göttingen und Grubenhagen nebst den im Norden daran stoßenden braunschweigischen Aemtern, dann die am rechten Weserufer liegenden hessischen Dörfer und einen Theil des Fürstenthumes Hildesheim. Die hildesheimischen Sagen verdanken wir gröstentheils der freundlichen Mittheilung des Hrn. Dr. Seifart in Göttingen, der demnächst auch eine eigene Sammlung derselben herausgeben wird. Anfangs gedachten wir noch die Sagen des uns nahe liegenden Harzes mit aufzunehmen, standen aber von diesem Entschlusse ab, als wir hörten, daß Pröhle ein besonderes Werk darüber zu veröffentlichen beabsichtige, das jetzt bereits erschienen ist. Herr Pröhle war so freundlich uns mehrere Sagen zuzusenden, die in unser Gebiet gehörten, während wir ihm dagegen einige für sein Werk passende Beiträge lieferten. Unter denen, welchen wir sonst Beiträge zu unserm Werke zu verdanken haben, nimmt ein ehemaliger Schüler Schambachs, August Beyer aus Wulften, die erste Stelle ein. Von ihm rühren, bis auf zwei oder drei, die sämmtlichen Sagen aus Wulften her. Die Sagen aus Förste verdanken wir dem Lehrer Wedemeyer in Einbeck, die aus Schwiegershausen dem Lehrer Cordes. Ihnen, so wie allen andern, die uns mit freundlicher Bereitwilligkeit bei unserm Werke unterstützt haben, statten wir hier gern unsern herzlichsten Dank ab.
Das Verdienst bei weitem die meisten der unmittelbar aus dem Munde des Volkes geschöpften Stücke gesammelt zu haben, gebührt Schambach. Er durchwanderte unermüdet besonders die beiden Fürstenthümer nach den verschiedensten Richtungen und es gelang ihm bei seiner genauen Kenntnis der Oertlichkeiten und des niedersächsischen Dialektes, von welchem er ein Wörterbuch herauszugeben beabsichtigt, manches zu erfahren, was sonst nicht an das Licht gekommen wäre, weil das Volk mit seinen Mittheilungen aus verschiedenen Gründen, namentlich aus Mistrauen und den seltsamsten Bedenklichkeiten sehr zurückhaltend zu sein pflegt. So wurde eine bejahrte Frau ohne allen Erfolg um Sagen befragt; später äußerte sie gegen andere, sie wisse allerdings recht viel, wolle sich aber wohl hüten es zu erzählen, weil sie keine Lust habe vor das Schwurgericht in Göttingen gestellt zu werden. Noch merkwürdiger ist die Besorgnis, welche eine alte Frau in Einbeck hegte. Sie hatte mehrere Sagen bereitwillig mitgetheilt, empfand aber später darüber Gewissensbisse und glaubte ihre Seligkeit gefährdet; eine Krankheit, welche sie betroffen hatte, ward von ihr als die dadurch verursachte Strafe des Himmels angesehen, und jeder Versuch sie wieder zum Erzählen zu bringen war vergeblich. Während ihrem Bedenken wohl eine geheime Scheu zum Grunde lag, die alten lieben Ueberlieferungen durch Mittheilung zu entweihen, weisen andere die Erkundigungen nach Volkssagen deshalb zurück, weil sie in Folge der neuern Aufklärung mit dem Glauben auch das Interesse daran verloren haben und sie verachten. Manche fühlen sich selbst beleidigt, wenn man etwas von ihnen zu erfahren wünscht, und schneiden wohl alle weiteren Fragen mit dem Bemerken ab, daß sie ja in der Schule gewesen seien. Ein Frauenzimmer erwiderte auf die Anfragen, die über den Nachtraben an sie gerichtet wurden, höhnisch: »glaubt der Herr, daß ich aus dem dummen Lande bin?« Wo der Glaube an die Volksüberlieferungen noch einigermaßen lebendig ist, da ist die Bereitwilligkeit sie zu erzählen noch größer. Darum lieferte die Umgegend von Einbeck, besonders die Ortschaften des Sollinger Waldes, eine ergiebige Ausbeute, und das Volk war hier leichter zum Erzählen zu bringen, als in der Gegend von Göttingen. Der Zweifel an der Wahrheit der Sage greift aber immer weiter um sich, und es wird jetzt schon von den einfachsten Leuten manches für unwahr gehalten, was vor funfzig Jahren im Glauben ganz fest stand, während man dagegen anderes noch nicht als unbegründet zu verwerfen wagt. So erklärte eine Frau aus Edemissen die Sagen von den feurigen Männern für »dummes Zeug«, hielt aber das Vorhandensein des gespenstischen Hundes, der Nachts den Leuten auf den Rücken springt, für ganz ausgemacht. Während man Aeußerungen, wie die, daß es jetzt keine Hexen mehr gebe, daß die meisten Gespenster von dem alten Fritz oder auch von der westphälischen Regierung »abgethan« sein, mehrfach zu hören Gelegenheit hat, haftet in unsern Gegenden der Glaube an Hackelberg noch fest in dem Gemüthe des Volkes; von ihm sprechen viele nur mit dem grösten Ernste, viele wollen ihn, wenn auch nicht gesehen, doch gehört haben. Mit dem abnehmenden Glauben an die Sagen werden diese selbst sich immer mehr verlieren. Alte Leute aus dem Volke erklärten, daß das jüngere Geschlecht wenig oder nichts mehr wisse, und daß in dreißig Jahren von Sagen nur noch wenig übrig sein werde. Namentlich sind, darauf kommen viele Nachrichten hinaus, die Märchenerzählerinnen fast ganz ausgestorben. Wer Märchen kennt, weiß in der Regel nur noch Trümmer davon, welche aufzuzeichnen kaum der Mühe werth ist.
Die Sichtung und Anordnung des gesammelten Vorrathes übernahm Müller. Es sind dabei manche Stücke, die zu unbedeutend waren, zur Seite gelegt; dagegen schien es unbedenklich, diejenigen, welche irgend Bedeutung haben, nach der uns mitgetheilten Ueberlieferung aufzunehmen, auch wenn sie schon früher gedruckt waren. Der Sagenforscher, der diese bereits aus andern Werken kennt, wird von seinem Standpunkte aus unser Verfahren vielleicht nicht billigen; er wird es aber doch gerechtfertigt finden, wenn er bedenkt, daß unser Werk zugleich einen landschaftlichen Charakter haben soll. Auch werden die Formen der Sagen, die wir gehört haben, selten oder nie ganz mit den bereits gedruckten Mittheilungen stimmen. Nur mehrere uns zugegangene, aber aus der Sammlung der Brüder Grimm sehr bekannte und damit ganz übereinstimmende Märchen sind weggelassen. Einige Erzählungen sind uns mitgetheilt, die keinen echt volksmäßigen Ursprung haben. Namentlich hat die Halbgelehrsamkeit in älterer und neuerer Zeit hie und da Sagen hervorgebracht, welche auch wohl in das Volk dringen, sich aber doch in der Regel bald durch ihren Ton und ihren Inhalt von echten Ueberlieferungen unterscheiden lassen. Solche Stücke sind in unsere Sammlung gar nicht aufgenommen, oder es ist, wenn wir sie berücksichtigt haben, auf ihren apokryphen Ursprung hingewiesen. Eben so ist verfahren, wo sich moderne Zusätze und Erklärungsversuche in die echte Ueberlieferung eingeschlichen hatten. Der in dem Sagenkreise einer Landschaft heimisch gewordene Sammler weiß dergleichen Auswüchse und Entstellungen wohl zu erkennen. Uebrigens haben wir alles getreu nach der Ueberlieferung mitgetheilt, mehrfach auch durch Anführungszeichen angedeutet, daß wir die eigensten Ausdrücke des Volksmundes gebrauchen, oder den hochdeutschen Worten die niederdeutschen hinzugefügt.
Die Anordnung der Sagen folgt, wie der Leser selbst finden wird, vorzugsweise der Verwandtschaft ihres Inhaltes. Wenn diese Folge auch demjenigen, der mehr auf Unterhaltung, als auf Belehrung ausgeht, nicht den bunten Wechsel bietet, den eine geographische Anordnung gewähren würde, so wird doch dadurch die Benutzung des Werkes für die Wissenschaft sehr erleichtert und es werden Wiederholungen derselben oder ganz ähnlicher Sagen vermieden. Doch haben wir keine ängstliche Systematik erstrebt, die wieder andere Nachtheile mit sich bringt. Da insbesondere mehrere mythische Gestalten der deutschen Volkssage noch nicht hinlänglich klar sind, so würde es in vielen Fällen voreilig sein, ihnen als fraglichen Göttern oder Halbgöttern eine genau bestimmte Stelle anzuweisen.
Auch die Anmerkungen und Abhandlungen sind von Müller ausgearbeitet; zu den erstern hat jedoch auch Schambach manches Material geliefert. Sie geben die nöthigen Nachweise über unsere Quellen und über abweichende Formen, die uns außerdem mitgetheilt oder in andern Werken bekannt gemacht sind; auch vergleichen sie ganz oder theilweise entsprechende Sagen aus andern Gegenden. Für die literärischen Nachweise (und dieser Theil der Arbeit fiel wieder vorzugsweise Müller zu) sind die wichtigsten neuern Sagenwerke benutzt, von denen der Anhang ein Verzeichnis gibt. Besondere Aufmerksamkeit haben wir aber der Erklärung der Sagen mit Hülfe der Geschichte und der Mythologie gewidmet, je nachdem sie mehr in das eine oder in das andere Gebiet gehören.
Der historische Gewinn, der sich aus der noch jetzt lebenden deutschen Volkssage ergibt, darf freilich an und für sich nicht hoch angeschlagen werden. Die Sage wird uns in der Regel keine Einzelheiten lehren, die wir nicht durch unsere glaubwürdigen Geschichtswerke besser wüsten. Was sich von historischen Erinnerungen in unserm Volke erhalten hat, trägt in der Regel den Charakter der Specialgeschichte und knüpft sich an einzelne Oertlichkeiten. Begebenheiten von einem weit reichenden Einflusse werden nur ganz im allgemeinen behalten und die verschiedenen Zeiten nur roh gesondert. Die letzten Kriege mit Frankreich, der siebenjährige und der dreißigjährige Krieg sind noch im Andenken des Volkes geblieben; was dazwischen liegt, ist vergessen. Aus der frühern Vergangenheit unterscheidet es noch das Mittelalter, welches als die Zeit der Raubritter oder die Zeit, in welcher das Pulver noch nicht erfunden war, bezeichnet wird, und die uralte heidnische Zeit. Zwar werden auch wohl einmal die Zeiten Karls des Großen und der Bekehrung zum Christenthume erwähnt, aber hier wird man in den meisten Fällen schon einen Einfluß der Gelehrsamkeit annehmen dürfen. Länger können in der Erinnerung des Volkes ausgezeichnete Persönlichkeiten unter seinen Königen und Fürsten haften. Dann werden sie aber gewöhnlich mit einer Oertlichkeit in Verbindung gebracht, die vielleicht nur in ihrem Namen an sie erinnert, wie z.B. nur deshalb Heinrich der Vogelsteller noch in der Sage von Vogelbeck lebt, oder es hat sich, wie die in unserer zweiten Abhandlung besprochene Sage von Heinrich dem Löwen zeigt, die Poesie und der Mythus mit der geschichtlichen Erinnerung verbunden und sie dem Gemüthe tiefer eingeprägt. An die Zeiten und die Personen, die in der Erinnerung noch fortleben, heftet nun das Volk seine speciellen Orts- und Familiengeschichten, besonders Erzählungen von Gründungen und Zerstörungen von Städten, Burgen, Kirchen und andern Bauwerken, Erwerbungen von Grundstücken, oder Geschichten, durch welche bestehende Sitten und Einrichtungen erklärt werden. Der historische Kern solcher Sagen ist in der Regel äußerst gering. Man wird höchstens nur das einfache Faktum als beglaubigt ansehen dürfen; die Zeit, in welche es versetzt wird, die Umstände, unter denen es vor sich ging, die Personen, die dabei thätig waren, werden sich häufig als nicht dahin gehörig und andern Erinnerungen entnommen, oder als ganz unhistorisch erweisen. Selbst die nackte Thatsache ist noch nicht immer als begründet anzunehmen. So heißt es z.B. häufig im Volke von einer Burg, daß sie im dreißigjährigen Kriege zerstört sei, wenn es auch fest steht, daß sie gar nicht zerstört, sondern nur allmählich verfallen ist. Daß auf alle Sagen, bei welchen die Volksetymologie in irgend einer Weise thätig gewesen ist, kein Gewicht gelegt werden darf, ist bereits anerkannt. Diese zeigen gewöhnlich auch eine gewisse Dürftigkeit. Aber selbst dann, wenn die genauesten Einzelheiten lebendig und anschaulich berichtet werden, wird die Glaubwürdigkeit der Sage nicht vermehrt, im Gegentheil zeigt sich dann besonders bei näherer Betrachtung eine Einwirkung der Dichtung oder des mythischen Denkens. Auch dann kann gewöhnlich nur das einfachste Faktum als historisch betrachtet werden. So erzählt N. 43 unserer Sagen ausführlich und lebendig, wie das Amt Radolfshausen an Hannover kam. Wäre uns dieses Ereignis sonst nicht bekannt, so würden wir nach der Sage nur annehmen dürfen, daß dieses Amt in Folge eines Todesfalles von Hannover erworben wurde, und man würde höchstens nur aus den Umständen, daß der Besitzer von Radolfshausen – eine mythische Personification – als Bruder des Grafen von Plesse erscheint, noch schließen dürfen, daß Radolfshausen einst zur Herschaft Plesse gehörte. – So gering also der Gewinn ist, den die Sagen als Geschichtsquellen für einzelne Begebenheiten betrachtet abwerfen, so wenig dürfen sie doch aus andern Gründen von dem Historiker verachtet werden. Die Betrachtung der Sagenbildung und ihre Vergleichung mit der wirklichen Geschichte kann ihn lehren, wie er die Volksüberlieferung, da wo sie die einzige Quelle ist, zu benutzen hat, und kann ihn namentlich vor dem Fehler bewahren, das was der Mythologie angehört, als wirkliche Geschichte aufzufassen. Dann gibt uns die Sage darüber Auskunft, wie der Geist des Volkes die Vorzeit auffaßt und behält, und das ist für die Culturgeschichte in vielen Fällen sehr wichtig. Damit dieses Verhältnis der Sage zu der wirklichen Geschichte immer deutlicher werde, hat der Sagensammler die Aufgabe, wo es möglich ist, beide mit einander zu vergleichen, wie wir es in den meisten Fällen in den Anmerkungen gethan haben.
Bedeutender ist der Gewinn, den die Mythologie aus der deutschen Sage schöpft. Ihre Wichtigkeit in dieser Hinsicht ist so anerkannt, daß wir darüber nicht ausführlich zu sprechen brauchen; doch dürfen wir einige Bemerkungen über die Art und Weise ihrer Benutzung hier nicht übergehn.
Mit der von J. Grimm begründeten und von andern noch weiter ausgedehnten Behandlung deutscher Volkssagen als Quellen der deutschen Mythologie können wir in vielen Punkten jetzt noch weniger einverstanden sein, als früher. Zunächst scheint uns die Meinung, nach welcher die noch jetzt lebenden Volkssagen mehrfach Ueberbleibsel eddischer Mythen enthalten, weder durch den bisherigen Erfolg, noch auch grundsätzlich gerechtfertigt. Bis jetzt haben wir bei aller angewandten Mühe aus der noch lebenden deutschen Sage nur zwei Götternamen kennen gelernt, die mit den nordischen stimmen, Wuotan und Frigg. Aber der Wuotan des deutschen Volkes, der als wilder Jäger durch die Luft zieht, erinnert an den eddischen Odhinn in nichts als in einigen uralten Symbolen, die dem deutschen und skandinavischen Glauben gemeinsam waren, in dem Mantel, von dem Hackelbernd den Namen hat, und vielleicht in dem Nachtraben, der ihm voran fliegt. Alle andern Versuche, die man bisher angestellt hat, deutsche Volkssagen auf eddische Mythen zurückzuführen, sind entweder geradezu falsch, oder doch in einem höchsten Grade unsicher. Sie hätten nur dann gelingen können, wenn angenommen werden dürfte, daß die Edden nicht nur die nordische Mythologie vollständig enthielten, sondern auch in ihren Einzelzügen mit dem heidnischen Glauben der andern deutschen Stämme übereinstimmten, was keinesweges der Fall ist. In den Edden sind vorzugsweise solche Mythen erhalten, die von den nordischen Dichtern behandelt und individuell ausgebildet wurden; eine vollständige Darstellung des nordischen Götterglaubens geben sie eben so wenig, wie die homerischen Gedichte die ganze griechische Mythologie umfassen. Auch sehen wir schon aus Saxo Grammatikus, eine wie reiche Fülle von Sagen und Mythen der Norden besaß, die sich nicht auf den Inhalt der Edden zurückführen lassen; in einem noch höheren Maße müssen wegen der Verschiedenheit der Stämme die deutschen Mythen, von deren Reichthum wir uns nach der noch jetzt vorhandenen Menge der verschiedensten Traditionen eine Vorstellung machen können, von den Edden abgewichen sein, wenn auch einige religiöse Grundanschauungen den Skandinaviern und den Deutschen gemeinsam waren.
Nur in einem Falle ist es nach unserer Ansicht erlaubt, eddische Göttermythen mit ihren individuellen Einzelzügen in deutschen Volkssagen aufzuführen: wenn diese erweislich Nachklänge älterer deutscher Gedichte sind. So wie einzelne spätere nordische Gedichte, z.B. das dänische Lied vom Hammerraub, eddische Mythen bewahrt haben, so waren auch in älterer Zeit mehrere mythische Stoffe der skandinavischen und der deutschen Dichtung gemeinsam, wie schon durch die nordischen und deutschen Sagen von den Nibelungen und dem Schmiede Wieland bewiesen wird. So haben wir in unserer zweiten Abhandlung aus mehreren ältern deutschen Gedichten, die zum Theil unserer Heldensage im engeren Sinne angehören, einen Wuotansmythus nachgewiesen, wovon spätere Volkssagen noch Nachklänge enthalten. Doch ist der Mythus, den wir dort in den verschiedensten Verzweigungen verfolgt haben, in den Edden nur kurz und dunkel angedeutet; wir lernen ihn vorzugsweise durch Saxo und durch die deutschen Quellen kennen.
Ueber den geringen Erfolg jener Vergleichung der Edden mit der deutschen Volkssage konnte man sich nur durch eine andere gleichfalls wenig begründete Annahme täuschen. Man meint, daß die deutsche Volkssage der Hauptsache nach nur aus zerstreuten und entarteten Ueberbleibseln von mythischen Vorstellungen bestehe, die früher eine reinere Form hatten und in dieser den eddischen Mythen näher standen oder mit ihnen identisch waren. Nun läugnen wir zwar nicht, daß die Ueberlieferungen unsers Volkes in einigen Punkten besonders durch die Einführung des Christenthums verändert sind, erkennen aber jene in den verschiedensten Fällen ohne weitere Begründung angenommenen Entstellungen in diesem Maße nicht an. Wir wissen ja, daß alle volksmäßigen, namentlich die mythischen Ueberlieferungen sich mit einer großen Zähigkeit erhalten, und daß die Sage, so lange sie besteht, ein organisches Leben hat, weshalb ihre Veränderungen eben so wohl bestimmten Gesetzen unterliegen, als die Umwandlungen der Sprache. So lange uns also nicht bestimmte Gesetze aufgedeckt werden, nach denen eine Sage ihre vermuthete reinere Form in die vorliegende angeblich getrübte umgewandelt hat, so lange sind wir berechtigt die Annahme der Entstellung zurückzuweisen, die Ursprünglichkeit der vorliegenden Form zu vertheidigen und zu behaupten, daß sie schon in den ältesten Zeiten wesentlich in keiner andern Weise bestand, als jetzt. Ein Beispiel mag die Sache näher erläutern. Herr J.W. Wolf hat in seiner Zeitschrift für deutsche Mythologie (1, 70) in einer Tiroler Sage, nach welcher das Nachtvolk eine Kuh schlachtete und verzehrte, nachher die Knochen derselben zusammenlas und das Thier wieder lebendig machte, den bekannten Mythus von Thors Böcken zu finden geglaubt, die verspeist und von dem Gotte wieder ins Leben gerufen wurden. Wollten wir hier auch zugeben, was noch nicht einmal bewiesen werden kann, daß die Sage aus den Böcken eine Kuh machte, so müste vor allen Dingen doch gezeigt werden, warum in dieser Geschichte das Nachtvolk statt des Gottes auftritt. So lange das nicht geschieht, werden wir die angenommene ursprüngliche Identität beider Sagen zurückweisen und behaupten, daß man schon in alter Zeit, unabhängig von der nordischen Ueberlieferung, in Tirol von dem Nachtvolke eine ähnliche Geschichte erzählte, wie sie die Edden von Thorr berichten.
Es ist hier nicht der Ort, die vielen einzelnen Misgriffe, die man bei der Vergleichung deutscher Volkssagen und eddischer Mythen gemacht hat, weiter zu verfolgen; wir müssen nur noch unsere Verwunderung darüber aussprechen, daß man bei dieser Weise ganz äußerlich verfuhr. Man verglich mehrfach die heterogensten Sagen, historische und mythische, entschieden christliche und heidnische, Göttersagen und Thiermärchen, mit einander, weil sie in einzelnen Zügen, vielleicht nur in einem überein kamen, kümmerte sich aber um die Erläuterung ihres symbolischen oder sonstigen Inhaltes wenig oder gar nicht. Doch kann man zwei Sagen erst dann vergleichen, und die eine aus der andern herleiten, wenn man jede für sich verstanden und gedeutet hat.
Wir sehen es dagegen als die nächste Aufgabe einer wissenschaftlichen deutschen Mythologie an, die vielen symbolischen Züge, welche unsere Volkssagen und Märchen enthalten, uns verständlich zu machen. So lange das nicht geschieht, bleibt nicht allein jede Vergleichung übereinstimmender einzelner Züge in mehreren Sagen unsicher, sondern man verkennt auch, daß erst durch die Erklärung des Symbolischen die Mythologie ihren Zweck erfüllt. Denn es ist weniger der Inhalt der mythischen Volkssagen an und für sich, der uns anzieht, als vielmehr die Form, in welcher das Volk seine Gedanken ausspricht. Bei diesem Bestreben ist auch eine Vergleichung mehrerer Sagen nöthig, zunächst solcher, die auf demselben Boden entsprossen sind, dann die Vergleichung deutscher Volkssagen mit nordischen, denen sie aus mehreren Gründen näher stehn, als den Edden. Auch die Mythen, die diese enthalten, sollen berücksichtigt werden, wie selbst die Mythen anderer Völker; aber nicht um die einen aus den andern herzuleiten, um in den deutschen Volkssagen die Spuren nordischer und selbst indischer Mythen nachzuweisen, sondern zunächst nur um die Formen, in welche der Volksgeist seine Anschauungen gekleidet hat, zu verstehn. Der Umstand, daß der Zusammenhang unsers Sagenschatzes mit dem ehemaligen deutschen Göttersysteme so gut wie ganz unbekannt ist, macht diese Aufgabe freilich zu einer besonders schwierigen, jedoch muß der Versuch gemacht werden, die Mythologie der deutschen Volkssage in dieser Weise auf ihre eigenen Füße zu stellen. Die Erläuterung der Symbole unserer Sagen wird uns eine Reihe von Vorstellungen erkennen lassen, die in mancher Beziehung einfacher und roher ausgedrückt sind, als die eddischen Mythen, aber nichts desto weniger, oder vielmehr eben deshalb, wie das bereits Schwartz in seiner sinnigen und noch nicht hinlänglich gewürdigten Abhandlung (Der heutige Volksglaube und das alte Heidenthum) ausgesprochen hat, so wie sie vorliegen, in das fernste Alterthum reichen.
In diesem Sinne sind unsere Anmerkungen, so weit sie sich auf Mythisches erstrecken, abgefaßt; denselben Zweck verfolgen auch die drei hinzugefügten mythologischen Abhandlungen, von welchen die zweite auch für unsere Literaturgeschichte, namentlich die Ausdehnung und Bedeutung der deutschen Heldensage, nicht ohne Interesse sein wird. Nach dem Obigen befinden wir uns dabei mehrfach in einem Gegensatze gegen herschende Vorstellungen, hoffen aber, daß man uns dasselbe Recht widerfahren läßt, welches wir jedem gern zugestehen, der seine Ansichten wissenschaftlich begründet. An die Aussprüche incompetenter Beurtheiler werden wir uns nicht kehren. Obgleich auf dem Gebiete der Mythologie oft genug willkürliche Phantasieen zum Vorschein gekommen sind, so ist sie doch eine Wissenschaft, die ihre Methode und ihre Gesetze hat, und diese müssen hier eben sowohl erlernt werden, wie bei jeder andern. Wer nun nicht gezeigt hat, daß er diese Wissenschaft inne hat, und sich doch, wie Gervinus, ein Urtheil über mythologische Werke erlaubt, das nur ihre Resultate verwirft, ohne die Methode zu widerlegen, der wird uns nicht verdenken, daß wir auf sein Urtheil gar kein Gewicht legen.
Schließlich richten wir an alle diejenigen, welche im Stande sind, uns bei der beabsichtigten Fortsetzung unsers Werkes zu unterstützen, die Bitte, uns alles, was unserm Zwecke förderlich sein kann, freundlichst zusenden zu wollen. Wir werden jeden Beitrag von Sagen, Märchen, auch Aberglauben, mag er den Zusendern selbst auch vielleicht unbedeutend erscheinen, mit dem herzlichsten Danke annehmen und gewissenhaft benutzen.
Göttingen, im August 1854.
W. Müller.
A. Sagen.
1. Die Bramburg.
Auf der etwa drittehalb Stunden von Münden entfernten Bramburg wohnte vor Zeiten ein Herr von Stockhausen, der als Raubritter in der ganzen Gegend gefürchtet war. Um die auf der Weser an der Burg vorüberfahrenden Schiffe leichter anhalten und ausplündern zu können, hatte er unter dem Wasser des Stromes her eine Kette ziehen lassen, woran eine Klingel befestigt war, die durch ihren Ton den Leuten in der Burg von dem vorüberfahrenden Schiffe selbst bei Nacht Kunde gab. Nun begab es sich, daß von Münden aus, wo damals der Herzog residirte, eine Prinzessin eine Wallfahrt nach Corvei unternehmen wollte und zu diesem Zwecke die Weser hinunterfuhr. Der Ritter erhielt von ihrer Fahrt Kunde und beraubte sie. Darüber ergrimmte der Herzog, sammelte Truppen und belagerte die Burg; doch diese ward tapfer vertheidigt und er verlor viele Leute. Dadurch noch mehr erbittert, schwur er, es solle kein männliches Wesen lebendig aus der Burg kommen. Zuletzt konnte sich die Besatzung nicht länger halten und mußte sich ergeben. Die Burgfrau bat um Gnade und es ward ihr gewährt mit dem frei abzuziehen, was sie in ihrer Schürze forttragen könnte, und sich am Fuße des Berges (?) wieder ein Haus zu bauen, das aber nicht mit einer Mauer, sondern nur mit einem hâgen (einer Hecke) umgeben sein dürfe. Da nahm sie ihr einziges Söhnlein in die Schürze und zog damit aus der Burg ab. Als sie an dem Herzoge vorüber ging, schlug dieser ihr die Schürze zurück, um zu sehen was sie mitgenommen habe. Wie er den kleinen Knaben erblickte, ward er tief gerührt und fing an zu weinen. Darauf schenkte er auch dem Ritter das Leben, hielt ihn aber in Münden gefangen. Die Burgfrau mit ihrem Sohne baute sich nun einen Hof und umgab diesen mit einem Hagen. Als der Bau fertig war, sagte sie: »dat sal mek en lêwe [leiwe] hâgen sîn.« Daher hat das Dorf Lêwenhâgen, jetzt gewöhnlich Löwenhagen geschrieben, seinen Namen erhalten.
Eine andere Ueberlieferung berichtet:
Herzog Erich reiste zu Schiffe von Münden nach Hameln. Als er vor der Burg vorüber fuhr, wurde von da aus mit Bolzen auf das Schiff geschossen; einer dieser Bolzen traf den Herzog selbst, prallte aber von einem der großen Knöpfe, mit dem sein Wamms besetzt war, ab ohne ihn zu verletzen. Er zog später vor die Burg und schwur: alles was männlich in der Burg sei, solle sterben. Er nahm die Burg ein und ließ alles, was er darin fand tödten; nur die Burgfrau erhielt mit ihrem Söhnlein freien Abzug und die Erlaubniß sich anzubauen: nur dürfe der neue Bau nicht mit einer Mauer, sondern nur mit einem Hagen umgeben werden. Wo jetzt Löwenhagen liegt, baute sie sich an und sprach dabei die Worte: »dat sal mî en leiwe hâgen sîn.«
2. Der Sensenstein und der Sichelstein.
Die beiden Burgen Sensenstein (hessisch) und Sichelstein haben durch einen Draht miteinander in Verbindung gestanden, wodurch sich die Raubritter, welche auf beiden hausten, ein Zeichen gaben, wenn es galt einen Ueberfall auszuführen oder sich gegenseitig zu Hülfe zu kommen.
3. Der Brackenberg.
Auf der Burg Brackenberg, von welcher jetzt nur noch geringe Mauerreste zu sehen sind, wohnten früher die Herren von Riedesel. Diese waren Raubritter und beraubten regelmäßig die Schiffe, welche mit Gütern von Eschwege und Wanfried auf der Werra hinunter nach Münden fuhren, da sie dieselben von der Burg aus schon in der Ferne erblicken konnten. Um ihren Räubereien ein Ende zu machen, schickte der Herzog Erich von Münden aus Truppen gegen die Burg, doch der Hauptmann derselben ward von denen auf der Burg mit einem Doppelhaken erschossen. An der Stelle, wo der Hauptmann fiel und begraben ward, steht ein Denkstein, etwa 1000 Schritte nördlich von der Burg. Jetzt zog der Herzog selbst vor die Burg, nahm sie ein und zerstörte sie.
4. Die Gleichen.
1.
Die Ritter, welche auf den Gleichen wohnten, sind Raubritter gewesen; die auf Burg Teistungen bei Heiligenstadt waren es ebenfalls und standen mit ihnen im Bunde. Wollten sie nun gemeinschaftlich etwas unternehmen, oder drohte einem von ihnen Gefahr, so gaben sie sich mit einer ausgesteckten Laterne ein Zeichen. – Auch mit den Herren der alten Burg Niedeck hatten die Ritter auf den Gleichen ein Bündniß geschlossen, und für diese war ebenfalls die an einem Thurme ausgehängte Laterne das verabredete Zeichen, daß jene ihnen zu Hülfe kommen sollten.
2.
Auf den beiden Gleichen haben einmal zwei feindliche Brüder gelebt, die stets mit einander in Fehde lagen. Auf dem Platze unter den Gleichen, welcher Kriegplatz oder Kriegholz heißt und jetzt den Reinhäusern gehört, haben sie mit einander gekämpft. Wollte der eine Bruder seinen Freund auf der Niedeck besuchen, so ließ er seinem Pferde die Hufeisen verkehrt unterschlagen, damit der andere nicht wissen sollte, ob er weggeritten oder wieder zu Hause gekommen sei. Einst wollte der Ritter, welcher auf der nach Gelliehausen hin gelegenen Burg wohnte, ausreiten; weil er aber etwas vergessen hatte, kehrte er wieder um es zu holen. Sein Bruder, der ihn bemerkt hatte, stand schon auf der Lauer und schoß nach ihm mit einer Pistole, traf ihn aber nicht. Zuletzt forderten sich die Brüder zu einem Zweikampfe heraus. Zu dem Ende stellte sich jeder in das Thor seiner Burg und beide schossen gleichzeitig auf einander. Beide wurden getroffen und blieben todt auf dem Platze.
3.
In der Vertiefung (senke) zwischen den beiden Gleichen ist ein Brunnen, der mit der Garte in Verbindung stehen soll. Eine Ente, welche man hinein gesetzt hatte, kam, wie erzählt wird, ganz ohne Federn in der Garte wieder zum Vorschein.
4.
In dem Reinhäuser Walde, etwa eine halbe Stunde von dem Dorfe Reinhausen liegt das Klausthal. Oben am Ende desselben steht der sog. Hurkuzstein, ein Felsen, worin eine stubenhohe Höhle ausgehauen ist. Dieser Felsen hat seinen Namen von einem Einsiedler Namens Hurkuz, der darin lebte und starb. Früher hatte er auf den Gleichen gelebt und hier einst von dem Burgherrn den Auftrag erhalten ein Kind umzubringen und dasselbe auch wirklich ausgesetzt, so daß er es todt glaubte. Später ergriff ihn die Reue über diese That; er verließ die Gleichen und siedelte sich in dem Klausthale an, wo er sich in dem Felsen, von wo aus er gerade auf die Gleichen sehen konnte, diese Höhle ausgehauen hat. Lange Jahre lebte er hier, that Buße und kasteite sich bis zum Ende seines Lebens. Auch sein Grab hatte er selbst im Felsen ausgehauen und legte sich, als er den Tod nahe fühlte, hinein und starb.
5. Die Burg Grone.
Auf dem kleinen Hagen hinter der Maschmühle hat die Burg Grone gestanden. Sie gehörte einem »Herrn von Hagen« der daselbst wohnte. Einst sprach er, auf das Land vor sich hindeutend: »vom Hagen bis an den Rhein, was ich da sehe, das ist mein.« Dieser hat den Bewohnern der drei Dörfer Grone, Hetjershausen und Ellershausen das Groner Holz geschenkt, welches früher diesen drei Dörfern gemeinschaftlich gehörte, jetzt aber (seit etwa zwanzig Jahren) unter ihnen getheilt ist.
6. Die Plesse.
1.
Als die Burg Plesse erbaut werden sollte, glaubten die Leute allgemein, die Burg könne nicht erobert werden, in deren Fundamente ein lebendiges Kind eingemauert würde. So sollte nun auch in dem Fundamente der Plesse ein Kind lebendig eingemauert werden. Deshalb wurde in allen Gemeinden bekannt gemacht, wer ein Kind hierzu hergeben wolle, der solle eine Summe Geldes dafür erhalten. Lange wollte sich niemand finden, der dazu bereit gewesen wäre: endlich aber verkaufte eine Frau aus Reiershausen ihr taubstummes, dreijähriges Kind für 300 Dreier. Als nun das Kind eingemauert werden sollte, erhielt es mit einem Male die Sprache und sagte: Mutter-Brust war weicher als ein Kißchen, aber Mutter-Herz war härter als ein Stein. Und so wurde das Kind eingemauert.
2.
Um die Tiefe des Brunnens auf der Plesse zu bezeichnen, erzählt die Sage folgendes: der Eimer sei an einer Kette festgeschmiedet und diese selbst so lang gewesen, daß der Eimer, wenn er einer Ausbesserung bedurfte, nicht abgenommen wurde, sondern an der Kette bleibend nach Bovenden geschafft und in der dem Amthause gegenüberliegenden Schmiede ausgebessert wurde.
Die Quelle Mariaspring soll mit dem Brunnen auf der Plesse in Verbindung stehn. In früheren Jahren, als der Brunnen auf der Plesse noch nicht zugeworfen war, soll man einst eine Ente in den Brunnen gesetzt haben und diese soll in Mariaspring – wie Einige hinzufügen ganz ohne Federn – wieder zu Tage gekommen sein.
3.
Zu der Zeit, wo die Plesse noch bewohnt wurde, ging einst das Fräulein Adelheid von Plesse spaziren. Sie kam auf ihrem Spazirgange nach dem Arenstein in der Nähe von Mariaspring, welches damals noch nicht existirte. Der Platz gefiel ihr so sehr, daß sie ihre Dienerin zurückschickte ihre Laute zu holen. Sie spielte und sang dazu auf das lieblichste. Dies hörten zwei vorüberreitende Herren von Hardenberg, – die Hardenberger waren damals gerade mit den Plessern in Feindschaft – raubten sie und brachten sie sammt der Dienerin nach dem Hardenberge. Bald wurde das Fräulein vermißt, überall gesucht, aber nirgend gefunden; endlich erfuhr man, daß sie geraubt und auf dem Hardenberge sei. Jetzt wurde ein Knappe nach dem Hardenberge geschickt um die Entführte zurückzufordern, aber vergebens; auch der Knappe wurde zurückbehalten. Die Plesser sannen nun auf Rache und lauerten den Hardenbergern überall auf, bis es ihnen gelang einen Herrn von Hardenberg gefangen zu nehmen. Diesen befestigten sie mit Stricken an dem kleinen Thurme, daß er mit dem Gesichte immer nach dem Hardenberge hinüberschauen mußte, und ließen ihn da verhungern.
4.
Der Vater Adolfs des Kühnen, Raugrafen von Dassel, hatte die Plesse an das Kloster in Nordheim versetzt. Als nun Adolf dieselbe wieder einlösen wollte, waren die Mönche wenig geneigt diese Besitzungen wieder herauszugeben und erklärten, die Plesse wäre ihnen verkauft. Zu dem Ende machten vier von ihnen einen falschen Kaufbrief und um demselben das Ansehen des Alters zu geben, räucherten sie ihn tüchtig. Einer der Mönche erklärte sich gegen diesen Betrug und meinte, es wäre doch Unrecht, aber die anderen erklärten, dies ginge ihn nichts an, sie hätten es einmal angefangen und sie wollten es auch vollenden. Nun diente in dem Kloster ein Koch, der wußte um diesen Betrug und hatte es selbst gesehen, wie die Mönche den Kaufbrief geräuchert hatten. Der Koch hatte aber seinem Bruder, der Diener des Grafen Adolf von Dassel war, alles erzählt. Als nun eines Tages der Graf tief betrübt über die Betrügerei der Mönche und ganz schwermüthig spaziren ging, begegnete ihm der Diener und fragte ihn, weshalb er so traurig sei. Der Graf antwortete: das könne er ihm nicht sagen. Doch der Diener meinte, er glaube es schon zu wissen und könne ihm vielleicht helfen. Da erzählte der Graf: er könne die Plesse nicht wieder einlösen, und wenn er das nicht könne, so könne er auch die Adelheid von Plesse nicht zur Gemahlin bekommen. Darauf erzählte der Diener alles was ihm sein Bruder von dem falschen Kaufbriefe mitgetheilt hatte. Bald nachher kam einer der Mönche aus dem Kloster zu Nordheim, der eine Wallfahrt nach Jerusalem machen wollte, hin zum Grafen, um mit ihm im Auftrage des Klosters zu verhandeln. Diesen ließ der Graf gefangen nehmen und in den Keller sperren. Alsdann zog er mit seinen Knappen vor Nordheim und steckte es an; die Adelheid von Plesse aber, welche im Kloster war, nahm er vor sich auf das Pferd und brachte sie so bis Fredelsloh. Von hier an trug er sie, die noch lebte, auf seinen Armen bis auf den Ohrenberg (Arbârg) bei Lauenberg; hier wollte er ihr einen Kuß geben, aber sie war todt.
5.
Im dreißigjährigen Kriege flüchtete ein Landgraf von Hessen nach der Plesse, seine Gemahlin reiste ihm dahin nach, fand ihn aber nicht mehr vor, indem er kurz vorher schon weiter gereist war. Sie übernachtete also nur auf der Plesse und reiste am folgenden Tage – es war der 5. März – weiter. Es hatte stark geglatteist, und wie nun der Wagen den Berg hinabfährt, können die Pferde den Wagen nicht halten und er rollt hinab in einen tiefen Abgrund, der jetzt das Fürstenloch heißt. Wunderbarer Weise war die Landgräfin völlig unverletzt geblieben. Aus Dank für ihre Rettung bestimmte die Landgräfin, daß alljährlich am 5. März unter die Armen in Eddiehausen 7 Malter Roggen vertheilt, und von dem Prediger des Dorfes eine Gedächtnißrede gehalten werden solle, wofür derselbe ein Malter Roggen erhält.
Früher wurde der Roggen auf der Domäne in Eddiehausen vertheilt; später geschah dies auf dem Amte in Bovenden und so ist es noch jetzt. In neuerer Zeit war einmal die Vertheilung unterblieben, da hörte man um diese Zeit auf dem herrschaftlichen Kornboden in Eddiehausen immerfort ein gewaltiges Schaufeln. Der Volksglaube brachte damit auch folgenden Vorgang in Verbindung. Unter dem Kornboden war ein Pferdestall, worin sieben Füllen standen. In der Nacht von 5-6. März waren alle ausgebrochen, ohne daß man sehen konnte, wie dieß möglich gewesen wäre. Nur ein kleines Loch zeigte sich in der Wand, und man nahm an, daß die Füllen auf den Knien durch dasselbe gekrochen wären. Lange wurden die Füllen vergeblich gesucht: endlich sah man sie alle sieben oben auf der Plesse hart am Rande gerade über dem Dorfe stehen. Nur mit vieler Mühe wurden sie von dort weg wieder ins Dorf und in den Stall gebracht.
7. Weshalb die Herren von Hardenberg einen Schweinskopf im Wappen führen.
Einst belagerten die von der Plesse die Burg Hardenberg. Weil man aber damals noch keine Kanonen hatte, so konnten die Belagerer nur mit Pfeilen gegen die Burg schießen, wodurch die Belagerten wenig Schaden litten, und die Belagerung zog sich in die Länge. Deshalb beschlossen die von der Plesse den Hardenberg mit Sturm zu nehmen. Mit der größten Heimlichkeit hatten sie alles zum Sturm vorbereitet, und fast hatten sie die Burg schon erstiegen, ohne daß die Belagerten, welche alle im tiefsten Schlafe lagen, etwas gemerkt hatten. Da »prûstete« auf einmal ein altes Mutterschwein in der Burg »lâs« und weckte so die Schlafenden. Alsbald eilten diese auf die Mauern und der Sturm wurde glücklich abgeschlagen. Zur Erinnerung an diese Rettung der Burg durch ein Schwein haben dann die Herren von Hardenberg einen Schweinskopf in ihr Wappen genommen.
8. Das Fräulein von Bomeneburg.
In der Nähe von Wiebrechtshausen liegt der Retoberg (Reteberg); mitten im Retoberge aber auf einer kleinen Anhöhe ist der sog. Altar des Reto, jetzt nur noch ein Loch. Von diesem Retoberge geht alle Jahre in der Osternacht eine schöne Frau, welche heftig weint, hin zur Ruhme und wäscht sich daraus. Das Mädchen oder die Frau, welche hinterhergeht und sich nach ihr aus dem Flusse wäscht, erhält dadurch wunderbare Schönheit. Die schöne Frau aber ist die Tochter des Ritters von der Bomeneburg, welche zwischen Nordheim und dem Nordheimer Brunnen gelegen haben soll. Sie hieß Kunigunde und wollte sich nicht zum Christenthume bekehren. So verlobte sie sich denn mit einem fremden Ritter, der ebenfalls vom Christenthum nichts wissen wollte. Dieser bestimmte den Tag der Hochzeit, machte aber die ausdrückliche Bedingung, daß er nicht in der Kirche getraut würde. Der Hochzeitstag war gekommen, aber den ganzen Tag über erwartete die Braut ihren Bräutigam vergebens. Draußen wüthete ein furchtbarer Sturm. Endlich kam um Mitternacht unter Donner und Blitz der Bräutigam, ganz in schwarzer Rüstung, durch das Fenster herein, nahm sie trotz ihres Sträubens mit sich, und keiner hat sie wieder gesehen. Er brachte sie dann in den Retoberg, worin sie jetzt noch wohnt und aus dem sie nur einmal im Jahre herauskommen darf, um an die Ruhme zu gehn und sich da zu waschen.
9. Die Burg Brunstein.
Die alte Burg Brunstein lag auf dem sog. Burgberge, nahe bei der jetzigen Domäne des Namens. Zur Zeit des siebenjährigen Krieges versteckten noch die Bauern der benachbarten Dörfer ihre Pferde in den wohlerhaltenen Kellern der ehemaligen Burg. Auf dem Burgberge geht um Mittag und Mitternacht eine weiße Jungfrau um, welche vom Volke die Käsejungfer genannt wird und für die Ahnfrau der ehemaligen Burgherrn gilt. In der Burgscheuer soll sie namentlich sich zeigen. Von der Burg geht sie herunter hin zu dem sog. Eselbrunnen, der davon den Namen hat, daß früher das Wasser von hier auf Eseln hinauf in die Burg geschafft wurde. Sie erscheint in einem langen weißen Gewande und mit einem weißen Schleier; an der Seite trägt sie ein Schlüsselbund. Oft zeigt sie sich längere Zeit nicht, dann wieder häufiger.
10. Die Vogelsburg und das Dorf Vogelbeck.
1.
Auf der Vogelsburg, einem bewaldeten Berge bei dem Dorfe Vogelbeck, soll vor alten Zeiten eine Burg gestanden haben, worin ein Fürst wohnte. Bisweilen wird ein Mann Namens Vogel als der Bewohner derselben genannt, gewöhnlich aber Heinrich der Vogelsteller, der hier auch seinen Vogelheerd gehabt haben soll. Die Spuren von einer dreifachen Umwallung sind noch jetzt sichtbar, und eine Stelle wird als der Küchengarten bezeichnet. Zwischen dem Braunschweigischen Dorfe Ahlshausen und dem Hannöverschen Dorfe Hohnstedt zieht sich ein Weg hin, der Kârweg genannt, auf welchem Heinrich der Vogelsteller auf einem zweiräderigen Karren nach der Vogelsburg gefahren sein soll. Eben so wird auch eine erhabene Fläche in der Hohnstedter Feldmarkt der Königsstuhl genannt. Von der Vogelsburg kommt ein kleiner Bach herunter; an diesem bauten sich Menschen an und nannten das so entstandene Dorf, weil es an diesem Bache lag, Vogelbeck. Beismanns Hof ist von den etwa 50 Häusern des Dorfes das erste gewesen, welches hier gebaut wurde.
2.
Als Kaiser Heinrich einst auf der Vogelsburg mit Vogelstellen eifrig beschäftigt war, wurde er abgerufen. Da sagte er: nur noch einen Finken! (will ich fangen) und blieb so lange, bis er den einen Finken auch gefangen hatte. Davon hat er den Beinamen der Finkler erhalten. In dem von der Vogelsburg herabfließenden Bache sind des Kaisers Vögel getränkt; daher ist der Bach und das Dorf Vogelbeck (Vogel-bêke) genannt worden.





























