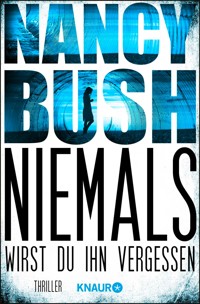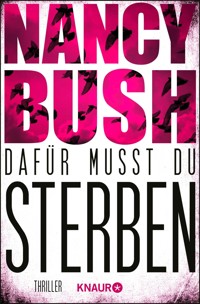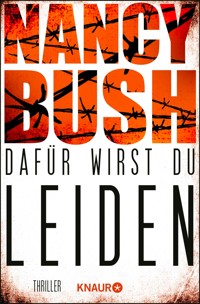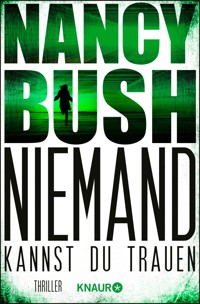
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Detectives-Rafferty-Reihe
- Sprache: Deutsch
Vor der Post in Oregon wird die nackte Leiche des Postboten gefunden. Um seinen Hals trägt er ein Schild mit den Worten "Ich muss für das bezahlen, was ich getan habe". Wenig später taucht ein weiterer nackter Mann auf, gefesselt, vor einer Grundschule. "Ich will, was ich nicht haben kann" steht auf dem Schild um seinen Hals. Dabei handelt es sich ausgerechnet um den Stiefbruder von Detective September Rafferty. Was September ahnt, bestätigt sich im Laufe der Ermittlungen: Beide Männer sind mutmaßliche Triebtäter, die der Polizei unbekannt waren; sie wurden ermordet, bevor sie noch mehr Menschen Leid zufügen konnten. September steht vor ihrem bisher schwersten Fall, bei dem die Grenzen zwischen Täter und Opfer immer mehr verschwimmen … Die schlafraubende Thrillertrilogie von New York Times-Bestsellerautorin Nancy Bush beinhaltet außerdem "Nirgends wirst du sicher sein" (bereits erschienen) und "Niemals wirst du ihn vergessen" (bereits erschienen).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Nancy Bush
Niemand kannst du trauen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kristina Lake-Zapp
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Ein Mörder macht Jagd auf Männer. Die Opfer wirken auf den ersten Blick harmlos, doch der Killer enthüllt ihre dunklen, perversen Geheimnisse. Offenbar hat er sie aus dem Weg geräumt, bevor sie noch mehr Menschen Leid zufügen konnten. Dtective September Rafferty steht vor ihrem bisher schwersten Fall: Sie muss den Killer aufhalten, doch die Grenzen zwischen Täter und Opfer verschwimmen …
Inhaltsübersicht
Prolog
Kapitel eins
Kapitel zwei
Kapitel drei
Kapitel vier
Kapitel fünf
Kapitel sechs
Kapitel sieben
Kapitel acht
Kapitel neun
Kapitel zehn
Kapitel elf
Kapitel zwölf
Kapitel dreizehn
Kapitel vierzehn
Kapitel fünfzehn
Kapitel sechzehn
Kapitel siebzehn
Kapitel achtzehn
Kapitel neunzehn
Kapitel zwanzig
Kapitel einundzwanzig
Kapitel zweiundzwanzig
Kapitel dreiundzwanzig
Kapitel vierundzwanzig
Kapitel fünfundzwanzig
Kapitel sechsundzwanzig
Kapitel siebenundzwanzig
Kapitel achtundzwanzig
Prolog
Der Boden unter ihm war hart, kalt und feucht. Langsam kam er zu sich, hörte das Rauschen von Blättern um sich herum und fühlte, wie eine Brise über seine bloßen Arme strich, so kalt, dass ihm der Atem stockte. Er schauderte. Blickte starr geradeaus, stierte an seinen nackten Beinen hinab bis zu den jetzt bläulichen Zehen. Aus den Augenwinkeln sah er orange-, rost- und goldfarbene Blätter in einem kleinen Tornado vor dem Maschendrahtzaun durch die Luft wirbeln. Hinter dem Zaun führte eine Straße entlang, davor stand eine halbhohe Hecke.
Er war auf dem Schulhof, wurde ihm schlagartig klar.
Auf dem Schulhof der Twin Oaks Elementary School.
Nackt.
»Ach du Scheiße …«, murmelte er, durchflutet von eiskalter Panik.
Er versuchte, auf die Füße zu kommen, und stieß sich den Kopf an der Metallstange hinter ihm. Der Schmerz war so heftig, dass er aufheulte. Einen Augenblick sah er Sternchen. Rasch kniff er die Augenlider zusammen. Über seinem Kopf flatterte etwas. Vorsichtig öffnete er ein Auge. Ein Basketballnetz tanzte im kräftigen Wind. Der Schmerz in seinen Armen rührte daher, dass sie auf seinem Rücken gefesselt waren, die Stange, an der der Korb befestigt war, in der Mitte. Seine Handgelenke pochten, so fest waren sie mit harten, steifen Fesseln zusammengebunden. Kabelbinder?
Angsterfüllt schnappte er nach Luft und spürte, wie sein Herz galoppierte. Er war auf dem Schulhof, an eine Basketballstange gefesselt … auf dem Gelände der Grundschule, an der er angestellt war.
Blinzelnd warf er sich hin und her, suchte mit den Augen panisch seine Umgebung ab. Jetzt stellte er auch fest, dass er doch etwas anhatte. Seine Boxershorts. Sonst nichts.
Dieses Miststück. Das Miststück, das ihm einen Elektroschock verpasst hatte. Sie war hierfür verantwortlich. Sie hatte ihn an diese Stange gebunden. Was hatte sie noch gleich geantwortet, als er sie fragte, wer zum Teufel sie eigentlich sei? Was hatte sie gesagt?
»Ich bin Lucky.«
Nun, unter Glück stellte er sich etwas anderes vor.
Herr im Himmel! Wenn die Kinder ihn so sahen … die Kollegen … Wie sollte er das erklären? Was um alles in der Welt könnte er tun? Zum Glück war es recht früh, der Morgenhimmel noch nicht richtig hell.
Mit einiger Mühe kam er auf die Füße und richtete sich langsam auf. Die harten Fesseln schnitten ihm schmerzhaft in die Handgelenke, kleine Kieselsteine und Erdbröckchen auf dem Beton bohrten sich in seine Fußsohlen. Zu voller Größe aufgerichtet, blickte er über die Hecke in Richtung Straße, bis ihm klar wurde, dass ihn nun alle, die dort vorbeikamen, sehen konnten. Wollte er gesehen werden? In der Hoffnung, dass ihn jemand fand und ihm half?
Zum Teufel, nein.
Benommen ließ er sich auf den Boden zurücksinken, wobei er sich heftig das Steißbein stieß. Verdammter Mist. Seine Zähne klapperten vor Kälte und Furcht.
Um seinen Hals hing ein Plakat. Voller Angst blickte er an sich hinab. Er wusste, was darauf stand, trotzdem hoffte er absurderweise, die Worte würden nicht dort stehen, obwohl er sie höchstpersönlich geschrieben hatte. Sie hatte ihn dazu gezwungen. Dieses Miststück! Wenn er das Kinn auf die Brust presste, las er: Ich will, was ich nicht haben kann. Ein gequälter Schrei aus den tiefsten Tiefen seiner Seele entrang sich seiner Kehle.
Verfluchtes Miststück! Sie hatte ihm das angetan! Sie hatte ihm dieses Zeug verabreicht, das ihn ausgeknockt hatte! Jetzt fiel ihm alles wieder ein. Er krümmte sich innerlich bei der Vorstellung, wie er sie angefleht hatte, ihn laufen zu lassen, wie er um Gnade gebettelt hatte. Sie hatte ihn auf dem Beifahrersitz seines eigenen Vans angeschnallt, als er von dem Elektroschock noch weitestgehend außer Gefecht gesetzt gewesen war, und ihn gefesselt. Seinen schwachen Versuchen, sich zur Wehr zu setzen, war sie mit einem erneuten Stromstoß begegnet. Dann hatte sie ihm ihr Gebräu verabreichen wollen, aber er hatte sich geweigert, es zu trinken. Nein, er würde sich ihr nicht völlig hilflos ausliefern!
Also hielt sie ihm den Elektroschocker an den Hals und drückte ab. Zum dritten Mal. Er hörte das Knistern, konnte den Strom förmlich riechen, sah die Entschlossenheit in ihrem Blick. Er bettelte und bettelte, versprach ihr Dinge, die er niemals würde halten können, alles – nur um freizukommen. Er redete auf sie ein, sie habe den falschen Mann erwischt. Was immer sie vorhabe, er wäre nicht der Richtige. Es müsse sich um ein Missverständnis handeln, das wäre ihr doch klar, oder?
Ihre Antwort war eindeutig gewesen. »Hier liegt kein Missverständnis vor, Stefan.« Ihm entgleisten die Gesichtszüge. Sie kannte seinen Namen? Kannte ihn? Hatte ihn ganz bewusst ausgewählt?
Sie hatte ihn angesehen, abwartend, das Gebräu in der einen Hand, den Elektroschocker in der anderen. Er hatte ein weiteres Mal auf sie eingeredet, so lange, bis sie die Geduld verloren und erneut abgedrückt hatte, was ihm einen schrillen Aufschrei entlockte. Alles, was er sagte, stieß auf taube Ohren. Sie hörte ihm nicht zu. Es war ihr einfach egal.
Also hatte er den kleinen Becher geleert, den sie ihm an die Lippen drückte. Hatte alles ausgetrunken, bis auf den letzten Tropfen, denn er glaubte ihr, wenn sie kühl behauptete: »Wenn du es ausspuckst, bist du ein toter Mann.«
Das Miststück war zu allem fähig.
Und jetzt war er Stunden später an der Schule wieder zu sich gekommen – an seiner Schule! Wer zur Hölle war sie? Ach, sei’s drum, im Grunde war ihm das egal. Momentan gab es Wichtigeres zu bedenken. Zunächst einmal musste er sich aus dieser prekären Lage befreien. Bevor der Unterricht begann. Bevor es richtig hell wurde.
Er bewegte prüfend die Hände und stellte fest, dass er tatsächlich mit Kabelbindern gefesselt war. Kabelbinder, wie sie seine Stiefschwester und sein Stiefbruder benutzten – diese gottverdammten Cops –, wenn sie keine richtigen Handschellen zur Hand oder nicht genügend davon bei sich hatten. Mit Kabelbindern gefesselt … wie um alles auf der Welt sollte er sich bloß befreien?
Und dann dachte er an die jungen Mädchen, die in ihren hübschen Kleidchen und Schuhen zur Schule kamen, an ihr glänzendes Haar, ihre weichen, rosigen Gesichter. Er wollte doch nur eine … nur für eine kurze Weile … nur um sie zu lieben.
Sie durften ihn so nicht sehen!
Wieder ruckte er hin und her, versuchte angestrengt, sich zu befreien. Das Miststück kannte seine heimliche Begierde. Woher? Er war so vorsichtig gewesen. Dass sie ihn hier gefesselt hatte, sah aus wie ein Vergeltungsschlag, wie Rache, aber wofür? Er hatte doch gar nichts gemacht! Nichts. Ja, er hatte diese Fotos von seiner Stiefnichte im Badezimmer aufgenommen, aber er hatte sie nicht angefasst. Nie.
Nur weil du nie die Gelegenheit dazu hattest.
Kalte Tränen stiegen ihm in die Augen, und er versuchte, sie wegzublinzeln. Es war nicht fair. Es war einfach nicht fair.
Das Miststück hatte ihm versichert, dass ihn das Gebräu nicht umbringen würde, also hatte er es geschluckt. Was hätte er sonst tun sollen? Aber jetzt … jetzt wünschte er sich beinahe, es hätte ihm den Garaus gemacht. Die Leute durften ihn so nicht sehen, das war unmöglich.
Nun fing er doch an zu weinen, krank vor Sorge. Und dann hörte er Schritte. Jemand kam in seine Richtung gejoggt, auf der anderen Seite der Hecke. Er hob den Kopf, rappelte sich ein kleines Stück hoch und sah einen Mann mit Mütze vorbeilaufen. Als hätte er Stefans Blick gespürt, schaute er zu ihm herüber und wäre fast gestolpert. Vor Überraschung klappte seine Kinnlade hinunter, eine weiße Atemwolke bildete sich in der kalten Luft.
»He!«, rief der Mann. »Alles in Ordnung?«
Nein … nein … Es war gar nichts in Ordnung, und er bezweifelte, dass für ihn je wieder etwas in Ordnung kommen würde.
Mit allerletzter Kraft setzte Stefan ein zittriges Lächeln auf. »Ein dummer Scherz … Ich kann mich nicht befreien. Könnten Sie mir … helfen?«
Sofort drehte der Mann um und joggte an der Hecke entlang zur Vorderseite des Gebäudes, um auf das Schulgelände zu gelangen. Stefan stellte sich vor, wie er über den Bürgersteig lief und den Rasen überquerte in Richtung Spielplatz, an den das Basketballfeld grenzte. Krampfhaft versuchte er, sich umzudrehen. Er hörte klatschende Schritte auf dem Beton, und dann stand der Mann vor ihm, außer Atem, die Hände auf den Knien.
»Ach du Scheiße«, stieß er hervor. »Wer immer Ihnen das angetan hat – ein Scherz war das nicht! Sie hätten erfrieren können!« Er richtete sich auf und zog ein Handy aus der Reißverschlusstasche seiner Jacke. Seine Augen wanderten zu dem Schild um Stefans Hals.
»Wen … brrr … rufen Sie an?«, fragte dieser mit klappernden Zähnen.
»Die Neun-eins-eins. Mein Gott …«
Nein. Nein!
Doch es war zu spät, der Mann sprach bereits mit der Notrufzentrale. Stefan zermarterte sich das Hirn nach einer plausiblen Erklärung. Er könnte nach wie vor behaupten, es handle sich um einen bösen Streich, aber dann würde er mit Namen aufwarten müssen. Nein, das funktionierte nicht. Er brauchte einen Plan B. Dringend.
Minuten später bremste ein Jeep vom Laurelton Police Department – kurz LPD – mit blinkendem Lichtbalken vor der Schule. Stefan begann trotz der eisigen Temperaturen zu schwitzen. Na schön. Dann kommt eben her und befreit mich, denn schon bald, ganz bald würden die ersten Schüler eintreffen. Beeilt euch, dachte er, während er sich eine Geschichte zurechtlegte. Beeilt euch!
Der Jogger winkte den Polizisten, der aus dem Jeep gesprungen war, zu ihnen herüber. In diesem Augenblick bog ein Rettungswagen mit heulender Sirene in die Straße ein, die zur Schule führte. Ein Rettungswagen – so ein Mist! Er wollte nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Das würde viel zu viel Aufmerksamkeit erregen. Nein, bloß das nicht …
Der Streifenpolizist in seiner dunkelblauen Uniform bückte sich und sah ihm ins Gesicht. Er war jung, sein Gesichtsausdruck ernst. »Keine Sorge. Wir befreien Sie gleich.« Er zog ein Messer aus der Tasche und schnitt die Kabelbinder durch. »Was ist passiert?«
Der Jogger hob den Kopf, als wollte er antworten, aber Stefan kam ihm zuvor.
»Ich wurde überfallen«, stieß er mit bebender Stimme hervor. »Der Kerl hat mich außer Gefecht gesetzt und mir meine Klamotten und meine Brieftasche abgenommen. Dann ist er abgehauen.«
Der Jogger starrte ihn überrascht an. »Aber … Haben Sie nicht gesagt, jemand hätte Ihnen einen bösen Streich gespielt?«
»Einen sehr gefährlichen Streich«, befand der Polizist. »So, das wäre geschafft. Sie sind frei.« Stefans Arme fielen herab. Sie waren steif vor Kälte und der unbequemen Haltung, und er konnte sie kaum heben.
Der Uniformierte half ihm auf. Stefan sah zwei Sanitäter mit einer Rollbahre in ihre Richtung eilen. Hinter dem Rettungswagen traf das erste Auto ein – bald würde die Schule beginnen. Die Sanitäter halfen Stefan auf die Bahre. Gut. Deckt mich zu, flehte er stumm und nahm unbeholfen das Plakat ab. Seine Arme fühlten sich an, als wären sie aus Gummi. Es war besser, wenn die anderen dachten, er sei verletzt.
»Also kein Streich?«, fragte der Polizist, der ihm mit behandschuhter Hand das Plakat abnahm.
Der Van. Wo war sein Van? Das Miststück hatte seinen Van geklaut!
Er spürte den fragenden Blick des Cops und murmelte: »Er hat sich auf mich gestürzt und mir alles abgenommen, was ich bei mir hatte.« Die Sanitäter schoben ihn auf den wartenden Rettungswagen zu. Plötzlich durchzuckte ihn ein neuer, besorgniserregender Gedanke: sein Handy. Sie hatte es an sich genommen. Wenigstens waren die Fotos nicht mehr darauf, die er damit aufgenommen hatte. Er hatte Abzüge gemacht und die Bilder gelöscht. Inzwischen gab es selbst die Abzüge nicht mehr.
»Ich will, was ich nicht haben kann«, las der Uniformierte laut vor. Die Worte erfüllten Stefan mit Furcht, verfolgten ihn wie ein übler Geruch.
Wie um Himmels willen sollte er das Plakat erklären?
Vor seinem inneren Auge zuckte das Bild auf, wie man ihn ins Polizeipräsidium von Laurelton schleifte, wo er von September gegrillt wurde – oder noch schlimmer, von ihrem Zwillingsbruder August, der ebenfalls ein Cop war.
Seine elende Lage wurde ihm mit voller Wucht bewusst und ließ ihn laut aufstöhnen, als die Sanitäter die Türen des Krankenwagens hinter ihm zuschlugen.
Das war einfach nicht fair!
Kapitel eins
Heute saß jemand anderes als Guy an dem Schreibtisch am Empfang, stellte September fest, als sie das Laurelton Police Department durch die Haupteingangstür betrat. Jemand, der September leicht nervös anblickte, als wüsste er von dem Kleinkrieg, der sich tagtäglich zwischen Guy Urlacher, der für gewöhnlich diesen Platz einnahm, und sämtlichen Angestellten des Präsidiums abspielte. Urlacher war ein so fürchterlicher Paragrafenreiter, dass ihn die anderen am liebsten erwürgt hätten. Nur Septembers Partnerin Gretchen Sandler, die gegenwärtig vom Dienst beurlaubt war, weil sie einen Mann erschossen hatte, der vor Kurzem mit einem Messer auf September losgegangen war, war grimmig genug, um Mr. Streng-nach-Vorschrift einschüchtern zu können. Jedes Mal, wenn sie an ihm vorbeiging, warf sie ihm einen bösen Blick zu, und er machte einen Rückzieher und ließ sie passieren, ohne sich ihren Ausweis zeigen zu lassen. Nicht so September, die noch recht neu bei der Mordkommission war und, nun ja, ein wesentlich netterer Mensch als Gretchen. Urlacher verlangte jedes Mal, dass sie sich auswies, selbst wenn sie das Department nur kurz zum Mittagessen verlassen hatte. Er war wirklich eine Nervensäge.
»Wo ist Guy?«, fragte September die neue Kollegin, auf deren Namensschild Gayle stand.
»Ich glaube, er hat die Grippe«, antwortete diese. »Heute ist mein erster Tag«, fügte sie überflüssigerweise hinzu.
Ungefragt zog September ihren Ausweis aus der Tasche. Gayle wirkte erleichtert, weil sie sich kooperativ zeigte, doch dann sagte September: »Prägen Sie sich mein Gesicht ein«, bevor sie sich abwandte, um den Flur entlang ins Allerheiligste des Präsidiums zu marschieren. »Urlacher fordert uns jedes Mal auf, uns auszuweisen, wenn wir an seinem Schreibtisch vorbeikommen, was alle furchtbar nervt«, teilte sie der Aushilfe noch über die Schulter hinweg mit.
»Detective Pelligree behauptet, das sei hier üblich.«
»Wes veralbert Sie, glauben Sie mir. Urlacher geht ihm schrecklich auf den Geist.«
»Ach.«
Gayle schaute ihr ungläubig nach, aber September beließ es dabei. Sie hatte der Frau einen guten Rat gegeben, sollte sie damit anfangen, was sie wollte.
September nahm den Gang zum Pausenraum und blieb unterwegs vor ihrem Spind stehen, um ihre Umhängetasche zu verstauen, die sie wegen ihrer Schulterverletzung momentan nur wie eine Handtasche halten konnte. Mit ein wenig Mühe zog sie ihre Jacke aus. Die Wunde heilte gut, trotzdem brannte sie mitunter wie Feuer. Man hatte ihr nahegelegt, noch länger freizunehmen, aber nach einer Weile als Halbinvalidin im Haus ihres Freundes meinte sie, verrückt zu werden, wenn sie nicht endlich wieder arbeiten ging. Zum Glück wusste Jake, dass er sich nicht allzu besorgt um sie zeigen durfte; dann wäre sie vollends aus der Haut gefahren. Sie riss sich zusammen, allerdings war sie jedes Mal froh, wenn er zur Arbeit fuhr und sie das Haus für sich hatte – was kein gutes Zeichen war in Anbetracht ihrer Erwägung, zusammenzuziehen. War sie womöglich zu sehr daran gewöhnt, allein zu leben? Oder ertrug sie es nicht, wenn sich jemand zu sehr um sie kümmerte?
Sie hoffte, dass Letzteres der Fall war.
»Sag bitte, dass du wieder arbeitest«, stieß Detective George Thompkins mit einem tiefen Seufzer der Erleichterung hervor, als er sie das Großraumbüro betreten sah. Sein Drehstuhl quietschte protestierend unter seinem enormen Gewicht, als er sich zu ihr umwandte.
»Ich arbeite wieder.«
»Meine Gebete wurden erhört«, stellte er fest und beäugte voller Sorge, wie sie sich vorsichtig zwischen den Schreibtischen hindurchlavierte und sich auf ihren Stuhl sinken ließ.
»Du siehst aus, als hättest du seit Tagen nicht mehr geschlafen«, stellte September mit einem aufmunternden Lächeln fest.
George schnaubte. »Das habe ich auch nicht.«
Sie musste nicht fragen, warum. Die Mordkommission war knapp besetzt, und obwohl Wes »Weasel« Pelligree, der im vergangenen Sommer schwer verletzt worden war, seit kurzem wieder arbeitete, wenn auch nur in Teilzeit, hatte September eine ganze Weile gefehlt, und Gretchen Sandler, ihre Partnerin, würde voraussichtlich noch länger nicht zum Dienst erscheinen. Auggie, Septembers Zwillingsbruder, der mit richtigem Namen August hieß und ebenfalls als Detective beim LPD arbeitete, unterstützte momentan die Polizei von Portland bei einem Undercover-Einsatz. Die ganze Arbeit war an George hängen geblieben, der allerdings am liebsten an seinem Schreibtisch vor dem Computer hockte, anstatt vor Ort zu ermitteln. September konnte sich lebhaft vorstellen, was für eine Qual das für ihn bedeutet hatte.
»Wo steckt Wes?«, erkundigte sie sich.
»Irgendwo in der Gegend. Hat einen Anruf gekriegt – ein Typ, der an eine Stange gefesselt wurde.«
September warf einen Blick auf den Wust von Papieren auf ihrem Schreibtisch, Nachrichten, übermittelt von Candy aus der Verwaltung, außerdem Mitteilungen und Unterlagen, die George dort abgelegt hatte. Ihre Augen blieben an einer Notiz von Lieutenant D’Annibal, ihrem Vorgesetzten, hängen. Er bat sie, gleich nach ihrem Eintreffen bei ihm im Büro vorbeizuschauen. Offenbar stammte die Nachricht von gestern.
»An eine Stange gefesselt?«, fragte sie und schaute auf.
»Ja, ich weiß. Du denkst an diesen anderen Fall, den du übernommen hast.«
»Der Postbote wurde nackt an eine Fahnenstange vor dem Postamt gebunden. Er ist an Unterkühlung gestorben.«
George nickte. »Dasselbe ist diesem Kerl passiert, nur dass er nicht tot ist. Ihn hat man auf dem Gelände einer Grundschule gefunden.«
September schnappte nach Luft. »Weißt du, von welcher Grundschule?«
»Frag Weasel. Er ist vor über einer Stunde losgefahren, um mit dem Opfer zu reden.«
September griff bereits nach dem Hörer ihres Schreibtischtelefons und tippte Wes’ Handynummer ein. Es klingelte vier Mal, dann meldete er sich: »Pelligree.«
»Wes, hier spricht September. Bist du bei dem Typen, den man an eine Stange gefesselt hat? Auf dem Gelände einer Grundschule?«
»Ja, auf dem Schulhof der Twin Oaks Elementary. Der Mann wird inzwischen im Laurelton General Hospital durchgecheckt. He, September, wie geht’s dir eigentlich?«
»Ich arbeite wieder.« Twin Oaks, dachte sie stirnrunzelnd. Sie hatte dieser Grundschule erst kürzlich einen Besuch abgestattet, im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu einem anderen Fall.
»Was macht dein Hals?«
»Es ist eher die Schulter als der Hals«, erklärte sie. »Es geht schon. Und wie steht’s mit dir?«
»Es geht schon«, ahmte er sie scherzhaft nach. »Diese Woche versuche ich, wieder Vollzeit zu arbeiten. Du verstehst.«
»Ja, ich verstehe dich sogar sehr gut.« Obwohl es nervend und ein wenig beunruhigend war, wie ausgelaugt sie sich fühlte. Der Körper brauchte eben Ruhe, um zu genesen und wieder zu Kräften zu kommen.
»Hattest du nicht vor deiner Verletzung daran gearbeitet?«, fragte Wes. »Ich meine den Fall mit dem Mann, den man vor der Post an eine Fahnenstange gefesselt hatte?«
»Ja, den hat mir Chubb vererbt«, erzählte September. Detective Carson Chubb hatte an dem Fall gearbeitet, bevor September zur Mordkommission gestoßen war. Er war nach Nordkalifornien umgezogen, und sie hatte übernommen. »Das Opfer hieß Christopher Ballonni. Er hat als Postbote gearbeitet, die Fahnenstange befindet sich vor seiner Dienststelle. Die Tat fand letzten Februar statt. Der Mann ist an Unterkühlung gestorben.«
»Ach … ja. Ich erinnere mich.«
»Er hatte Frau und Kind. Einen Sohn im Teenager-Alter, er hieß … Weiß ich nicht mehr. In Chubbs Bericht steht, dass beide ein Loblied auf Ballonni gesungen haben. Bis jetzt habe ich nichts Gegenteiliges herausgefunden.«
»Klingt, als habe derselbe Täter erneut zugeschlagen«, sagte Wes. »Nur dass das Opfer diesmal überlebt hat.«
»Bist du gerade in der Notaufnahme?«
»Ja. Es ist besser, wenn du auch kommst. Das Opfer setzt alles daran, um so schnell wie möglich entlassen zu werden.«
September hatte Wes Pelligree immer gemocht. Er war ein großer schlanker Schwarzer, durchtrainiert und blitzgescheit. Im Department war er unter dem Spitznamen »Weasel« bekannt – nach dem M29 Weasel, einem Spezialfahrzeug der US Army, das sich einfach überall seinen Weg bahnen konnte. Manche nannten ihn wegen seiner gedehnten Sprechweise und seiner Vorliebe für Westernstiefel hinter vorgehaltener Hand auch den »schwarzen Cowboy«. Bevor September wieder mit ihrer Highschool-Liebe Jake Westerly zusammengekommen war, hatte sie insgeheim für Wes geschwärmt, obwohl er schon seit Ewigkeiten mit seiner Freundin Kayleen Jefferson zusammen war. Natürlich war sie längst darüber hinweg, doch sie mochte ihn sehr, und sie freute sich, dass sie inoffiziell Partner waren, solange Sandler beurlaubt war.
»Bin gleich da. Man hat ihn an der Twin Oaks gefunden?«, vergewisserte sich September.
»An eine Basketballstange gefesselt. Er hatte Glück, dass er entdeckt wurde, bevor die Kinder zur Schule kamen.«
»Du sagst es. Um wie viel Uhr hat man ihn gefunden?«
»Gegen halb sieben, sieben.«
»Okay. Ich mache mich auf den Weg«, sagte sie, legte auf und rappelte sich von ihrem Stuhl hoch.
»Ich halte hier die Stellung«, versicherte ihr George.
»Daran hege ich keinen Zweifel«, erwiderte sie trocken und eilte zu ihrem Spind, um die Umhängetasche und ihre Jacke herauszunehmen.
Jake Westerly leerte gerade eine seiner Schreibtischschubladen, als der Anruf einging. Es war noch früh, und da er als Erster in der Kaffeeküche eintraf, die sich die Büros im elften Stock des Geschäftsgebäudes in der Innenstadt von Portland teilten, hatte er Kaffee gekocht. Andrea, die neue Praktikantin, war noch nicht zur Arbeit erschienen. Nicht dass er und sein Kollege – oder vielmehr Rivale – Carl Weisz es mit der Pünktlichkeit so genau nahmen. Sie arbeiteten zwar auf derselben Etage, aber sie waren Konkurrenten, ebenso wie die anderen Investment-Berater, die nur eines verband: ihre gemeinsame Abneigung gegen die Capital Group Inc., kurz CGI, die ihre Büros am Ende des Flurs hatte. Ständig versuchten diese Typen, in fremdem Revier zu wildern.
Er griff nach seiner Kaffeetasse und nahm einen Schluck, die Augen auf das Durcheinander aus Bleistiften, Kugelschreibern, Büroklammern, Notizblöcken, Papierstapeln und anderem Krimskrams geheftet. Was er alles in seiner obersten Schublade aufbewahrte! Er durchlebte gerade eine hausgemachte Arbeitskrise, die ihn dazu trieb, mit dem Investment-Geschäft Schluss zu machen und etwas anderes mit seinem Leben anzufangen. Was um alles auf der Welt das sein sollte, war noch offen, zumal hinzukam, dass seine Klienten alles andere als glücklich über seinen Rückzug waren. Nur Carl Weisz rieb sich die Hände und machte sich bereit, sich auf sie zu stürzen.
Jake war dankbar für das Vertrauen seiner Klienten und deren Wunsch, dass er sich weiterhin um ihre finanzielle Zukunft kümmerte, aber in den vergangenen Jahren war er der Arbeit mit Vermögen überdrüssig geworden. Tja … andererseits konnte er an sich keine sonstigen speziellen Talente entdecken. Abgesehen von seiner neuen Beziehung mit September »Nine« Rafferty – oder vielleicht sollte er besser von seiner »wiederaufgefrischten« Beziehung sprechen, weil sie nach einem Highschool-Techtelmechtel kürzlich wieder zusammengekommen waren –, konnte er sich nicht groß für irgendetwas begeistern.
Und nun räumte er also seinen Schreibtisch aus. Langsam. Bedächtig. Hin- und herüberlegend, ob dies beruflich wirklich der richtige Schritt war. Sein älterer Bruder Colin führte das Weingut ihres Vaters weiter, Westerly Vale Vineyards, das auf dem Papier zum Großteil Jake gehörte, weil er es seinem Vater damals mit seinen Gewinnen aus den Investment-Geschäften abgekauft hatte, aber im Herzen gehörte es Colin. Jake glaubte nicht, dass es ihn glücklich machen würde, dort zu arbeiten. Die ländliche Verschlafenheit war wundervoll für eine Auszeit am Wochenende, doch die Vorstellung, dort in Vollzeit tätig zu sein, reichte aus, um bei ihm sämtliche Alarmglocken schrillen zu lassen. Das würde ihn in den Wahnsinn treiben, davon war er überzeugt.
Vielleicht sollte er doch bleiben. Zumal er nicht wollte, dass Carl seine Klienten abgriff, und CGI schon gar nicht.
Seine Gedanken wandten sich seinem Bruder zu. Colin war vor kurzem aus der Klinik entlassen worden. Der Irre, der Nine attackiert hatte, hatte auch seinen Bruder und dessen Frau Neela ins Visier genommen. Beide waren verletzt worden. Colin hatte eine Stichwunde in der Brust davongetragen, die Lunge und eine Arterie waren getroffen worden. Neelas Verletzungen hatten sich zum Glück als oberflächlich herausgestellt; sie war in die Notaufnahme gebracht, verarztet und gleich wieder entlassen worden. Jake hatte in Westerly Vale aushelfen wollen, während sein Bruder ans Bett gefesselt war, aber Neela versicherte ihm, dass sie alles unter Kontrolle hatte, auch wenn sie ständig zwischen Weingut und Krankenhaus hin- und herpendelte. Mittlerweile war Colin seit einer Woche wieder zu Hause und wurde bei Neelas liebevoller Pflege jeden Tag ein bisschen kräftiger. Ja, er war auf dem besten Wege, vollständig zu genesen.
Dennoch war der Übergriff eine Art Weckruf gewesen, zumindest hatte Colin das behauptet, als er Jake heute Morgen anrief, gerade als dieser auf seinen Stellplatz in der Tiefgarage des Geschäftsgebäudes eingebogen war.
»Du fährst also immer noch ins Büro«, hatte sein Bruder festgestellt.
»Ich habe Neela angeboten, ihr zu helfen«, verteidigte sich Jake sofort. »Sie sagte –«
»Nun mach mal halblang«, unterbrach ihn Colin. »Das war bloß eine Feststellung, kein Vorwurf. Du warst doch derjenige, der behauptet hat, er wolle aufhören. Neela und ich kommen wunderbar zurecht. Das weißt du.«
»Okay …«
»Ich wollte dir bloß mitteilen, dass wir versuchen, Eltern zu werden«, sagte Colin mit einem Lächeln in der Stimme.
»Ihr bekommt ein Baby?«, fragte Jake überrascht.
»Wir arbeiten daran. Das Leben ist kurz, man kann nie wissen.«
»Ja … aber du wurdest doch gerade erst aus der Klinik entlassen.«
»Letzte Woche. Manche Körperteile wurden verletzt, andere funktionieren dagegen wunderbar«, fügte er trocken hinzu.
»Das freut mich zu hören. Ach was, das ist einfach großartig!«
»Du klingst ein bisschen verunsichert.«
»Nein. Nein, im Ernst. Es ist großartig. Ich habe mir dich nur gerade als Vater vorgestellt …«
»Nun, noch ist ja nichts passiert, wir haben gerade erst angefangen.«
»Und wie ist das so, wenn man auf ein Baby hinarbeitet? Das habe ich mich immer schon gefragt.«
»Verdammt gut«, erwiderte Colin gedehnt, und beide fingen an zu lachen.
Jake verspürte einen Anflug von Neid. Sein Bruder und Neela hatten sich vor ein paar Jahren verliebt und beschritten seither gemeinsam den vorgezeichneten Pfad des Lebens: Verliebt, verlobt, verheiratet und dann ein Kind.
»Nun, gib mir Bescheid, wenn es so weit ist«, bat Jake, bevor er auflegte.
»Du wirst als Erster davon erfahren«, versicherte ihm sein Bruder.
Nun schob Jake die Schreibtischschublade zu und lehnte sich auf seinem Drehstuhl zurück.
Ja, in gewisser Weise galt der Weckruf auch für ihn. Er wollte die Dinge mit Nine vorantreiben. Wollte nicht länger warten, auch wenn sie erst so kurz wieder zusammen waren. September dagegen wollte es langsamer angehen lassen, was ihn höllisch frustrierte, obwohl er denselben Ich-drücke-mich-vor-einer-endgültigen-Bindung-Tanz jahrelang mit seiner Ex-Freundin Loni getanzt hatte. Sie waren das Paar gewesen, das nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander konnte, bis Jake vor fast einem Jahr die Beziehung beendet hatte. Ein für alle Mal. Danach war er glücklicher Single gewesen, bis er im letzten September Nine wiederbegegnet war.
Ein Wiedersehen mit September im September.
Er hatte sie immer nur als Nine gekannt, nach dem Monat, in dem sie geboren war. Sie und ihr Zwillingsbruder August waren an zwei verschiedenen Tagen in zwei verschiedenen Monaten, denen sie ihre Namen zu verdanken hatten, zur Welt gekommen – er am einunddreißigsten August um kurz vor Mitternacht, sie sechs Minuten später am ersten September. Allerdings wurde August Auggie genannt und September war Nine. Nine Rafferty. Sie war einverstanden gewesen, zunächst einmal bei ihm einzuziehen, aber sie zog eine endgültige Entscheidung in die Länge, und obwohl er das verstehen konnte oder vielmehr, obwohl er versuchte, das zu verstehen, nein, obwohl er so tat, als würde er es verstehen, wollte er doch, dass ihre Beziehung an Fahrt aufnahm. Carpe diem. Genieße den Tag. Vielleicht war er noch nicht bereit für ein Baby, aber ganz bestimmt war er bereit für sie.
In diesem Augenblick klingelte sein Handy und riss ihn aus seinen Gedanken. Es lag oben auf seinem Schreibtisch, und als er aufs Display blickte, sah er den Namen Loni Cheever aufblinken.
»Mein Gott«, murmelte er und wappnete sich automatisch.
Konnte sie Gedanken lesen, dass sie ihn ausgerechnet jetzt anrief, da er seine gemeinsame Zukunft mit Nine plante, obwohl sie schon so lange kaum noch miteinander sprachen?
Seine Hand schwebte über dem Telefon. Loni, seine Highschool-, College- und Meiste-Zeit-seines-Lebens-Freundin. Die Freundin, die er nach jahrelangem Hin und Her endlich endgültig verlassen hatte. Die Freundin, zu der er – dummerweise – nach jener Frühlingsnacht mit September im letzten Jahr auf der Highschool zurückgekehrt war. Die Freundin, deren bipolare Störung über die Jahre immer schlimmer geworden war.
Er wollte nicht mit ihr reden.
Feigling, schimpfte er sich selbst.
Das Handy trällerte weiter auf seinem Schreibtisch vor sich hin. Wenn er nicht dranging, würde sie es später noch einmal probieren. Oder aber ihre Mutter. Loni hatte ihre endgültige Trennung um einiges besser weggesteckt als Marilyn Cheever. Für gewöhnlich rief Marilyn Jake an – und zwar immer dann, wenn Loni wieder einmal ins Krankenhaus eingeliefert worden war.
Wenigstens war es diesmal nicht die Mutter. Es sei denn, sie benutzte Lonis Telefon, was schon ein paarmal vorgekommen war, wenn sie ihm mitteilen wollte, dass Loni eine Überdosis Tabletten geschluckt hatte.
»Hallo?«, fragte er argwöhnisch, unmittelbar bevor der Anruf an die Mailbox weitergeleitet wurde.
»Hallo, Jake«, sagte Loni mit angespannter Stimme. »Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Du bist ja immer so zugeknöpft.«
Kein gutes Zeichen. Er würde sich nicht in ein weiteres Drama hineinziehen lassen, aber ihm war klar, wie labil sie oft war. Bis er sicher war, mit welcher Loni er sprach – mit der manischen oder mit der depressiven –, musste er vorsichtig sein.
»He, Loni. Wie geht es dir?«
»Nun, ich bin zumindest nicht im Krankenhaus«, erklärte sie mit einem kurzen Lachen.
»Das ist gut«, erwiderte er leichthin. Vor gar nicht langer Zeit war sie nämlich im Krankenhaus gewesen, und er war hingefahren, weil Marilyn ihn angerufen und darum gebeten hatte.
»Ich weiß, dass … ähm … Ich weiß, dass du jetzt mit Nine Rafferty zusammen bist. Aber deshalb rufe ich nicht an. Es ist nur so …« Sie seufzte. »Es ist schwer, gleichzeitig den geliebten Partner und einen Freund zu verlieren. Das ist alles.«
Jake ließ sich ihre Worte durch den Kopf gehen. Sie waren nicht wirklich Freunde gewesen, und seit ihrer letzten und endgültigen Trennung hatten sie einander weitestgehend links liegen gelassen, mal abgesehen von ihrem letzten Tief, das sie ins Providence Hospital gebracht hatte.
Bevor er sich eine Antwort überlegen konnte, fragte sie schon: »Wie geht es Nine? Ich habe gehört, sie sei niedergestochen worden? Stimmt das? Ist alles in Ordnung mit ihr?«
Er versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass es ihn störte, wenn Loni September bei ihrem Spitznamen nannte. Immerhin waren sie zusammen auf der Highschool gewesen. Alle hatten Nine zu September gesagt. Wenn er sie so genannt hatte, warum dann nicht auch Loni? »Es geht ihr so weit gut. Ich habe sie gepflegt.«
»Sie hat einen höllisch furchteinflößenden Job.«
»Manchmal ja, da hast du recht.«
»Aber sie kommt wieder ganz in Ordnung, oder?«
»Sicher.«
»Sie wohnt bei dir?«, fragte Loni beiläufig. »Du sagtest, du hättest sie gepflegt.«
Er behielt seinen Plan, dass Nine für immer zu ihm ziehen sollte, für sich und fragte stattdessen: »Wie geht es dir? Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ging es dir ja nicht so prima.«
»Ich habe meine Medikamente genommen, was mir hilft, mein seelisches Gleichgewicht zu finden, aber du weißt ja, wie das ist. Ich fühle mich dann immer so benommen. Nun ja, ich hatte auf alle Fälle jede Menge Zeit zum Nachdenken, und ich möchte dir sagen, dass es mir leidtut. Entschuldige, Jake, dass ich mich seit Jahren so aufführe. Es tut mir aufrichtig leid.«
»Ist schon okay«, wiegelte er ab.
»Nein. Das ist nicht okay. Das sagst du immer, auch wenn es alles andere als okay ist. Du sollst wissen, dass mir das klar ist. Es geht mir wirklich besser. Ich bin wieder ins Immobiliengeschäft eingestiegen, der Markt ist momentan ziemlich turbulent. Bevor ich … meinen letzten Abstecher ins Providence Hospital unternommen habe, habe ich einem frisch verheirateten Paar ein paar Angebote unterbreitet, und es hat letzte Woche tatsächlich ein kleines Haus mit zwei Schlafzimmern gekauft. So ein süßes Zuhause.«
»Das ist ja großartig«, pflichtete er ihr bei. Ihm war sehr wohl bewusst, dass der »Abstecher nach Providence« ein Euphemismus für »eine Überdosis genommen« war.
»Es war nicht leicht, die beiden zu sehen. Frisch verheiratet. Ich habe ständig gedacht, dass wir das hätten sein können. Aber deshalb rufe ich nicht an. Nun, vielleicht doch.« Sie lachte wieder. »Ich wollte mich einfach mal melden, das ist alles. Ich bitte dich um nichts. Wirklich nicht. Wollte nur mit einem Freund sprechen.«
»Du kannst mich jederzeit anrufen.«
»Ja …« In ihrer Stimme schwang Traurigkeit mit. »Ich werde versuchen, es nicht zu tun. Ich möchte dir nicht zur Last fallen.«
»Du fällst mir nicht zur Last, Loni. Es freut mich zu hören, dass es dir gutgeht.«
»Tatsächlich? Das freut dich? Entschuldige. Ich klinge so verzweifelt. Dabei möchte ich bloß, dass zwischen uns alles in Ordnung ist.«
»Es ist alles in Ordnung.«
»Ich weiß, dass es nicht mehr so sein kann wie früher auf der Highschool. Das geht natürlich nicht. Es ist nur so: Gestern, als ich das Paar beobachtete, dachte ich, dass du und ich, wir beide, etwas ganz Besonderes geteilt haben – zumindest, als wir noch auf der Sunset Valley High waren. Ich weiß, dass das fast alle Liebenden von sich behaupten, aber bei uns traf das wirklich zu. Ich erinnere mich an all die guten Zeiten, die wir hatten – die schlechten habe ich vergessen.«
Jake stellte fest, dass sich seine Hand ums Telefon krampfte, und lockerte den Druck. Er würde die schlechten Zeiten wohl niemals vergessen.
»Später wird mir dieses Telefonat schrecklich peinlich sein, das weiß ich jetzt schon.« Sie lachte schnaubend. »Trotzdem ist es mir das wert, allein schon, mit dir zu reden. Ich weiß, dass du das nicht hören willst, Jake, aber du bist mein Fels in der Brandung. Das bist du immer schon gewesen, und das wirst du auch immer sein.«
»Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.«
Loni zögerte lange, dann schloss sie mit vorgetäuschter Heiterkeit: »Nun, ich lege dann mal besser auf. Heute steht noch eine Hausbesichtigung auf dem Plan, gleich drüben bei der Highschool. Jedes Mal, wenn ich dort vorbeifahre, muss ich an dich denken. Wahrscheinlich habe ich deshalb angerufen.« Noch bevor er etwas erwidern konnte, sagte sie: »Pass auf dich auf, Jake«, dann unterbrach sie die Verbindung.
Jakes Blick war auf den Inhalt der obersten Schreibtischschublade geheftet, aber er sah nichts davon. Er dachte an Loni, wie sie einst gewesen war: blond, schön, clever, verwöhnt. Sie hatten sich immer wieder getrennt und waren immer wieder zusammengekommen. Wieder und wieder und wieder. Ihre Krankheit hatte sich während der Highschool nicht wirklich bemerkbar gemacht, erst auf dem College, vielleicht auch kurz danach, aber jetzt war sie voll zum Ausbruch gekommen. Auch wenn er es versucht hatte – er würde sie nicht retten können.
Mit dem Gefühl, langsam, aber sicher selbst verzweifelt zu sein, wählte er Nines Handynummer. Er mochte Lonis Fels in der Brandung sein, aber September war seiner.
In der Notaufnahme des General Hospital von Laurelton war es an diesem Dienstagvormittag ziemlich ruhig. September sah Wes, als sich die automatischen Glasschiebetüren öffneten und sie die Eingangshalle betrat. Er trug ein schwarzes Hemd, Jeans und wie immer seine Cowboystiefel.
»Wo ist das Opfer?«, fragte sie und schaute auf die geschlossene Hydrauliktür, hinter der sich, wie sie wusste, die mit Vorhängen abgetrennten Untersuchungskabinen befanden.
Sein Blick folgte ihrem. »Dahinter. Der Mann hat jemanden angerufen, der ihm etwas zum Anziehen bringen soll, bislang ist allerdings niemand eingetroffen. Er wollte gar nicht hergebracht werden, aber der Streifenpolizist, der als Erster bei ihm war, und die Sanitäter haben ihn in den Rettungswagen verfrachtet. Seinen Wagen haben wir bislang nicht gefunden. Er heißt Stefan Harmak, und –«
»Wie bitte?«
Wes, der auf die Hydrauliktür zugegangen war, blieb abrupt stehen und drehte sich zu September um. »Du kennst ihn?«
»Ja, ich kenne ihn«, knurrte September. »Stefan Harmak war mein Stiefbruder. Es sei denn, es gibt zwei in der Gegend, was ich stark bezweifle.«
»Wow.« Wes schüttelte den Kopf.
»Stefan.« September konnte es nicht fassen. »Was zum Teufel ist da passiert?« Sie erinnerte sich schwach daran, dass ihr Stiefbruder eine Stelle als Tutor übernommen hatte, in der Hoffnung, eines Tages Lehrer zu werden.
»Er hat dem Mann, der ihn entdeckt hat – einem Jogger –, erzählt, er sei einem bösen Streich zum Opfer gefallen. Gegenüber Lennon, dem Streifenbeamten, hat er allerdings behauptet, er sei überfallen und ausgeraubt worden.«
»Und was hältst du für wahrscheinlich?«
»Letzteres. Es sieht ganz danach aus, dass er mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt wurde. Mehrfach. Als ich ihn danach gefragt habe, hat er dichtgemacht.«
»Ich will mit ihm reden.«
»Da er ein Familienmitglied ist, solltest du dich eigentlich aus dem Fall raushalten. Zumindest werde ich dich begleiten.«
»Er ist kein Familienmitglied«, erklärte September mit Nachdruck.
»Erzähl das dem Richter.«
Wes drückte auf einen Knopf an der Wand, und die Hydrauliktür schwang mit einem leisen Zischen langsam nach innen. Niemand hielt sie auf, also betraten sie einen großen, rechteckigen Raum mit einer langen Reihe von Kabinen, von denen lediglich eine belegt war – offensichtlich die von Stefan. Vor der angrenzenden Wand befand sich eine Schwesternstation, an der gegenüberliegenden eine Doppeltür zu einem weiteren Gang.
September ging zu der Kabine, deren Vorhang zugezogen war, und fragte: »Stefan? Bist du da drin?«
Der Vorhang wurde zurückgeschoben, und eine Krankenschwester erschien. Stefan lag im Bett, die Hände vor der Brust verschränkt, einen Ausdruck grimmiger Entschlossenheit im Gesicht. Als er September entdeckte, stieg ihm die Röte in die Wangen.
»Was ist passiert?«, fragte sie und trat ein, dicht gefolgt von Wes. Die Schwester schloss den Vorhang hinter ihnen, nahm ein paar Utensilien von dem Schwenktisch an Stefans Bett und ließ das kleine Grüppchen allein.
»Hat Mom dich angerufen?«, fragte er.
September schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht mit Verna gesprochen.«
»Sie sollte mir meine Sachen bringen.« In seinen Augen loderte Zorn auf.
Stefan Harmak war ein schlaksiger Teenager gewesen, und als Erwachsener war er das noch immer. Seine Hände hatten stets zu groß gewirkt für seine schmächtigen Arme. Als Verna, seine Mutter, mit Septembers Vater, Braden Rafferty, verheiratet gewesen war, hatte sie ein großes Bild ihres Sohnes über den Kamin im Wohnzimmer der riesigen Villa gehängt – »Schloss Rafferty«, wie diese von Jake spöttisch genannt wurde. Mittlerweile hatte auch Nine diesen Namen übernommen. Doch schon damals – geschweige denn jetzt – war Stefan kein geeigneter Kandidat für ein solches Porträt gewesen. Er sah zwar nicht schlecht aus, aber sein Charakter, der sich deutlich in seinem Äußeren widerspiegelte, ließ doch sehr zu wünschen übrig. Stefan war launisch und verschlossen und mitunter regelrecht gemein.
Bradens dritte und aktuelle Ehefrau Rosamund hatte das Porträt entfernt und durch ein Bild von ihr selbst im frühen Stadium ihrer Schwangerschaft ersetzt. Das kleine Mädchen sollte im Januar geboren werden. Obwohl Rosamund darauf bestand, die Kleine Gilda zu nennen, war sich September sicher, dass es eine January werden würde, denn alle Kinder von Braden Rafferty waren nach den Monaten benannt, in denen sie das Licht der Welt erblickt hatten: September und August, ihr Bruder March und ihre älteren Schwestern July und May. Letztere war als Teenager ums Leben gekommen.
»Jemand hat dich an eine Basketballstange auf dem Gelände der Twin Oaks gefesselt?«, fragte September ihren Stiefbruder, als dieser in Schweigen verfiel.
Auf Stefans Kinn zeigte sich ein leichter Bartschatten. Er war zwei Jahre jünger als September, im Augenblick kam er ihr allerdings wesentlich jünger vor. Es war ihm stets schwergefallen, sich in die Gesellschaft einzufügen, denn er war ein hinterlistiger, verschlagener Bursche gewesen, von dem sie sich so weit wie möglich ferngehalten hatte.
»Der Bastard hat mich unter Drogen gesetzt, damit ich mich nicht wehren konnte, und dann hat er mir meine Brieftasche und mein Handy geklaut. Das ist doch wohl der Wahnsinn! Fesselt der mich einfach fast nackt an die Stange und haut ab«, stieß er hervor. Sein Gesicht wurde noch röter.
»Er hat dich unter Drogen gesetzt, um dir deine Brieftasche und dein Handy abzunehmen?«
Stefan blickte sie herausfordernd an, offenbar auf der Hut wegen ihres argwöhnischen Tons. »Genau. Er hat mich unter Drogen gesetzt und mich anschließend ausgeraubt.«
»Nachdem er dir Stromschläge verpasst hat.« September deutete auf die unauffälligen Spuren, die der Elektroschocker hinterlassen hatte. Wes hatte recht, der Täter musste mehrmals abgedrückt haben.
»Herrgott noch mal.« Stefans Gesicht war nun dunkelrot. »Ja! Er hat einen Elektroschocker benutzt, mich unter Drogen gesetzt und mich an die Stange gefesselt!«
Im Ballonni-Fall war das Opfer ebenfalls unter Drogen gesetzt worden, aber sie hatten keinerlei Anzeichen für den Einsatz eines Elektroschockers gefunden. Nach einem Raubüberfall hatte es nicht ausgesehen, vor allem nicht wegen des Plakats, das der Mann um den Hals getragen hatte: Ich muss für das bezahlen, was ich getan habe. Auch der Übergriff auf Stefan wirkte nicht wie ein Raubüberfall.
»Hat der Täter dir ein Plakat um den Hals gehängt?«, wollte September wissen.
»Das ist schon bei der Spurensicherung«, schaltete sich Wes ein.
»Der Scheißkerl hat das für lustig gehalten«, murmelte Stefan.
»Aber es war kein Scherz. Es war ein Raubüberfall«, stellte September klar.
»Es war beides! Das liegt doch auf der Hand!«, blaffte Stefan.
»Hat er dich dazu gezwungen, das Plakat zu beschriften?«, fragte sie.
Schlagartig wich sämtliche Farbe aus seinem knallroten Gesicht. Stefan wurde leichenblass.
»Was stand darauf?«, bohrte sie, als er nicht antwortete.
»Ich will, was ich nicht haben kann«, ließ sich Wes vernehmen, als Septembers Stiefbruder beharrlich schwieg.
»Das hat nichts zu bedeuten!« Stefans Nasenflügel bebten. »Mein Gott! Das ist doch völlig absurd!«
»Was hast du gemacht, als er dich angegriffen hat?«, fragte September.
»Wie meinst du das?« Stefan verschränkte die Arme fester vor der Brust und funkelte die beiden Detectives an. Als sie seinen Blick erwiderten, wandte er rasch den Kopf ab.
»Warst du an der Schule? Offenbar hat der Überfall in den frühen Morgenstunden stattgefunden.«
»Ja, es war noch recht früh.«
»Was hattest du dort um eine solche Zeit zu suchen?«, hakte sie nach.
»Was soll das, Nine? Ich war … Ich gehe gern früh zur Arbeit, und ich wollte vorher noch ein bisschen joggen.«
»Er hat Sie mit dem Elektroschocker angegriffen, als Sie … joggen waren?«, vergewisserte sich Wes.
»Nun, ich bin einen Augenblick stehen geblieben.«
»Dann hat er dich auf der Joggingstrecke eingeholt, dich mit dem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt und dich anschließend zu der Basketballstange gezerrt, wo er dir die Hände auf dem Rücken zusammengebunden hat, ist das richtig?«, fragte September.
»Ja.«
»Und wann hat er dir die Drogen verabreicht?«
Stefan schwieg.
»Hat er irgendetwas zu dir gesagt?«, drängte sie.
»Nein.«
»Joggst du häufiger?«, bohrte sie weiter. »Ich meine, kannte er deinen üblichen Tagesablauf?«
»Nein, ich jogge nicht häufiger … Mein Gott, Leute, lasst mich doch einfach in Ruhe –«
»Stefan!«, ertönte eine schrille Stimme auf der anderen Seite des Vorhangs.
Stefan verstummte. Wes sah September an und schob den Vorhang zur Seite. Vor ihnen stand, einen tiefbesorgten Ausdruck zur Schau tragend, Verna Rafferty – Stefans Mutter und Septembers ehemalige Stiefmutter. Ihr blondes Haar war zu einer Banane hochgesteckt, und sie trug einen braunen Hosenanzug mit einer weißen Bluse. Der Kragen stand offen, als habe sie sich hastig angekleidet. In einer Hand hielt sie einen grauen Matchbeutel, den sie fallen ließ, als sie Stefan in dem Krankenhausbett liegen sah. Offenbar war ihr vor Schreck die Kraft aus den Fingern gewichen.
»Oh, Liebling …« Sie schob sich mit ausgestreckten Armen an September und Wes vorbei, doch noch bevor sie ihren heißgeliebten Sohn umarmte, erstarrte sie und ließ die Arme sinken. »Was ist passiert?«, fragte sie mit tränenerstickter Stimme.
»Meine Sachen«, presste Stefan zähneknirschend hervor.
»Was ist damit geschehen?« Erschüttert drehte sie sich zu Wes um, der den Matchbeutel aufgehoben hatte und ihn Verna nun entgegenstreckte.
»Der Bastard, der mich überfallen hat, hat sie mitgenommen«, antwortete Stefan.
»Ach, Schätzchen.« Nun schlang sie doch die Arme um ihren Sohn, der dies stumm über sich ergehen ließ, doch seine Körperhaltung sprach Bände. »Ich habe dir etwas zum Anziehen mitgebracht.« Sie nahm Wes den Matchbeutel ab und legte ihn vorsichtig auf Stefans Brust. Ihr Blick schweifte zu September, und ihre Lippen begannen zu zittern.
Mit einiger Mühe riss sie sich zusammen und musterte ihre ehemalige Stieftochter herablassend, dann fragte sie auf ihre schnippische, Verna-typische Art: »Und was machst du hier?«
Kapitel zwei
Ich wurde für den Fall abgestellt«, teilte September ihrer ehemaligen Stiefmutter mit. Sie hatte erst vor kurzem erfahren, dass Verna und Braden bereits zu Lebzeiten ihrer Mutter eine Affäre gehabt hatten und dass Kathryn Rafferty eine Nachricht von Verna an Braden entdeckt hatte, die zu ihrem Autounfall und damit zu ihrem Tod führte. War Verna dafür verantwortlich? Nein. Nicht wirklich. Aber wären die Umstände anders gewesen, würde Septembers Mutter vielleicht noch leben. Außerdem hatte sie Verna nie leiden können.
»Raus mit euch. Ihr alle«, sagte Stefan, die Spannung zwischen den beiden Frauen ignorierend. »Ich will mich anziehen.«
September und Wes traten aus der engen Kabine, aber Verna holte sich erst einen weiteren Anraunzer von ihrem Sohn ab, bevor sie ebenfalls herauskam. Ihre Wangen waren gerötet vor Ärger – den sie augenblicklich an September ausließ.
»Wer hat ihm das angetan?«, zischte sie. »Was für ein kranker Mensch lässt meinen Sohn bei diesem Wetter fast nackt da draußen liegen?«
»Dieses Wetter« bezog sich auf Temperaturen um die acht Grad Celsius, was zwar nicht gerade warm war, aber Stefan wäre mit Sicherheit nicht an Unterkühlung gestorben wie Christopher Ballonni.
»Das wissen wir noch nicht«, antwortete September.
»Ich dachte, du bist ein Detective und befasst dich mit echten Verbrechen.«
»Das hier ist ein echtes Verbrechen, Ma’am«, betonte Wes.
Verna warf ihm einen durchdringenden Blick zu, dann musterte sie ihn von Kopf bis Fuß. Wes strahlte einen natürlichen Sexappeal aus, was auch Verna bemerkt haben musste, denn sie drehte sich, leicht aus dem Konzept gebracht, zu September um, bevor sie weiterzeterte: »Versuch ja nicht, mir weiszumachen, du wärst hergekommen, um Stefan zu helfen! Ich weiß, wie ihr Rafferty-Sprösslinge denkt. Ihr habt Stefan nie als euren Stiefbruder akzeptiert.«
Dieses Lied hatte Verna gesungen, sobald sie mit Braden verheiratet gewesen war. Und obwohl ein Körnchen Wahrheit darinsteckte, lag das eher an Stefan, der sich nicht in ihre Familie eingefügt hatte, und nicht daran, dass er kein Rafferty war. Stefan war nun einmal seltsam, verschroben und mürrisch.
Kurz überlegte September, ob sie den Christopher-Ballonni-Fall ansprechen sollte; die Story war in sämtlichen Nachrichten gebracht worden, und das Plakat um Stefans Hals legte nahe, dass es sich um ein und denselben Täter handelte – derselbe Modus Operandi. Allerdings hatte Wes zutreffend festgestellt, dass Stefan im entfernteren Sinne zur Familie zählte, und sobald Lieutenant D’Annibal davon erführe, würde er September mit Sicherheit von dem Fall abziehen.
Bevor das passierte, wollte sie so viele Informationen wie möglich zusammentragen.
Außerdem hatte sie keine Lust, Verna irgendwelche Auskünfte zu erteilen.
Stefan trat hinter dem Vorhang hervor, bekleidet mit einer schwarzen, locker fallenden Baumwollhose und einem weißen Anzughemd. »Mein Gott, Mom«, murrte er. »Konntest du mir nicht einfach ein T-Shirt mitbringen?«
Verna wandte ihre Aufmerksamkeit wieder ihm zu. Ihr Gesichtsausdruck wurde weicher. »Ich habe dir die Sachen mitgebracht, die du immer zur Arbeit trägst.«
»Glaubst du etwa, ich gehe jetzt zur Arbeit?«, fragte er.
»Nicht unbedingt … Ich finde nur, dass dir die Sachen so gut stehen.«
September betrachtete Stefans bleiches Gesicht und seinen zu einer schmalen Linie zusammengekniffenen Mund und konnte sich Vernas Meinung nicht anschließen.
»Herrgott noch mal, Mom«, brummelte dieser weiter und machte Anstalten, an September vorbeizugehen.
»Dann können wir ja jetzt nach Hause fahren«, schlug Verna vor.
»Wohnt ihr zusammen?«, fragte September leicht überrascht. Sie hatte gehört, dass Stefan in einem eigenen Apartment lebte.
»Nur vorübergehend«, beeilte sich dieser, mit bitterer Stimme zu versichern.
»Stefan wird sich weiterbilden«, erklärte Verna steif.
»Du arbeitest als Tutor an der Twin Oaks«, stellte September fest.
»Das weiß ich«, gab er unwirsch zurück.
Rasch fügte Verna hinzu: »Er möchte Lehrer werden. Er kann gut mit Kindern umgehen, nicht wahr, Stefan?«
Stefan bedachte seine Mutter mit einem missmutigen Blick.
»Nur fürs Protokoll: Du warst also heute früh auf dem Weg zur Arbeit, und dann hat dich dieser Räuber angegriffen, während du eine Runde auf der Joggingstrecke gedreht hast«, fasste September zusammen.
»Exakt.«
»Du warst joggen?« Verna starrte ihren Sohn entgeistert an.
»Ja, joggen, Mom. Ich weiß, dass du der Ansicht bist, ich würde nichts auf die Reihe bringen, aber ich arbeite an meinem Körper.«
Verna runzelte die Stirn, öffnete den Mund und klappte ihn wortlos wieder zu.
»Ich … bin zu Fuß zur Schule gegangen. Wir wohnen nicht weit weg. Und dann hat er sich auf mich gestürzt. Hat die Knarre auf mich gerichtet und mich gezwungen, dieses Zeug zu trinken.«
»Einen Elektroschocker«, korrigierte September. Stefan sah sie an, als wollte er widersprechen, doch dann überlegte er es sich anders und schwieg. »Die Spuren sind noch zu sehen«, fügte sie hinzu.
»Es hat höllisch wehgetan!«, platzte ihr Ex-Stiefbruder heraus.
»Er hat dich also gezwungen, den Becher mit den Drogen zu leeren, und als du dich geweigert hast, hat er dir mehrere Stromstöße verpasst. Und dann hat er dich ausgeraubt.«
»Muss ich eigentlich mit dir reden?«, fragte Stefan. »Ich glaube nicht. Offenbar willst du unbedingt eine Riesensache daraus machen. Ich habe das Zeug getrunken, weil er mir Stromstöße verpasst hat, und das Nächste, an das ich mich erinnere, ist, dass ich an eine Stange gefesselt zu mir kam und dass es verflucht kalt war!«
»Ich versuche nur, die Ereignisse in die richtige Reihenfolge zu bringen«, erklärte September.
»Nun, das ist dir hiermit gelungen.«
»Möchtest du etwas sagen?«, wandte sich September an Verna, die den Mund auf und zu klappte wie ein Fisch auf dem Trockenen.
»Ich verstehe nicht, weshalb du Stefan verhörst. Er ist hier das Opfer«, stieß diese erbost hervor.
»Wie sah er aus?«, schaltete sich Wes, an Stefan gewandt, ein.
»Er war, hm, drahtig. Trug eine Baseballkappe. Jeans und eine Jacke.«
»War er schwarz oder weiß?«, fragte Wes.
Stefan sah in die dunklen Augen des Detectives, dann wandte er den Blick ab, als würde er angestrengt nachdenken. »Weiß …«
»Sie klingen nicht allzu überzeugt«, bemerkte Wes.
»Es war dunkel. Ich konnte nicht viel erkennen. Aber … hm … Nein, ich bin mir sicher, dass er weiß war.« Er entfernte sich ein paar Schritte, als könnte er die Anwesenheit der Polizei nicht länger ertragen.
»Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches an dem Mann aufgefallen? Etwas, woran Sie ihn identifizieren könnten?«
»Nein.«
»Ist er vom Parkplatz gekommen?«
»Nein, ich glaube nicht.«
»Standen irgendwelche Fahrzeuge darauf?«, fragte September.
»Ich weiß es nicht! Wie oft soll ich das denn noch sagen? Ich weiß es nicht.«
»Worin befand sich das Getränk mit den Drogen? In einem Becher, einem Glas oder in einem anderen Gefäß?«, bohrte Wes weiter, ohne auf Stefans Ausbruch zu achten.
»Es gefällt mir nicht, dass ihr ihn so in die Mangel nehmt«, sagte Verna anklagend.
»Es befand sich in einer Art Thermoskanne«, antwortete Stefan. »Er sagte bloß: ›Trink!‹, und weil er derjenige mit der Waffe war, hab ich getan, was er von mir verlangte.«
Das ist der erste Satz, der der Wahrheit zu entsprechen scheint, dachte September.
»Sind wir jetzt fertig?«, fragte Stefan, als sowohl September als auch Wes schwiegen.
»Fast«, antwortete sie. »Die Vorgehensweise bei dieser Attacke ist ungewöhnlich«, stellte sie dann fest. »Die meisten Raubüberfälle laufen nach einem schlichten Schema ab: Der Täter richtet eine Waffe auf sein Opfer und befiehlt ihm, sein Geld rauszurücken, was dieses angesichts der unmittelbaren Bedrohung in den meisten Fällen auch sofort tut. Einen Elektroschocker zu benutzen und dann auch noch eine Droge, damit du diesen Satz schreibst – das alles braucht viel zu viel Zeit und weist darauf hin, dass es dem Täter um etwas ganz anderes ging.«
»Vielleicht ist er verrückt, und es gefällt ihm, Menschen unter Drogen zu setzen«, murmelte Stefan. An seinem Kinn zuckte ein Muskel.
»Vielleicht wollte er aus irgendeinem Grund, dass du ohnmächtig wirst. Vielleicht damit man dich bei Schulbeginn in diesem Zustand findet?« September musste wieder an Ballonni denken, den man in einer ähnlichen Situation vor seiner Dienststelle gefunden hatte, allerdings erfroren. Bei der Obduktion hatte man Rohypnol in seinem Nervensystem gefunden, ein starkes Sedativum. Sie hätte wetten können, dass man auch Stefan Harmak K.-o.-Tropfen verabreicht hatte.
»Er wollte nicht, dass ich mich wehre und ihn womöglich überwältige, also ist er dem zuvorgekommen.«
»Sieht eher danach aus, als wollte er dich demütigen«, wandte September ein.
September hätte Stefans Theorie vielleicht geschluckt, wäre ihr Stiefbruder ein Kerl von kräftiger körperlicher Statur gewesen, aber so … Sie bezweifelte, dass ein erwachsener Mann, bewaffnet mit einem Elektroschocker, glaubte, Stefan Harmak zusätzlich mit Drogen außer Gefecht setzen zu müssen.
Es ging hier definitiv um etwas ganz anderes, und sie nahm an, dass ihr Stefan genau das verheimlichte. Vielleicht war es ihm peinlich, vielleicht entsprach es auch einfach nur seinem verschlagenen Charakter – auf alle Fälle wusste er etwas.
Sie würde einen Blick auf das Plakat werfen, sobald die Kriminaltechniker damit fertig waren. Da auf Ballonnis Schild Ich muss für das bezahlen, was ich getan habe stand, waren Gretchen und sie bislang davon ausgegangen, dass dieser in eine Straftat verwickelt gewesen war, bloß hatten sie diesbezüglich nichts entdeckt. Es gab keine schwarzen Flecken in der Vergangenheit des Postboten; Ballonni schien ein ehrbarer Familienvater und umgänglicher Mensch zu sein. Selbstmord schied wegen der Kabelbinder aus, doch auch assistierter Suizid kam nicht in Frage – niemand aus Ballonnis Familie und keiner seiner Freunde hatte den Eindruck, dass der Mann suizidgefährdet war. Er war fest in die Gesellschaft integriert, hatte einen guten Job, eine liebevolle Ehefrau, einen Sohn im Teenager-Alter, mit dem er auf die Jagd und zum Angeln gegangen war, gleich mehrere gute Kumpel, ein hübsches Haus mit einer geringen Miete, und die Kreditkartenabrechnung war überschaubar.
September stellte fest, dass sie so gut wie nichts über das soziale Umfeld ihres Stiefbruders wusste. »Dieser Übergriff wirkt persönlich.«
»Der Bastard hat mich herausgepickt«, knurrte Stefan.
»Er hat auf dich gewartet.« September ließ sich diese Vorstellung durch den Kopf gehen. »Ich würde gerne mit deinen Kollegen sprechen.«
»Nein!« Stefan schnappte nach Luft. »Sie dürfen das nicht wissen! Das ist viel zu peinlich!«
»Du kannst davon ausgehen, dass es in den Nachrichten gebracht wird«, hielt ihm September entgegen.
»Allmächtiger.« Stefan fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, und auf Vernas Gesicht spiegelte sich Entsetzen.
»Mit welchen Kollegen hast du engeren Kontakt?«, erkundigte sich September. »Vielleicht kann ich mit ihnen beginnen.«
»Mit niemandem. Das sind alles verheiratete alte Frauen.« Stefan blitzte September an, als sei das ihre Schuld. »Es ist bloß ein Job.«
»Ich werde Amy Lazenby anrufen«, beschloss September. Sie hatte sich zu Herbstbeginn schon einmal mit der Rektorin der Grundschule unterhalten.
»Du kennst sie?«, platzte Stefan erstaunt heraus. »Sprich nicht mit ihr, sie ist ein Miststück.«
»Sie wird so oder so davon erfahren, also kann ich sie genauso gut gleich informieren, bevor sie es in den Nachrichten hört.«
»Die Nachrichten …« Stefan schloss die Augen.
»Es ist auf dem Schulgelände passiert«, erklärte September geduldig. Ihr Stiefbruder benahm sich, als könnte man den Vorfall einfach unter den Teppich kehren, aber so funktionierte das nicht.
»Mit wem sollen wir reden?«, fragte Wes.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Stefan zögernd. »Am besten mit niemandem.« Er schloss die Augen, und es hatte den Anschein, als würde er gleich zusammenbrechen.
»Ist es nicht eure Aufgabe, das herauszufinden?«, herrschte Verna Nine an.
Im Augenblick war nicht mehr viel aus ihrem Stiefbruder herauszuholen, dachte September, daher lenkte sie ein: »Also gut, Stefan. Ich rufe dich später an.«
Wes und sie verließen zusammen das Krankenhaus. Während sie zu dem Parkplatz vor der Notaufnahme gingen, fragte sie ihn: »Und, wie gefällt dir meine Stieffamilie?«
»Ganz reizend. Du kannst dich glücklich schätzen.«
September grinste schief. »Du hast Rosamund noch nicht kennengelernt.«
»Möchte ich Rosamund denn kennenlernen?«, fragte Wes.
»Das bezweifle ich. Sie hat Vernas Platz eingenommen und ist damit meine aktuelle Stiefmutter. Sie ist etwa in meinem Alter, und sie ist schwanger, das Baby soll im Januar zur Welt kommen. Du weißt ja Bescheid über die Namensgebung in unserer Familie.«
»Ihr seid alle nach Monaten benannt.«
»Die Idee meines Vaters«, erklärte September. »Unser Halbbruder, von dessen Existenz wir kürzlich erst erfahren haben, hatte Glück – er ist diesem Irrsinn entkommen. Rosamund glaubt übrigens, sie könne ihr kleines Mädchen Gilda nennen, aber wir sind überzeugt davon, dass es am Ende January heißen wird.«
»Und ich dachte immer, meine Familie hätte einen Knall, aber ihr Raffertys schlagt uns um Längen.«
»Wir schlagen alle«, gab September seufzend zu und näherte sich ihrem silbernen Honda Pilot. »Hast du das mit dem Brand mitgekriegt? Jemand hat in der Garage meines Vaters Feuer gelegt, mit Benzin und Streichhölzern. Die Flammen haben aufs Haus übergegriffen.«
»Gibt es schon einen Verdächtigen?«, fragte Wes mit plötzlich erwachendem Interesse.
»Nein. Nicht wirklich. Mein Vater und mein Halbbruder haben jemanden davonlaufen sehen, aber sie haben ihn nicht erkannt. Meine Schwester July glaubt, es sei Stefan gewesen.«
Wes hatte sich seinem Range Rover zugewandt, doch jetzt drehte er sich um. »Warum?«
»Warum sie das denkt? Weil sie ihn nicht leiden kann. Weshalb sollte er so etwas tun?«
»Weshalb er so etwas tun sollte? Genau das ist doch die Frage!«
September schüttelte den Kopf. »Nein, die Frage ist eher, warum ihn jemand unter Zuhilfenahme von Drogen und eines Elektroschockers dazu zwingt, Ich will, was ich nicht haben kann auf ein Plakat zu schreiben und es sich um den Hals zu hängen, bevor er ihn fast nackt an eine Basketballstange vor der Schule fesselt, an der er arbeitet.«
Wes sah sie nachdenklich an, dann sagte er: »Was will er denn, was er nicht haben kann?«
»Was hat Christopher Ballonni verbrochen, der allseits beliebte Postbote, dass ihn jemand Ich muss für das bezahlen, was ich getan habe aufschreiben lässt?«
»Ich hatte darauf gewartet, dass du Stefan auf den Ballonni-Fall hinweist«, sagte Wes.
»Die Parallelen sind nicht zu übersehen, aber ich wollte zuvor mit D’Annibal reden.«
»Es wird ohnehin in den Nachrichten kommen. Lecks gibt es überall, und die Ballonni-Story hat ganz schöne Wellen geschlagen.«
»Dann werde ich eben noch heute mit dem Lieutenant reden«, versicherte ihm September.
Wes nickte und setzte sich wieder in Bewegung, während September in ihren Pilot stieg. Sie freute sich nicht auf das bevorstehende Gespräch mit D’Annibal.
Ihr Handy klingelte. Rasch fischte sie es aus ihrer Umhängetasche und warf einen Blick aufs Display. Sandler, ihre Partnerin.
Lächelnd meldete sie sich. »Und, wie gefällt dir dein Zwangsurlaub?«
»Grauenvoll.« Gretchen war dafür bekannt, dass sie niemals ein Blatt vor den Mund nahm. »Wo steckst du?«
»Ich habe heute Morgen wieder angefangen zu arbeiten. Es gibt eine interessante Entwicklung im Ballonni-Fall.«
»Ach?«
»Glaubst du, ich darf mit dir darüber reden?«
Gretchen stieß einen unterdrückten Fluch aus, was September zum Grinsen brachte. Es war so leicht, ihre Partnerin auf die Palme zu bringen.
»Wir treffen uns am Bean There, Done That«, schlug sie vor.
»Und wehe, du redest nicht«, drohte Gretchen.
»Ich kann nur ein paar Minuten bleiben«, erwiderte September und legte den Gang ein.
Das Bean There, Done That war ein Coffeeshop, den die beiden bevorzugten, auch wenn er nicht ganz in der Nähe des Präsidiums gelegen war. Es dauerte eine Weile, bis September einen Parkplatz gefunden hatte, und als sie endlich hineinging, stellte sie fest, dass Gretchen eine der heißbegehrten Sitznischen ergattert hatte.
»Ich musste förmlich darum kämpfen«, erklärte sie, »deshalb darfst du dich jetzt anstellen und die Getränke besorgen.«
»Kein Problem«, sagte September und schaltete entgegen ihrer Gewohnheit ihr Handy aus, um wenigstens ein paar Minuten ungestört mit Gretchen reden zu können. Dann reihte sie sich in die Schlange vor dem Tresen ein.
Sie stand hinter einem gehetzt wirkenden Mann im Geschäftsanzug und einem Mädchen, das so vertieft in sein Smartphone war, dass September es praktisch nach vorn schieben musste, wenn es weiterging.