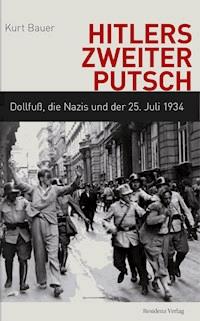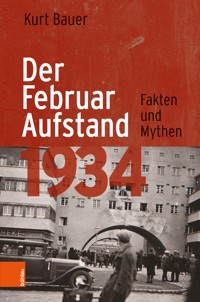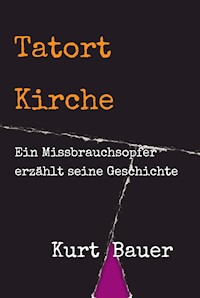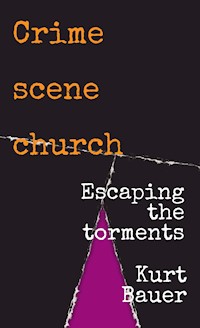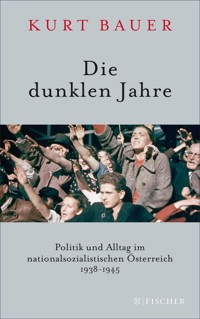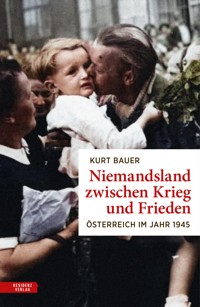
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frühjahr 1945: Österreich wurde zwischen den vorrückenden Armeen der alliierten Mächte für ungewisse Zeit in ein politisches Niemandsland verwandelt. Es herrschten Chaos, Hoffnung und Angst. Kurt Bauer beschreibt die unterschiedlichen Schicksale und Erfahrungen der Menschen in diesem turbulenten Jahr anhand von Alltagsgeschichten. Er erzählt von dem Wehrmachtssoldaten, der auf verschlungenen Pfaden in die Heimat zurückgelangt; von dem jüdischen Emigranten des Jahres 1938, der nach seinem erzwungenen Exil als Soldat der siegreichen Armee seine Heimatstadt wiedersieht, aber das alte Wien seiner Kindheit nicht mehr findet; von der jüdischen Frau, die den Krieg in Wien überlebt hat und nun so rasch als möglich in die USA will … Ein facettenreiches und packendes Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurt Bauer
Niemandsland zwischen Krieg und Frieden
Kurt Bauer
Niemandsland zwischen Krieg und Frieden
Österreich im Jahr 1945
Residenz Verlag
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
www.residenzverlag.com
© 2025 Residenz Verlag GmbH
Mühlstraße 7, 5023 Salzburg
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.
Keine unerlaubte Vervielfältigung!
Umschlaggestaltung: Boutiquebrutal.com
Umschlagfoto: Otto Croy, ÖNB
Umschlagfotocolorierung: Halina Stelmach
Alle Fotos Innenteil: Otto Croy, ÖNB
Typografische Gestaltung, Satz: Lanz, Wien
Lektorat: Eva-Maria Kronsteiner
ISBN ePub:
978 3 7017 4752 8
ISBN Printausgabe:
978 3 7017 3631 7
Ich widme dieses Buch meiner Bea. Und ich widme es dem Andenken ihrer Eltern Paula und Walter Bürkle, für die 1945 – wie für viele Millionen Menschen – ein Schlüsseljahr ihres Lebens war.
Alle unsere Kräfte sind aufs Überleben ausgerichtet, der Selbsterhaltungstrieb zwingt einen dazu. Die Jagd nach Lebensmitteln, das Anstellen um Brot, um Petroleum und Wasser, das sind Existenzfragen geworden (…). In der Ernährungsfrage hilft einem niemand, da ist jeder auf seinen eigenen Witz angewiesen, aber gerade diese Schwierigkeiten sind es, die uns letzten Endes helfen, die chaotischen Zeiten zu überstehen.
Wer jetzt krank ist, der ist schlimm dran. Jetzt ein eitriger Blinddarm oder eine Gallenkolik und man ist verloren. Man findet keinen Arzt, es gibt keine Medikamente. Wer alt und allein ist, geht ohne fremde Hilfe einfach unter. Wer ängstlich oder zu moralisch ist, ist gleichermaßen verurteilt. Der Hunger ist es nicht allein, Schmerz um den Verlust eines Angehörigen, der Verlust seiner ganzen Habe, die Ungewissheit über das Schicksal der Vermissten, die Existenzangst der vielen kleinen Parteimitläufer. Viele Wiener starben infolge von Gasgebrechen in den beschädigten Häusern, wurden von zusammenstürzenden Hausruinen begraben, kamen durch explodierende Blindgänger um, wurden Opfer der Übergriffe fremder Soldaten. Schändungen, Deportationen, Verschleppungen, Denunziation sind an der Tagesordnung. Man kann der eigenen Regierung nicht trauen. Um Hilfe kann man sich an niemanden wenden, keiner ist zuständig. Man ist der Willkür ausgesetzt. Wer die letzten Tage gelebt hat, der hat schon lange gelebt. Und der Krieg ist ja noch nicht aus, wir sind nur im Feindesland, oder besser gesagt: im Niemandsland.
Adolfine Schumann, Tagebucheintrag vom 25. April 19451
Inhalt
Vorbemerkungen
Mein 45er Jahr
Frühling
Heimwege
Fluchtbewegungen
Kampfzone
Nach dem Sturm
Befreiungen
Hinterland
Němci
Gefangene
Sommer
Ende, Anfang
Heimwege
Displaced
Nach Russland
Denkschrift
Reisen
Landsommer
Herbst
Alltag
Politik
In Russland
Warten
18. Oktober 1945
Letzte Frist
Heimkehr und nicht
Demokratie
Winter
3. Dezember 1945
Tour-retour
Demokratie
Entlassen
Überleben
Ende
Chronik März bis Dezember 1945
Akteurinnen und Akteure
Abkürzungen
Literatur
Quellen
Anmerkungen
Vorbemerkungen
Dies ist kein wissenschaftliches Buch, auch wenn es Fußnoten enthält. Das bedeutet nur, es ist nichts frei erfunden: Ich habe gehört, was andere erzählt haben, und erzähle, was ich von anderen gehört habe. Es sind alltägliche Geschichten von alltäglichen Menschen in wenig alltäglichen Zeiten, aber es ist keine Alltagsgeschichte. Und schon gar nicht ist es eine politische oder Sozialgeschichte des Jahres 1945. Diesen Anspruch stellt dieses Werk nicht. Es ist letztlich meiner unbändigen Neugier auf gelebtes Leben und der Lust am Erzählen entsprungen.
Einige editorische Hinweise: NS-Begriffe schreibe ich häufig ohne Anführungszeichen. Texte sollen übersichtlich, verständlich, lesbar sein. In diesem Sinne scheint es mir nicht zielführend, die gesamte Begrifflichkeit unter politisch korrekte Gänsefüßchen zu setzen. Dieser pragmatische Umgang – der aber beispielsweise am »Führer« haltmacht – bedeutet nicht, dass ich mich in irgendeiner Weise damit identifiziere. Bei wörtlichen Zitaten aus den Quellen korrigiere ich offensichtliche Tipp-, Flüchtigkeits- und orthografische Fehler stillschweigend. Sowohl Quellen- als auch Literaturzitate werden der heute gültigen Rechtschreibung angepasst, stilistische Eigenheiten hingegen beibehalten.
Vielen Menschen und Institutionen bin ich zu Dank verpflichtet. Zuallererst ist an dieser Stelle die »Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen« des Instituts für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien mit ihren reichhaltigen Beständen zu nennen. Stefan Eminger vom Niederösterreichischen Landesarchiv hat mir nicht nur wichtige Quellenbestände erschlossen, sondern auch die beklemmenden Erinnerungen seines Vaters sowie dessen beeindruckende Forschungsarbeit zur Verfügung gestellt. Hannes Schönner (Vogelsang-Institut), Florian Traussnig (Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung), Peter Egger (Mauthausen Memorial), Barbara Stelzl-Marx (Professorin der Uni Graz und Leiterin des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung) sowie der Vorarlberger Landeshistoriker Meinrad Pichler haben mich mit Hinweisen auf interessante Quellen und Literatur unterstützt.
Mit dem Residenz Verlag, allen voran Claudia Romeder, habe ich Büchernärrinnen und -narren nach meiner Façon gefunden. (Ich hoffe, euer verlegerischer Mut zahlt sich aus!) Danke ganz besonders an Eva-Maria Kronsteiner für ihr sorgfältiges Lektorat.
Bea danke ich für alles Übrige und mehr: Liebe, Geduld, Unterstützung im Alltag, unendlich viel Verständnis – und dass sie meinen »Vorlesungen« der einzelnen Kapitel so intensiv gelauscht und sie mit konstruktiver, wohlwollender Kritik begleitet hat.
Mein 45er Jahr
Mein 45er Jahr gibt es nicht. Ich bin Ende März 1961 zur Welt gekommen. Ziemlich genau 16 Jahre nach jenem Tag, als die 3. Ukrainische Front die »Reichsschutzstellung« im Osten überrollt hatte, ins Burgenland und südliche Niederösterreich eingedrungen und unaufhaltsam auf Wien vorgestoßen war. Aber ähnlich wie Walter Kempowskis Echolot sendet mein Bewusstsein Schallwellen auf den dunklen, schlammigen Bodensatz meiner Existenz. Und dieser Bodensatz, das ist eben das ominöse Jahr 1945, das ich nicht erlebt habe, das mir aber trotzdem unheimlich gegenwärtig ist, nah und fern zugleich, längst abgetan und nie überwunden. Jenes Jahr, von dem die Alten so oft, so viel, so eigentümlich gehemmt und erschreckend offen zugleich sprachen.
Was mich betrifft, ist das, was mir damals erzählt wurde, in gewisser Weise Teil meiner selbst geworden, ererbte, auf mich überkommene und von mir letztlich als Erbschaft auch akzeptierte Erinnerung. Aber das mag die Berufskrankheit eines Historikers sein: sich mit Zeitläuften zu solidarisieren, die man zum Glück nicht persönlich erlebt hat.
Das chaotische Durcheinander von Erinnerungssplittern, Anekdoten, Halberinnertem und Halbvergessenem, von Fakten, Mythen und Legenden, das ich mit mir herumtrage, will ich hier nicht ausbreiten. Aber zumindest die Geschichte von den beiden Karls möchte ich erzählen. Der eine, Karl Kankovsky mit Namen, geboren im Jänner 1908, war ein Kind des Roten Wien. Sein Vater Karel, aus Böhmen zugewandert, Schmied von Beruf (wie das Wiener Adressverzeichnis2 von 1927 ausweist), wohnhaft in der Inzersdorfer Straße in Favoriten, dem bevorzugten Wohnquartier der in der Monarchie hunderttausendfach nach Wien übersiedelten Tschechen.3 Der Sohn Karl wurde ebenfalls Metallfacharbeiter, daneben war er ein leidenschaftlicher, talentierter Fußballer, der es immerhin bis in die zweithöchste Liga schaffte. Der phänomenale Ruf des Wiener Fußballs in jenen Tagen (Stichwort: »Wunderteam«) führte dazu, dass Karl Kankovsky mitten in der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre als eine Art Halbprofi nach Lille in Nordfrankreich gehen konnte. Das heißt, er arbeitete in einem der dortigen Maschinenbauwerke, war zugleich im Fußballteam des Werks tätig und verdiente, für damalige Begriffe, gutes Geld. Das Katastrophenjahr 1934 verbrachte er in Frankreich, hörte nichts vom Kanonendonner des 12. Februar – von dem er gleichwohl oft sprach –, ging erst einige Jahre später nach Wien zurück. Am 15. März 1938 stand er, der Erz-Rote, jubelnd am Heldenplatz. Er hat das nie verheimlicht. Nicht, weil man Hitler so sehr geliebt habe, sondern weil alle froh gewesen seien, dass es mit der »schwarzen Dollfuß-Schuschnigg-Bande« endlich aus gewesen sei.4 Und weil es Hoffnung gegeben habe, nicht auf Freiheit – das wusste er –, aber immerhin auf Arbeit und Brot, soziale Sicherheit und Lebenschancen.
Im Krieg kam Karl Kankovsky glimpflich davon. Er war ein hochspezialisierter Dreher und damit »u. k.« gestellt, das heißt »unabkömmlich«. Als sich das Ende näherte, wurde er trotzdem zum Volkssturm einberufen, Hitlers letztem Aufgebot. Aber es hätte nicht zu einem Karl Kankovsky gepasst, sich in letzter Minute für nichts und wieder nichts abknallen zu lassen. Er entzog sich dem Einsatz und floh vor dem Eintreffen der Russen aus Wien. (Seine Frau war, wenn ich mich recht erinnere, mit der Tochter schon vorher evakuiert worden.) Mit meinem späteren Wissen frage ich mich, wie Karl den »Kettenhunden« der Feldpolizei entgehen konnte, die in den Flüchtlingskolonnen nach wehrfähigen, gesunden Männern Ausschau hielten, die dem Kriegseinsatz zu entkommen versuchten. Jedenfalls kam er durch.
Das Dorf, in dem er letztlich landete, heißt St. Peter am Kammersberg, malerisch in einem einsamen Seitental des Murtals gelegen, zu Füßen des fast 2500 Meter hohen Greims, der stolz über der Region thront. Er begab sich zum Bürgermeister und bat um Kost und Quartier. Und damit kommt der zweite Karl dieser Geschichte ins Spiel, Karl Gerold, mein Großvater. Der war nämlich zu diesem Zeitpunkt Bürgermeister hier, also ein Nazi – »aber ein guter Mensch«, wie Karl Kankovsky stets betonte. Karl Gerold fragte nicht lange nach irgendwelchen Papieren, wohl ahnend, dass jener »Weaner« dem Volkssturm entflohen sein musste. Vielmehr brachte er ihn im eigenen und später in anderen Häusern des Ortes unter und versorgte ihn mit den notwendigen Lebensmittelmarken.
Ich muss betonen, dass mein Großvater damit Mut bewies und sich über strikte Befehle hinwegsetzte, denn selbst noch am allerletzten Kriegstag drohte der steirische Gauleiter, »dass vor dem Standgericht angeklagt wird, wer Fahnenflüchtigen und Drückebergern Unterkunft gewährt«.5 Karl Kankovsky wusste, wie die Dinge standen, und war meinem Großvater deshalb lebenslang dankbar für seine couragierte Hilfe.
Die beiden Karls waren gleich alt (geboren jeweils im Jänner 1908). Sonst verband sie nach ihrer Herkunft und Lebensgeschichte wenig. Karl Gerold war der Sohn eines Gutsbeamten (»Sägeplatzmeister«) aus dem obersteirischen Kalwang. Er hatte zuerst selbst in diesem Sägewerk gearbeitet, dann bei seinem älteren Bruder den Kaufmannsberuf erlernt und schließlich 1934 ein Haus samt Gemischtwarenhandlung und angeschlossener kleiner Landwirtschaft am oberen Marktplatz in St. Peter am Kammersberg erworben. Schon am 1. März 1931 war Karl Gerold unter der Nummer 441 537 der NSDAP beigetreten und hatte sich auch nach dem NS-Verbot in Österreich (Mitte 1933) weiterhin als Zellenleiter für die nunmehr illegale Partei betätigt. Im März 1939, ein Jahr nach dem Umbruch, wurde er zum Bürgermeister von St. Peter ernannt, im Oktober 1942 zur Wehrmacht einberufen, allerdings im Mai 1944 wegen eines Herzfehlers entlassen, woraufhin er bis Kriegsende wieder das Bürgermeisteramt übernahm.
Karl Kankovsky blieb den Sommer 1945 über in der Obersteiermark, wo die Ernährungslage hundertmal besser war als in der Stadt. Irgendwann im Frühherbst – vielleicht zu Schulbeginn – kehrte er mit Frau und Tochter zurück nach Wien. Später, in den 1960er Jahren, als meine Großeltern in ihrem Haus neben dem Kaufmannsladen noch eine Fremdenpension einrichteten, kam Karl Kankovsky oft und gerne auf Sommerfrische nach St. Peter, und er kam auch nach dem frühen Tod von Karl Gerold noch viele Jahre – längst ein herzlich aufgenommener guter Freund der Familie.
Eine Geschichte, die ich von Karl Kankovsky habe, versöhnte mich ein wenig mit dem Nazitum meines Großvaters. Ganz zu Ende des Krieges langte ein Befehl des steirischen Gauleiters Uiberreither ein: Die im Ort anwesenden Fremdarbeiter könnten gefährlich werden und seien deshalb – zu erschießen. War ein solches Verbrechen auch nur auszudenken? Karl Gerold begab sich in der Dunkelheit zu den Quartieren der in der Gemeinde tätigen Fremdarbeiter, warnte sie eindringlich und forderte sie auf, in den nächsten Tagen auf der Hut zu sein – für den Fall, dass jemand käme, um sie zu verhaften und abzuführen. Und dergleichen geschah auch nicht, zumindest nicht in St. Peter.6
Wie erging es meinem Großvater nach dem Zusammenbruch des NS-Regimes? Vorerst scheint das Leben mit seinen Pflichten und Sorgen weitgehend unbehelligt weitergegangen zu sein. Noch im Mai bescheinigte die britische Militärverwaltung dem Gemischtwarenhändler Karl Gerold, sein Motorrad der Marke NSU »for supply« benützen zu dürfen. Ebenfalls im Mai bestätigte ihm das Ernährungsamt des »Aktionsausschusses des ›Freien Österreich‹« in Murau, als »Erfassungsverteiler in Heu und Stroh« beauftragt zu sein, die vorhandenen Lagerbestände zu überwachen.7 Offenbar war die Murauer Widerstandsbewegung8 nicht zimperlich – oder zumindest sehr pragmatisch –, wenn es um ehemalige Nazis ging.
Es muss im Juni 1945 gewesen sein, als ein britisches Militärfahrzeug nach St. Peter kam. Mehrere prominente Nazis des Ortes wurden darauf verladen und weggebracht,9 unter anderem eben auch Karl Gerold. Für meine Mutter, Gretl, damals acht Jahre alt, war das Erlebnis prägend. Oft und oft hat sie es erzählt und schließlich auch aufgeschrieben: »Als ich von der Schule nach Hause ging, kam beim Nachbarhaus der N. N. auf mich zu, lachte, zeigte mit einer Handbewegung quer zu seinem Hals und sagte: ›Das wird deinem Vater jetzt passieren!‹«10
So schlimm kam es nicht. Karl Gerold wurde, wie viele andere, in das britische Anhaltelager Camp 373 in Wolfsberg, Kärnten, gebracht.11 Dort blieb er bis Ende April 1946. Als verhältnismäßig wenig Belasteter landete er danach im Camp 203 in Weißenstein bei Villach. Mitte September 1946 wurde er von den Briten entlassen, anschließend aber noch bis Ende des Jahres zur Arbeit im Kohlenbergwerk Seegraben bei Leoben verpflichtet.
Mit einem Mal hatte meine Großmutter Wilhelmine (»Minnerl«) Gerold die gesamte Last für das große Haus, das Geschäft, die Landwirtschaft und die beiden kleinen Mädchen zu tragen. Sie wurde krank, hatte starke Ischiasbeschwerden. In einer Eingabe vom Sommer 1946 schreibt sie: »Mein Gesundheitszustand hat sich durch die größere Belastung, die durch den Anbau und die Pflege der Felder an mich gestellt werden, nur verschlechtert. Der Ablieferungspflicht der Ernte möchte ich aber zumindest gerecht werden. Zudem die gleichbleibende Anspannung in der Geschäftsführung.«
Die Belastung muss tatsächlich enorm gewesen sein. Die erhalten gebliebenen hektografierten, oft mehrmals wöchentlich einlangenden Rundschreiben vom Wirtschaftsamt der Bezirkshauptmannschaft Murau und von anderen amtlichen Stellen geben einen Eindruck vom kaum zu bewältigenden Aufwand mit Lebensmittelkarten und regelmäßigen Lagerbestandsmeldungen sowie Anweisungen bis ins kleinste Detail zur »Zündholzbewirtschaftung«, »Ausgabe von Brennspiritus«, zu »Nähmittel-Bezugsscheinen«, »Preisen für Kalkeier«, Bestimmungen über die Abgabe von »ARCANA Ozon Mundwasser«, »Ölkuchenverteilung«, »Topfreiniger aus Draht«, »Kürzung der Brotration« etc. pp.12
Freilich, es gab Unterstützung aus der Familie für Minnerl Gerold. Zwei Tanten aus Graz standen eines Tages da und packten mit an. Gretl, meine Mutter, erinnerte sich an die »fleißige Tant Ella (…) und die sangesfreudige, lustige Tant Ridi«. Letztere wäre gerne Sängerin geworden, wurde es nicht, sondern ging mit einem Besatzungssoldaten nach Kanada. Die britische Armee trat auch in St. Peter in Erscheinung. Die Soldaten quartierten sich im benachbarten Gasthaus ein. Gretl: »Unsere Dienstmädchen, allen voran die N. N., flirteten mit den Engländern, weil es gab ja keine Arbeitsdienstler mehr. Eigentlich waren es ja Schotten, die machten samstags am Marktplatz eine Parade. Sie hatten Kilts an und schottische Mützen auf, marschierten [über den Platz] und bliesen auf ihren Dudelsäcken. Mir gefiel das. In Burgstallers Waschküche (…) kochten die Schotten ihr Essen, weil es immer herausdampfte beim offenen Fenster. Ich bin immer beim Gartentor gestanden und hab durch die Holzstäbe gespäht. Oft hat einer gezeigt, ich soll hinüberkommen. Zuerst habe ich mich nicht getraut, aber eines Tages bin ich hingelaufen, und da hat mir dann einer ein Packerl Keks in die Hand gedrückt.«
Erinnerungssplitter der Achtjährigen: Die Wehrmachtssoldaten, die auf dem Rückzug im Garten lagerten, sich Zivilkleider besorgten, ihre Uniformen verbrannten. Ein graues Auto blieb zurück, ein »Schwimmer«,13 wie es hieß. Jahrelang stand er herum. Hinter dem Lenkrad unternahmen die Kinder lange Ausfahrten in die herrlichsten Phantasielandschaften. Und – war es vor oder nach Kriegsende? – ein nicht enden wollende Zug von Flüchtlingen, der durch den Ort zog. Man hielt Türen und Fenster fest verschlossen, lugte verstohlen zwischen den Balken der Fensterläden durch. »Männer, Frauen und Kinder mit Pferdewagen, Leiterwagen und Kinderwagen, zu Fuß und auch mit Pferden, hochbepackt.« Die Baracken des RAD-Lagers14 am Ortsrand, zuerst plötzlich leer, dann auf einmal wieder voll, diesmal von Flüchtlingen, Menschen mit seltsamer Aussprache und fremdartigem Verhalten. Die meisten gingen bald wieder weg, manche blieben ihr Leben lang im Ort. Einquartierungen gab es auch im Elternhaus, zwei Frauen mit je zwei Kindern. Zum Glück spuckten die Kleinen die Tabletten aus, die Gretl ihrer Mutter gestohlen und ihnen gegeben hatte, als seien es Bonbons.
Gendarmerie-Inspektor Zechner, der eine Hausdurchsuchung nach versteckten Lebensmitteln machte. Die Dose Orangen-Zitronen-Spalten – im Wäscheschrank gut, aber nicht gut genug versteckt – fand er zu Gretls Entsetzen. Und gleich darauf eine zweite Dose: Kaffee. Sie fiel dem Gendarmen beim Herausnehmen aus der Hand, die Kaffeebohnen kullerten über den Boden. Der Inspektor barsch zu Gretl: »Klaub das zusammen!« Gretl, empört über die Wegnahme der Zuckerln, weigerte sich entschieden, so musste der Herr Inspektor sich selbst bücken. Zum Glück vergaß er, durch den Ärger wegen des Malheurs abgelenkt, ganz unten in den Kasten reinzuschauen. Stoffe hätte er dort finden können, orange, mit Blümchen, daraus schneiderte Mutti Kleider und Blusen für ihre beiden Mädchen. Was er auch nicht fand: den großen Sack mit Reis auf dem Dachboden, gut versteckt in einer Truhe unter einem Haufen von altem Gewand.15
Zugegeben, das alles klingt harmlos, wenn man die Ereignisse in anderen Teilen Österreichs, vor allem im Osten, bedenkt. Meine Heimat, der Raum Murau, blieb von dramatischen Kriegsereignissen weitgehend verschont: einige Notabwürfe alliierter Bomber, gezählte drei abgeschossene Flieger, ein katastrophaler Tieffliegerangriff auf die Schmalspurbahn mit fünf Toten und zahlreichen Schwerverletzten, viel mehr war an Bemerkenswertem nicht zu verzeichnen. Natürlich die vielen Flüchtlinge, die sich in den letzten Kriegswochen hier sammelten. Und die Massen an Soldaten, die ab dem 7. Mai durchzogen.16 Schließlich gelang es dem Murauer Kaufmann Karl Brunner sogar, mit einer zu Recht berühmt gewordenen Köpenickiade den Einmarsch der Russen in Murau zu verhindern. Als die Briten mit der Besetzung der Steiermark aus dem Süden nicht vorankamen, während die Rote Armee durch das Murtal zügig vorstieß, bat Brunner englische Kriegsgefangene um Hilfe. Er ließ sie uniformieren und bewaffnen. Diese errichteten dann mehrere Kilometer vor der Stadt eine Straßensperre, hissten den Union Jack und markierten echt wirkende Posten. Diese Stellung wirkte so überzeugend, dass die bis Scheifling (rund zwanzig Kilometer flussabwärts) vorgedrungenen Russen tatsächlich davon Abstand nahmen, Murau und Umgebung, damit auch St. Peter, zu besetzen.17
Als Historiker habe ich von vielen Nachgeborenen der zweiten und dritten Generation Ähnliches vom 45er Jahr zu hören bekommen, Erinnerungen aus zweiter oder dritter Hand, dennoch tief verankert in der Familienüberlieferung. Mir scheint, dass sich eine Art kollektives Bewusstsein gebildet hat, das seine »lange Dauer« (»longue durée« im Sinne Fernand Braudels) noch unter Beweis stellen wird. – Aber das ist schon zu viel an Theorie, fangen wir besser an.
Frühling
Heimwege
Karl. Im Ducken und Springen und Rennen plötzlich eine Art Stoß, ein elektrischer Schlag oder Ähnliches. Blut am Ärmel. Er bemerkte es erst, als die rettende Deckung erreicht war. Ein Kamerad schlitzte ihm mit dem Bajonett den Stoff der Uniform auf, half ihm, die Wunde notdürftig zu verbinden. Ein Sanitäter war bald gefunden. Der verabreichte ihm eine Tetanusspritze und stellte einen »Begleitzettel für Verwundete« aus. Schnelldiagnose: »Durchschuss des rechten Ellbogens. Knochenverletzung?« Kein roter Streifen auf dem Zettel. Das hieß: marschfähig. Dies mag einer der glücklichsten Momente im Leben des Karl Pisa gewesen sein. Er fühlte sich, schreibt er, mit einem Mal wie ein freier Mann. »Dem Schützen, der wohl auf meinen Körper gezielt hatte, wollte ich nicht dankbar sein, aber meinem Schicksal.«18
Keinen Monat nach seiner Reifeprüfung, im April 1942, war Karl zum Arbeitsdienst eingezogen worden, hatte mit Spaten exerzieren und mit Gewehren scharf schießen gelernt. Im Juli mit dem RAD in die Ukraine, wo er erstmals eine Ahnung von der grauenvollen Realität des Krieges bekam. Gelbsucht befreite ihn im Spätherbst von der Plackerei, bescherte ihm einen Lazarettaufenthalt und eine längere Freistellung wegen Leberschwellung. Dann im Frühjahr 1943 Einberufung zur Wehrmacht, Artillerie-Ausbildung in Brünn. Im sogenannten Protektorat Böhmen und Mähren war man vor alliierten Fliegerangriffen sicher, nicht aber vor den sadistischen Ausbildnern. Nach Ende der viermonatigen Schulung meldete Karl sich zu einem Kurs für Reserveoffiziersbewerber. Alles andere als ein Vergnügen, aber man blieb vorläufig der Front fern. Und das zählte.
Im April 1944 ging es schließlich nach Osten. Bilder und Szenen, die sich ins Gedächtnis einbrannten: Beim Räumen eines Holzhauses, das als Artilleriestellung verwendet werden sollte, schlug eine feindliche Granate ein. Sie traf den kleinen Jungen der Familie, die hier lebte. Es riss ihm den Fuß ab, der nur noch an Kleiderfetzen hing, als die schreienden Angehörigen das Kind bargen. Und ein gefallener Kamerad. In seinem Mund steckte ein blutiger Erdklumpen, die Brust hatte es ihm weggerissen. »Ratsch-Bumm« hießen die sowjetischen Panzerabwehrgeschütze im Wehrmachtsjargon, die derartige Verletzungen verursachten.
Bald nach der alliierten Landung in der Normandie brach die sowjetische Sommeroffensive los. Fluchtartiger Rückzug. Karl, mit dem Marschbefehl zum Fahnenjunkerlehrgang in der Tasche, schlug sich mit Kameraden auf eigene Faust in den Westen durch. In der Waffenschule von Groß Born in Hinterpommern wurde er zum Offizier ausgebildet, avancierte zum Leutnant der Reserve und kam im Spätherbst 1944 in die »Führerreserve West« in der Rhön. Im Dezember 1944 warf Hitler seine letzten Reserven in die Ardennenoffensive, darunter den zwanzigjährigen Karl. Nach kurzen Erfolgen brach die Offensive zusammen. Nun bildete man aus Versprengten, aus dem Personal von Küchen und Schreibstuben, aus Gehfähigen aus Lazaretten etc. sogenannte Alarmkompanien. Karl, als junger Offizier, hatte eine solche Kompanie (»ein zusammengewürfelter Haufen Unfreiwilliger«) an die Front zu führen.
Es kam jener 10. März 1945 und jener Ort in der Eifel, Großlittgen, wo ein GI den Wehrmachtsleutnant Karl Pisa schlecht, aber gut genug traf, um ihm sein ganz persönliches Kriegsende zu bescheren. Nur: Um der Kriegsgefangenschaft zu entgehen, um sich nach Wien zu seiner allein zurückgebliebenen Mutter – der Vater war mit 57 Jahren zur Wehrmacht eingezogen worden – durchzuschlagen und ihr in den letzten Kriegstagen beizustehen, hieß es, rasch und entschlossen zu handeln.
Karl machte sich mit angeschwollenem, schmerzendem Ellbogen in einer Behelfsschlinge querfeldein auf den Weg nach Traben-Trarbach, wo die Wehrmacht eine letzte Brücke über die Mosel freigehalten hatte. Weiter mit zurückflutenden deutschen Truppen Richtung Mainz. Am 12. März überquerte Karl Pisa den Rhein. Die vom Luftkrieg weitgehend unbehelligte Lazarettstadt Bad Homburg, wo Karl am 13. März eintraf, erschien ihm wie eine Fata Morgana, sein Lazarett wie ein Luxushotel. Hier wurde er geröntgt und mit einem Stützgipsverband versehen – seinem »Gipsausweis«, der ihm für die kommenden Wochen seine Frontuntauglichkeit bescheinigte. Am 25. März wurde ihm die Verlegung in ein Wiener Lazarett gestattet. Man mochte ihn für verrückt halten, denn mit seiner Verletzung hätte er seelenruhig die Gefangennahme durch die US-Truppen abwarten können. (Bad Homburg wurde am 30. März kampflos von den Amerikanern eingenommen.) War es nicht verrückt, in den Osten zu gehen, während alles in den Westen strebte, den Amerikanern entgegen, weg von den Russen? Zuerst zog er inmitten von Flüchtlingskolonnen aus Frankfurt nordwärts nach Gießen. Dann auf Lastautos nach Fulda, weiter auf dem Kotflügel eines abgeschleppten Autowracks nach Hersfeld. Dort erklomm Karl die Ladefläche eines Lkws Richtung Meiningen. Als er den Fahrer beiläufig fragte, wohin die Reise eigentlich ginge, erhielt er in breitem Wiener Dialekt die Antwort: »Noch Wean.« Und ergänzend: »Oba nur bis Hitteldorf!« Was für ein glücklicher Zufall. Eigentlich waren es zwei sich ständig abwechselnde Fahrer, Obergefreite der Wehrmacht, die es verstanden hatten, einen Befehl zum Transport einer »kriegswichtigen« Kabelrolle zu ergattern und sich »rein zufällig« damit selbst in ihre Heimatstadt zu verfrachten. Über Bayreuth, Regensburg, Passau ging es, erstaunlich geschickt den rasch vorstoßenden Panzern des Generals Patton entgehend, in die »Donau- und Alpenreichsgaue« hinein. Unterwegs beklemmende Bilder: Trecks mit Flüchtlingen aus dem Südostraum, die in die entgegengesetzte Richtung strebten.
Am 30. März 1945 erreichte der Kabeltransport Hütteldorf, den westlichen Vorort Wiens. Karl verabschiedete sich von den zwei, die ihn mitgenommen hatten, und wünschte ihnen, was sie alle in den kommenden Wochen brauchen würden: viel Glück.19
Walter. Gerade einmal 16-jährig war Walter Martin20 im Herbst 1944 zum »Kriegseinsatz in der Heimat« eingezogen worden. Das konnte alles Mögliche bedeuten: Meldedienst am Polizeirevier zum Beispiel, höchst begehrt. Man döste in schlecht gelüfteten, aber gut geheizten Räumen vor sich hin, hörte den Polizisten zu – durchwegs reaktivierte Pensionisten –, die sich schweinische Witze oder Anekdoten aus ihrer aktiven Zeit erzählten. Materialverwaltung in einer Baufirma, das war schon weniger angenehm. Ziegel schleppen, bis die Finger blutig waren, 50-Kilo-Säcke mit Zement oder Staubkalk abladen. Material an Bombengeschädigte mit Zulassungsschein ausgeben – nun, das ging. Meistens aber hieß es, dort aufräumen, wo am Vortag gebombt worden war, graben nach Verschütteten. Eine grausige und gefährliche Arbeit. Mauerwerk konnte plötzlich herabfallen, ein unentdeckter Zeitzünder losgehen. Einmal, beim hektischen Buddeln unmittelbar nach einem Angriff, stieß einer von Walters Freunden auf einen Toten mit abgerissenem Kopf. Später wurde die Leiche auf einer Bahre weggetragen, zugedeckt mit einer grauen Decke, nur die Schuhe ragten heraus. In dieser Nacht, in vielen Nächten kein Schlaf, die Eindrücke des Tages waren übermächtig, drückten Walter nieder. Und immer diese Angst, einmal weiter hinten, einmal weiter vorne, irgendwo in der Magengrube.
Regelmäßig Vorladungen zur Musterung, dreimal zurückgestellt wegen Untergewicht und Nabelbruch. Weniger wählerisch war die Waffen-SS-Division »Hitlerjugend«. Zuerst bekamen die Buben die Vorzüge der Waffen-SS erklärt, dann einen Zettel zugeschoben: »Hier Name in Blockschrift, Adresse, Unterschrift!« Allgemeines Zögern. An der Tür zwei baumlange SS-Leute: »Bei der Tür kommt nur hinaus, wer unterschreibt!« Einiges Hin und Her, eindrückliche Ermahnungen, nochmalige Erläuterungen, wie gut es bei der Waffen-SS sei. Irgendwann unterschrieben – alle. Walter und seine frischgebackenen Waffen-SS-Kameraden erhielten ein schmales rotes Bändchen, das sie am Rockaufschlag zu tragen hatten. Es bedeutete: Kriegsfreiwilliger. Der SS-Arzt stellte ihn aber dann doch noch einmal zurück.
Das »Wehrertüchtigungslager« in Bruck an der Leitha gab einen Vorgeschmack des Kommenden: endloser Drill, Erniedrigung, großspuriges Männlichkeitsgehabe und verstohlene Kinderangst. Wenn die restlos erschöpften Jugendlichen unter martialischem Gesang durch die Straßen marschierten, schauten die Passanten mitleidig. Oder grinsten schadenfroh. Der Einberufung zu einem »Panzer-Nahbekämpfungs-Kurs« in Dresden entging Walter in letzter Minute. Man sah ein, dass er körperlich tatsächlich zu schwach für das zu Erwartende war. Die Abmarschierenden grinsten den Zurückbleibenden höhnisch zu: »Verschimmelt doch in Bruck, wir fahren nach Dresden!« Drei Tage später bombardierten die alliierten Flieger »Elbflorenz« in Grund und Boden.
Das Lager Bruck wurde aufgelassen. Zurück nach Wien für Aufräumarbeiten. Auf der Fahrt, immer in Angst vor Tieffliegern, sangen die Jugendlichen zur Melodie des SA-Liedes Volk ans Gewehr: »Wir woll’n nicht kämpfen, wir woll’n uns nicht schlagen, / woll’n endlich wieder Zivilkleider tragen. / Leckts uns im Arsch, / leckts uns im Arsch!« Zwei zufällig anwesende Landser, die das hörten: Ob sie verrückt seien? Dafür können sie wegen Wehrkraftzersetzung aufgehängt werden.
In Wien ging es daran, die zerbombte Ostbahn wieder flottzumachen. Eine elende Schinderei für die stets hungrigen Jugendlichen. Sie durften zu Hause schlafen, mussten nur jeden Tag um sieben Uhr am Ostbahnhof sein. Aber kaum hatten sie damit begonnen, in den Trümmern herumzustochern, gab es Fliegeralarm, und zwar tagtäglich. Hinein in den gewaltigen Tiefbunker, der zum Zeitpunkt des Eintreffens der Aufräumtruppen bereits voll war mit den »Bunkerwanzen« aus den umliegenden Bezirken, die oft schon Stunden vor dem Alarm am Eingang gewartet hatten. Dicht an dicht, wie in einer Sardinenbüchse, stand man, unsagbar die Angst, hier mit all den Menschen ersticken zu müssen. Grenzenlose Erleichterung, wenn es Entwarnung gab und man ins Freie durfte. Dann wieder eine brennende Sorge: Ob zu Hause wohl alles in Ordnung ist?
Mitte März hatte die Wehrertüchtigung ein Ende. Zurück zum »Kriegseinsatz«. Immer weniger Freunde waren da, immer mehr waren irgendwohin abberufen worden: zur Heimatflak, zu Sonderausbildungen usw. Und auch für Walter hieß es: Wieder einmal zur Musterung. Es ging schnell, der Andrang war gering. Alle tauglich, bis auf einen offensichtlich Debilen. Am selben Tag traf eine amerikanische Fliegerbombe dasjenige Haus in Wien-Währing, in dem die Familie Martin seit vielen Jahren wohnte. Die Wohnung halb zerstört, unbewohnbar. Eine Katastrophe. Aber vieles war zu retten, bei Verwandten am Alsergrund fand sich eine Unterkunft. Die Bürokratie für Ausgebombte begann zu laufen. Mit einem »Bombenschein« konnte man alles Mögliche kaufen. Nun ja, wenn es tatsächlich zu bekommen war. Ostern verbrachte die Familie im Gartenhäuschen am Schafberg und arbeitete im Grabeland, das man an verschiedenen Stellen in der Stadt gepachtet hatte, um Gemüse, Kartoffeln usw. für den Eigenbedarf anzubauen.
Auf dem Heimweg am Nachmittag fernes Donnern. Ganz sicher kein Gewitter, und von Feindeinflügen hatte man nichts gehört. Zudem kamen die Flieger immer am Vormittag. Nachdenken, dann die Schrecksekunde: Konnte das sein? Hörte man mitten in Wien die Artillerie des Feindes?21
Alexander. Er stammte aus dem östlichsten Teil des Reichsgaus Steiermark, dem früheren »Burgenland«. Hier war er geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen, hatte die Lehrerbildungsanstalt absolviert und an Volksschulen in der Region unterrichtet, zuletzt im pittoresken Städtchen Stadtschlaining. Aber Lehrer hin oder her, gleich nach Stalingrad hatte sein »Führer« auch den 37-Jährigen, der mit seinen blonden Haaren und blauen Augen als »richtiger Germanentyp« beschrieben wird, zu den Waffen gerufen. Im August 1943 war er nach Frankreich verlegt worden, in die Normandie, zum Küstenschutz. Ausgerechnet. Viele Monate lang war das Leben hier ruhig verlaufen, kaum anders als in den Kasernen zu Hause. Die Malaise begann am 6. Juni 1944. Von da an hieß es: zurückgehen, immer schneller zurück.
Alexander Unger kam unbeschadet durch, bis es ihn Mitte Jänner 1945 während der Ardennenoffensive doch erwischte: Granatsplitter streiften seine Stirnseite und verletzten seine Schlagader. Bergung, Operation, zur Genesung ins Reich. Mitte Februar Bewilligung eines Heimaturlaubs. Krank und fiebrig kam Unger zu Hause an, erholte sich all die zehn Tage nicht, die ihm bewilligt worden waren. Am 26. Februar Abreise zurück zu seiner Einheit. Bis Salzburg ging es noch einigermaßen zügig. Danach wurde das Reisen so richtig mühsam, denn viele Abschnitte der Bahnstrecken waren von alliierten Fliegern zerstört worden. Zur Überbrückung musste man auf Lkws umsteigen oder schlichtweg zu Fuß gehen.
Auf diese Weise gelangte Unger bis Mainz, wo er sich bei der Frontleitstellung nach dem Standort seiner Einheit erkundigte. Bedauerndes Achselzucken. Er möge sich an die Frontleitstelle in Köln wenden. Unmöglich. Seit seiner Abreise von daheim war er nun sechs Tage unterwegs und vollkommen erschöpft. Verzweifelt wandte er sich in Gießen an den Bahnhofsoffizier, der ihn zum Standortarzt schickte, den er erst nach längerem Herumirren ausfindig machen konnte. Dessen Lazarett war unmittelbar vorher schwer getroffen worden: sechzig Tote, zahlreiche Verwundete. Der Arzt schaute ihn nicht einmal an und schickte ihn weiter. Über Dillenburg nach Herborn. Das dortige Lazarett nahm ihn auf, eine Erlösung. Hier wurde er erstaunlich gründlich untersucht und blieb bis 23. März als Patient.
Als die Amerikaner bedrohlich heranrückten, wurde Alexander Unger in sein Heimatlazarett nach Pinkafeld entlassen. Normalerweise wäre das ein Grund zur Freude gewesen. Aber Unger fragte sich, wie er in seinem nach wie vor äußerst geschwächten Zustand die Strapazen einer solchen Reise würde bewältigen können. An Bahnreisen war gar nicht mehr zu denken, sondern man war ganz auf Lkws angewiesen. Bis Alsfeld ging es mühsam, dann aber ohne Unterbrechung bis Brünn: auf der Reichsautobahn durch Thüringen, Oberfranken, Niederbayern, Böhmen. In Brünn nahm er die Eisenbahn nach Wien und weiter – mit Fußmarsch durch das völlig zerstörte Wiener Neustadt – bis St. Johann in der Haide (bei Hartberg).
Seine Eltern, die im nahegelegenen Dorf Wolfau wohnten, waren bei guter Gesundheit, aber in größter Besorgnis. Es hieß, die Russen stünden schon in Szombathely, also nahe der Reichsgrenze, knapp fünfzig Kilometer entfernt. Solche Nachrichten erweckten enorme Kräfte in dem maroden Soldaten. Unger schnappte sich ein Fahrrad und fuhr damit 22 Kilometer bis Stadtschlaining zu seiner Familie. Er traf seine Frau in der denkbar größten Hektik an. Sie war am Packen. Am nächsten Tag wollte sie mit den Kindern nach Mürzzuschlag fliehen, wo es – hoffentlich – sicherer sein würde als hier.
Die Eheleute berieten sich. Am besten war es wohl, vorläufig zu den Eltern nach Wolfau zu ziehen. Es wurde dunkel, bis sie vollbepackt mit dem Allernötigsten loszogen. Seinen jüngeren Sohn Harald band Alexander Unger sich mit einem Tuch auf den Rücken, den älteren Friedl setzte er auf die Stange des Fahrrads. Auf dem Gepäckträger ein riesiges, gut verschnürtes Paket platziert. Die Frau schleppte einen vollbepackten Rucksack. Der Weg durch die mondhelle Nacht war mühsam. Erst in den Morgenstunden erreichte man Wolfau. Unterwegs am Waldesrand entlang der Straße brannten Feuer. Die Männer des Volkssturms scharten sich darum, um sich aufzuwärmen. (Und vermutlich darüber nachzudenken, wie sie hier wieder lebend rauskommen sollten.)
Am nächsten Tag fuhr Unger noch einmal per Fahrrad nach Stadtschlaining, um weitere Sachen aus der Wohnung zu holen und nach Wolfau zu schaffen. So wurde es Gründonnerstag, 29. März. (Also jener Tag, an dem die Rote Armee bei Klostermarienberg, rund fünfzig Kilometer nordöstlich gelegen, erstmals in österreichisches Gebiet vordrang.) Unger war von Herborn in Hessen ins heimatliche Pinkafeld verlegt worden. Und da er noch immer Soldat war und ihm im Fall einer unerlaubten Entfernung von der Truppe das Standrecht drohte, war es höchste Zeit, – gemeinsam mit zwei Kameraden in ähnlicher Lage – ins Lazarett nach Pinkafeld zu fahren, um aufgenommen zu werden. Dort hatte man verständlicherweise andere Sorgen und wies die drei ab. Stattdessen bekamen sie einen Marschbefehl für Graz. Das hieß, zuerst einmal zurück nach Wolfau.
Bemerkenswert war der ungeheure Betrieb auf der Straße zwischen Pinkafeld, Oberwart und Markt Allhau. Kolonnen von Planwagen, auf denen ungarische Familien nach Westen zogen, kilometerweit, ein ständiges Rasseln von Fahrzeugen. Dazwischen und daneben Wehrmachtsfahrzeuge aller Art in beide Richtungen jagend. Unger und seine Kameraden ergatterten einen Lkw, der sie mitnahm. Über dem Heimatort aber, Wolfau, lag – sehr im Gegensatz zur überfüllten Landstraße – eine unheimliche Stille. Die Leute verkrochen sich in ihren Häusern. Das Osterfest wollte Unger – bei aller Ungewissheit – jedenfalls noch hier mit seiner Familie begehen.22
Fluchtbewegungen
Gerti. Ostersonntag, 1. April. Seit einer Woche schon endlose Kolonnen von Flüchtlingen aus Ungarn und dem Burgenland, dazwischen Militärfahrzeuge und Rotkreuzautos ohne Ende. Der Verkehr, der in einem unendlichen Strom durch die Kurstadt Baden23 floss, war noch lauter als der Lärm, der seit einigen Tagen drohend am Horizont zu vernehmen war: Kanonen, Geschütze, Flieger. Fernes Wummern, Donnern, Krachen, das sukzessive näher rückte, unaufhaltsam, wie es schien. Dazwischen Sirenen, Alarm, Luftangriffe, Stunde um Stunde im Keller hocken. Immer diese nagende Sorge, diese tief in der Magengrube sitzende Angst. Unruhe über der Stadt. Das elektrische Licht war schon seit Tagen ausgefallen. Daher kein Radio mehr, keine Nachrichten über den Stand der Dinge. Einer lief zum anderen: Ob er Neues wüsste? Was er zu tun gedenke?
Es herrschte »Panzeralarm«. Das hieß: feindliche Panzer in fünfzig bis achtzig Kilometer Entfernung. Ob die Vielzahl von Panzersperren, die mühsam rings um die Stadt errichtet worden waren, etwas nützen würde? Wer mochte daran glauben? Ältere Männer, wie Gertrud (»Gerti«) Hauers Vater, die um die fünfzig und sechzig Jahre alt waren, sollten gemeinsam mit 14- bis 16-jährigen Buben die Stadt verteidigen. Volkssturm nannte sich diese traurige Truppe. Gezählte 75 Panzerfäuste gab es in Baden. Wie damit umzugehen sei, wusste niemand von den Volksstürmern. Immerhin hatte am Karsamstag bei der Kreisleitung eine Einschulung mit Attrappen stattgefunden.
Den Frauen der Familie Hauer stellte sich eine immer dringlicher werdende Frage: Bleiben oder weggehen? Abwarten und hoffen, dass es doch nicht so schlimm kommen würde? Allein schon die lebenslustige, hübsche Gerti, die vor einem Monat 16 Jahre alt geworden war, war Grund genug, es nicht auf den Versuch ankommen zu lassen. Nur Josefine, die ältere Schwester des Vaters, weigerte sich beharrlich. Sie wolle lieber in den eigenen vier Wänden sterben als die Heimat verlassen. Da half kein Zureden. Und der Vater selbst, mit seinen 47 Jahren? Der Herr Gymnasialprofessor, der schon den ersten Krieg mitgemacht hatte, wartete auf die Alarmierung. Revolver, Kartentasche, Stiefel usw. lagen griffbereit in der Küche. Bevor es so weit war, vergrub Professor August (»Gustl«) Hauer Wertgegenstände im Garten, rollte mit Hilfe seiner Tochter den wertvollen Perserteppich vom Wohnzimmer zusammen und packte das schöne Geschirr ein, um alles im Schupfen zu verstecken.
Zu Mittag, hatte es geheißen, sollte vom Kurpark ein Treck für Frauen und Kinder starten, die die Stadt verlassen wollten. Aber dazu kam es nicht. Der Grund: Fliegeralarm, wie so oft. Nächste Nachricht am Nachmittag, der Treck war nun für Ostermontag, halb sechs Uhr abends geplant. Aber war das nicht spät? Denn von Blumau, keine 15 Kilometer entfernt, konnte jeder in Baden deutlich Explosionen hören. Man solle alle Fenster öffnen, hieß es, um das Zerspringen der Scheiben zu vermeiden. Und man solle alle Gefäße mit Wasser auffüllen, denn bald würde es keine Wasserzufuhr mehr geben. Die fiel dann am Abend auch tatsächlich aus.
Die Nacht zum Ostermontag, 2. April. Lilli Hauer war sofort aus dem Bett, als sie um ein Uhr morgens von draußen den Ruf eines Nachbarn vernahm: »Herr Hauer! Herr Hauer!« Sie schüttelte ihren Mann aus dem Schlaf. Dieser stürzte ans Fenster, riss die Flügel auf. »Was ist?« – Der Mann, atemlos und in höchster Aufregung: »Die Russen, die Russen! Zum Doblhoffpark, die Frauen mit Kindern …«
Lilli Hauer rief panisch nach ihren Töchtern, der 16-jährigen Gerti und der neunjährigen Nora. Gustl Hauer lief, um seine Mutter und Schwester zu holen. Im Grunde war man ja vorbereitet, trotzdem dauerte es lange, bis alles abmarschbereit war. Viel zu lange, wie es schien. Ein Strom von Menschen drängte in der kalten Nacht zum Park. Verzweifelte Rufe, angstvolles Weinen. Tante Josefine war nun auch dabei. Widerwillig. Als ein Autobus vorfuhr, der von allen Seiten gestürmt wurde, schrie sie: »Und da wollts ihr mit? Ihr werdts z’ Tod trampelt!«
Man wartete ab. Ein zweiter Bus kam. Gegen halb vier ein dritter. Lilli Hauer und ihre Töchter schafften es diesmal im ärgsten Gedränge in den Wagen, sogar mit dem vollständigen Gepäck. Gertis Großmutter, Tante und Vater blieben zurück. Der Wagen war so voll, dass man selbst in der schärfsten Kurve nicht umfallen konnte. »Wie die Sardinen.« Kaum, dass man Luft bekam. Als der Bus losfuhr, hingen sogar an den Trittbrettern Leute. Die wankende, schwankende Fahrt dauerte zum Glück nicht lange. Sie ging durchs romantische Helenental in den Wienerwald hinein und endete bei der Krainerhütte, einem beliebten Ausflugsziel der Badener zu besseren Zeiten, keine sieben Kilometer von der Stadt entfernt. Von hier aus sollte es irgendwann irgendwie weitergehen. Vorläufig hieß es abwarten. Die Hütte war voll von Flüchtlingen, aber Mutter und Töchter samt Gepäck fanden ein Plätzchen für sich. Die NS-Volkswohlfahrt (NSV) schenkte mit Saccharin gesüßten Tee aus, kleine Kinder bekamen sogar Milch. Im Raum herrschte eine fast hysterische Stimmung. Die Kleinkinder plärrten wie am Spieß, da half auch keine Milch. Trotzdem nickten Gertrud und Nora, auf dem Boden zwischen ihren Bündeln hockend, bald ein.
Als sie in der Dämmerung wach wurden, hörten sie von der Straße her das ununterbrochene Rollen der Räder. Gegen halb sieben kam ein schier endloser Treck des ungarischen Militärs vorbei, ein Leiterwagen nach dem anderen. Hier durften die Badener Flüchtlinge nach einigem Hin und Her aufsteigen. Mühsam ging es im Schritttempo weiter. Wenn die Kolonne wieder einmal stand, konnte Gerti zusehen, wie Fußgeher, Radfahrer und Reiter in endloser Folge müde vorbeizogen. Die meisten Fahrräder wurden geschoben, sie waren in der Regel voll bepackt, und im Gedränge war ohnehin kein Fahren möglich.
Bis gegen Mittag brauchte der Zug, um die sieben Kilometer bis zum Dorf Mayerling zu bewältigen. Dort gab es Fliegeralarm, vermutlich Tiefflieger. Während die meisten Flüchtlinge einfach sitzen blieben, baten Lilli, Gerti und Nora um Schutz in einem nahegelegenen Haus. Sie wurden freundlich aufgenommen und bekamen nach dem Ende des Alarms sogar ein Mittagessen serviert: gesottene Erdäpfel, Leber, Brot. Mehr habe man selbst nicht, erklärten die Leute.
Weiter ging es mit den Ungarn den kurzen, aber wegen der Verstopfung der Straßen unendlich langen Weg bis Alland. Endlich angekommen, verließen Lilli, Gerti und Nora den Treck, weil er eine Richtung einschlug, in die man nicht weiterziehen wollte. Erneutes Sirenengeheul, Tieffliegeralarm. Es fand sich ein Gasthaus, wo man zumindest ein wenig geschützt war. Es war voll von Soldaten. Lautstarke Diskussionen waren im Gang. Ein Flüchtling, der erst am frühen Vormittag aus Baden weggegangen war und sich bis hierher durchgechlagen hatte, erzählte von verheerenden Bombardements durch die Russen. Man besprach, wie weit diese schon an Baden herangerückt sein mochten. Dann warf ein Soldat das Wort »Wunderwaffe« in den Raum. Allgemeines Aufhorchen. Er wollte im Militärsender gehört haben, dass sie bereits seit Mitternacht im Einsatz sei. Gerti konnte solchen Unsinn nicht glauben. Schließlich stand der Feind vor der eigenen Haustür. Nach einer Wende in allerletzter Minute sah das wahrlich nicht aus.
Wieder draußen auf der Straße, schauten sich die drei nach einer Mitfahrgelegenheit um. Ein Ochsengespann nahm das Gepäck von Mutter und Töchter Hauer auf. Die drei mussten allerdings neben dem Wagen hergehen, für weitere Passagiere war kein Platz. Es wurde Abend, bis man Klausen-Leopoldsdorf erreichte. Ein wenig mehr als zwanzig müde Kilometer hatte man an diesem Ostermontag zurückgelegt. Auf dem Heuboden von hilfsbereiten Bauersleuten bezogen die drei Quartier. Alles voll von Flüchtlingen. Plärrende Kinder, hysterische Frauen, sogar ein Mann darunter, der noch überdrehter wirkte als die Frauen.
Dienstag, 3. April. Die Besitzer des Gehöfts, auf dem man Unterkunft gefunden hatte, waren über Nacht verschwunden, waren zweifellos selbst auf die Flucht gegangen. Auf der Straße zogen die Kolonnen vorüber, ein endloser Zug. Es schien, als sei er selbst in der Nacht nicht abgerissen. Die Geschäfte im Ort hatten geöffnet, waren aber so gut wie leergekauft: kein Brot, keine Butter oder Fett in sonstiger Form. Ein kleiner Militärzug, bestehend aus zwei Lkws, von denen der erste eine Kanone und der zweite einen kleinen Kettenpanzer zog, kam vorbei. Beim zweiten Lastwagen durften die drei aufsteigen und fanden auf der Ladefläche eine große Volksdeutsche Familie aus Ungarn, zwei einheimische 15-jährige Buben und zwei völlig apathisch daliegende Schweine vor. Wohin die Fahrt eigentlich ginge? Keiner der Passagiere hatte eine Ahnung: »Wohin uns der Lkw halt bringt.«
Zwölf Kilometer weiter, in Brand-Laaben, eine erste Panne. Das hieß: Pause, absteigen, Füße vertreten. Lilli und ihre Töchter gingen in der Wartezeit in den Ort hinein, um Essbares zu suchen. Ein Gasthaus fand sich, in dem es freilich nichts zu essen gab. So bestrich Lilli die letzten Stücke mitgebrachten Brotes dick mit Schmalz, das sie in dem verlassenen Bauernhaus gefunden hatte. Die Wirtin spendierte Salz dazu. Die Geschäfte waren mangels Verkaufbarem geschlossen. In einem weiteren Gasthaus ergatterten die drei immerhin je einen Teller heiße Suppe. Zurück zum Lkw. Weiterfahren.
Nun ging die Reise aus dem tiefen waldreichen Wienerwald hinaus in eine hügelige, offene Landschaft. »Herrliche Fahrt«, notiert sich Gerti. »Die Wiesen abwechselnd weiß, hell- oder dunkelgelb bzw. blau vor lauter Buschwindröschen, Himmelschlüsseln, Sumpfdotterblumen oder Veilchen. Die Sonne schien, aber durch die Staubwolke, in die der Flüchtlingszug gehüllt war, sah man alles nur wie durch einen Schleier.«24 Wenn eine Stockung eintrat, sprangen die Kinder ab und rannten in die Wiese. Die Straße war eng, dicht gesäumt von Birnbäumen, die so nahe standen, dass einem die Äste hin und wieder ins Gesicht schlugen. Manchmal ging es kurvig durch kleine Wäldchen dahin, da war die Luft herrlich. Auf der Ebene hingegen war alles in ein Meer aus Staub gehüllt.
Auf einem steilen Straßenstück fuhr sich der Wagen fest. Alle, die vorbeikamen – ungarische Flüchtlinge, russische Kriegsgefangene, Wehrmachtssoldaten –, mussten mithelfen, das Fahrzeug wieder flottzukriegen. Bei der Weiterfahrt touchierte man leicht einen entgegenkommenden Lkw, was den Begleitsoldaten reichlich Gelegenheit zum Fluchen und den Passagieren eine halbe Stunde Wartezeit bescherte. Eine weitere Panne kurz vor Böheimkirchen, diesmal war es die angehängte Kanone. Damit Schluss für heute. Die Fahrzeuge wurden in eine Wiese dirigiert. Morgen zwischen sechs und sieben Uhr sollte es weitergehen.
Lilli Hauer und zwei volksdeutsche Frauen gingen in den Ort, um sich nach einer Unterkunft und Essen umzusehen. Sie kamen mit einer erfreulichen Nachricht zurück. In einem Wirtshaus wäre eine Mahlzeit zu bekommen und gerne könne man auf den Bänken in der Gaststube übernachten. Alles eilte hin. Wie sich herausstellte, gab es sogar zwei Mahlzeiten: erstens das Tagesmenu ohne Marken und dann noch Gulasch mit Erdäpfelschmarrn und Most. Gesättigt bettete man sich auf den harten Bänken zur Nachtruhe.
Mittwoch, 4. April. Die ganze Nacht über war in der Gaststube zu hören, wie Fahrzeug um Fahrzeug vorbeiratterte. Um halb vier Uhr morgens wollte jemand sogar den Ruf »Die Russen kommen, die Russen!« vernommen haben. Das stellte sich als falsch heraus. Aber nun konnte und wollte niemand mehr schlafen. Es ging zurück zu den Lkws, um nur ja nicht die Weiterfahrt zu versäumen. Es sollte allerdings bis elf Uhr dauern, bis die Kanone wieder transportbereit war. Die Soldaten hatten es nicht eilig, zum befohlenen Einsatzort zu gelangen.
Unterwegs herrschte gewaltiges Gedränge auf der Landstraße: Flüchtlingstrecks, ungarische Reiterei ohne Waffen, Militärautos in hoher Geschwindigkeit in beide Richtungen, ein Trupp russischer Gefangener aus Wiener Neustadt, darunter Buben, die vielleicht 14 Jahre alt waren. Plötzlich, zwei mächtige deutsche Panzer. Sie rasten querfeldein auf die Straße zu und überquerten sie, ohne die Geschwindigkeit im Geringsten zu verringern. Die Flüchtlinge stoben panisch zur Seite. Gerti hatte das Gefühl, dass die Panzer gegebenenfalls auch ein paar Menschen überrollt hätten.
Vor St. Pölten bog der Militärtransport nach Süden ab. Für die Flüchtlinge bedeutete das: Ende der Fahrt, aussteigen. Lilli Hauer zog mit ihren Töchtern in die Stadt hinein. In einem Gasthaus erhielt man in der Küche einen Teller Suppe. Lilli besorgte Brot und erfuhr am Flüchtlingsamt, dass es von St. Pölten aus einen Pendelverkehr bis Prinzersdorf gab, von wo Flüchtlingszüge Richtung Westen abfahren sollten. Unterwegs traf sie einen Kollegen ihres Ehemanns Gustl, der ihr von den letzten Stunden Badens vor der Besetzung durch die Russen erzählte, von den Bomben, die gefallen waren, von den Toten und Verletzten. Und von der Auflösung des Volkssturms. Sie horchte auf. Wo mochte ihr Mann nur sein, wo seine Mutter, seine Schwester?
Per Autobus gelangten Lilli, Gerti und Nora zum Bahnhof des acht Kilometer westlich von St. Pölten gelegenen Ortes Prinzersdorf. Es begann zu regnen. Dann kam der Wind. Die Kälte kroch bis in die Knochen, setzte sich im ganzen Körper fest. Aber niemand blieb lange im geheizten Wartesaal, die Flüchtlinge warteten lieber in dichten Reihen auf dem Bahnsteig. Warteten endlos. Schließlich doch ein Zug, dann gleich ein zweiter und dritter. In keinen war ein Hineinkommen. Die Stärkeren drängten sich rücksichtslos nach vorne, stießen die Kinder, die schon zur Hälfte drinnen waren, erbarmungslos von den Stufen. Mittlerweile hörte man, dass die Russen schon im Vormarsch auf Hainfeld waren, einer rund 35 Kilometer südöstlich von St. Pölten gelegenen kleinen Stadt.
Um halb zehn Uhr abends kam ein Zug, der vorerst nach St. Pölten fuhr, denn die Strecke war mittlerweile wieder repariert worden. Diesmal schafften es die drei mit Hilfe eines Soldaten in einen Wagen. Der Zug war bald am Hauptbahnhof in St. Pölten, blieb dort stundenlang stehen und füllte sich so dicht mit Flüchtlingen, dass man Angst haben musste, die Wände der Waggons könnten bersten. Die Fliegergefahr war ständig präsent. Wenn irgendwo eine Taschenlampe aufblitzte, hieß es sofort böse: »Licht aus, Licht aus!«
Viele Ausländer waren im Zug, man hörte sie reden: Italiener, Ungarn. Soldaten zwängten sich durch den Zug: »Ausländer raus – hoppla!« Diese wehrten sich, wollten partout nicht aussteigen. Zivilisten mengten sich ein, manche unterstützend, andere reagierten gehässig: »Schmeißts ihm ’s Gepäck aussi, dann wird er glei vo selber aussihupfen!« Tatsächlich drängten die Soldaten die Ausländer bei den Fenstern hinaus. Dann hieß es boshaft: »Gott sei Dank, dass er aussi muass, der Kerl stinkt wiar a Scheißheisl.« Oder: »Italiener – hoppla – raus!« – »Alles hatte einen Viechszorn auf die Ausländer«, schreibt Gertrud Maurer in ihren Erinnerungen an jene Szenen. »Wären die nicht gewesen«, sagten die Leute, »so lägen wir nicht auf der Straße. Wären die Sau-Ungarn drunten am Plattensee nicht übergelaufen, wäre der Iwan niemals hereingekommen« usw.25
Kurz vor ein Uhr nachts brach im Zug Panik aus. Es verbreitete sich das Gerücht – unerfindlich woher –, der Zug würde nach Wien statt nach Amstetten fahren. Dann fuhr er doch los, zum Glück in die richtige, nämlich westliche Richtung. Mittlerweile war es Donnerstag, 5. April, geworden. Im Morgengrauen erreichte man Ybbs an der Donau. Hier hieß es: Endstation. Die Gleise bis Neumarkt an der Ybbs, fünf Kilometer entfernt, waren zerstört. Eine traurige, müde Menschenschlange wand sich die Straße entlang. Gertrud Maurer sollte diese Bilder nie vergessen: »Frauen und Kinder, die teils in Kinder- oder Leiterwagerln, teils an der Hand geführt wurden, alte Frauen mit Bündeln auf dem Rücken oder hochgetürmt auf uralten, klapprigen Kinderwagengestellen, jüngere Frauen, die sich mit Koffern, Körben, Kartons abmühten, fast niemand ohne zusätzliche Taschen oder einem Rucksack – viele von den Kindern, manche von den Frauen weinten –, und viele mussten sich zumindest von einem Teil ihres letzten geretteten Hab und Guts trennen, weil sie es nicht mehr zu schleppen vermochten! Zu beiden Seiten war die Straße dicht gesäumt von weggeworfenem Flüchtlingsgepäck: Koffer, Rucksäcke, verschnürte Pakete, Taschen, Bündel …«26
Gerti schleppte in jeder Hand einen Koffer, drinnen die gesamte Wäsche für alle drei, nur das Allernotwendigste. Und zwei Luxusgegenstände: Patiencekarten und ein Badeanzug. Der Riemen des Rucksacks schnitt ein, aber da war nichts zu machen, keine Hand war frei. Wirklich lästig war die Kodak-Box in der Manteltasche, die beim Gehen ständig gegen ihren Schenkel schlug. Wieso nicht einfach dieses billige Gerät wegwerfen? Sie hatte ohnehin keinen Film mehr. Und es war ihr klar, dass in nächster Zeit auch keiner zu bekommen sein würde. Aber freilich, sie liebte das Gerät, nie würde sie sich davon trennen.
Als Lilli, Gerti und Nora endlich Neumarkt erreichten, warfen sie sich beim ersten Gehöft erschöpft auf eine Bank. Lilli Hauer schmierte ein paar Schmalzbrote. Die Bäuerin sah es und gab ihnen Milch und später noch drei Eier. Nach einer längeren Ruhepause ging es zum Bahnhof. Und wie nicht anders zu erwarten, herrschte ein gewaltiger Massenandrang. Lärm, Geschrei, Gezänke, Weinen, Plärren und Kreischen von Kindern – und Nachrichten, wahre und falsche, die die Runde machten. So saßen die drei schicksalsergeben am Bahnsteig und hofften auf einen gnädigen Zug, der sie ins Exil nach Maria Schmolln in Oberösterreich – pardon, noch hieß es ja Oberdonau – bringen sollte. Dort gab es einen Ankerpunkt für die Flüchtlinge: Tante Anni, die Frau von Lilli Hauers jüngstem Bruder, war schon vor einigen Monaten mit ihren drei Kindern – ein viertes war unterwegs – in den Innviertler Wallfahrtsort evakuiert worden.
Der Himmel war blau. Die Kinder zählten die Kondensstreifen der feindlichen Flugzeuge. Als der Zug endlich kam, herrschte das übliche lebensgefährliche Gedränge. Soldaten halfen den Leuten, sorgten für Ordnung und bedrohten die Ausländer: »Wer von de Ausländer ei’steigt, wird derschossen!« Alle drei Hauer-Frauen schafften es in den Zug, der brechend voll war. Die Fahrt ging langsam, die Lok tastete sich vorsichtig vorwärts. Die durch alliierte Flieger wiederholt schwer beschädigten Geleise waren nur notdürftig ausgebessert worden. Als der Zug einmal auf offener Strecke stehen blieb, klopfte es ans Fenster des Abteils. Man öffnete, schaute nach, zog drei Wiener Krankenschwestern herein. Die vierte war beim besten Willen nicht mehr im Inneren zu verstauen. Sie blieb draußen, stellte sich aufs Trittbrett und klammerte sich fest.
Amstetten. Der Zustand des Bahnhofs hinterließ bleibenden Eindruck. Nie gesehene Verwüstungen. Schienen aufgerissen, hochgebogen, ganze Züge zur Seite gestürzt, Lokomotiven zerfetzt.27 Ein unvergesslicher Anblick: Die Wucht der Explosionen hatte Schienen samt den Schwellen und der darauf stehenden Lokomotive in die Luft gehoben und auf dem Dach des danebenstehenden Zuges wieder abgesetzt.
Es wurde Nacht. Freitag, der 6. April. In St. Valentin gab es einen elendslangen Aufenthalt. Alle Männer mussten zur Kontrolle aus dem Zug, längst nicht alle kamen wieder zurück. Dann verbreitete sich die Meldung, die Flüchtlinge kämen in irgendein Sammellager. Dorthin wollten die Hauer-Frauen aber unter keinen Umständen. In der Morgendämmerung erreichte der Transport Wels. Mit der Hilfe der anderen Passagiere wurden Lilli, Gerti und Nora samt Gepäck durch das Fenster auf den Bahnsteig gehievt.