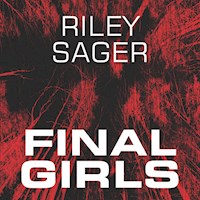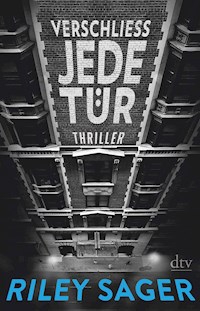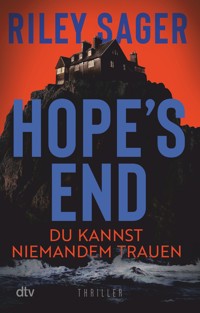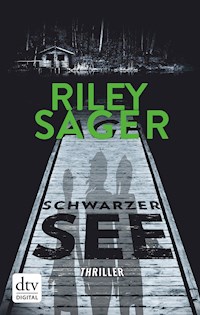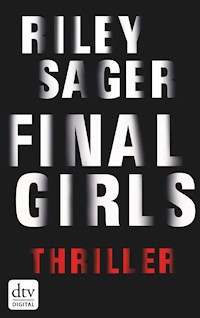Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Irgendwie muss sie diese Nacht überleben Ein alptraumhafter Roadtrip durch die Nacht - Der neue ›New York Times‹–Bestseller von Riley Sager 1991. George W. Bush sitzt im Weißen Haus, im Kassettendeck läuft Nirvana, und die filmbegeisterte Studentin Charlie fährt mit einem Mann durch die Nacht, der vielleicht ein Serienkiller ist. Es war nur eine Mitfahrgelegenheit. Josh behauptet, er wolle zu seinem kranken Vater in Ohio. Aber etwas stimmt nicht an seiner Geschichte. Während sie über leere, dunkle Highways fahren, steigt in Charlie ein furchtbarer Verdacht auf. Ist es möglich, dass Josh der Campus-Killer ist, der ihre beste Freundin ermordet hat? Sie kann nicht weg, Hilfe holen ist unmöglich. Sie ist gefangen. Ein Thriller der Extraklasse, gruselig-atmosphärisch, voller Twists und mit einem überraschenden und schockierenden Ende. »Noir vom Feinsten. Bravo!« Jeffery Deaver »Wenn Sie einen schaurigen, unheimlichen Lass-bloß-das-Licht-an-Thriller suchen, gibt es nichts Besseres für Sie als Riley Sager.« CNN Von Riley Sager sind bei dtv außerdem folgende spannende Thriller erschienen: »Final Girls« »Schwarzer See« »Verschließ jede Tür« »HOME – Haus der bösen Schatten«
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Riley Sager
NIGHT
Nacht der Angst
Thriller
Deutsch von Christine Blum
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Für all die wunderbaren Menschen dort im Dunkel des Saals
»Bitte anschnallen, meine Herrschaften. Ich glaube, es wird eine stürmische Nacht.«
›Alles über Eva‹
Aufblende.
Ein Parkplatz.
Mitten in der Nacht.
Mitten im Nirgendwo.
Ein Vorgriff auf das Ende, wie bei einem großen Film noir. Bill Holden tot im Swimmingpool. Fred MacMurray, der seine letzte Beichte ablegt.
Der Kreis schließt sich. Wie eine Schlinge.
Das einsame Auto auf dem Parkplatz, der Diner, das Neonschild verschwimmen im Rückspiegel des davonrasenden Fahrzeugs. Zwei Menschen sitzen darin, eine junge Frau auf dem Beifahrersitz und ein Mann am Steuer. Beide starren durch die Windschutzscheibe nach vorn. Unsicher.
Wer sie sind.
Wohin sie unterwegs sind.
Wie sie hierhergekommen sind. An genau diesen Ort zu genau dieser Zeit. Kurz vor Mitternacht. Die letzten Sekunden des Tages: Dienstag, 19. November 1991.
Charlie aber weiß es. Während das Geschehen Einstellung für Einstellung gleich einem Film auf der Leinwand abläuft, ist ihr vollkommen klar, wie es dazu kam.
Weil es kein Film ist.
Sondern das Hier und Jetzt.
Sie ist das Mädchen im Auto.
Der Mann hinter dem Steuer ist ein Killer.
Und so sicher wie jemand, der Filme wie diese schon hundertmal gesehen hat, weiß sie, dass nur einer von ihnen den nächsten Morgen erleben wird.
Neun Uhr abends
INNEN – ZIMMER STUDENTENWOHNHEIM – TAG
Sie kann unmöglich hier bleiben.
Deshalb hat Charlie das Angebot angenommen, zu einem Fremden ins Auto zu steigen.
Sie hat Robbie – und sich selbst – versprochen, dass sie abhauen wird, falls ihr etwas seltsam vorkommt. Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein.
Nicht nach dem, was mit Maddy passiert ist.
Innerlich ist Charlie vorbereitet und hat alle Szenarien durchgespielt, die zur Flucht mahnen: wenn das Auto ramponiert ist und/oder getönte Scheiben hat. Wenn eine weitere Person darin sitzt, egal, wie die Erklärung dafür lautet. Wenn der Fahrer übereilt startet oder, andersherum, wenn er sich zu viel Zeit damit lässt. Sie hat Robbie – und sich selbst und Maddy, mit der sie noch immer manchmal redet, auch wenn sie schon zwei Monate unter der Erde liegt – geschworen, beim geringsten Unbehagen wieder ins Studentenwohnheim zurückzukehren.
Doch sie bezweifelt, dass es dazu kommen wird. Denn er wirkt nett. Freundlich. Ganz sicher nicht der Typ Mann, der zu dem fähig wäre, was man Maddy und den anderen angetan hat.
Außerdem ist er kein Fremder. Jedenfalls nicht ganz. Sie hat ihn bereits kennengelernt, in der Mensa vor dem Schwarzen Brett für Mitfahrgelegenheiten, das wie immer übervoll war von Suchanfragen und Angeboten. Gerade hatte Charlie ihr eigenes, sorgfältig ausgedrucktes Gesuch mit genau bemessenen Abreißzetteln für die Telefonnummer dazugehängt, als er zu ihr trat. Er blickte zwischen ihr und dem Blatt Papier hin und her. »Du willst nach Youngstown?«
Sie hatte mit der Antwort gezögert. Wie sie es sich nach Maddy angewöhnt hatte. Nie freiwillig mit Unbekannten ein Gespräch beginnen, ehe nicht klar ist, was sie wollen. Vielleicht wollte er Smalltalk machen. Oder sie anbaggern. Unwahrscheinlich, aber nicht ganz ausgeschlossen – so hatte sie immerhin Robbie kennengelernt. Damals, als sie noch hübsch war. Bevor sich Schuld und Schmerz ihrer bemächtigt hatten.
»Ja«, sagte sie schließlich, nachdem sein Blick zum Schwarzen Brett zurückgekehrt war, woraus sie schloss, dass er aus demselben Grund da war wie sie. »Du auch?«
»Nach Akron«, sagte er.
Charlie horchte auf. Nicht Youngstown, aber dieselbe Route. Youngstown wäre nur ein kurzer Zwischenstopp.
»Mitfahrer oder Fahrer?«, erkundigte sie sich.
»Fahrer. Wäre schön, wenn ich mir die Fahrtkosten mit jemandem teilen könnte.«
»Dieser Jemand könnte ich sein.« Sie gab ihm Zeit, sie zu mustern, zu entscheiden, ob er mehrere Stunden mit ihr in einem Auto verbringen wollte. Sie wusste, wie sie auf andere wirkte – gereizt und mürrisch. Eigentlich müsste das Typen wie diesen hier zu einer Bemerkung provozieren, »Lächle doch mal ein bisschen« oder so. Aber sie sagten nie etwas, weil sie den Eindruck erweckte, als würde sie ihnen dafür eine reinhauen. Schwermut und Untergangsstimmung hingen wie eine Sturmwolke über ihr.
Charlie betrachtete ihr Gegenüber ebenfalls. Er schien ein paar Jahre älter zu sein als der Durchschnittsstudent, wobei das auch an seiner Statur liegen konnte. Großgewachsen, breitschultrig, kantiges Gesicht, geradezu hünenhaft. In seinen Jeans und dem Sweatshirt der Olyphant University sah er aus wie der Held in einer Studentenkomödie aus den Vierzigerjahren. Oder der Bösewicht in einer aus den Achtzigern.
Sie nahm an, dass er im Aufbaustudium war, wie Robbie. Einer von denen, die Gefallen am Uni-Dasein gefunden und beschlossen hatten, dass sie es gar nicht mehr aufgeben wollten. Aber seine Frisur war klasse – etwas, was Charlie noch immer auffiel, auch wenn ihre eigenen Haare inzwischen viel zu lang und die Spitzen kaputt waren. Und er hatte ein tolles Lächeln, das er nun aufblitzen ließ. »Möglich. Wann wolltest du denn fahren?«
Charlie deutete auf ihren Zettel und die vier Buchstaben exakt in der Mitte.
ASAP
Er riss einen der Abschnitte ab; die Lücke erinnerte Charlie an einen fehlenden Zahn. Bei dem Gedanken überlief sie ein Schauder.
Der Typ steckte den Zettel mit ihrer Telefonnummer in seine Geldbörse. »Mal sehen, was ich tun kann.«
Sie hatte nicht erwartet, dass er sich wieder melden würde – es war mitten in der Woche und Mitte November, zehn Tage vor Thanksgiving. Da wollte normalerweise niemand nach Hause fahren. Niemand außer ihr.
Doch an jenem Abend klingelte ihr Handy, und eine Stimme, die irgendwie bekannt klang, sagte: »Hi, hier ist Josh. Vom Schwarzen Brett.«
Charlie, die in ihrem Zimmer gesessen und auf die öde Zimmerhälfte gestarrt hatte, wo einst Maddys Sachen gewesen waren, erwiderte spaßeshalber: »Hi, Josh vom Schwarzen Brett.«
»Hi –« Josh hielt inne, sicherlich, um nach ihrem Namen auf dem Abriss zu schauen. »Charlie. Ich wollte nur sagen, dass ich morgen fahre, aber erst am späteren Abend. Um neun. Wenn du willst, reserviere ich dir den Beifahrersitz.«
»Den nehme ich.«
Damit war die Sache geklärt.
Nun ist »morgen«, also heute. Charlie schaut sich ein letztes Mal in dem Wohnheimzimmer um, in das sie höchstwahrscheinlich nie zurückkehren wird. Bedächtig lässt sie den Blick schweifen und nimmt jedes Detail des Ortes auf, der ihr in den vergangenen drei Jahren ein Zuhause war. Die Schreibtische voller Chaos. Die ungemachten Betten. Die Lichterkette, die Maddy an ihrem ersten Weihnachten hier aufgehängt und nie wieder abgenommen hat – eingeschaltet und prachtvoll funkelnd.
Durchs Fenster fällt das goldene Sonnenlicht des Herbstnachmittags und verleiht dem Raum einen sepiaartigen Schimmer. Es stimmt Charlie froh und traurig zugleich. Nostalgie. Dieser herrliche Schmerz.
Hinter ihr tritt jemand ins Zimmer.
Maddy. Charlie kann ihr Parfüm riechen. Chanel Nr. 5.
»Dreckloch, verdammtes«, sagt Maddy.
Charlies Lippen verziehen sich zu einem melancholischen Lächeln. »Ich glaube, ich –«
»Charlie?«
INNEN – ZIMMER STUDENTENWOHNHEIM – NACHT
Der Klang von Robbies Stimme dringt durch die offene Tür und bricht den Zauber wie mit einem Fingerschnippen. Im Nu verliert das Zimmer seine Magie. Die Schreibtische sind kahl. Die Betten abgezogen. Die Lichterkette hängt noch, aber ausgestöpselt, wie schon seit Monaten. Das Fenster erstrahlt nicht in warmem Sonnenlicht, sondern bildet ein scharfes Rechteck aus Dunkelheit.
Und Maddy ist fort, schon lange. Nicht ein Hauch ihres Parfüms ist geblieben.
»Es ist neun Uhr«, sagt Robbie. »Wir sollten los.«
Noch etwas durcheinander steht Charlie im Raum. Wie seltsam es ist – geradezu desorientierend –, aus dem inneren Film zurück in die Realität gerissen zu werden. An diesem Zimmer ist nichts Frohes mehr, erkennt sie jetzt. Es ist nur ein weiß gestrichener Kasten voller Erinnerungen, die durch die Tragödie bitter geworden sind.
Robbie steht noch immer im Türrahmen und beobachtet sie. Er weiß, was gerade passiert ist.
Einer dieser Filme in ihrem Kopf.
Dass er sich an denen nie störte, ist eines der Dinge, die sie an ihm liebt. Er weiß, was mit ihr los ist, weiß von ihren Problemen, und den Rest versteht er einfach.
»Hast du heute deine Tablette genommen?«
Charlie schluckt und nickt. »Ja.«
»Und hast du fertig gepackt?«, fragt er, als fahre sie nur übers Wochenende weg und nicht aller Voraussicht nach für immer.
»Ich glaube. Leicht war’s nicht.«
Den größten Teil des Tages hat sie damit verbracht, ihre Sachen in zwei Haufen zu sortieren: mitnehmen und dalassen. Letztendlich nahm sie kaum etwas mit. Nur zwei Koffer mit dem Nötigsten und einen Karton mit Erinnerungsstücken und den geliebten Videokassetten. Der Rest wanderte in Kisten, die sie gewissenhaft in die Zimmermitte stellte. Das würde dem Hausmeisterservice die Entsorgung erleichtern, sobald sie begriffen hätten, dass sie nicht zurückkehren würde.
»Du kannst dir ruhig noch mehr Zeit lassen«, sagt Robbie. »Du musst nicht heute Abend fahren. Und wie gesagt, wenn du bis zum Wochenende wartest, fahre ich dich gern.«
Das weiß Charlie. Aber zu warten, und seien es nur wenige Tage, kann sie sich genauso wenig vorstellen wie zu bleiben. »Jetzt gibt’s kein Zurück mehr, glaube ich.«
Sie nimmt ihren Mantel. Also, Maddys Mantel, ein Geschenk von deren Großmutter. Er war versehentlich zurückgeblieben, als man Maddys Sachen fortschaffte. Charlie fand ihn unter dem Bett und behielt ihn für sich selbst. Ein echtes Vintage-Stück aus den Fünfzigerjahren und ungewohnt spektakulär für Charlie, die sich eigentlich möglichst unauffällig kleidet. Ein knallroter Wollmantel mit riesigem Kragen, der sich wie zwei Schmetterlingsflügel auf ihre Schultern legt, als sie ihn bis zum Kinn zuknöpft.
Robbie nimmt die beiden Koffer und überlässt Charlie den Karton und den JanSport-Rucksack, den sie statt einer Handtasche benutzt. Die Zimmertür schließt sie nicht ab. Wozu auch? Als letzte Handlung wischt sie die beiden Namen ab, die mit Whiteboardmarker auf der kleinen Tafel an der Tür geschrieben stehen.
Charlie + Maddy.
Sie hinterlassen eine Farbspur auf ihrer Handfläche.
Leise huschen Charlie und Robbie nach draußen, unbemerkt von den anderen Mädchen auf der Etage, von denen die meisten im Fernsehraum am Ende des Flurs versammelt sind. Man hört die schnarrende Stimme von Roseanne Barr, gefolgt von Konservengelächter. Charlie hat nie begriffen, warum ihre Mitbewohnerinnen derart süchtig nach Serien sind (warum fernsehen, wo Filme doch so viel besser sind?), aber heute Abend ist sie froh darüber, dass alle abgelenkt sind. Sie will sich nicht verabschieden. Früher war sie mit einigen der Mädchen gut befreundet, aber das endete abrupt, als Maddy starb. Jetzt ist es am besten, still und heimlich zu verschwinden. Von einem Moment auf den anderen. Wie Maddy.
»Das wird dir sicher guttun«, sagt Robbie im Aufzug auf dem Weg ins Erdgeschoss. Charlie entgeht nicht, wie hohl die Worte klingen – man hört deutlich, dass er das Gegenteil denkt. »Eine kleine Auszeit ist wahrscheinlich alles, was du brauchst.«
Seitdem Charlie vor drei Tagen die Absicht geäußert hatte, das College zu verlassen, verharrte Robbie in süßer Verleugnung dessen, was das für sie als Paar bedeutete. Trotz der Versprechen, einander treu zu sein, und des hastig gefassten Plans, sich in den Weihnachtsferien in Youngstown zu treffen, weiß Charlie, wie die Dinge wirklich stehen.
Ihre Beziehung geht zu Ende.
Nicht auf diese »Lass uns ab jetzt getrennte Wege gehen«-Art. Und ganz bestimmt nicht wie bei Rhett Butler mit seinem »Offen gesagt, pfeif’ ich drauf«. Aber Charlie ist klar, dass es unweigerlich auf eine Trennung hinausläuft. Sie wird zwei Staaten und sechshundert Kilometer weit entfernt leben. Er wird an der Olyphant University bleiben und die Aufmerksamkeit der anderen Studentinnen auf sich ziehen. Ein echter Fang, um es mit Maddys Worten auszudrücken, nachdem sie ihn kennengelernt hatte. Robbie Wilson, Mathegenie des Campus und Assistenz-Schwimmtrainer mit dem Richard-Gere-Kinn und dem Brad-Pitt-Waschbrettbauch. Schon jetzt kreisen die Mädchen über ihm wie Geier, begierig, Charlies Platz einzunehmen. Vermutlich wird eine von ihnen irgendwann Erfolg haben.
Wenn das der Preis dafür ist, dass sie von hier fortkommt, dann muss es wohl so sein. Sie hofft nur, dass sie es niemals bereuen wird.
AUSSEN – STUDENTENWOHNHEIM – NACHT
Als sie aus dem Aufzug treten, ist die Vorhalle des Wohnheims verlassen. Ebenso der schneebestäubte Hof, den sie auf dem Weg zum Parkplatz überqueren. Obwohl der Winter Einzug gehalten hat, stehen die Fenster einiger Zimmer in den oberen Etagen offen, und die vertrauten Laute des Campuslebens dringen heraus. Gelächter. Das Brummen von Mikrowellenherden in den Zimmern. Musik, lauter als eigentlich erlaubt. Charlie erkennt das Lied: »Kiss Them For Me« von Siouxsie and the Banshees.
Maddy hatte es geliebt.
Am Straßenrand angekommen, stellt Robbie die beiden Koffer am vereinbarten Treffpunkt neben einer Straßenlaterne ab. »Das war’s dann wohl, nehme ich an.«
Charlie macht sich auf eine Neuauflage der Diskussion gefasst, die sie schon Dutzende Male geführt haben. Muss sie wirklich weg? Besteht wirklich keine Hoffnung, dass sie bis Semesterende durchhält?
Ihre Antwort war jedes Mal dieselbe. Ja, sie muss weg. Nein, sie hält nicht bis Semesterende durch. Kurz nach Maddys Tod, da hatte sie es noch für möglich gehalten.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt weiß sie mit absoluter Klarheit, dass sie hier rausmuss, koste es, was es wolle.
Sie hat alle Veranstaltungen sausen lassen und trifft sich nicht mehr mit ihren Freundinnen. Sie hat ihr altes Leben nahezu aufgegeben, eine Existenz im Leerlauf. Es wird Zeit, dass sie sich wieder bewegt, und sei es nur fort von allem.
Es ist Robbie hoch anzurechnen, dass er im letzten Moment nicht doch noch einen Versuch macht, sie zum Bleiben zu überreden. Wahrscheinlich hat sie ihn mürbe gemacht, vermutet Charlie. Alles, was jetzt noch bleibt, ist, sich zu verabschieden.
Robbie zieht sie fest in die Arme und küsst sie. In seiner Umarmung plagen Charlie Gewissensbisse, dabei beruht ihre Entscheidung auf einem anderen, ganz eigenen Schuldgefühl. Wie eine Matrjoschka-Puppe aus Reue. Schuldgefühl über Schuldgefühl, weil sie das Einzige kaputt macht, das noch heil geblieben war.
»Tut mir leid«, sagt sie, bestürzt über den kleinen Knacks in ihrer Stimme, den sie mit Schlucken bekämpft. »Ich weiß, wie bitter das für dich ist.«
»Du warst schlimmer dran«, sagt Robbie. »Ich hab inzwischen verstanden, warum du das hier machen musst. Hätte mir schon früher klar werden sollen. Jetzt hoffe ich einfach, dass dieser Abstand genau das ist, was du brauchst, und dass du es zum Sommersemester schaffst, hierher zurückzukommen. Zu mir.«
Wieder nagt das Schuldgefühl an ihr, als Robbie sie mit riesigen braunen Augen ansieht. Bambi-Augen nannte Maddy sie immer. So rund und seelenvoll. Charlie war wie verzaubert, als sie Robby zum ersten Mal sah.
Ihre erste Begegnung war im Grunde ziemlich unspektakulär, aber in ihrer Erinnerung hat sie etwas von klassischer Liebeskomödie. Es war in der Bibliothek: sie, die vor Cola light und Semesterhalbzeitstress kaum noch zurechnungsfähige Studentin im zweiten Studienjahr, er, der unverschämt attraktive frischgebackene Aufbaustudent auf der Suche nach einem Sitzplatz. Er wählte ausgerechnet ihren Tisch, der eigentlich für vier Personen gedacht, aber völlig von Charlie und ihren Büchern in Anspruch genommen war.
»Hast du noch ein Eckchen für mich?«, hatte er gefragt.
Charlie sah von dem Pauline-Kael-Buch auf, in das sie vertieft war, erblickte diese Augen und war zu nichts mehr fähig. »Äh … klar.«
Aber sie räumte ihm keinen Platz frei. Sie konnte tatsächlich keinen Finger rühren. Nur ihn anstarren. So intensiv, dass er sich über die Wange wischte und fragte: »Hab ich etwas im Gesicht hängen?«
Da musste sie lachen. Er setzte sich. Sie fingen an, sich zu unterhalten. Über die Semesterhalbzeitprüfungen. Das Leben am College. Das Leben überhaupt. Sie erfuhr, dass Robbie bereits das Grundstudium an dieser Universität absolviert und dann beschlossen hatte, weiterzumachen und eine Laufbahn als Mathematikprofessor anzustreben. Robbie erfuhr, dass Charlie dreimal mit ihren Eltern in ›E.T.‹ gewesen war und jedes Mal auf dem ganzen Heimweg geheult hatte.
Sie redeten, bis die Bibliothek schloss. Und dann redeten sie in einem Diner außerhalb des Campus weiter und waren noch nicht fertig, als sie um zwei Uhr nachts zu Charlies Wohnheimblock schlenderten. Da gestand Robbie ihr: »Weißt du was, ich brauchte gar nicht wirklich einen Sitzplatz. Das war nur eine Ausrede, um dich anzusprechen.«
»Warum denn das?«
»Weil du etwas Besonderes bist«, sagte er. »Das habe ich sofort erkannt, als ich dich sah.«
Da war es um Charlie geschehen. Robbie gefiel ihr rein äußerlich, klar, und auch, dass ihm das gar nicht bewusst zu sein schien. Ihr gefiel sein Sinn für Humor. Und dass ihn Filme überhaupt nicht interessierten, was ihr erfrischend fremd vorkam. Ganz anders als die Milchbubis in ihren Seminaren, die nur von ›Der Pate‹ schwärmten.
Eine ganze Weile lief es gut zwischen ihnen – ach was, es lief einfach toll. Dann starb Maddy, und Charlie veränderte sich, und nun wird sie nie wieder das Mädchen sein, das damals in der Bibliothek saß.
Robbie schaut auf die Uhr und nennt ihr die Zeit. Fünf nach neun. Josh verspätet sich. Charlie fragt sich, in welche Kategorie Sorge sie das stecken soll.
»Du musst nicht mit mir hier warten«, sagt sie.
»Ich will aber.«
Eigentlich sollte Charlie das auch wollen, das weiß sie. Es wäre nur normal, so viel Zeit wie möglich mit ihm verbringen zu wollen. Sie hingegen möchte ein hastiges »Tschüs, bis dann« vor den Augen eines Beinahe-Fremden vermeiden. Normal ist der Wunsch nach einem traurigen Abschied ganz in Ruhe, nur zu zweit, ohne Zeugen. Das Ende von ›Casablanca‹, als Humphrey Bogart Ingrid Bergman zum Flugzeug begleitet. Oder wie Barbra Streisand Robert Redford in ›So wie wir waren‹ übers Haar streicht.
»Es ist kalt«, sagt sie. »Geh lieber zurück in dein Apartment. Du hast doch morgen ganz früh ein Seminar.«
»Bist du sicher?«
Charlie nickt. »Ich komme klar. Wirklich.«
»Ruf mich an, wenn du zu Hause ankommst«, sagt Robbie. »Egal wie spät es ist. Und wenn du zwischendrin eine Telefonzelle siehst, bitte auch. Damit ich weiß, dass alles in Ordnung ist.«
»Was soll auf der Fahrt von New Jersey nach Ohio schon passieren, außer vor Langeweile zu sterben?«
»Das meine ich nicht.«
Ja, das weiß sie. Sie denkt an dasselbe wie er. An das, was keiner von ihnen aussprechen will, weil es diesen Abschied verderben würde.
Maddy wurde ermordet.
Von einem Unbekannten.
Der irgendwo noch frei herumläuft. Und wahrscheinlich nur darauf wartet, erneut zuzuschlagen.
»Ich versuche mich zu melden. Versprochen.«
»Hey, tu doch so, als wäre es einer von diesen Filmen, die du mir ständig gezeigt hast. Mit dem französischen Namen.«
»Film noir?« Charlie schüttelt den Kopf. Hat er in dem Jahr mit ihr denn gar nichts gelernt?
»Ja, genau so einer. Du bist entführt worden, und deine einzige Chance, Hilfe zu bekommen, besteht darin, deinem besorgten Freund eine verschlüsselte Botschaft zu übermitteln.«
Charlie ist froh darüber, wie er mit diesen Abschied umgeht. Nicht traurig – im Gegenteil, cineastisch. »Und wie lautet der Code?«, geht sie darauf ein.
»›Die Sache hat eine neue Wendung genommen.‹« Sein Tonfall legt nahe, dass er Humphrey Bogart imitieren will, auch wenn es in ihren Ohren eher nach Jimmy Stewart klingt.
»Und wenn alles in Ordnung ist?«
»›Es läuft wie geschmiert, Baby.‹«
Diesmal klingt er tatsächlich wie Bogart. Charlies Herz öffnet sich einen Spalt. »Ich liebe dich«, sagt sie.
»Ich weiß.«
Sie kann nicht erkennen, ob das eine bewusste Anspielung auf ›Star Wars‹ ist oder nur ein glücklicher Zufall. Aber es ist egal, denn jetzt küsst er sie wieder, umarmt sie ein letztes Mal und verabschiedet sich endgültig von ihr, auf viel traurigere Art als in jedem Film. Der Schmerz in ihrer Brust schwillt an, ein heftiges Stechen, von dem sie befürchtet, dass es sie die ganze Fahrt begleiten wird.
»Du bist und bleibst etwas ganz Besonderes, Charlie«, sagt er. »Vergiss das nie.«
Dann ist er weg, und sie steht allein mit ihren beiden Koffern und dem Karton am Straßenrand, und allmählich fühlt sich die Sache real an.
Sie tut es wirklich.
Sie kehrt dem College den Rücken.
In ein paar Stunden wird sie zu Hause sein und wahrscheinlich mit Nana Norma einen Film schauen. Und vielleicht anfangen, wieder zu der Charlie zurückzufinden, die sie einmal war.
Sie öffnet ihren Rucksack und holt die orange Pillenflasche heraus, die seit September ganz unten darin klappert. Auch ihr Inhalt ist orange: kleine Pillen, bei denen sie immer an M&Ms denken musste, wenn sie eine nahm. Als sie sie noch nahm.
Denn was sie zu Robbie sagte, war gelogen. Es ist drei Tage her, seit sie die letzte heruntergewürgt hat. Die Psychiaterin, die sie ihr verschrieb, sagte zwar, sie würden die Filme in ihrem Kopf im Zaum halten, und das war richtig. Aber Charlie wurde davon auch schläfrig und unruhig, und zwar beides zugleich – ständig schwankte ihr Körper zwischen diesen Extremen. Was zu einigen Wochen voller schlafloser Nächte und verlorener Tage führte. Ein Vampir. Das machten diese orangen Pillen aus ihr.
Damit sie schlafen konnte, verschrieb die Psychiaterin ihr zusätzlich andere, weiße Pillen.
Die waren noch schlimmer.
So schlimm, dass sie sie bereits entsorgt hat.
Jetzt ist es an der Zeit, auch die orangen zu entsorgen. Sie hat genug von Pillen gleich welcher Farbe.
Charlie tritt auf die Fahrbahn, geht ein paar Schritte zu einem in den Asphalt eingelassenen Gully, schüttet die Pillen hinein und genießt voller Befriedigung den Anblick, wie sie am Metallgitter abprallen und dann in der Finsternis darunter verschwinden. Die Flasche wirft sie in einen Mülleimer nahebei.
Sie kehrt zu ihrem Gepäck zurück und zieht den roten Mantel enger um sich. Es ist ein typischer Novemberabend am Übergang von Herbst zu Winter. Klarer Himmel, hell leuchtende Sterne, aber ein eiskalter Frosthauch, der sie erschauern lässt. Vielleicht erschauert sie auch deshalb, weil sie ganz allein hier draußen steht, während irgendwo noch ein Killer herumläuft.
Wäre sie sich der Gefahr nicht von sich aus bewusst, der »Holt euch die Nacht zurück!«-Flyer, der an der Straßenlaterne neben ihr klebt, würde sie daran erinnern. Diese Flyer waren eine unmittelbare Reaktion auf Maddys Tod. Genau wie die Mahnwachen bei Kerzenlicht. Die Gastredner. Die Trauerbegleiter, die mit Pamphleten und guten Absichten bewaffnet über den Campus herfielen.
Charlie hielt sich von alldem fern und trauerte lieber allein. Deshalb bekam sie auch nicht mit, dass die Atmosphäre auf dem Campus in den letzten zwei Monaten von großer Furcht geprägt war. Sie verbrachte die meiste Zeit in ihrem Zimmer und hatte folglich keinen Grund, Angst zu haben.
Doch nun kribbelt es ihr eiskalt im Nacken. Da ist es nicht hilfreich, die Liste der Regeln auf dem Flyer zu lesen, von denen sie gerade die meisten missachtet.
Geh nachts niemals allein nach draußen.
Geh immer zu zweit.
Sag immer jemandem Bescheid, wohin du gehst.
Traue niemals einem Fremden.
Der letzte Punkt gibt Charlie zu denken. Denn so gern sie es anders sehen würde, Josh ist ein Fremder. Oder wäre einer, wenn er denn endlich käme. Charlie trägt keine Uhr und weiß nicht, wie spät es inzwischen ist. Bestimmt schon Viertel nach. Wenn er nicht bald auftaucht, wird sie ins Wohnheim zurückkehren müssen. Wahrscheinlich hätte sie das längst tun sollen. Himmel, wenn es nach dem Flyer geht, sollte sie gar nicht erst hier herumstehen, allein am Straßenrand mit zwei Koffern und einem Karton, weithin erkennbar als eine, die alles hinter sich lässt und die fürs Erste niemand vermissen wird.
Doch der Drang fortzukommen übersteigt die Angst um ein Vielfaches, daher bleibt sie, wo sie ist, den Blick auf die Einfahrt des Parkplatzes gerichtet.
Nicht lange, da erscheinen in der Ferne zwei helle Lichter.
Scheinwerfer.
Sie biegen in den Parkplatz ein, beschreiben eine weite Kurve und kommen genau auf sie zu. Charlie kneift die Augen zusammen und richtet den Blick auf den Gehweg, wo ihr langgestreckter Schatten wie ein Geist über das schneebestäubte Gras hinter ihr huscht. Einen Moment später steht das Auto am Bordstein. Die Fahrertür öffnet sich, und Josh steigt aus.
»Hi, Charlie«, sagt er mit einem schüchternen Lächeln, als wäre das hier ein erstes Date.
»Hi.«
»Tut mir leid, dass wir in der Nacht fahren müssen. Ging nicht anders.«
»Das macht mir nichts aus.« In den letzten zwei Monaten ist ihr die Dunkelheit sehr vertraut geworden. Viele Nächte hindurch war sie hellwach, auch wegen der Pillen, und verbrachte die Zeit vor dem Fernseher, in Gesellschaft irgendeines Films.
Josh klopft auf das Dach des Wagens. »Na dann – deine Kutsche wartet. Nicht gerade eine Limousine, aber ans Ziel bringt sie uns.«
Charlie mustert das Auto. Auf sie zumindest wirkt der schiefergraue Pontiac Grand Am alles andere als armselig. Er scheint frisch gewaschen zu sein. Er ist nicht augenfällig zerkratzt oder verbeult, und die Fenster sind definitiv nicht getönt. Charlie kann problemlos den Beifahrersitz sehen, der erfreulich leer ist. So ein Auto könnte ihr Vater fahren, wenn er noch lebte. Funktional. Und hoffentlich zuverlässig. Ein Auto, gemacht dafür, nicht aufzufallen.
Josh lässt den Blick über ihre beiden Koffer und den Karton wandern. »Hätte nicht gedacht, dass du so viel dabeihast. Planst du, länger fort zu sein?«
»Hoffentlich nicht zu lange«, sagt sie, ohne es wirklich zu meinen. Wobei sie sich fragt, ob sie es tief drinnen nicht doch hofft. Warum auch nicht? Ist sie Robbie nicht einen Versuch schuldig, zum Sommersemester zurückzukommen? Oder sich selbst?
Auch wenn Maddy der Grund für ihr Handeln ist, weiß Charlie, dass die es nicht gut fände.
Du bist einfach nur dämlich, Schätzchen, hätte sie zu der Idee gesagt, das Studium sausen zu lassen.
»Passen die Sachen denn noch rein?«, fragt sie.
»Auf jeden Fall.« Schnell geht er zum Kofferraum und schließt ihn auf.
Charlie hebt den Karton an und will ihn dorthin tragen, aber Josh kommt ihr schon entgegen und nimmt ihr die Last ab. »Lass mich das machen.«
Mit plötzlich leeren Armen, nur den Rucksack auf dem Rücken, schaut Charlie zu, wie er ihre Sachen einlädt. In den wenigen Sekunden fällt ihr auf, dass er merkwürdig steht. Statt zum Einladen genau hinter den Kofferraum zu treten, bleibt er schräg davor stehen, sodass sein breiter Rücken ihr die Sicht versperrt. Als wäre noch etwas darin. Wovon er nicht will, dass sie es sieht.
Vermutlich ist es nichts von Belang.
Nein, es ist ganz sicher nichts von Belang. Menschen tun die seltsamsten Dinge. Sie zum Beispiel sieht im Kopf Filme ablaufen, und Josh lädt eben seinen Kofferraum komisch ein. Basta.
Doch dann knallt er den Kofferraum zu, und sie bemerkt noch etwas an ihm. Etwas, das ihr seltsamer vorkommt als das Einladen ihrer Koffer.
Josh trägt genau dieselbe Kleidung wie bei ihrer Begegnung am Schwarzen Brett.
Dieselben Jeans. Dasselbe Sweatshirt. Dieselbe gute Frisur. Ja, sie sind an einer Universität, hier sieht jeder so aus; im Prinzip ist es die inoffizielle Olyphant-Uniform. Aber Josh macht den Eindruck, als fühle er sich darin nicht ganz wohl, als sei es nicht seine übliche Kleidung. Irgendwie, wird Charlie klar, sieht er nach Filmklischee aus, wie ein Statist. Typischer College-Frauenschwarm Folge 2.
Wieder lächelt er ihr zu, und sie bemerkt, wie absolut perfekt das Lächeln ist. Das Lächeln eines Matinee-Stars, so strahlend, dass es schon einschüchternd wirkt. Könnte sexy sein. Oder unheimlich. Charlie kann sich nicht entscheiden.
»Fertig«, sagt er. »Und, machen wir uns vom Acker?«
Charlie antwortet nicht sofort. Sie überlegt, ob das alles Warnzeichen sein könnten. Der Kofferraum. Die Kleidung. Sie hatte sich geschworen, angesichts solcher Dinge sofort kehrtzumachen und zurück ins Wohnheim zu gehen.
Noch ist es nicht zu spät. Sie könnte Josh einfach sagen, sie hätte es sich anders überlegt und er solle ihre Sachen wieder ausladen. Stattdessen ermahnt sie sich, nicht so misstrauisch zu sein. Nicht Josh ist das Problem oder seine Kleidung oder wie er den Kofferraum belädt. Das Problem ist sie selbst – nämlich, dass sie jetzt, unmittelbar vor der Abreise, plötzlich nach Gründen sucht, hierzubleiben.
Und Gründe gibt es genug. Sie sollte ihr Studium fortsetzen. Sie liebt ihr Studienfach. Außerdem würde es Robbie glücklich machen.
Aber wäre sie glücklich?
Charlie bezweifelt es.
Sie könnte so tun als ob, Robbie zuliebe. Sie könnte mit dem Alltagstrott weitermachen wie schon die ganze Zeit über seit September. Und vielleicht, ganz vielleicht, würde sich die düstere Wolke, die über ihr hängt, schließlich heben, und sie könnte wieder zu einer normalen Studentin werden. Nun ja, halbwegs normal. Charlie weiß, dass sie nie genau so sein wird wie die anderen. Schon immer umwehte sie eine Aura des Absonderlichen, und das wird so bleiben. Aber das ist okay.
Nicht okay ist, jedenfalls in ihren Augen, an einem Ort zu bleiben, wo sie unglücklich ist. Wo sie täglich an einen tiefen, schmerzlichen Verlust erinnert wird. Wo jede Erinnerung ein Nadelstich ist, wo Schuld an ihr klebt und keine Woche, kein Tag, ja, keine Stunde vergeht, in der sie nicht denkt: Hätte ich sie nur nicht alleingelassen. Hätte ich ihn nur aufgehalten. Hätte ich sie nur gerettet.
Sie schaut Josh an, der noch immer geduldig auf ihre Antwort wartet.
»Ja, lass uns verschwinden«, sagt sie.
INNEN – PONTIAC GRAND AM – NACHT
Charlie hat das Autofahren in dem Fahrzeug gelernt, in dem später ihre Eltern starben.
Ihr Vater brachte es ihr bei, Runde für stotternde Runde auf dem Schulparkplatz, seine Geduld zunehmend strapaziert. Er bestand darauf, dass sie mit einem Schaltwagen übte, weil sie dann »alles würde fahren können«, wie er sagte. Aber für Charlie blieb die Gangschaltung ein Rätsel. Drei Pedale statt der zwei im Auto ihrer Mutter, und dazu die Schrittfolge. Ein Tanz, den sie nicht beherrschte und von dem sie glaubte, sie würde ihn nie lernen.
Den linken Fuß auf die Kupplung.
Den rechten auf die Bremse.
Ganghebel in Leerlaufstellung. Anlassen. Vorsichtig Gas geben.
Sie brauchte einen ganzen Nachmittag, bis sie eine Runde über den Parkplatz zustande brachte, ohne den Motor abzuwürgen oder die Kupplung auf eine Art aufheulen zu lassen, dass ihr Vater Schweißausbrüche bekam. Danach dauerte es noch zwei Wochen, bis sie sich hinter dem Steuer jenes rotbraunen Chevy Citation wirklich wohlfühlte. Aber den Rest lernte sie dann mühelos. Wenden in drei Zügen, paralleles Einparken, Slalomfahren zwischen Warnhütchen, die sich ihr Vater von einem Kumpel in der Baubranche ausgeliehen hatte. Die Fahrprüfung bestand sie beim ersten Versuch mit Bravour, anders als ihre beste Freundin Jamie, die drei Anläufe brauchte. Danach ging sie mit ihrem Vater zur Feier des Tages ein Eis essen – sie setzte sich hinters Steuer, er auf den Beifahrersitz, von wo aus er ihr weiteren Unterricht und Ratschläge gab.
»Fahr nie mehr als zehn Stundenkilometer über dem Tempolimit. Wegen so wenig hält dich keiner an.«
»Und bei über zehn?«, kitzelte sie ihn ein bisschen mit dem Gedanken, sie könnte zur notorischen Raserin werden.
Ihr Vater bedachte sie mit einem dieser »Also wirklich«-Blicke, die sie seit Beginn ihrer Pubertät nur zu gut kannte. »Willst du etwas mit deinem Führerschein anfangen oder nicht?«
»Doch, natürlich.«
»Dann halte dich immer ans Tempolimit.«
Als Charlie in den zweiten Gang schaltete, schien auch ihr Vater umzuschalten. Er lehnte sich zurück und ließ den Blick durch das Beifahrerfenster schweifen. »Erzähl das nicht deiner Mutter, sonst explodiert sie«, sagte er, »aber manchmal gibt es Situationen, in denen man es nicht vermeiden kann, zu schnell zu fahren. Manchmal hat man keine andere Wahl, als zu rasen wie der Teufel.«
Josh rast keinesfalls wie der Teufel, sondern hält sich an die vorgeschriebenen sechzig Stundenkilometer, und die reichen Charlie völlig aus. Nach zwei Monaten Stillstand ist sie endlich wieder in Bewegung. Nun gut, das wird nichts an dem ändern, was passiert ist. Und auch nicht an der Rolle, die sie dabei gespielt hat. Aber Charlie hofft, dass dieses bisschen Bewegung der erste Schritt auf dem langen Weg dahin ist, das Geschehene zu akzeptieren und sich selbst zu vergeben. Als sie das hell erleuchtete »Olyphant University«-Schild an der Ausfahrt passieren, gibt sie sich der Erleichterung hin, die sich wie eine Woge zu einer tröstlichen Umarmung um sie legt.
Vielleicht ist es aber auch nur die warme Heizungsluft, die durch die Schlitze im Armaturenbrett auf sie einströmt. Nach dem langen Herumstehen in der Kälte genießt sie die Wärme genauso wie die Tatsache, dass das Auto im Innern ebenso sauber ist wie von außen. Kein Dreck auf dem Boden oder McDonald’s-Verpackungen auf dem Beifahrersitz wie in Robbies Auto. Es riecht sogar sauber, als hätte Josh gerade das volle Programm in der Waschanlage absolviert. Vom Sitz steigt dezent der Geruch von Polstershampoo auf und mischt sich mit dem starken, nur mäßig angenehmen Kiefergeruch des Duftbaums, der am Rückspiegel hängt. Als sie in die Hauptstraße einbiegen, die am Campus entlang verläuft, schlägt ihr eine frische Wolke Kiefergestank entgegen. Sie rümpft die Nase.
Josh entgeht das nicht – wie auch. Der Grand Am ist zwar alles andere als ein Kleinwagen, dennoch sitzt man ziemlich dicht nebeneinander. Einzig die Mittelkonsole, in der Kleingeld sowie Kunststoffteile klappern, trennt die beiden Vordersitze. Josh lenkt mit links und schaltet mit rechts, wodurch sein Unterarm oft nur Zentimeter von Charlies entfernt ist.
»Tut mir leid mit dem Lufterfrischer«, sagt er. »Der ist ziemlich, äh, wirkungsvoll. Wenn du willst, kann ich ihn entfernen.«
»Ist schon gut«, sagt Charlie, auch wenn sie sich dessen nicht ganz sicher ist. Eigentlich liebt sie den Duft von Nadelbäumen. Als Kind grub sie die Nase in jeden frisch geschlagenen Weihnachtsbaum und atmete tief ein. Aber das hier ist etwas anderes. Chemie, die sich als Natur ausgibt. Am liebsten würde Charlie das Fenster ein Stück herunterkurbeln. »Ich gewöhne mich bestimmt bald daran.«
Für Josh ist die Sache damit erledigt. Er nickt, den Blick auf die Straße gerichtet. »Nach meiner Berechnung müsste die reine Fahrtzeit etwa sechs Stunden betragen. Pausen nicht eingerechnet.«
Das weiß Charlie von früheren Heimfahrten. Bis zur Interstate 80 braucht man eine halbe Stunde, auf einer von Bastelläden, Zahnarztpraxen und Reisebüros gesäumten kleinen Landstraße. Dann, auf dem Highway, überquert man nach etwa einer weiteren halben Stunde den Delaware-Durchbruch, die Grenze zu Pennsylvania. Danach kommen die Pocono Mountains und dann stundenlang gar nichts. Nur Felder, Wälder und Monotonie, bis man endlich Ohio und kurz darauf auch schon die Ausfahrt Youngstown erreicht. Als Josh sagte, vor neun würden sie nicht losfahren, fand sie sich damit ab, frühestens um drei Uhr nachts zu Hause zu sein. Sie hatte sowieso keine andere Wahl.
»Du darfst gern schlafen, wenn du willst«, sagt Josh.
Das kommt nicht in Frage. So nett und freundlich Josh zu sein scheint, Charlie hat vor, die ganze Fahrt über hellwach zu bleiben.
Sei immer auf der Hut – noch einer der Ratschläge von dem »Holt euch die Nacht zurück«-Flyer.
»Geht schon«, sagt sie. »Ich kann dir gern Gesellschaft leisten.«
»Dann sehe ich zu, dass wir uns vor dem Highway noch einen Kaffee besorgen.«
»Hört sich gut an«, sagt sie.
»Na dann.«
Und schon ist ihr Gesprächsstoff erschöpft. Nach nur zwei Minuten. Unbehaglich sitzt Charlie in dem entstandenen Schweigen und fragt sich, ob sie etwas sagen sollte, irgendetwas, um das Gespräch am Laufen zu halten. Das ist einer der Punkte, über die sie sich Gedanken gemacht hat, seit Josh angeboten hat, sie mitzunehmen: wie man sich verhält, wenn man im Auto eines Beinahe-Fremden sitzt.
Ihr war klar, dass es nicht wie im Film sein würde. Da haben sich zwei einander fremde Personen im Auto immer endlos viel zu sagen, was üblicherweise mit einer Lovestory oder einem Mord endet. Im echten Leben wirkt es oft aufdringlich, wenn man zu viel redet. Und unhöflich, wenn man schweigt. Das gilt natürlich auch für Josh – beim Packen hatte Charlie abwechselnd Sorge, er könnte zu viel oder zu wenig reden.
Das Schweigen zwischen Fremden ist etwas anderes als die langen Perioden des Schweigens, die sie mit Maddy oder Robbie erlebt hat. Mit jemandem, den man kennt und bei dem man sich wohlfühlt, ist Schweigen kein Problem. Ist man einander fremd, kann es alles Mögliche bedeuten.
Ein Fremder ist nur ein Freund, den man noch nicht kennt, sagte Maddy immer. Eigentlich seltsam, denn Maddy war immer schnell dabei, andere zu bewerten. Charlie hingegen war schüchtern und gehemmt. Um sie aus ihrem Schneckenhaus zu locken, musste man schon hartnäckig sein. Maddy war das genaue Gegenteil: extrovertiert und theatralisch. Von Menschen, die ihren Sinn fürs Dramatische nicht teilten oder nicht zu schätzen wussten, hatte sie schnell genug. Genau deshalb waren Charlie und sie das perfekte Gespann: Maddy setzte sich in Szene, und Charlie sah bewundernd zu.
»Du bist gar nicht ihre Freundin«, hatte Robbie einmal verärgert gesagt, nachdem Maddy eine Unternehmung zu dritt abgesagt hatte, weil sie lieber mit ihren Kommilitonen aus der Theaterwissenschaft auf eine Party wollte. »Du bist ihr Publikum.«
Doch Robbie verstand nicht – würde nie verstehen können –, dass Charlie das sehr wohl wusste und dass es sie nicht störte. Ja, sie war dankbare Zuschauerin, wenn Maddy sich selbst inszenierte. Das verlieh ihrem ruhigen Leben die dringend benötigte Dramatik, und dafür liebte Charlie Maddy.
Doch das alles ist vorbei. Maddy ist tot. Charlie hat sich von der Welt zurückgezogen. Und da sie Josh nie wiedersehen wird, sobald er sie in Youngstown abgesetzt hat, sieht sie keinen Sinn darin, aus diesem Fremden einen Freund zu machen.
Gerade als sie sich damit abgefunden hat, die nächsten sechs Stunden in unbehaglichem, kieferduftgeschwängertem Schweigen zu verbringen, wird Josh auf einmal gesprächig.
»Was zieht dich eigentlich so nach Youngstown?«, fragt er.
»Meine Großmutter.«
»Nett.« Josh nickt wohlwollend. »Familienbesuch?«
»Ich wohne bei ihr.« Aus langjähriger Erfahrung weiß sie, dass auf diese Antwort weniger Nachfragen kommen, als wenn sie die ganze Wahrheit sagt – nämlich, dass ihre Großmutter in dem Haus wohnt, das Charlie von ihren toten Eltern geerbt hat.
»Muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich einen Mitfahrer finden würde«, sagt er. »Um diese Jahreszeit verlässt fast niemand den Campus. Und die meisten haben sowieso ein eigenes Auto. Ist dir das schon aufgefallen? Die Parkplätze sind total voll. Es überrascht mich, dass du keines hast.«
»Ich fahre nicht Auto.« Charlie weiß, dass das klingt, als könne sie nicht fahren. Tatsache ist, dass sie nicht will. Nicht, seit ihre Eltern den Unfall hatten. Das letzte Mal, als sie hinter dem Steuer saß, war am Tag, bevor sie starben. Als vor drei Monaten ihr Führerschein ablief, machte sie sich nicht die Mühe, ihn zu verlängern.
Mit jemandem mitzufahren, ist für sie in Ordnung. Es geht ja auch nicht anders. Es führt kein Weg daran vorbei, dass sie gelegentlich in ein Auto steigen muss. Sie weiß auch, dass jederzeit etwas passieren kann, ob sie nun selbst fährt oder nicht. Wie ihrer Mutter. Die saß auch nur neben ihrem Vater, als der Wagen von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte – beide waren sofort tot.
Niemand weiß, warum er das Steuer herumriss. Theorien gibt es viele. Er wollte einem Wildtier ausweichen. Er bekam einen Herzinfarkt. Mit der Steuerung hat tragischerweise etwas nicht funktioniert.
Unfälle passieren eben.
Das bekam Charlie in den Wochen danach ständig zu hören, als sich abzeichnete, dass sie nie wieder Auto fahren würde. Unfälle passieren, und Menschen sterben, und das ist schlimm, aber das sei kein Grund, fortwährend Angst zu haben und sich nicht mehr hinters Steuer zu setzen.
Niemand begriff, dass es nicht um die Angst ging, bei einem Autounfall zu sterben, sondern um die Angst, einen Unfall zu verursachen und schuld daran zu sein, wenn Menschen dabei starben. Sie wollte niemandem den Schmerz zufügen, den ihr Vater anderen zugefügt hatte.
Welch Ironie des Schicksals, dass nun jemand gestorben ist und Charlie schuld daran ist – ohne dass ein Auto im Spiel war.
»Dann ist es ja ein Glück, dass wir uns gefunden haben«, sagt Josh. »Machst du das öfter mit dem Schwarzen Brett?«
Charlie schüttelt den Kopf. »Zum ersten Mal.«
Bisher war es nie nötig gewesen. Zu Beginn des Semesters hatte Nana Norma sie immer nach Olyphant gebracht und am Ende wieder abgeholt. Nachdem ihre Augen immer schlechter geworden waren und auch sie nicht mehr fahren wollte, hatte Robbie das im vergangenen Herbst übernommen. Der einzige Grund, warum Charlie jetzt nicht bei ihm in seinem Volvo sitzt, ist, dass Robbie für die zwei Tage, die er nach Youngstown und zurück gebraucht hätte, keine Vertretung für seine Tutorien und Schwimmkurse gefunden hatte.
»Ich auch«, sagte Josh. »Eigentlich dachte ich, es wäre nur Zeitverschwendung – na, und dann warst du da und hast deinen Zettel aufgehängt. Charlie. Spannender Name übrigens. Ist das ein Spitzname?«
»Ja. Für Charles.«
Maddy hatte diese Antwort geliebt. Jedes Mal, wenn Charlie sie anbrachte – gewöhnlich auf einer der vielen lauten, grauenhaften Kennenlernpartys, zu denen man sie mitgeschleppt hatte –, brach Maddy in wieherndes Gelächter aus, das Charlie stolz machte. Für ihre Verhältnisse war diese Bemerkung ziemlich frech. Etwas, was auch Barbara Stanwyck in einer Screwball-Komödie hätte sagen können.
»Du heißt in Wirklichkeit Charles?«, fragt Josh.
»War ein Witz«, sagt Charlie, enttäuscht, dass sie es erklären muss. Barbara Stanwyck hat nie etwas erklärt. »Nein, mein Name ist schon Charlie, aber es ist keine Kurzform. Ich heiße so nach einem Filmcharakter.«
»Einem Jungen?«
»Einem Mädchen. Die zufällig nach ihrem Onkel benannt wurde.«
»Wie heißt der Film?«
»›Im Schatten des Zweifels‹.«
»Nie gehört.«
»Alfred Hitchcock. Von 1943. Mit Joseph Cotten und Teresa Wright.«
»Ist er gut?«
»Sehr gut. Ein Glück für mich – wer will schon nach einem Charakter in einem Scheißfilm heißen?«
Josh schielt mit erhobener Augenbraue zu ihr herüber, entweder beeindruckt oder erstaunt über ihren Eifer. Die Augenbraue verrät Charlie, dass sie zu viel redet. Was nur vorkommt, wenn sie über Filme spricht. Sie kann stundenlang schweigen, aber sobald jemand einen Filmtitel erwähnt, sprudeln die Worte nur so aus ihr heraus. Einmal sagte Maddy, Filme seien Charlies Ersatz für Alkohol. Bei denen wirst du total locker, hatte sie gesagt.
Charlie weiß, dass das stimmt. Deshalb besteht ihre einzige Methode, das Eis zwischen sich und anderen zu brechen, darin, sie nach ihrem Lieblingsfilm zu fragen. Auf diese Weise findet sie in Sekundenschnelle heraus, ob es sich lohnt, Zeit und Energie in jemanden zu investieren, oder nicht. Nennt die betreffende Person einen Film von Hitchcock, Ford, Altman oder auch Argento, kann man vermutlich ganz gut mit ihr reden. Ist es ›The Sound of Music‹ oder etwas in der Art, ist es besser, sich kurzzufassen.
Josh indessen scheint nichts gegen ihr Geplauder zu haben. Er nickt zustimmend. »Ich wollte nicht wie jemand aus einem Scheißfilm heißen. Das wäre, als hieße man nach einem Serienmörder oder so.«
»Davon handelt der Film sogar«, sagt Charlie. »Da ist dieses Mädchen namens Charlie …«
»Das nach ihrem Onkel benannt ist und du nach ihr.«
»Genau. Und ihr Onkel ist ihr großes Idol, deshalb ist sie überglücklich, als er für ein paar Wochen zu Besuch kommt. Aber Onkel Charlie benimmt sich verdächtig, eines fügt sich zum anderen, und schließlich beginnt Charlie zu ahnen, dass ihr Onkel in Wahrheit ein Serienmörder ist.«
»Und, ist er wirklich einer?«
»Ja. Sonst gäbe der Film ja nicht viel her.«
»Wer sind seine Opfer?«
»Reiche Witwen im fortgeschrittenen Alter.«
»Klingt nach einem ganz schönen Mistkerl.«
»Ist er auch.«
»Kommt er damit durch?«
»Nein. Charlie macht der Sache ein Ende.«
»Dachte ich mir«, sagt Josh. »So wie du von ihr sprichst, muss sie Schneid haben.«
Das Wort überrascht Charlie. Sie ist sich nicht sicher, ob sie es schon einmal in einem normalen Gespräch gehört hat, und ganz sicher hat es noch nie jemand in Bezug auf sie verwendet. Man hat sie schon als alles Mögliche bezeichnet. Als komisch. Als schüchtern. Als unnahbar. Traurig, aber wahr. Doch nie hat jemand gesagt, sie hätte Schneid. Charlie hält sich keinesfalls für mutig und hat plötzlich ein seltsam schlechtes Gewissen, als würde sie dem Ruf ihrer Namenspatin nicht gerecht.
»Ist das dein Hobby?«, fragt Josh. »Filme?«
»Mehr als ein Hobby. Filme sind mein Leben. Und sogar mein Studium – Filmwissenschaft.«
»Wie, du lernst, Filme zu machen?«
»Ich lerne, sie wissenschaftlich zu analysieren. Wie sie funktionieren. Was im Film wirkt und was nicht. Sie als Kunstwerk zu schätzen.« All das hat sie anderen schon oft erklärt. Maddy zum Beispiel, als sie zu Beginn des ersten Semesters gemeinsam einem Zimmer zugeteilt wurden. Robbie an jenem Abend, als sie sich in der Bibliothek kennenlernten. Und jedem, der es hören wollte. Charlie ist fanatische Cineastin und missioniert, wo sie kann.
»Und warum Filme?«, fragt Josh.
»Weil sie sich unsere Welt vornehmen und sie verbessern«, sagt Charlie. »Das macht ihren Zauber aus. Alles ist überhöht. Die Farben sind leuchtender. Die Schatten dunkler. Die Gewalt ist krasser und die Liebesgeschichten leidenschaftlicher. Es wird aus dem Nichts heraus gesungen, zumindest war das lange Zeit üblich. Alle Emotionen – Liebe, Hass, Angst, Spaß – sind intensiver. Und die Menschen! Die wunderschönen Gesichter in Nahaufnahme. So schön, dass man den Blick gar nicht abwenden mag.« Sie hält inne. Ihr ist klar, dass sie sich hat mitreißen lassen, aber eines muss sie noch loswerden. Sie kann nicht anders. Denn es ist die Wahrheit. »Filme sind wie das Leben«, sagt sie endlich. »Nur besser.«
Eine weitere Wahrheit erwähnt sie nicht. Nämlich, dass man sich in Filmen verlieren kann. Das erkannte Charlie an dem Tag, als ihre Eltern starben und Nana Norma kam, um für immer bei ihr zu bleiben.
Der Unfall geschah an einem Samstagvormittag Mitte Juli. Ihre Eltern waren früh zu dem Gartencenter zwei Orte weiter aufgebrochen, hatten sie noch kurz aufgeweckt und ihr Bescheid gesagt, dass sie gegen zehn zurück sein wollten.
Charlie machte sich keine Gedanken, als es zehn wurde und sie noch nicht da waren. Auch nicht, als die alte Standuhr im Wohnzimmer elf schlug. Eine Viertelstunde später stand ein Polizist vor der Tür. Deputy Anderson. Der Vater ihrer Freundin Katie. Einmal, mit zehn, hatte sie bei Katie übernachtet, und am Morgen hatte Mr. Anderson ihnen Pfannkuchen gebacken. Das war das Erste, woran Charlie dachte, als sie ihn auf der Türschwelle sah. Wie er mit dem Pfannenwender am Herd gestanden und Pfannkuchen vom Durchmesser von Pizzatellern umgedreht hatte.
Aber dann bemerkte sie, dass er seinen Hut in den Händen hielt. Wie grau sein Gesicht war. Und dieses unsichere Scharren auf der Fußmatte, als müsste er seine Beine zwingen, nicht wegzurennen.
Da wusste Charlie, dass etwas Schreckliches passiert war.
Deputy Anderson räusperte sich und sagte: »Ich fürchte, es gibt schlimme Neuigkeiten, Charlie.«
Den Rest hörte sie kaum noch. Nur die wichtigsten Stichworte registrierte sie: Unfall. Highway. Sofort tot.
Da war schon Mrs. Anderson da, die er vermutlich zur Verstärkung gerufen hatte, zog Charlie in die Arme und fragte: »Können wir jemanden für dich anrufen, Liebes? Aus deiner Verwandtschaft?«
Ja, wimmerte Charlie. Nana Norma. Und dann brach sie in Tränen aus und hörte nicht auf zu weinen, bis Stunden später Nana Norma bei ihr war.
Nana Norma war einmal Schauspielerin gewesen. Oder hatte jedenfalls versucht, eine zu werden. Mit gerade mal achtzehn Jahren hatte sie das komplette Programm durchgezogen, das In-den-Bus-nach-Hollywood-steigen-Klischee, wie Millionen anderer Kleinstadtmädchen auch, denen man gesagt hatte, sie seien hübsch oder hätten Talent. Nana Norma verfügte über beides. Charlie kennt die Fotos von der brünetten Schönheit mit der Rita-Hayworth-Figur und hat ihre Großmutter schon in der Küche singen hören, wenn diese glaubte, niemand sei in der Nähe.
Was die junge Norma Harrison nicht hatte, war Glück. Nach einem Jahr Jobben an der Garderobe und zahlreichen Vorsprechterminen, die sie der Erfüllung ihres Traums nicht einen Deut näherbrachten, stieg sie wieder in den Bus und kehrte etwas härter und zutiefst gedemütigt nach Ohio zurück.