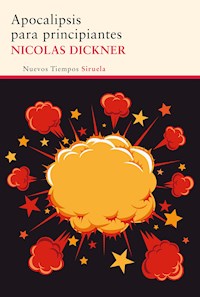Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Nikolski" ist ein ungemein charmantes, fliegend leicht lesbares Buch, das von der ersten Seite an bezaubert. Tausende Kilometer voneinander getrennt und doch - ohne es zu wissen - derselben Familie angehörig, leben drei Jugendliche, drei in jeder Hinsicht grundverschiedene Charaktere. Es sind zwei Söhne und eine Nichte des ruhelosen Matrosen Jonas Doucet. Diesem in seiner Rastlosigkeit in nichts nachstehend, verlassen sie - gerade volljährig geworden - ihr jeweiliges Zuhause und ziehen nach Montréal.
Da ist der namenlose Erzähler, der für kleines Geld in Montréal als Buchhändler jobbt. Die einzige Erinnerung an seinen Vater Jonas ist ein alter Kompass mit einer "magnetischen Anomalie", den er den "Nikolski-Kompass" getauft hat, weil er nicht exakt nach Norden weist, sondern stur auf den kleinen, hinter Alaska auf den Aleuten gelegenen Ort Nikolski...
Noah ist der Halbbruder des Erzählers, seine Mutter ist eine von ihrem Stamm verstoßene Indianerin. Zwischen Manitoba und Alberta bringt er seine gesamte Kindheit damit zu, in einem Wohnmobil die Prärie zu durchkreuzen. Als Noah das Nomadentum seiner Mutter eines Tages reicht, bricht er nach Montréal auf, um dort ein Archäologiestudium zu beginnen. In seinem Gepäck ist das "dreiköpfige Buch", das auf geheimnisvolle Weise mit seiner Herkunft verbunden zu sein scheint…
"Nikolski", der faszinierende Debütroman von Nicolas Dickner, ist das Lieblingsbuch der kanadischen Buchhändler und gilt bereits jetzt - wie Yann Martels "Schiffbruch mit Tiger"Nikolski" - als Klassiker der neuen kanadischen Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nicolas Dickner
NIKOLSKI
Romanaus dem Französischen von Andreas Jandl
Titel der Originalausgabe
NIKOLSKI
© 2005 by Éditions Alto
Diese Übersetzung wurde gefördert durch SODEC, Québec.
Deutsche Erstausgabe
© der deutschen Ausgabe
Frankfurter Verlagsanstalt GmbH, Frankfurt am Main 2008
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung und Schutzumschlaggestaltung: Laura J Gerlach
unter Verwendung xxxxxxxxxxxx
eISBN: 978-3-627-02157-3
für Mariana Leky
Inhalt
1989
Magnetische Abweichung
Granpa
Tête-à-la-Baleine
Providence
Politisch Verfolgte haben Vorrang
Maßstab 1:1
San Pedro de Macorís
Colmado Real
Erster Kontakt mit Ihrem Macintosh
CCM
Großfang
Texas Instruments
Viele tausend Kilometer
1990
William Kidd
Thomas Saint-Laurent
1994
Bei den Seeschlangen im fünften Stock
Jututo
Sintflut
Die Giftkammer
Gradgenau
1995
Die Stevenson-Insel
Pigmentierung
Blitzableiter Jim
Piraten sind pragmatische Leute
Eine Portion Zukunft
1999
Charles Darwins wundersame Abenteuer auf den Galápagos-Inseln
Das betrübliche Epos der Garifuna
Keratin
María Libre
Kolonialarchiv
Überallhin zugleich
Die Bestie
Distant Early Warning
Visum
Der Kleine Wagen
Schutzgott der dreisten Lügner
Die allgemeine Unwahrscheinlichkeit der Situation
Ein kleiner Kreis
Ausverkauf
1989
Magnetische Abweichung
Mein Name ist ohne Bedeutung.
Alles beginnt im September 1989 gegen sieben Uhr in der Frühe.
Ich schlafe noch, eingerollt in meinen Schlafsack, im Wohnzimmer auf dem Boden. Um mich herum stapeln sich Pappkartons, zusammengerollte Teppiche, halb auseinandergenommene Möbel und Werkzeugkisten. Die Wände sind kahl bis auf die hellen Flecken von den Bilderrahmen, die dort allzu lange hingen.
Durch das Fenster hört man den monotonen Rhythmus der Wellen, die sich auf dem Kieselstrand brechen.
Jeder Strand hat seine ganz eigene akustische Signatur, die abhängig ist von der Länge und Stärke der Wellen, von der Beschaffenheit des Bodens, der Morphologie der Landschaft, der vorherrschenden Windrichtung und der relativen Luftfeuchtigkeit. Es ist so gut wie unmöglich, das leise Murmeln Mallorcas mit dem kräftigen Rollen der vorgeschichtlichen Steine Grönlands zu verwechseln oder die Musik der Korallenstrände Belizes mit dem dumpfen Grollen der Küsten Irlands.
Und auch die Brandung, die ich an diesem Morgen höre, ist ganz klar zuzuordnen. Dieses tiefe, ein wenig raue Rauschen, der kristalline Klang des vulkanischen Gesteins, die leicht asymmetrische Wiederkehr der Wellen, das nährstoffreiche Wasser – das ist die unnachahmliche Brandung auf den Aleuten.
Grummelnd öffne ich das linke Auge einen Schlitz breit. Woher kommt dieses höchst unwahrscheinliche Geräusch? Der nächste Ozean ist über tausend Kilometer weit entfernt. Und ich war in meinem Leben übrigens auch noch nie an einem Strand.
Ich schäle mich aus dem Schlafsack und taumele zum Fenster. Am Vorhang festgekrallt sehe ich den Wagen der Müllabfuhr unter Druckluftgequietsche vor unserem Bungalow anhalten. Seit wann imitieren Dieselmotoren das Geräusch der Brandung?
Schäbige Vorstadtpoesie.
Die zwei Müllmänner springen von ihrem Fahrzeug und betrachten den Berg übereinandergetürmter Plastiksäcke auf dem Gehweg. Der erste tut so, als würde er sie zählen und macht einen schwer geschafften Eindruck. Plötzlich kommen mir Zweifel: Habe ich etwa gegen eine städtische Verordnung verstoßen, die die Anzahl der Müllsäcke pro Haus beschränkt? Der zweite Müllmann, sehr viel pragmatischer, beginnt den Wagen zu beladen. Ihm sind die Anzahl, der Inhalt oder die Geschichte der Säcke ganz offensichtlich egal.
Es sind genau dreißig Stück.
Ich habe sie im Laden an der Ecke gekauft – ein Einkaufserlebnis, das ich so bald nicht vergessen werde. Am Regal mit den Dingen für den Haushaltsbedarf stehend, fragte ich mich, wie viele Müllsäcke man wohl bräuchte, um die unzähligen Erinnerungen, die meine Mutter seit 1966 angesammelt hatte, darin unterzubringen. Wieviel Platz brauchte man wohl für dreißig Jahre eines Lebens? Ich sträubte mich dagegen, diese pietätslose Rechnung anzustellen. Zu welchen Ergebnissen ich auch käme, ich fürchtete, die Existenz meiner Mutter zu gering einzuschätzen.
Ich hatte eine Marke ins Auge gefasst, die mir ziemlich reißfest erschien. In jedem Paket befanden sich zehn revolutionäre Müllsäcke aus Ultra-Plastik mit einem Volumen von 60 Litern. Ich nahm drei Stück, entsprechend einem Gesamtvolumen von 1800 Litern.
Diese dreißig Säcke erwiesen sich als ausreichend – auch wenn ich ab und zu mit dem Fuß nachhelfen musste – und nun machen sich die Müllmänner daran, sie dem Wagen ins Maul zu schleudern. Von Zeit zu Zeit zerdrückt ein schwerer Eisenkiefer die Abfälle und grunzt dabei ganz nach Art eines Dickhäuters. Weit entfernt vom poetischen Säuseln der Wellen.
Aber der eigentliche Beginn der ganzen Geschichte, da ich sie nun einmal erzählen muss, war der Nikolski-Kompass.
Dieser alte Kompass kam im August wieder zum Vorschein, zwei Wochen nach der Beerdigung.
Der endlose Todeskampf meiner Mutter hatte mich vollkommen erschöpft. Seit der ersten Diagnose war mein Leben zu einem wahrhaften Staffellauf geworden. Rund um die Uhr pendelte ich zwischen Wohnung, Arbeit und Krankenhaus hin und her. Ich schlief nicht mehr, aß immer weniger und hatte fast fünf Kilo abgenommen. Man hätte glauben können, ich sei es gewesen, der sich mit den Metastasen herumschlug – doch gab es kein Verwechseln: Meine Mutter starb nach sieben Monaten, und da stand ich nun, die ganze Welt auf meinen Schultern.
Ich war leer, verwirrt, aber aufgeben kam nicht in Frage. Sobald der Papierkram erledigt war, machte ich mich an das letzte Großreinemachen.
Nach Art eines Abenteurers beim Survivaltraining hatte ich mich im Keller des Bungalows verschanzt, ausgestattet mit meinen dreißig Abfallsäcken, einem soliden Vorrat an Schinkenbroten, mehreren Litern tiefgefrorenem Orangensaft und einem Radio auf Hintergrundlautstärke. Eine Woche hatte ich angesetzt, um fünf Jahrzehnte Existenz in Nichts aufzulösen, fünf Schränke voll mit Krimskrams, der von seinem eigenen Gewicht ganz plattgedrückt war.
Eine solche Aufräumaktion mag vielleicht wie eine trübselige Angelegenheit wirken oder wie ein Racheakt. Doch man darf mich nicht falsch verstehen: Ich war plötzlich allein auf der Welt, ohne Freunde und Verwandte, aber mit der dringlichen Notwendigkeit weiterzuleben. Ich musste Ballast abwerfen.
Mit der Kaltblütigkeit eines Archäologen machte ich mich an die Schränke und unterteilte die Erinnerungsstücke in mehr oder weniger logische Kategorien:
– eine Zigarrenkiste voller Muscheln;
– vier Bündel Zeitungsausschnitte über amerikanische Radaranlagen in Alaska;
– ein alter Fotoapparat Instamatic 104;
– über 300 Fotos, aufgenommen mit ebendieser Instamatic 104;
– mehrere Taschenbuchromane, sorgfältig mit Anmerkungen versehen;
– eine Handvoll billigen Schmucks;
– eine rosa Sonnenbrille à la Janis Joplin.
Und so weiter.
Ich machte eine verstörende Reise zurück in die Vergangenheit: Je tiefer ich mich in die Schränke hineingrub, umso weniger erkannte ich meine Mutter wieder. Diese staubigen Gegenstände gehörten zu einem früheren, weit entfernten Leben, berichteten von einer Frau, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Die Menge dieser Gegenstände, ihre Textur, ihr Geruch schlichen sich in meinen Kopf und fraßen sich in meine eigenen Erinnerungen.
Meine Mutter bestand nunmehr nur noch aus einem Haufen unzusammenhängender Artefakte, die nach Mottenkugeln rochen.
Was dann geschah, verwunderte mich. Das, was nichts weiter als ein einfaches Ausmisten hätte sein sollen, verwandelte sich nach und nach in eine Initiationsprüfung. Ungeduldig wartete ich auf den Moment, in dem ich auf dem Grund der Schränke ankommen würde, aber ihr Inhalt schien unerschöpflich zu sein.
Und genau da stieß ich auf einen dicken Stapel Tagebücher – fünfzehn Hefte in einem biegsamen Einband, vollgeschrieben mit Prosa im Telegrammstil. Ich fasste wieder Mut. Vielleicht würden diese Tagebücher mir helfen können, die verschiedenen Teile des Puzzles zusammenzufügen?
Ich sortierte die Hefte nach ihrer zeitlichen Reihenfolge. Das erste begann am 12. Juni 1966.
Meine Mutter war mit neunzehn Jahren nach Vancouver abgehauen, ausgehend von dem Gedanken, dass ein wirklicher, dieses Namens würdiger Bruch mit der Familie an der Anzahl der zurückgelegten Kilometer messbar sei, und dass es in ihrem Fall Kontinente sein sollten.
Sie hatte an einem 25. Juni bei Tagesanbruch zusammen mit einem Hippie namens Dauphin das Weite gesucht. Die zwei Komplizen teilten sich die Benzinkosten, wechselten sich beim Fahren ab und pafften zusammen ausgiebig kleine Joints, die eng gerollt waren wie Zahnstocher. Wenn sie nicht am Lenkrad saß, schrieb meine Mutter in ihr Notizbuch. Ihre Schrift, anfangs noch ordentlich und sauber, begann sehr bald sich zu kräuseln und zu verlaufen, imitierte Wogen und Schwaden von THC.
Zu Beginn des zweiten Hefts erwachte sie allein auf der Water Street, kaum in der Lage ein Wort auf Englisch herauszubringen. Bewaffnet mit einem Schreibblock, kommunizierte sie mit Hilfe von Ideogrammen, wobei sie abwechselnd Gesten und Zeichnungen machte. In einem Park lernte sie eine Gruppe von Studenten der Bildenden Künste kennen, die gerade mikroskopisch kleine Mantarochen als Origami aus psychedelisch buntem Papier falteten. Sie boten ihr an, ihre übervölkerte Wohnung, ihr Wohnzimmer voller Kissen sowie ein Bett zu teilen, das schon von zwei anderen Frauen belegt war. Jede Nacht gegen zwei Uhr schlüpften sie alle drei unter die Decke, rauchten selbstgedrehte Zigaretten und redeten über Buddhismus.
Meine Mutter schwor, nie wieder an die Ostküste zurückzukehren.
Wurden die ersten Wochen in Vancouver noch mit viel Liebe zum Detail erzählt, so fiel die Fortsetzung ihres Reiseberichts immer lückenhafter aus, die Ansprüche an ihr Nomadentum fielen offensichtlich mit jenen an die Berichterstattung. Sie blieb niemals länger als vier Monate an einem Ort, brach immer überstürzt auf, fuhr nach Victoria, Prince Rupert, San Francisco, Seattle, Juneau und an tausend andere Orte, um deren genaue Bezeichnung sie sich manchmal wenig scherte. Ihr Brot verdiente sie mit armseligen Notbehelfen: Sie bot Passanten Gedichte von Richard Brautigan an, verkaufte Postkarten an Touristen, jonglierte, machte in Motels die Zimmer sauber und stahl in Supermärkten.
Dieses abenteuerliche Leben führte sie vier Jahre lang. Dann, im Juni 1970, hatten wir uns mit zwei riesigen, zum Bersten vollen Militärrucksäcken im Hauptbahnhof von Vancouver eingefunden. Meine Mutter hatte ein Zugticket nach Montréal gekauft und wir durchquerten den Kontinent in entgegengesetzter Richtung, sie in ihren Sitz gekauert, ich in ihre Gebärmutter eingeschmiegt – unsichtbares Komma eines noch zu schreibenden Romans.
Nach ihrer Rückkehr hatte sie sich kurzfristig mit meinen Großeltern versöhnt – ein strategischer Waffenstillstand, dessen Ziel es war, die nötige Bankbürgschaft für den Kauf eines Hauses zu bekommen. Kurz darauf wurde sie die Besitzerin eines Bungalows in Saint-Isidore Junction, nur einen Katzensprung von Châteauguay entfernt, dort wo später der südliche Speckgürtel Montréals entstehen sollte, wo man sich damals aber noch ganz wie auf dem Land fühlen konnte, mit alten Häusern, Brachen und einem beeindruckenden Bestand an Stachelschweinen.
So stand sie fortan in der Pflicht ihrer Hypothek und hatte sich eine Arbeit als Beraterin in einem Reisebüro in Châteauguay suchen müssen. Ironischerweise setzte diese Anstellung ihrem jugendlichen Vagabundendasein ein Ende und damit auch dem Tagebuchschreiben.
Das letzte Heft endete mit einer nicht datierten Seite von ungefähr 1971. Ich klappte es gedankenverloren wieder zu. Von allen Auslassungen, die die Prosa meiner Mutter durchzogen, war die wichtigste Jonas Doucet.
Von diesem unsteten Erzeuger gab es nichts als ein Bündel Postkarten in unleserlicher Schrift, von denen die letzte aus dem Sommer 1975 stammte. Ich hatte oft versucht, das Geheimnis dieser Karten zu lüften, aber diese Hieroglyphen ließen sich einfach nicht entziffern. Sogar die Poststempel gaben mehr Informationen preis, Meilensteine eines Parcours, der im Süden Alaskas begann, in den Yukon aufstieg und dann hinab Richtung Anchorage ging und schließlich bis zu den Aleuten führte – genau genommen zur dortigen Militärbasis, auf der mein Vater Arbeit gefunden hatte.
Unter dem Stapel Postkarten befand sich ein kleines verknautschtes Päckchen und ein Brief der US Air Force.
Dem Brief konnte ich nichts Neues entnehmen. Das Päckchen hingegen erhellte einige vergessene Winkel in meinem Gedächtnis. Heute war es plattgedrückt, doch einst enthielt es einen Kompass, den Jonas mir zum Geburtstag geschickt hatte. Dieser Kompass kam mir wieder in den Sinn, mit ganz erstaunlicher Genauigkeit. Wie hatte ich ihn nur vergessen können? Als greifbarer Beweis für die Existenz meines Vaters war er der Nordstern meiner Kindheit gewesen, das glorreiche Instrument, das es mir ermöglicht hatte, Tausende imaginäre Ozeane zu durchqueren. Unter welchem Haufen Kram mochte er jetzt liegen?
Von einem plötzlichen Eifer gepackt, durchstöberte ich alle Winkel des Bungalows, leerte Schubladen und Schränke, schaute hinter Truhen und unter Teppiche und kroch bis in die dunkelsten Kammern.
Ich bekam den Kompass um drei Uhr morgens zu fassen, eingeklemmt zwischen einer Taucherfigur für das Aquarium und einem apfelgrünen Körbchen ganz unten in einem Pappkarton, der quer auf zwei Balken oben im Dachgebälk stand.
Mit den Jahren hatte sich die äußere Erscheinung dieses Fünf-Dollar-Spielzeugs, das er damals sicher neben der Registrierkasse einer Eisenwarenhandlung in Anchorage gefunden hatte, nicht unbedingt verbessert. Glücklicherweise hatte die langjährige Nachbarschaft zu den Metallspielzeugen den Magneten nicht entmagnetisiert, denn er trippelte noch immer wacker in den (vermeintlichen) Norden.
Der Kompass war kein gewöhnlicher Nadelkompass, sondern die Miniaturausgabe eines Schiffskompasses. Er bestand aus einer durchsichtigen Plastikkugel, in der in einer hellen Flüssigkeit eine magnetisierte und mit einer Gradeinteilung versehene zweite Plastikkugel schwamm. Die Einfassung einer Kugel in die andere, nach Art einer winzigen Matroschka-Puppe, sorgte für die gyroskopische Stabilität, der auch die schwersten Stürme nichts anhaben konnten: Selbst bei hohem Seegang würde der Kompass immer waagerecht bleiben und Kurs halten.
Ich schlief auf dem Dachboden ein, den Kompass auf der Stirn und den Kopf in eine Wolke pinkfarbene Mineralwolle getaucht.
Auf den ersten Blick scheint dieser alte Kompass völlig banal, vergleichbar mit jedem anderen Kompass. Bei eingehender Betrachtung kann man allerdings feststellen, dass er nicht ganz genau nach Norden zeigt.
Einige Leute behaupten, immer genau sagen zu können, wo Norden ist. Ich bin da wie die meisten Menschen: Ich brauche einen Anhaltspunkt. Wenn ich beispielsweise in der Buchhandlung hinter dem Tresen sitze, weiß ich, dass sich der magnetische Nordpol in 4238 km Luftlinie hinter dem Regal mit den Bob Morane befindet – was auf der Landkarte der Ellef-Ringnes-Insel entspricht, einem verlorenen Kieselstein in der ungeheuren Weite des Königin-Elisabeth-Archipels.
Statt jedoch auf das Regal mit den Bob Morane zu zeigen, zeigt mein Kompass einen Meter fünfzig weiter nach links, direkt auf die Ausgangstür.
Es kann tatsächlich passieren, dass sich das Magnetfeld unseres Planeten lokal verzerrt und der magnetische Norden nicht mehr ganz an seinem eigentlichen Platz angezeigt wird. Mögliche Gründe für eine solche Anomalie gibt es viele: ein großes Eisenvorkommen im Keller, die Wasserrohre im Badezimmer des Nachbarn über uns oder das Wrack eines Ozeandampfers, das unter der Rue Saint-Laurent vergraben liegt. Leider sind diese Theorien alle sehr zweifelhaft, da mein Kompass immer links am Nordpol vorbeizeigt, ganz egal an welchem Ort ich ihn benutze. Diese Erkenntnis bringt zwei unbequeme Fragen mit sich:
– Was ist der Grund für diese magnetische Anomalie?
– Wohin (zum Teufel) zeigt der Kompass dann?
Der gesunde Menschenverstand legt nahe, dass die größte Anomalie des lokalen Magnetfeldes meine lebhafte Fantasie ist und dass es sinnvoller wäre aufzuräumen statt rumzuträumen. Aber Anomalien sind wie Zwangsvorstellungen: Jeder Widerstand ist zwecklos.
Ich erinnerte mich vage an meinen Erdkundeunterricht, die magnetische Deklination, den Wendekreis des Krebses, den Polarstern. Es war an der Zeit, dieses vergessene Wissen in der Praxis anzuwenden. Ausgestattet mit einem Stapel Erdkundebücher und einem Arsenal von Karten in verschiedenen Maßstäben, machte ich mich daran zu bestimmen, wohin mein Kompass genau ausgerichtet war.
Nach einigen ermüdenden Berechnungen kam ich auf eine Abweichung von 34° westlich. Folgte man dieser Richtung, durchquerte man die Insel Montréal, die Regionen Abitibi und Témiscamingue, Ontario, die Prärie, Britisch Kolumbien, die Prinz-von-Wales-Insel, die Südspitze Alaskas, einen Zipfel vom nördlichen Pazifik und die Aleutischen Inseln, wo man schließlich auf der Insel Umnak landete – in Nikolski genau genommen, einem winzigen Dorf mit 36 Einwohnern, 5000 Schafen und einer unbestimmbaren Anzahl von Hunden.
Daraus konnte man schließen, dass der Kompass nach Nikolski zeigte – eine Erkenntnis, die mich durchaus befriedigte, auch wenn sie den Nachteil hatte, das Ganze eher zu verschleiern als zu erklären.
Es kann nicht alles perfekt sein.
Manchmal fragt ein Kunde, was das denn für ein komischer Talisman sei, den ich da um den Hals trage. Ich antworte dann:
„Ein Nikolski-Kompass.“
Der Kunde lächelt ohne zu verstehen und wechselt höflich das Thema. Er fragt beispielsweise, in welcher Abteilung bei uns die Bob Morane stehen.
Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich nicht in einem Geographischen Institut oder Globus-Laden arbeite. Eigentlich ist S. W. Gam Inc. ein Geschäft, das sich ausschließlich dem Erwerb und dem Wiederverkauf von gebrauchten Büchern widmet. In anderen Worten, eine Antiquariatsbuchhandlung. Eines schönen Herbstes, als ich gerade vierzehn war, hat mich Madame Dubeau, meine geschätzte Chefin, eingestellt. Ich verdiente damals 2,50 $ die Stunde und akzeptierte das miserable Gehalt ohne Weiteres, allein um inmitten all dieser Büchern zu thronen und nichts anderes tun zu müssen, als zu lesen.
Ich arbeite hier seit nunmehr vier Jahren, eine Zeitspanne, die sich um einiges länger anfühlt, als sie in Wirklichkeit ist. In der Zwischenzeit bin ich mit der Schule fertig geworden, meine Mutter ist gestorben und meine wenigen Jugendfreunde sind von der Bildfläche verschwunden. Einer von ihnen ist mit einem alten Chrysler nach Mittelamerika abgehauen und man hat nie wieder etwas von ihm gehört. Ein zweiter studiert Meeresbiologie an einer norwegischen Uni. Kein Lebenszeichen. Und die übrigen haben sich ganz einfach in Luft aufgelöst, vom Leben verschlungen.
Und ich sitze immer noch in der Buchhandlung hinter dem Tresen, habe aber einen erstklassigen Blick auf die Rue Saint-Laurent.
Meine Arbeit ist eher eine Berufung als ein normaler Beruf. Die Stille bietet Gelegenheit zur Meditation, das Gehalt tut dem Armutsgelübde Genüge und die Arbeitsausstattung entspricht voll und ganz klösterlichem Minimalismus. Keine hochmoderne Registrierkasse, alle Preise werden ganz nach der alten Schule auf dem erstbesten Fetzen Papier von Hand zusammengerechnet. EDV-unterstützte Warenwirtschaft gibt es auch keine: Ich bin selbst der Computer und muss mich auf Knopfdruck daran erinnern, wo ich beispielsweise diese Esperanto-Übersetzung von Dharma Bums zum letzten Mal gesehen habe. (Antwort: auf dem Klo hinter den Rohrleitungen des Waschbeckens.)
Die Arbeit ist nicht so einfach, wie sie scheint: Die Buchhandlung S. W. Gam ist einer dieser Winkel im Kosmos, wo der Mensch seit langem die Kontrolle über die Materie verloren hat. Auf jedem Regalbrett stehen die Bücher in drei Reihen und die Fußböden verschwinden unter Dutzenden von Kisten, zwischen denen sich enge Pfade für die Kunden hindurchschlängeln. Auch die kleinsten Zwischenräume werden genutzt: unter der Kaffeemaschine, zwischen Möbeln und Wänden, im Spülkasten der Toilette, unter der Treppe und bis in die kleinsten, staubigen Nischen unter dem Giebel. In unserem Ordnungssystem befinden sich Mikroklimate, unsichtbare Grenzen, Flöze, Müllhalden, ungeordnete Giftschränke, weite Ebenen ohne sichtbare Orientierungspunkte – eine komplexe Kartografie, die im Wesentlichen von einem guten visuellen Gedächtnis abhängt, ohne das man in diesem Metier nicht lange bestehen kann.
Doch um hier zu arbeiten, braucht es mehr als gute Augen und ein paar Löffel Grips. Man muss zusätzlich über eine ganz besondere Zeitwahrnehmung verfügen. Tatsache ist, dass – wie soll ich sagen? – verschiedene Zustände unserer Buchhandlung in mehreren Zeiträumen parallel nebeneinander bestehen und nur von schmalen Spalten getrennt sind.
Dieses Bild verlangt zweifellos nach einer Erklärung.
Jedes Buch, das hier ankommt, kann zu einem Zeitpunkt auf seinen nächsten Leser treffen, der sich irgendwo in der Zukunft oder in der Vergangenheit befindet. Beim Sortieren von neuen Lieferungen schlägt Madame Dubeau unablässig in in ihrer Enzyklopädie Lavoisier nach – einem Bündel von dreißig Heften, in denen sie seit dem Februar 1971 alle außergewöhnlichen Kundenanfragen vermerkt hat –, um sich zu vergewissern, ob nicht zehn Jahre zuvor jemand nach einem der frisch eingetroffenen Bücher gefragt hatte.
Von Zeit zu Zeit greift sie mit einem Siegerlächeln zum Telefon.
„Monsieur Tremblay? Hier Andrée Dubeau von der Buchhandlung S. W. Gam. Sie haben Glück, wir haben soeben die Geschichte des Walfangs in Fairbanks im 18. Jahrhundert reinbekommen!“
Monsieur Tremblay am anderen Ende der Leitung muss ein Schaudern unterdrücken. Plötzlich sind die strahlend weißen Eisberge, die im Rekordsommer 1987 seine Träume durchzogen haben, zum Greifen nah.
„Ich komme sofort!“, haucht er fieberhaft, als würde man ihn an eine wichtige Verabredung erinnern.
Madame Dubeau streicht die Anfrage aus und schließt die Enzyklopädie Lavoisier. Auftrag erfüllt.
Ich kann diese dreißig Hefte nicht durchblättern ohne zu zittern. Kein anderes Werk zeigt so deutlich, wie die Zeit vergeht: Manche Kunden, die hier namentlich auftauchen, sind seit vielen Jahren tot, einige haben jegliches Interesse an diesen Büchern verloren, andere sind nach Asien gezogen, ohne ihre neue Adresse zu hinterlassen – und viele werden das Buch, das sie einst begehrten, niemals finden.
Ich frage mich manchmal, ob irgendwo eine Enzyklopädie Lavoisier für all unsere Wünsche existiert, ein vollständiges Verzeichnis unserer kleinsten Träume, der noch so unscheinbaren Begierden, in der nichts verloren geht, nichts hinzukommt, in der sich aber die unaufhörliche Veränderung aller Dinge in ständigem Kommen und Gehen vollzieht – wie ein Paternoster, der die verschiedenen Stockwerke unseres Daseins verbindet.
Unsere Buchhandlung ist alles in allem eine gänzlich von Büchern erschaffene und regierte Welt – und es erscheint mir vollkommen natürlich, mich ganz und gar darin aufzulösen, mein Schicksal den Tausenden auf Hunderten von Regalbrettern ordentlich übereinander gestapelten Schicksalen zu widmen.
Manchmal wirft man mir vor, es mangele mir an Ehrgeiz. Vielleicht leide ich auch einfach nur an einer leichten magnetischen Anomalie?
Damit sind wir fast am Ende des Prologs angekommen.
Ich brauchte zwei Wochen, um die dreißig Müllsäcke zu füllen, die die Müllmänner an diesem Morgen in ihren Wagen werfen. Eintausendachthundert Liter Ultra-Plastik, dreißig Jahre Leben. Ich habe nur das absolute Minimum aufgehoben: einige Kisten mit Erinnerungsstücken, ein paar Möbel, meine eigenen Sachen. Der Bungalow steht zum Verkauf, zwei Käufer scheinen interessiert. Die Sache sollte innerhalb der nächsten Woche über die Bühne gehen.
Ich werde dann schon woanders sein, in meiner neuen Wohnung in Petite Italie, direkt gegenüber der Statue des alten Dante Alighieri.
Die Müllmänner haben ihre Arbeit erledigt und wischen sich den Schweiß von der Stirn, ohne etwas von der Geschichte zu ahnen, in der sie soeben auch einen Part übernommen haben. Ich schaue zu, wie der Müllwagen die Säcke mühelos zerkaut und das, was von meiner Mutter übrig ist, hinunterschluckt.
Das Ende einer Ära – ich betrete Neuland, ohne jeden Haltepunkt. Nervös blicke ich mich um. Der Nikolski-Kompass liegt auf dem Boden in der Nähe des Schlafsacks und zeigt immer noch 34° westlich am Norden vorbei. Ich lege mir seine kirschrote Schur um den Hals.
Das Müllauto entfernt sich. In seinem Kielwasser kommt der Umzugswagen.
Granpa
Noah schreckt aus dem Schlaf.
Alles ist ruhig im Wohnwagen, er hört nichts als das Geräusch eines vorbeifahrenden Autos auf der Straße. Eine Etage unter ihm liegt Sarah in ihren Schlafsack gerollt und atmet ruhig. Er dreht sich auf die Seite, in der Hoffnung wieder einzuschlafen, kann aber keine bequeme Position mehr finden. Im Alter von fünf Jahren war ihm diese enge Schlafkoje noch riesengroß erschienen. Jetzt vergeht keine Nacht, ohne dass er sich eine Beule am Kopf oder eine Schürfwunde am Ellenbogen zuzieht.
Ein paar Minuten plagt er sich noch in der Hoffnung auf eine komfortable Liegeposition und wird durch diesen stillen Kampf schließlich vollends wach. Er seufzt und beschließt aufzustehen. Lautlos steigt er die Leiter hinab und schlüpft in T-Shirt und Jeans. Am Küchentisch sitzen zwei Chipewyan-Indianer. Sie haben lange weiße Zöpfe und zerfurchte Hände. Noah weiß nicht, wie sie heißen. Der eine ist sein Ur-Ur-Großvater. Was den anderen angeht, hat er keine Ahnung. Es ist fast nichts über die beiden bekannt, außer dass sie im Norden Manitobas lebten und gegen Ende des 19. Jahrhunderts dort auch starben.
Noah grüßt sie stillschweigend und geht hinaus.
Der Wohnwagen steht inmitten von vierzig Millionen Hektar Roggen, über denen ein leichter Nebel liegt, aus dem hin und wieder einige Strommasten aufragen. Die Sonne steht noch unter dem Horizont und die Luft riecht nach nassem Heu. In Böen trägt der Wind das weit entfernte Brummen eines Traktors heran.
Noah geht barfuß vor bis an den Rand des Feldes. Auf dem Grund des Bewässerungsgrabens rinnt etwas Wasser. Der beißende Gestank des Diazinon vermischt sich mit dem Duft der feuchten Erde – bekannte Gerüche.
Er ist gerade dabei, sich die Hose aufzuknöpfen, als er auf der Straße einen Kleintransporter herannahen hört. Die Hände in die Seiten gestemmt unterbricht er sein Vorhaben. Ein alter roter Ford taucht auf, der voller Karacho vorbeirast und nach Westen verschwindet. Sobald er weit genug entfernt ist, schickt Noah einen langen, glitzernden Strahl Urin in den Bewässerungsgraben.
Auf dem Weg zurück in den Wohnwagen denkt er über dieses seltsame Gefühl von Scham nach. Er wird den unangenehmen Eindruck nicht los, dieses Fahrzeug sei in einen Bereich seiner Privatsphäre eingedrungen, als führe die Route 627 quer durch ihr Badezimmer.
Wenn man es sich genau überlegt, ist dieses Bild gar nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt.
Auf die Frage, wo er aufgewachsen sei, hat Noah über Jahre hinweg immer nur vage Antworten genuschelt – in Saskatchewan, in Manitoba, oder auch in Alberta – und schnell vom Thema abgelenkt, bevor man ihn weiter über dieses rätselhafte Tabu ausfragte.
Nur ganz wenigen Menschen würde Noah die wahre (und wenig glaubwürdige) Geschichte der Sarah Riel, seiner Mutter, erzählen.
Alles begann im Sommer 1968, als sie ihr heimatliches Reservat nahe von Portage La Prairie verließ. Sie war 16 und hatte die Absicht, einen gewissen Bill zu ehelichen. Seine Haut verschwand die meiste Zeit über unter einer dicken Schicht Rohöl, diese Tarnung aber täuschte niemanden: Der Kerl war weiß, leicht rosa sogar in den Gelenken – und Sarah verlor, indem sie ihn heiratete, ein für alle Mal ihren Status als Indianerin, mitsamt dem Recht, in einem Reservat zu wohnen.
Diese verwaltungstechnische Spitzfindigkeit erlangte zehn Monate nach der Hochzeit höchste Bedeutung, als sich Sarah vom ehelichen Wohnsitz davonmachte – mit einem blauen Auge, einem auf die Schnelle gepackten Müllsack voller Kleidung und dem festen Entschluss, nie wieder dorthin zurückzukehren. Sie borgte sich Bills Auto mit Wohnanhänger und begann, die Gegend von den Rockies bis nach Ontario zu durchkämmen, je nachdem, wohin die Saisonarbeiten sie verschlugen.
Als das Ministerium für indianische Angelegenheiten achtzehn Jahre später den Indian Act mit Zusatzartikeln versah, hätte Sarah ihren Status als Indianerin wieder einfordern können. Die dafür notwendigen Schritte würde sie jedoch niemals eingeleitet haben: Sie würde sich in der Zwischenzeit so gut an das Leben unterwegs gewöhnt haben, dass sie es gar nicht mehr in Erwägung zog, sich jemals wieder in einem Reservat einzuschließen. Sie ließe sich, bekräftigte sie immer wieder gerne, auf gar keinen Fall von einer Handvoll Beamter sagen, ob sie Indianerin sei oder nicht. Ihr Stammbaum weise zwar ein paar französischsprachige Einschläge auf, aber schon drei Generationen zurück ließen sich nur noch alte indianische Nomaden finden, die sesshaft gemacht und anschließend in unzähligen, exotisch benannten Reservaten geparkt wurden: Sakimay, Peepeekisis, Okanese, Poor Man, Star Blanket, Little Black Bear, Standing Buffalo, Muscowpetung, Day Star, Assiniboine.
Ein halbes Dutzend dieser Ahnen spukte noch immer in ihrem Wohnwagen, saß für die Ewigkeit am Küchentisch aus sternenbesätem Holzimitat. Reglose und schweigsame Geister, die die vorbeiziehende Landschaft betrachteten und die sich fragten, wo zum Teufel all die Büffel abgeblieben waren.
Noahs Vater stammte seinerseits von der weit entfernten Atlantikküste. Er kam aus einer akadischen Familie aus der Gegend von Beaubassin, sesshaft und dickköpfig, die durch die Briten in die abgelegensten Winkel ihrer amerikanischen Kolonien verschleppt wurden: Massachusetts, Carolina, Georgia, Maryland, New York, Pennsylvania, Virginia.
Noah mochte den Kontrast zwischen den beiden Seiten seines Stammbaums, das Paradox, ein Nachkomme sowohl der Reservate als auch der Deportation zu sein. Seine Begeisterung beruhte jedoch auf einem historischen Fehler, da seine Vorfahren in Wirklichkeit gar nicht deportiert worden waren. Genau wie eine gewisse Anzahl von Akadiern waren sie kurz vor dem Grand Dérangement, der Deportation, geflohen, um Schutz in Tête-à-la-Baleine zu suchen, einem isolierten Dorf am Sankt-Lorenz-Golf, das über keine Straße zu erreichen war.
Und an diesem abgelegenen Ort wurde zwei Jahrhunderte später Noahs Vater geboren: Jonas Doucet.
Er war der siebte Sprössling einer umfangreichen Familie: acht Brüder, sieben Schwestern, fünf Cousins, zwei Onkel, eine Tante, ein Paar Großeltern – insgesamt drei Generationen von Doucets, die sich in eine kleine Hütte drängen mussten. Er wurde auf den Namen Jonas getauft, ein Glücksfall, denn aus dem biblischen Repertoire hätten ihm auch weniger klangvolle Namen wie Ilia, Ahab oder Ismael beschert werden können.
In dieser verlorenen Ecke des Kontinents wurde man schnell erwachsen und mit vierzehn Jahren streunte Jonas durch den Montréaler Hafen – ungefähr achthundert Seemeilen flussaufwärts von seinem Heimatdorf. Er ging an Bord eines Frachtschiffs mit Weizen, das nach Kuba unterwegs war, eine Hin- und Rückfahrt, die nicht länger als drei Wochen hätte dauern sollen. Jonas wechselte im Hafen von Havanna jedoch den Kahn und sprang an Bord eines Frachtschiffs, das sich auf dem Weg nach Trinidad befand. Ein drittes Frachtschiff brachte ihn nach Zypern. Von Zypern aus durchfuhr er den Suezkanal in Richtung Borneo und von Borneo machte er sich auf nach Australien.
Etappe für Etappe hat Jonas so ungefähr zwölf Mal den Erdball umrundet. Je mehr Häfen er vorbeiziehen sah, umso höher stieg er im Dienstgrad, kam aus der Küche in den Motorraum, vom Motorraum zu den Funkern. Nach einigen Jahren als Assistent bekam er eine eigene Lizenz und wurde seines Zeichens Funker.
Jonas liebte diesen sonderbaren Beruf, auf halber Strecke zwischen Elektronik und Schamanismus, bei dem der Funker sich in einer rhythmisierten, für den Laien unverständlichen Sprache mit den hohen Luftschichten unterhielt. Den Schamanen zu spielen brachte jedoch auch einige Gefahren mit sich: Die alten Funk-Hasen – diejenigen, die zu lange schon auf diesem Posten waren – litten oftmals an einem irreversiblen Stimmbandschwund. Man sah sie in Hafenspelunken hocken wie eingeschnappte Barden, die nicht mehr anders als durch Morsezeichen auf ihre Bierkrüge kommunizieren konnten.
Verschreckt von dieser Aussicht beschloss Jonas, sich wieder auf dem Festland niederzulassen.
Zehn Jahre nach seiner Abreise ging er im Montréaler Hafen wieder von Bord und sah sich nervös nach allen Seiten um. In seiner Abwesenheit war Québec nacheinander vom Tod des Premiers Duplessis, der Oktoberkrise, der Modernisierung von Montréal, der Weltausstellung und der sexuellen Revolution durchgerüttelt worden. Was er da zu Gesicht bekam, hatte nichts mit dem Seemannsleben oder der industriellen Betriebsamkeit der Häfen zu tun – und schon gar nichts mit dem Québec aus seiner Erinnerung, das sich auf vierzehn Jahre Elend in einem mikroskopisch kleinen Dorf der Basse-Côte-Nord beschränkte.
Sobald er den Fuß an Land gesetzt hatte, wurde Jonas von einem sonderbaren Übel heimgesucht: Er konnte sich auf einer unbewegten Oberfläche nicht mehr fortbewegen. Die alten Seewölfe kannten diese Gleichgewichtsstörung durch den zu langen Aufenthalt auf dem Meer nur allzu gut. Gegen die Landkrankheit gab es kein Heilmittel. Man musste einfach ein paar Tage warten, bis sich das Innenohr von selbst an die Lage gewöhnt hatte. Jonas machte sich jedoch Sorgen: Tag um Tag verging und seine Horizontlinie hörte noch immer nicht auf zu schwanken. Im Sitzen brachte ihn der Schwindel so weit, dass er vom Stuhl fiel. Im Stehen musste er sich vor lauter Übelkeit über die Reling hängen. Im Liegen rollte er auf dem Bett hin und her wie eine Fahrwassertonne und hatte sich, wenn er erwachte, im Bettzeug verheddert.
Nach zwei Wochen des Würgens und Bemühens auf diese Art entschied er sich zu einer Radikalkur, die ihn entweder dahinraffen oder genesen lassen würde: Er wollte im Alleingang den Kontinent durchqueren.
Dieses Großvorhaben mochte unbedeutend anmuten, doch dürfen wir nicht vergessen, dass für Jonas die kürzeste Verbindung zwischen Montréal und Vancouver bisher durch den Panamakanal verlief. Er schwang sich also den Seesack über die Schulter und machte sich auf, grünlich und schwankend, um an der Route 40 den Daumen rauszuhalten.
Eine Woche später lag Jonas allein am Rand einer kleinen Straße in Manitoba: Schweißüberströmt hatte er sich in der aussichtslosen Hoffnung, seine Übelkeit damit zu lindern, in den Schotter geworfen. Zehn Mal hatte er den Inhalt seines Magens erbrochen und verfluchte sich zwischen zwei Aufstoßern dafür, nicht wieder zur See gefahren zu sein. Da könnte er jetzt gemütlich durch den Norden des Indischen Ozeans schippern, inmitten eines Monsumsturms mit einer Morsetaste unter dem Finger . . .
Hoch über ihm in der Vertikalen kreiste eine Meute interessierter Geier. Er schloss die Augen, bereit, sich dem Tod durch Übelkeit und durch Verdursten hinzugeben. Als er sie fünf Minuten später wieder öffnete, hielt Sarah ihm eine Trinkflasche mit lauwarmem Wasser hin.
Das sanfte Schaukeln von Granpa holte Jonas wieder zurück zu den Lebenden.
Granpa war eine gelbgraue Bonneville Kombilimousine, Baujahr 1966, breiter als lang, mit rostbesprenkeltem Panzerkleid, deren Radio sich weigerte etwas anderes zu empfangen als die Country-Sender auf der Langwelle. Der stotternde Motor dieses Ozeanriesen, durch Zehntausende zurückgelegte Kilometer Fronarbeit am Wohnanhänger vorzeitig verschlissen, gestattete es nur bei Rückenwind, das Tempo von 15 Knoten zu überschreiten. Dieses Festlandgefährt, das noch nie etwas anderes als Prärie und immer nur Prärie gesehen hatte, verstand es gleichwohl auf das Beste, das Wiegen des Meeres perfekt nachzuahmen. Vielleicht waren seine Stoßdämpfer in der Nähe des Atlantiks hergestellt worden? Vielleicht hatten seine abgenutzten Reifen früher an den Bordwänden eines Schleppers gehangen?
Wie dem auch sei, das künstliche Schlingern rettete Jonas. Er konnte wieder ruhig atmen, die Übelkeit legte sich und das Schwindelgefühl verschwand so erfolgreich, dass sich der Sterbende, der in extremis vor der Insolation gerettet worden war, bereits nach einigen Stunden in einen Corto Maltese verwandelt hatte.
Als es Abend wurde, lud Sarah Jonas ein, sich im silberglänzenden Wohnwagen ein Plätzchen zu suchen. Dazu muss man sagen, dass sie seit gut zwei Jahren so umherzog und dass sie die Einsamkeit mitunter leid war. Jonas hatte die Absicht, bis zum anderen Ende des Kontinents zu gelangen? Kein Problem. Die Fahrt dorthin ließ sich mit dem Tausch gegen etwas Gesellschaft einfach begleichen.
Das Paar war nur für die Strecke von 1500 Kilometern füreinander bestimmt. Das reichte aus.
Ende August kamen sie in die östlichen Vororte von Fort Mcleod, Alberta, dort wo sich zwei Highways trennen. Die 2 geht hinauf in den Norden, in Richtung Calgary. Die 3 verliert sich im fernen Blau der Rocky Mountains. Sarah parkte Granpa auf dem Seitenstreifen und brachte die Situation auf den Punkt:
„Zum Pazifik, da lang, immer geradeaus.“