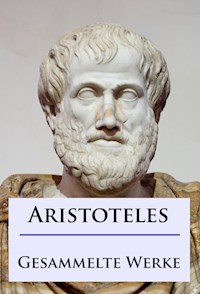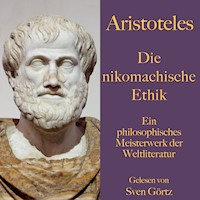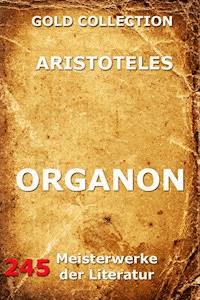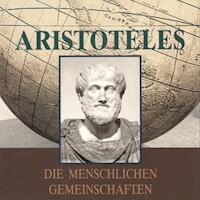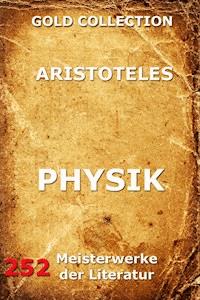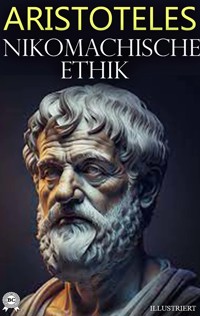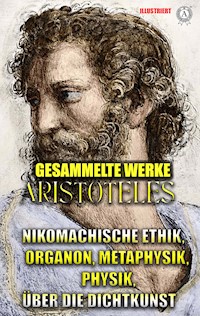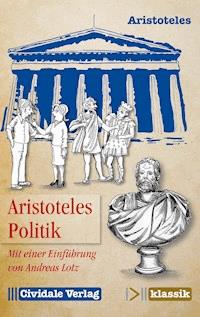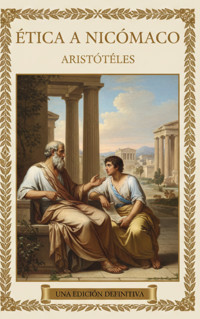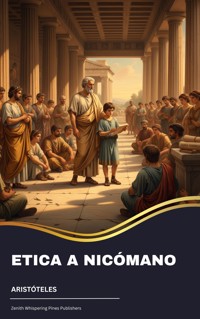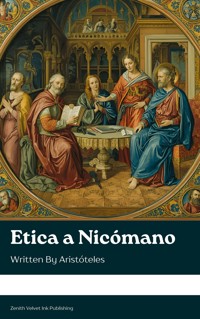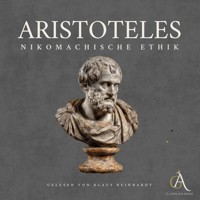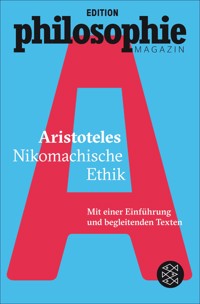
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Edition Philosophie Magazin: Eine exklusive Auswahl zentraler philosophischer Texte durch das »Philosophie Magazin«. Mit dem ungekürzten Originaltext sowie - einer sachkundigen Einführung in Werk und Vita - einer Zeitleiste zu Leben und historischem Kontext - Erläuterungen der Grundbegriffe Aristoteles - mit Beiträgen von Julian Nida-Rümelin sowie Brigitte Falkenburg zur bleibenden Bedeutung des Werks Die ›Nikomachische Ethik‹ ist die bedeutendste der drei ethischen Schriften Aristoteles' und gilt als sein ethisches Hauptwerk. Ziel ist es, einen Leitfaden zu geben, um zu erlernen, wie man ein guter Mensch wird und wie man ein glückliches Leben führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Aristoteles
Nikomachische Ethik
Mit einer Einführung und begleitenden Texten
Über dieses Buch
Edition philosophie Magazin: Eine exklusive Auswahl zentraler philosophischer Texte durch das »philosophie Magazin«.
Mit dem ungekürzten Originaltext sowie
– einer sachkundigen Einführung in Werk und Vita
– einer Zeitleiste zu Leben und historischem Kontext
– Erläuterungen der Grundbegriffe des jeweiligen Werks
– mit Beiträgen von Julian Nida-Rümelin sowie Brigitte Falkenburg zur bleibenden Bedeutung des Werks
Die ›Nikomachische Ethik‹ ist die bedeutendste der drei ethischen Schriften Aristoteles’ und gilt als sein ethisches Hauptwerk. Ziel ist es, einen Leitfaden zu geben, um zu erlernen, wie man ein guter Mensch wird und wie man ein glückliches Leben führt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Covergestaltung: hauser lacour kommunikationsgestaltung gmbh, Frankfurt
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403688-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Einführung
Ein feinfühliger Realist
Politik der Freundschaft
Auch hier wohnen Götter
Ein eifersüchtiger Schüler
Blüte, Exil und Vermächtnis
Daten zu Aristoteles’ Leben
Daten zum geschichtlichen Kontext
Aristoteles’ Grundbegriffe
Glück und Lust
Verwirklichung und Vermögen
Besonnenheit
Staat, Staatsbürger
Zweck
Substanz, Wesen
Weiterführende Lektüre
Stimmen zu Aristoteles’ Bedeutung
»Keine genetische Determination« Von Brigitte Falkenburg
»Kooperiert freiwillig!« Von Julian Nida-Rümelin
Vorwort zur Nikomachischen Ethik
Aristoteles Nikomachische Ethik
Vorbemerkung
1. Die Stufenleiter der Zwecke und der höchste Zweck
2. Form und Abzweckung der Behandlung des Gegenstandes
Einleitung
1. Verschiedene Auffassungen vom Zweck des Lebens
2. Kennzeichen und Erreichbarkeit der Eudämonie
I. Teil Die sittliche Anforderung
I. Kennzeichen der sittlichen Beschaffenheit und ihrer Betätigung
1. Die Trefflichkeit eines Menschen
2. Gewöhnung und Erziehung
3. Verstandesbildung und Fertigkeit
4. Fertigkeit und rechtes Maß
II. Das freie und das unfreie Handeln
1. Zwang und Irrtum
2. Vorsatz und Überlegung
3. Der Willensinhalt
4. Das freie Wollen
III. Die einzelnen Arten der sittlichen Betätigung
1. Willensstärke gegenüber dem Trieb
2. Das Verhalten zu den äußeren Gütern
3. Verhalten zu den anderen Menschen im Umgang
4. Verhalten im Verkehr der Güter, Gerechtigkeit
II. Teil Das sittliche Subjekt
I. Verstandesbildung
1. Der Intellekt und seine Vermögen
2. Überlegung und Vorsatz
3. Die Formen intellektueller Betätigung
4. Praktische Einsicht
5. Intellektuelle Bildung und Sittlichkeit
II. Willensbildung
1. Sittlicher und unsittlicher Wille
2. Wille und Intellekt
3. Der Wille im Verhältnis zu Affekten und Begierden
III. Gefühlsbildung
1. Kritik herrschender Ansichten
2. Die Gefühle und die Tätigkeit
3. Edle und niedere Gefühle
III. Teil Die menschlichen Gemeinschaften
1. Die Bestimmung des Menschen zur Gemeinschaft
2. Arten der Verbindung zwischen den Menschen
a) Gründe der Befreundung
b) Unterschiede in den Befreundungsverhältnissen
3. Freundschaftsverhältnis und Rechtsverhältnis
a) Allgemein
b) Im Staate
c) In der Familie
d) In der wirtschaftlichen Gemeinschaft
e) Austausch ohne Entgelt
4. Einzelfragen das Freundschaftsverhältnis betreffend
a) Das Maß der Verpflichtung
b) Die Auflösung freundschaftlicher Beziehungen
c) Selbstliebe und Nächstenliebe
5. Freundschaftsähnliche Verhältnisse
a) Wohlwollen
b) Eintracht
c) Wohltäter und Empfänger
d) Selbstliebe
6. Das Bedürfnis nach Freunden
a) Im Glück
b) Die rechte Zahl der Freunde
c) Freunde im Glück und im Unglück
d) Die Freundschaft als Lebensgemeinschaft
IV. Teil Motive, Ziele und Stufen des sittlichen Lebens
1. Der sittliche Wert der Gefühle
a) Verschiedenheit des Urteils über den Wert der Lustgefühle
b) Die Bedeutung der Lustgefühle für das tätige Leben
2. Das Leben nach reiner Vernunft
3. Die moralische Betätigung
4. Staat, Gesetz, Zwang im Dienste des sittlichen Lebens
Editorische Notiz
Einführung
Von Émilie Chapuis
Auf seinem berühmten Fresko »Die Schule von Athen« zeigt Raffael alle bekannten Philosophen der Antike. Platon und Aristoteles stehen in der Mitte. Während Ersterer mit seinem Zeigefinger zum Himmel deutet, bewegt Letzterer seine Hand in Richtung Erde. Platon steht für den Idealismus, den Himmel, die Mathematik, Aristoteles ergreift Partei für die Erde, den Realismus und den gesunden Menschenverstand.
Ein feinfühliger Realist
Aristoteles war 17, als er im Jahre 367 v. Chr. nach Athen kam. »Er stotterte, war dünnbeinig, kleinäugig, stets sorgfältig gekleidet und frisiert«, berichtet Diogenes Laertios. Er verließ seine Heimatstadt Stageira, um sich an der berühmten, von Platon gegründeten Akademie in Athen einzuschreiben. Er profilierte sich bald als Meisterschüler, und schließlich wurde er Lehrer. Bis zu Platons Tod unterrichtete Aristoteles an der Akademie.
Die Denkweisen der beiden Geistestitanen sind sehr verschieden, teilweise gegensätzlich. Über ihre Beziehung zueinander kann heute nur spekuliert werden. Es ist keineswegs klar, ob zwischen ihnen freundschaftliche Gefühle geherrscht haben. Laut Claudius Aelianus, einem Historiker aus dem 3. Jahrhundert, hat Platon Aristoteles nie gemocht: »Er schnitt sich die Haare, was Platon missfiel, und trug viele Ringe und war stolz darauf. Seine Miene war spöttisch, und das war, zusammen mit seiner Neigung zu ungestümem Gerede, ein Hinweis auf seinen Lebenswandel.« Gewiss, die antiken Biographen vermischen Details und Legenden. Stellenweise widersprechen sie sich auch. So findet man Zeugnisse, denen zufolge Platon Aristoteles als »Leseratte« verspottete, an anderer Stelle heißt es, dass er ihn »nous« (intelligent) nannte. Mit großer Wahrscheinlichkeit war Aristoteles, der als Erster die Freundschaft zum Gegenstand der Philosophie erklärte, kein verabscheuungswürdiger Mensch. Selbst wenn er Kritik an Platons Thesen übte, geschah dies mit viel Feingefühl. So heißt es etwa an einer Stelle der »Nikomachischen Ethik« (I, 4): »Freilich fällt uns diese Unterscheidung schwer, da befreundete Männer die Ideen eingeführt haben. Es scheint aber vielleicht besser, ja sogar Pflicht zu sein, zur Rettung der Wahrheit auch die eigenen Empfindungen nicht zu schonen, zumal wir Philosophen sind.«
Mit seiner realistischen Sicht des Menschen stellte Aristoteles die Grundlage der platonischen Metaphysik in Frage. Zwar gibt der ebenbürtige Schüler seinem Lehrer in dem Punkt recht, dass das allgemeine Ziel des philosophischen Denkens darin besteht, die Welt in ihrer Mannigfaltigkeit verständlich zu machen. Platon veranschlagte den Einheitsgrund der Vielfalt in den übersinnlichen Ideen. Für Aristoteles hingegen liegt die Einheit im Irdischen selbst. Für ihn gab es eine unveränderliche Substanz in den Dingen und Lebewesen, veränderlich waren lediglich manche der Eigenschaften und Zustände, die ihnen zukamen. Was Platon in den Himmel der Ideen hob, siedelte Aristoteles im endlichen Individuum an, und diese ebenso affektive wie rationale Sicht des Menschen bildet die Grundlage seiner ganzen ethischen und politischen Reflexion. Für ihn ist das Ziel des Menschen – das »höchste Gute« – Glück und Tugend, Lust und Askese zugleich. Während zum Beispiel der Zorn weder ein Laster noch eine Tugend ist, ist der Tugendhafte jemand, der »zürnt, worüber er soll, und wenn er soll, und dazu wie, wann und solange er soll« (Nikomachische Ethik, IV, 11). Als Realist unterscheidet er »dianoetische« (verstandesmäßige) Tugenden, die gelehrt werden können, da sie rational sind, von »ethischen« Tugenden, die durch Gewohnheit erworben werden. Letztere spielen auch bei der aristotelischen Bestimmung der Bedeutung und Aufgabe des Gesetzgebers eine Rolle. Denn gute Gewohnheiten werden durch wiederholten Zwang erworben, den das Gesetz ausübt. Der Stadtstaat ist somit eine Bedingung des »glücklichen Lebens«. Einzig in der Polis erhält der Mensch, das »politische Tier«, die Möglichkeit, seine Natur zu vervollkommnen.
Politik der Freundschaft
Im Gegensatz zu Platon findet sich bei Aristoteles keine klare Definition des vollkommenen Stadtstaates. Flexible Gesetze, die sich an Gewohnheiten orientieren, sind für ihn viel wirksamer als statische, und »der gute Gesetzgeber muss sich gleichzeitig um die absolut beste Verfassung und die in einer gegebenen Situation am besten mögliche Verfassung bemühen« (Politik, IV). Während Platon die Polis als eine rationale Konstruktion versteht, zu deren Stabilisierung es gilt, die affektiven und irrationalen Beziehungen zu verringern, ist es für Aristoteles gerade die menschliche Gemeinschaft, aus der heraus der Stadtstaat seine Stärke bezieht. Die politische Freundschaft ist für ihn viel wertvoller als »die Gerechtigkeit selbst«, da sie es ermöglicht, auf das, was andere einem schulden, zu verzichten.
Bemerkenswerterweise war Aristoteles nicht nur der Theoretiker der Polis, sondern auch der Erzieher Alexanders des Großen, desjenigen, der mit seinen Eroberungsfeldzügen das Ende der »real existierenden« griechischen Stadtstaaten einleitete.
Auch hier wohnen Götter
Kurz vor seinem Tod im Jahr 348 oder 347 v. Chr. übergab Platon die Leitung der Akademie seinem Neffen Speusippos. Womöglich enttäuscht darüber, verließ Aristoteles Athen und begab sich nach Assos. Dort herrschte ein ebenfalls ehemaliger Schüler der Akademie, Hermias von Atarneus, der neben den Regierungsgeschäften eine platonische Schule leitete. Aristoteles gewann diesen zum Freund und nahm dessen Nichte Pythias zur Frau. Sie schenkte ihm eine gleichnamige Tochter und starb bei der Geburt. Der Philosoph heiratete später ein zweites Mal. Aus der Ehe mit Herpylis stammt sein Sohn Nikomachos.
Aristoteles knüpfte in Assos wieder an den Empirismus seiner philosophischen Frühphase an. Er vertiefte sich in zoologische Untersuchungen und verfasste eine »Naturgeschichte der Tiere«. Von seinem früh verstorbenen Vater Nikomachos, dem Leibarzt des Königs von Makedonien, hatte Aristoteles das Interesse für alles Lebendige geerbt. Seit Pythagoras wurde in Griechenland vor allem die Mathematik verehrt; Aristoteles verhalf den Naturwissenschaften zu Ansehen. »In allen Teilen der Natur gibt es wunderbare Dinge; man sagt, dass Heraklit gegenüber fremden Besuchern, die ihn fanden, wie er sich am Feuer in seiner Küche wärmte, und die zögerten einzutreten, die folgende Bemerkung machte: ›Tretet nur ein, auch hier wohnen Götter.‹ Nun gut, treten wir genauso und ohne Scheu in das Studium jeder Tierart ein: bei jeder gibt es Natur und Schönheit«, schreibt er in »Über die Teile der Tiere«. Als Verfasser von »Über den Himmel«, »Über Entstehen und Vergehen« oder auch der »Meteorologica« begründete er mit der »Physik« ein Welt- und Naturverständnis, das bis zum Mittelalter Bestand hatte. Im Gegensatz zu Platon und dessen mythologischer Darstellung der kosmischen Ordnung versteht Aristoteles die Natur als eine Realität, die »das Prinzip der Bewegung in sich trägt«.
Im Jahre 345 v. Chr. erfuhren die Perser von Hermias verräterischem Plan, sich mit den Makedoniern zu verbünden. Der Monarch von Assos wurde verhaftet, die Philosophen vertrieben. Aristoteles floh nach Mytilene, der bedeutendsten Stadt auf der Insel Lesbos, wo sich ihm Theophrast, sein heute wohl bekanntester Schüler, anschloss. Im Jahr 343 oder 342 bat ihn Philipp, der König von Makedonien, die Erziehung seines dreizehnjährigen Sohnes Alexander zu übernehmen.
Ein eifersüchtiger Schüler
Die langjährigen Freundschaftsbande zwischen der Familie des Aristoteles und dem makedonischen Hof verfestigten sich. So berichtet Plutarch in seinen »Parallelen Lebensbeschreibungen«: »Als Philipp gewahrte, dass Alexanders Charakter nicht leicht zu beugen war und sich gegen jeden Zwang zur Wehr setzte, sich aber durch vernünftigen Zuspruch leicht zum Rechten führen ließ, versuchte er es selber mehr mit Überzeugen als mit Befehlen, und … ließ den berühmtesten und gelehrtesten Philosophen kommen und zahlte ihm ein hohes und seiner würdiges Lehrgeld: er ließ die Stadt Stageira, aus der Aristoteles stammte und die von ihm zerstört worden war, wieder aufbauen.« Über den Inhalt dieser kostspieligen Erziehung ist nur wenig bekannt, doch Plutarch weiß, dass sie Alexander gefiel: »Den Aristoteles bewunderte er im Anfang und liebte ihn, wie er selbst sagte, nicht weniger als seinen Vater, weil er durch diesen wohl das Leben habe, dank jenem aber ein rechtes Leben führe.« Interessant auch Plutarchs Bericht, dass Alexander eifersüchtiges Missfallen äußerte, als er erfuhr, dass Aristoteles seine Werke veröffentlicht hatte: »Denn wodurch werden wir uns über die anderen erheben, wenn die Lehren, nach denen wir erzogen worden sind, Allgemeingut werden?«, beschwerte sich der künftige Eroberer.
Blüte, Exil und Vermächtnis
Nach der Ermordung Philipps im Jahr 336 v. Chr. wurde Alexander König von Makedonien. Aristoteles kehrte nach Athen zurück, wo er sein berühmtes Lykeion gründete. Die Akademie stand zu dieser Zeit in großer Blüte und wurde von Xenokrates geleitet. Die beiden Schulen gerieten in ein Konkurrenzverhältnis. Aristoteles’ Lykeion wurde zunächst als »peripatetische« Schule bezeichnet, da Aristoteles es liebte, während des Unterrichts in den Laubengängen des Gebäudes umherzuwandeln.
Als Alexander im Jahr 322 v. Chr. starb, brach in Athen eine antimakedonische Revolution aus. Aristoteles, der als Hofphilosoph der makedonischen Herrscher in Misskredit geriet, wurde – wie einst Sokrates – wegen Gottlosigkeit verfolgt. Er floh aus der Stadt, um die Athener daran zu hindern, »sich ein zweites Mal an der Philosophie zu versündigen«. Er wählte den Geburtsort seiner Mutter zum Exil – Chalkis, wo er nach kurzer Zeit, vermutlich an einem Magenleiden, im Alter von 63 Jahren starb. Das Testament des großen Logikers und Philosophen hat Diogenes Laertios überliefert. Es ist weder politisch noch philosophisch, sondern behandelt lediglich familiäre Angelegenheiten. Aristoteles bittet darin den Sohn seines Vormunds, den er selbst adoptiert hatte, seine Tochter zu heiraten und für das Wohlergehen seiner Frau zu sorgen. Er vermachte die Akademie und seine Bibliothek Theophrast von Eresos. Bis heute wirft man Aristoteles vor, in seiner »Politik« die Sklaverei zu verteidigen. Am Ende seines Lebens verfügte er die Freilassung mehrerer seiner Sklaven und ordnete an: »Keiner der Sklaven, die mich bedient haben, ist zu verkaufen, sondern weiterzubeschäftigen und, wenn erwachsen, nach Verdienst freizulassen.«
Übersetzung: Ronald Voullié
Daten zu Aristoteles’ Leben
Aristoteles wird in der nordgriechischen Stadt Stageira als Spross einer Arztfamilie geboren, die dem makedonischen Hof nahesteht. Nach dem frühen Tod beider Eltern wird Proxenos von Atarneus zu seinem Vormund
–367Im Alter von 17 Jahren kommt Aristoteles als Schüler der Akademie Platons nach Athen
–348Tod Platons. Aristoteles verlässt Athen und geht nach Assos
–345Nach dem Tod des Hermias, dem Herrn von Assos, geht Aristoteles nach Mytilene, der bedeutendsten Stadt auf Lesbos
–342Aristoteles wird zum Lehrer des makedonischen Thronfolgers Alexander
–336Alexander wird König, Aristoteles kehrt nach Athen zurück, wo er sein Lykeion gründet – eine öffentliche Schule, die mit der Akademie konkurriert
–322Der Gottlosigkeit bezichtigt, verlässt Aristoteles Athen. Er stirbt in Chalkis im Alter von 63 Jahren
Daten zum geschichtlichen Kontext
Tod des Pythagoras, der die Mathematik zur Königswissenschaft der Griechen gemacht hat
–428Geburt Platons
–399Prozess und Tod des Sokrates
–356Philipp II. wird König von Makedonien. Während seiner Regierungszeit bringt Makedonien ganz Griechenland unter seine Vorherrschaft
–346Frieden des Philokrates zwischen den Athenern und Philipp von Makedonien
–342Philipp von Makedonien schlägt Athen vor, ein Handelsabkommen zu unterschreiben, um den Frieden des Philokrates vertraglich abzusichern. Demosthenes überredet das Volk, dieses Angebot abzulehnen
–341Geburt Epikurs
–337Philipp von Makedonien erklärt Persien den Krieg
–336Philipp wird ermordet. Sein Sohn Alexander wird König von Makedonien
–323Tod von Alexander dem Großen und antimakedonische Revolution in Athen. Der Lamische Krieg führt zur Niederlage Athens
Aristoteles’ Grundbegriffe
Von Pierre-Marie Morel
Aristoteles ist ein enzyklopädischer Denker, der alltäglichen Lebenserfahrungen eine metaphysische Dimension gibt und Allerweltsthemen wie Glück, Tugend oder Freundschaft in den Rang philosophischer Probleme erhebt.
Glück und Lust
Alle Menschen streben nach Glück, weil alle Menschen in allen ihren Tätigkeiten von Natur aus nach dem Guten trachten. Das wirklich Gute ist tatsächlich zugleich das Gute, das man anderen erweist, und jenes, das man sich selbst erweist oder in sich selbst empfindet. Gleichwohl haben nicht alle Menschen dieselbe Vorstellung vom Glück, das sie oft mit Lust, Reichtümern oder Ehren verwechseln. Warum macht uns das Gute glücklich? Weil es nach nichts anderem mehr verlangt, sobald es verwirklicht ist. Glück wird nicht summiert, wie dies für Freuden oder materielle Güter gilt. Glücklich zu sein bedeutet somit, sich in einem Zustand der Vollendung und Selbstgenügsamkeit zu befinden, doch diese Selbstgenügsamkeit erstreckt sich auch auf andere. Der selbstgenügsame Mensch, der wirklich glückliche Mensch, ist es zusammen mit seinen Freunden, Angehörigen und Mitbürgern (Nikomachische Ethik, I, 5): Er ist nicht der einzige Gestalter seines eigenen Glücks. Allein der Weise erreicht diesen Zustand vollkommen selbstgenügsamer Glückseligkeit. Doch man kann sich kein Glück vorstellen, das ganz ohne Lust wäre. Eine gute Tat ist wie die Anwendung des theoretischen Wissens eine Quelle von Befriedigungen. Man soll die Lust zwar nicht um ihrer selbst willen erstreben, doch ist sie nicht das Gegenteil des Guten: Sie kommt wie ein Nebenzweck zu den erfolgreichen Tätigkeiten hinzu, so wie die Schönheit beim Menschen in der Blüte der Jahre hinzukommen kann (Nikomachische Ethik, X, 4). Glücklich ist, wer Lust in den guten Tätigkeiten findet.
Verwirklichung und Vermögen
Für die Dinge der Welt gibt es grundsätzlich zwei Seinsweisen: »in actu« (in Wirklichkeit) und »in potentia« (in Möglichkeit). »In actu« ist etwas, was tatsächlich verwirklicht ist, so wie sich im üblichen Wortsinn eine Handlung von einer bloßen Handlungsabsicht oder von der bloßen Fähigkeit, etwas zu tun, unterscheidet. So ist das Haus, wenn es erst einmal gebaut ist, »in actu«, weil es nicht mehr vollständiger Haus sein kann, als es ohnehin schon ist. Die meisten Wirklichkeiten, die »in actu« sind, waren zuerst »in potentia«, was sie sind: Als die für den Hausbau notwendigen Materialien auf dem Gelände der Baustelle abgelegt waren, waren sie erst »ein Haus in potentia«. So ist auch das Kind »ein Erwachsener in potentia«. Die Beziehung zwischen Verwirklichung und Vermögen ist jedoch nicht symmetrisch: Die Verwirklichung bestimmt die Richtung, das zu erreichende Ziel. In manchen Fällen gibt das Prinzip der Verwirklichung dem mit einem bestimmten Vermögen ausgestatteten Seienden das Ziel vor, so wie der Bildhauer der Materie eine Form gibt, wenn er den Marmorblock zur Hermes-Skulptur werden lässt. Die Unterscheidung von »in actu« und »in potentia« ist unter anderem zentral bei der aristotelischen Erklärung der Kontinuität biologischer Prozesse, wie etwa der Zeugung und der Entwicklung eines Lebewesens. Auch seine Beschreibung des menschlichen Handelns, beispielsweise der Übergang von der moralischen Anlage zur faktischen Tugendhaftigkeit, basiert auf diesen beiden Prinzipien.
Besonnenheit
Besonnenheit ist die Haupttugend oder moralische Vortrefflichkeit. Anders als Mut oder Hochherzigkeit, die erworbene Charaktereigenschaften, spontan gewordene moralische Bestrebungen sind, ist die Besonnenheit – Verstandesschärfe oder praktische Klugheit (phronesis) – eine rationale oder geistige Tugend. Die Klugheit kommt nicht bei theoretisch-wissenschaftlichen Problemen zur Anwendung, sondern erweist sich bei alltäglichen Handlungsentscheidungen. Überdies wird der Bereich der menschlichen Handlungen von einer gewissen Unvorhersehbarkeit und einer relativen Kontingenz beeinflusst, so dass sich die gute Tat nicht mit der Genauigkeit der Mathematik betrachten lässt, deren Gegenstände unveränderlich sind. Die Besonnenheit ist deshalb nicht weniger eine geistige Tugend, weil sie darin besteht, gut über das zu urteilen, was von uns abhängt: Sie dient uns als Richtschnur bei der Einschätzung der Mittel, die man für eine tugendhafte Tat einsetzen muss. Wenn sie eine bestimmte Erfahrung und eine bestimmte intuitive Einsicht in die menschlichen Situationen impliziert, ist sie vor allem eine Überlegung, eine Berechnung, die diese oder jene besondere Situation auf eine allgemeine, das moralisch Gute betreffende Regel bezieht. Deshalb ist sie sehr wertvoll für den Politiker, sei es nun, dass es darum geht, Gesetze zu verkünden, oder darum, im Interesse des Gemeinwohls zu handeln und zu überlegen. Der besonnene Mensch ist also nicht der lediglich geschickte und pragmatische Mensch, auch nicht der Vorsichtige, der sich vor den Zufällen des Daseins schützt: Er ist derjenige, der überlegen kann, was für ihn selbst gut ist, wobei er zugleich bedenkt, was das Leben im Allgemeinen gut und glücklich macht (Nikomachische Ethik, VI, 5; 8; 9).
Staat, Staatsbürger
Der (Stadt-)Staat (polis) ist diejenige von allen Gemeinschaften, die das höchste Gut anstrebt (Politik, I, 1). Für den Menschen ist es natürlich, in Gemeinschaft zu leben, und da es jedem Menschen ums eigene Wohl geht, ist es logisch, dass der Mensch »von Natur aus ein politisches Tier ist« (Politik, I, 2). Der Staat ist die natürliche Form der menschlichen Gemeinschaft. Aristoteles beschreibt ihn nach dem Vorbild des lebendigen Organismus. Er untersucht seine Entstehung, seinen Zweck und das Zusammenwirken seiner Teile. Der Mensch – für Aristoteles jedenfalls: der freie Mensch männlichen Geschlechts – ist also ebenso sehr Staatsbürger (polites), aktiver Teil des Staates, wie er Mensch ist. Der Staat bildet den natürlichen Rahmen für den Zweck, den er als Mensch verfolgt: nicht nur zu leben, sondern auch gut zu leben. Allerdings heißt das nicht, dass jeder Mensch naturgemäß ein vorbildlicher Bürger sei: Der Mensch ist zum Besten wie zum Schlimmsten fähig. Daher ist der Staat nichts ohne eine Verfassung (politeia): eine Gesamtheit von Gesetzen, die eine gewisse Ordnung einführen und die verschiedenen Gewalten organisieren. Gerade diese Verfassung bestimmt das Wesen des Bürgers, weil sie die Voraussetzungen seiner Teilnahme an den Entscheidungen und den einzelnen öffentlichen Ämtern begründet (Politik, III, 1). Sie regt ebenfalls die Erziehung im Staat an und ermöglicht damit dem Politiker, über die Tugend der Bürger zu wachen.
Zweck
»Die Natur tut nichts umsonst«: Sie wird von Zwecken bestimmt, denen sich die meisten Erscheinungen verdanken. Manche sind auf den Zufall zurückzuführen, doch dieser erklärt niemals, warum die Dinge sind, was sie sind. Die Ursache, die dies bewirkt, ist die Endursache. Sie setzt für die Prozesse ein Ziel fest, und sie stimmt mit dem überein, was bei einem natürlichen Wesen wesentlich ist. Ebenso wie wir eine gewisse Zahl von Mitteln anwenden, um unsere Ziele zu erreichen, vereint die Natur die Mittel, die für die Verwirklichung ihrer Zwecke notwendig sind. Ganz wie die Axtklinge aus einem Metall bestehen muss, das hart genug ist, um schneiden zu können, müssen die Gewebe und Organe besondere materielle Eigenschaften haben, um ihre Funktion zu erfüllen. Aristoteles nennt dies die bedingte oder hypothetische Notwendigkeit. Die Natur ist wie der Arzt, der sich selbst heilt (Physik, II, 8). Wird die Natur deshalb von so etwas wie einem vorausschauenden Verstand beseelt? Der natürlichen Zweckbestimmtheit liegen keine providenziellen Absichten zugrunde: Der Zweck ist weitaus eher das Äquivalent eines umfassenden Entwicklungsprogramms, das zur Konstitution der natürlichen Wesen gehört. Nun schließt dieses Programm aber keine zufälligen Tatsachen aus: »Das Auge ist für einen Zweck da, aber es ist nicht blau, um einen bestimmten Zweck zu erfüllen« (Über die Entstehung der Tiere, V, 1).
Substanz, Wesen
Die Substanz oder das Wesen (ousia) bildet den irreduziblen Aspekt eines jeden Seienden. Ohne ousia würde ein Seiendes aufhören zu existieren oder seine Natur ändern. Aristoteles versteht darunter die Gesamtheit der kennzeichnenden Eigenschaften eines Dings oder eines Lebewesens, sein bestimmendes Prinzip, seine Form. Weil Sokrates ein Mensch ist, gehört es zu seinen substantiellen Eigenschaften, rational zu sein und sich durch Sprache artikulieren zu können. Die Tatsache, dass man sitzt oder steht, hingegen ist eine akzidentielle, also zufällige Eigenschaft: Wenn Sokrates aufsteht, hört er deshalb nicht auf, zu existieren und derjenige zu sein, der er seiner Substanz nach ist. Also äußert man dieses oder jenes Prädikat über eine Substanz. Dabei kann es sich um ein wesenhaftes Attribut (»rational«) handeln, ein Gattungsattribut (»sterblich«, eine Eigenschaft, die der Mensch mit den übrigen Tieren teilt) oder aber um ein Akzidens (»sitzend«). Die Substanz dient als logisches Subjekt, als Begriff, auf den die Prädikate sich beziehen. Im weiteren Sinne bezeichnet »Substanz« jedes Wesen, das aus Materie und Form besteht und durch sich selbst existiert, weil es nicht nur ein Teil, eine Seinsweise oder eine Eigenschaft von etwas anderem ist.
Die Freundschaft vereint die Individuen durch ein affektives Band. Der Begriff ist bei Aristoteles durchaus in der heutigen Bedeutung zu verstehen, allerdings meint er damit ebenso Beziehungen zwischen Staatsbürgern, Eheleuten, Eltern und Kindern. Wirkliche Freundschaft zeichnet sich in dem Maße aus, wie sie nicht auf dem Vorteil beruht, den man daraus im Hinblick auf eine Lust oder in Bezug auf etwas uns lediglich Nützliches gewinnen kann. Eine derartige Freundschaft entsteht im Allgemeinen unter Gleichen und unter tugendhaften Leuten. Doch die Freundschaft kann nicht beständig sein, wenn sie nur eine affektive Bindung ist. Ist die menschliche Freundschaft die Weiterführung der natürlichen Neigungen, wie die Liebe der Eltern zu ihren Kindern? Tatsächlich »ist die Freundschaft eine Tugend oder eng mit der Tugend verbunden« (Nikomachische Ethik, VIII, 1). Denn in der Freundschaft zwischen tugendhaften Leuten liebt man beim anderen, was ihn tugendhaft macht und was es an Edelstem in ihm gibt, nämlich seinen Verstand. Umgekehrt regt die Freundschaft zur Tugend an: Die Rechtschaffenen wetteifern untereinander in Tugendhaftigkeit, weil es Freude bereitet, von anderen als rechtschaffen und tugendhaft anerkannt zu werden. Die Freundschaft ist das stabile Band der politischen Gemeinschaft, der Garant dafür, dass die Bürger nicht allein wegen ihres Vorteils und um ihrer Sicherheit willen zusammenhalten (Politik, III, 9).
Weiterführende Lektüre
Als erste Einführung mag Otfried Höffes »Aristoteles« dienen, erschienen im C.H. Beck Verlag (1999). Vom gleichen Autor werden in der Reihe »Klassiker Auslegen« des Akademie Verlags auch empfehlenswerte Einführungen in die Hauptwerke herausgegeben. Einen Einstieg in die englischsprachige Rezeption gewährt John Ackrills »Aristoteles« (de Gruyter, 1985). Forschungsgeschichtlich bedeutend ist Werner Jaegers »Aristoteles: Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung« (1927, 2009 neu aufgelegt bei BiblioBazaar).
Pierre-Marie Morel ist Professor an der Universität Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Stimmen zu Aristoteles’ Bedeutung
Zusammengestellt von Marianna Lieder
Ob in Kunst, Naturwissenschaft oder Politik, auch nach über zweitausend Jahren übt das Denken des Aristoteles prägenden Einfluss auf unsere Kultur aus. Zwei wegweisende Beispiele.
»Keine genetische Determination« Von Brigitte Falkenburg
»Nach Aristoteles ist die Natur das, was sich von selbst hervorbringt – in Form von Bewegung, Entwicklung oder Wachstum. Ihm stand ein geordneter Kosmos vor Augen, mit der Erde im Zentrum. Alles entwickelte sich zweckmäßig und war auf den Menschen ausgerichtet.
Die Physik hat sich vor Jahrhunderten vom aristotelischen Weltbild abgewendet, in der Biologie hingegen ist sein Denken erstaunlich aktuell. Aristoteles zufolge war die Entwicklung eines Lebewesens nicht im Keim vorprogrammiert. Diese Lehre findet sich in der heutigen Epigenetik wieder, ein Zweig der Biologie, der untersucht, wie die Zellumgebung das Auslesen der in der DNS kodierten genetischen Information steuert (Genexpression). Die Zellumgebung kann Gene an- und ausschalten. Die genetisch angelegten Eigenschaften prägen sich deshalb nur teilweise im Organismus aus. Vor einiger Zeit ging das Foto unterschiedlich gefleckter Klon-Katzenbabys um die Welt. Lebewesen sind durch ihre genetischen Anlagen nicht strikt determiniert, und dies nahm schon Aristoteles an.«
Die Philosophin und Wissenschaftstheoretikerin Brigitte Falkenburg lehrt an der Universität Dortmund. Seit 2004 ist sie Sprecherin des Arbeitskreises Philosophie der Physik der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. 2012 ist im Springer Verlag ihr Werk »Mythos Determinismus. Wieviel erklärt uns die Hirnforschung?« erschienen.
»Kooperiert freiwillig!« Von Julian Nida-Rümelin
»Aristoteles lieferte den ersten Entwurf für unseren heutigen republikanischen Demokratiebegriff. In der ›Nikomachischen Ethik‹ beschreibt er die Bürger des antiken Stadtstaats, der Polis, als selbstbestimmte Individuen, die es nicht einsahen, sich den Machtansprüchen eines anderen ohne weiteres zu beugen. Die Frage, wie sich eine Gesellschaft jenseits autoritärer Herrschaftsstrukturen organisieren lässt, beantwortet Aristoteles mit dem Modell der freiwilligen Kooperation – man einigte sich darüber, welchen Beitrag ein jeder zum Wohl der Gemeinschaft zu leisten hatte. Selbstverständlich handelt es sich hier um die vormoderne Version der demokratischen Bürgergesellschaft. Kinder, Sklaven und Frauen hatten sich qua natürlicher Ordnung dem Willen des Hausherrn zu beugen. Aristoteles lebte in einer Zeit des politischen Umbruchs. Der Theoretiker der Polis war interessanterweise auch der Erzieher von Alexander dem Großen, der mit seiner Eroberungspolitik den Niedergang der griechischen Stadtstaaten einleitete, die dann im hellenistischen Imperium nach Alexanders Tod ihre Selbständigkeit vollständig verloren.
Ein vergleichbares Drama scheint sich in unserer globalisierten Welt zu wiederholen, etwa dann, wenn kommunalpolitische Gesetzgebung, die ihre Impulse aus der Zivilgesellschaft erhält, durch eine kosmopolitische Ordnung verdrängt zu werden droht. Diese Entwicklung halte ich für verheerend. Denn gerade die zivilgesellschaftliche Kooperation ist nicht nur ein traditionsreicher, sondern auch ein elementarer Bestandteil der Demokratie.«
Der ehemalige Kulturstaatsminister Julian Nida-Rümelin lehrt Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Veröffentlichungen zum Thema: »Demokratie und Wahrheit« (C.H. Beck, 2006) und »Philosophie und Lebensform« (Suhrkamp, 2009). Zuletzt erschien »Der Akademisierungswahn. Zur Krise beruflicher und akademischer Bildung« (Edition Körber-Stiftung 2014) und »Auf dem Weg in eine neue deutsche Bildungskatastrophe« (Herder, 2015, zus. mit Klaus Zierer).
Vorwort zur Nikomachischen Ethik
Von Pierre Aubenque
Die Seiten über die Freundschaft gehören zu den schönsten, die Aristoteles geschrieben hat, obwohl man ihm gewöhnlich vorwirft, einen kalten und trockenen Stil zu haben. Diese Hymne an die Freundschaft hat all jene inspiriert, die, von Montaigne bis Derrida, einschließlich der deutschen Romantiker oder auch Carl Schmitts, über die Bedingungen und Wirkungen dieser einzigartigen existentiellen Erfahrung und außerdem – und dies manchmal auf kritische oder kritikwürdige Weise – über deren ethische oder politische Implikationen nachgedacht haben.
Stellen wir zunächst fest, dass Aristoteles die Rechtmäßigkeit und Schönheit der Freundschaft gegen die Einwände verteidigt, die man gegen sie vorbringen könnte. Die Freundschaft entspringt offenbar dem Bedürfnis, der Einsamkeit zu entfliehen, Beistand und Trost im Unglück zu erhalten. Aber wäre es nicht besser, diesem Bedürfnis nicht nachzugeben und mutig sich selbst zu genügen? Das Bedürfnis der Freundschaft widerspricht dem Ideal der Autarkie, der Selbstgenügsamkeit: Die Götter brauchen keine Freunde; ohnehin schon glückliche Menschen haben sie ebenso wenig nötig. Die Freundschaft widerspricht gleichfalls der natürlichen Neigung jedes Menschen, zuerst sich selbst zu lieben (philautia) und die anderen nur so weit gehend zu lieben, wie er ihre Hilfe wirklich nötig hat.
Dies sind nachdrückliche Argumente gegen die übermäßige Aufwertung einer nutzbringenden und gewissermaßen instrumentalen Freundschaft. Doch es gibt eine höhere Form der Freundschaft, die selbstlose Freundschaft, die auf der Tugend beruht, ohne deshalb das Angenehme auszuschließen. Das Glück, wofür tugendhaftes Tätigsein eine wesentliche Voraussetzung ist, gibt es nur in der Tat; es offenbart also einen Überfluss, in gewisser Hinsicht eine Überfülle von sich selbst, die danach strebt, sich auf andere zu übertragen. Glück ist nicht egoistisch, sondern ansteckend. Noch tiefgründiger betrachtet: Wenn das Dasein (das, wie Aristoteles präzisiert, mit dem Daseinsbewusstsein übereinstimmt) ein Gut an sich ist, wird die Freude, die wir aus ihm gewinnen, von dem Anteil vervielfacht, den wir durch die Kommunikation an dem Bewusstsein nehmen, das unser Freund von seinem eigenen Dasein hat.
So verbindet Aristoteles die Freundschaft, die eine Öffnung zum anderen ist, und die Selbstliebe: Denn der Freund ist ein Alter Ego, ein anderes Ich selbst. Ich erkenne mich und liebe mich selbst, indem ich mich im Blick des Freundes wie in einem Spiegel anblicke.
Doch warum brauchen wir die Vermittlung des Freundes, damit wir wirklich wir selbst sind und weil wir es nicht unmittelbar sein können? Aristoteles antwortet, dass das Verlangen nach Vermittlung, das Bedürfnis nach Kommunikation und Austausch die Besonderheit des menschlichen Daseins ist. Nichts anderes will er sagen, wenn er im Zusammenhang mit der Freundschaft daran erinnert, dass der Mensch ein »politisches Tier« oder, wie er es an anderer Stelle sagt, ein »gemeinschaftliches Tier« (koinonikon) ist. Die Freundschaft ist selbst eine Gemeinschaft (koinonia). Doch im Unterschied zu den natürlichen Gemeinschaften, wie es Familie und Polis sind, ist sie eine gewollte und gewählte Gemeinschaft, die wenigstens tendentiell über die natürlichen Grenzen hinausgeht. Allerdings gibt es eine Ausschließlichkeit der Freundschaft wie der Liebe. Man kann nicht der Freund aller sein, und die Freundschaft gewinnt an Intensität, was sie an Universalität verliert. Wenn es zutrifft, dass Freundschaft die Wahl ist, zusammenzuleben und dieselben Tätigkeiten zu teilen, so ist es wahrscheinlich, dass wir unsere Freunde unter den uns Nahestehenden, unseren Nachbarn, unseren Arbeitsgefährten, unseren Mitbürgern auswählen werden. Doch wenn Aristoteles »den Freund« und »den Fremden« gegenüberstellt, will er nicht sagen, dass der Fremde von unserer Freundschaft ausgeschlossen sei, sondern dass er uns so lange »fremd« bleiben wird, wie er nicht – mit voller Absicht – in den geschlossenen, aber erweiterungsfähigen Kreis unserer Freunde aufgenommen wird.
Im Grunde ist die unvermeidliche Abgeschlossenheit der Freundschaft die Voraussetzung für ihre innere Öffnung. In einer schönen Formulierung, die oft von Hannah Arendt zitiert wurde, heißt es vom Zusammenleben, worin die Freundschaft bestehe, dass es nicht nur ein gemeinschaftliches Empfinden sei, eine Art spontanen und pathetischen Konsenses wie der, der in einer Herde herrsche, sondern ein »aktiver Austausch (koinonia) von Wort (logoi) und Gedanken«. Die freundschaftliche Gemeinsamkeit ist nicht nur Gemeinschaft, sie ist das Ergebnis der Kommunikation und der gemeinsamen Beratung. Eine gute Freundschaft ist in diesem Sinne eine Freundschaft, die nicht blind, jedoch wechselseitig kritisch ist, mit der Freiheit, die Wohlwollen und Nachsicht den Freunden gewähren. Das macht ihre Gefährdung aus (man müsse der Freundschaft die Tugend vorziehen, hat Aristoteles einmal gesagt, als er sich – in aller Freundschaft – von seinen platonischen Freunden distanzierte). Das macht aber auch ihre Größe aus, und ich würde nicht zögern, sie im Gegensatz zu so vielen euphorisierenden Interpretationen als tragisch oder wenigstens heroisch zu bezeichnen.
Wenn sich jüdische, christliche oder islamische Denker im Mittelalter mit seinen Argumenten beschäftigten, hieß es einfach: »Der Philosoph hat gesagt …« Der Platonschüler Aristoteles ist bis heute für Philosophen, Naturwissenschaftler, Künstler, vor allem aber für engagierte Bürger und Politiker der große Lehrmeister. Er interessierte sich vor allem für das Lebendige der irdischen Welt, erforschte unablässig die Vielfalt der Natur und die Verhaltensweisen der Menschen. Er gilt als Begründer der Logik sowie der politischen Philosophie und setzte Maßstäbe auf dem Gebiet der Ethik und Metaphysik.
Pierre Aubenque ist emeritierter Professor der Universität Paris-La Sorbonne und Autor zweier klassischer Werke über die theoretische Philosophie des Aristoteles (»Le Problème de l’être chez Aristote« [»Das Problem des Seins bei Aristoteles«], PUF, 1962) und über seine praktische Philosophie (auf Deutsch: »Der Begriff der Klugheit bei Aristoteles«, Meiner, 2007). 2009 erschien von ihm bei Vrin: »Problèmes aristotéliciens. Philosophie théorique« (»Aristotelische Probleme. Theoretische Philosophie«).
Aristoteles Nikomachische Ethik
Vorbemerkung
1.Die Stufenleiter der Zwecke und der höchste Zweck
Alle künstlerische und alle wissenschaftliche Tätigkeit, ebenso wie alles praktische Verhalten und jeder erwählte Beruf hat nach allgemeiner Annahme zum Ziele irgendein zu erlangendes Gut. Man hat darum das Gute treffend als dasjenige bezeichnet, was das Ziel alles Strebens bildet. Indessen, es liegt die Einsicht nahe, daß zwischen Ziel und Ziel ein Unterschied besteht. Das Ziel liegt das eine Mal in der Tätigkeit selbst, das andere Mal noch neben der Tätigkeit in irgendeinem durch sie hervorzubringenden Gegenstand. Wo aber neben der Betätigung noch solch ein weiteres erstrebt wird, da ist das hervorzubringende Werk der Natur der Sache nach von höherem Werte als die Tätigkeit selbst.
Wie es nun eine Vielheit von Handlungsweisen, von künstlerischen und wissenschaftlichen Tätigkeiten gibt, so ergibt sich demgemäß auch eine Vielheit von zu erstrebenden Zielen. So ist das Ziel der ärztlichen Kunst die Gesundheit, dasjenige der Schiffsbaukunst das fertige Fahrzeug, das der Kriegskunst der Sieg und das der Haushaltungskunst der Reichtum. Wo nun mehrere Tätigkeiten in den Dienst eines einheitlichen umfassenderen Gebietes gestellt sind, wie die Anfertigung der Zügel und der sonstigen Hilfsmittel für Berittene der Reitkunst, die Reitkunst selbst aber und alle Arten militärischer Übungen dem Gebiete der Kriegskunst, und in ganz gleicher Weise wieder andere Tätigkeiten dem Gebiete anderer Künste zugehören: da ist das Ziel der herrschenden Kunst jedesmal dem der ihr untergeordneten Fächer gegenüber das höhere und bedeutsamere; denn um jenes willen werden auch die letzteren betrieben. In diesem Betracht macht es dann keinen Unterschied, ob das Ziel für die Betätigung die Tätigkeit selbst bildet, oder neben ihr noch etwas anderes, wie es in den angeführten Gebieten der Tätigkeit wirklich der Fall ist.
Gibt es nun unter den Objekten, auf die sich die Betätigung richtet, ein Ziel, das man um seiner selbst willen anstrebt, während man das übrige um jenes willen begehrt; ist es also so, daß man nicht alles um eines anderen willen erstrebt, / denn damit würde man zum Fortgang ins Unendliche kommen und es würde mithin alles Streben eitel und sinnlos werden /: so würde offenbar dieses um seiner selbst willen Begehrte das Gute, ja das höchste Gut bedeuten. Müßte darum nicht auch die Kenntnis desselben für die Lebensführung von ausschlaggebender Bedeutung sein, und wir, den Schützen gleich, die ein festes Ziel vor Augen haben, dadurch in höherem Grade befähigt werden, das zu treffen, was uns not ist? Ist dem aber so, so gilt es den Versuch, wenigstens im Umriß darzulegen, was dieses Gut selber seinem Wesen nach ist und unter welche Wissenschaft oder Fertigkeit es einzuordnen ist. Es liegt nahe anzunehmen, daß es die dem Range nach höchste und im höchsten Grade zur Herrschaft berechtigte Wissenschaft sein wird, wohin sie gehört. Als solche aber stellt sich die Wissenschaft vom Staate dar. Denn sie ist es, welche darüber zu bestimmen hat, was für Wissenschaften man in der Staatsgemeinschaft betreiben, welche von ihnen jeder einzelne und bis wie weit er sie sich aneignen soll. Ebenso sehen wir, daß gerade die Fertigkeiten, die man am höchsten schätzt, in ihr Gebiet fallen: so die Künste des Krieges, des Haushalts, der Beredsamkeit. Indem also die Wissenschaft vom Staate die andern praktischen Wissenschaften in ihren Dienst zieht und weiter gesetzlich festsetzt, was man zu tun, was man zu lassen hat, so umfaßt das Ziel, nach dem sie strebt, die Ziele der anderen Tätigkeiten mit, und mithin wird ihr Ziel dasjenige sein, was das eigentümliche Gut für den Menschen bezeichnet. Denn mag dieses auch für den einzelnen und für das Staatsganze dasselbe sein, so kommt es doch in dem Ziele, das der Staat anstrebt, umfassender und vollständiger zur Erscheinung, sowohl wo es sich um das Erlangen, wie wo es sich um das Bewahren handelt. Denn erfreulich ist es gewiß auch, wenn das Ziel bloß für den einzelnen erreicht wird; schöner aber und göttlicher ist es, das Ziel für ganze Völker und Staaten zu verfolgen. Das nun aber gerade ist es, wonach unsere Wissenschaft strebt; denn sie handelt vom staatlichen Leben der Menschen.
2.Form und Abzweckung der Behandlung des Gegenstandes
Was die Behandlung des Gegenstandes anbetrifft, so muß man sich zufrieden geben, wenn die Genauigkeit jedesmal nur so weit getrieben wird, wie der vorliegende Gegenstand es zuläßt. Man darf nicht in allen Disziplinen ein gleiches Maß von Strenge anstreben, sowenig wie man es bei allen gewerblichen Arbeiten dürfte. Das Sittliche und Gerechte, die Gegenstände also, mit denen sich die Wissenschaft vom staatlichen Leben beschäftigt, gibt zu einer großen Verschiedenheit auseinandergehender Auffassungen Anlaß, so sehr, daß man wohl der Ansicht begegnet, als beruhe das alles auf bloßer Menschensatzung und nicht auf der Natur der Dinge. Ebensolche Meinungsverschiedenheit herrscht aber auch über die Güter der Menschen, schon deshalb, weil sie doch vielen auch zum Schaden ausgeschlagen sind. Denn schon so mancher ist durch den Reichtum, andere sind durch kühnen Mut ins Verderben gestürzt worden. Man muß also schon für lieb nehmen, wenn bei der Behandlung derartiger Gegenstände und der Ableitung aus derartigem Material die Wahrheit auch nur in gröberem Umriß zum Ausdruck gelangt, und wenn bei der Erörterung dessen, was in der Regel gilt und bei dem Ausgehen von ebensolchen Gründen auch die daraus gezogenen Schlüsse den gleichen Charakter tragen. Und in demselben Sinne muß man denn auch jede einzelne Ausführung von dieser Art aufnehmen. Denn es ist ein Kennzeichen eines gebildeten Geistes, auf jedem einzelnen Gebiete nur dasjenige Maß von Strenge zu fordern, das die eigentümliche Natur des Gegenstandes zuläßt. Es ist nahezu dasselbe: einem Mathematiker Gehör schenken, der an die Gefühle appelliert, und von einem Redner verlangen, daß er seine Sätze in strenger Form beweise.
Jeder hat ein sicheres Urteil auf dem Gebiete, wo er zu Hause ist, und über das dahin Einschlagende ist er als Richter zu hören. Über jegliches im besonderen also urteilt am besten der gebildete Fachmann, allgemein aber und ohne Einschränkung derjenige, der eine universelle Bildung besitzt. Darum sind junge Leute nicht die geeigneten Zuhörer bei Vorlesungen über das staatliche Leben. Sie haben noch keine Erfahrung über die im Leben vorkommenden praktischen Fragen; auf Grund dieser aber und betreffs dieser wird die Untersuchung geführt. Indem sie ferner geneigt sind, sich von ihren Affekten bestimmen zu lassen, bleiben die Vorlesungen für sie unfruchtbar und nutzlos; denn das Ziel derselben ist doch nicht bloße Kenntnis, sondern praktische Betätigung. Dabei macht es keinen Unterschied, daß einer jung ist bloß an Jahren oder unreif seiner Innerlichkeit nach. Denn nicht an der Zeit liegt die Unzulänglichkeit, sondern daran, daß man sich von Sympathien und Antipathien leiten läßt und alles einzelne in ihrem Lichte betrachtet. Leuten von dieser Art helfen alle Kenntnisse ebensowenig wie denen, denen es an Selbstbeherrschung mangelt. Dagegen kann denen, die ihr Begehren vernünftig regeln und danach auch handeln, die Wissenschaft von diesen Dingen allerdings zu großem Nutzen gereichen.
Dies mag als Vorbemerkung dienen, um zu zeigen, wer der rechte Hörer, welches die rechte Weise der Auffassung, und was eigentlich unser Vorhaben ist.
Einleitung
1.Verschiedene Auffassungen vom Zweck des Lebens
Wir kommen nunmehr auf unseren Ausgangspunkt zurück. Wenn doch jede Wissenschaft wie jedes praktische Vorhaben irgendein Gut zum Ziele hat, so fragt es sich: was ist es für ein Ziel, das wir als das im Staatsleben angestrebte bezeichnen, und welches ist das oberste unter allen durch ein praktisches Verhalten zu erlangenden Gütern? In dem Namen, den sie ihm geben, stimmen die meisten Menschen so ziemlich überein. Sowohl die Masse wie die vornehmeren Geister bezeichnen es als die Glückseligkeit, die Eudämonie, und sie denken sich dabei, glückselig sein sei dasselbe wie ein erfreuliches Leben führen und es gut haben. Dagegen über die Frage nach dem Wesen der Glückseligkeit gehen die Meinungen weit auseinander, und die große Masse urteilt darüber ganz anders als die höher Gebildeten. Die einen denken an das Handgreifliche und vor Augen Liegende, wie Vergnügen, Reichtum oder hohe Stellung, andere an ganz anderes; zuweilen wechselt auch die Ansicht darüber bei einem und demselben. Ist einer krank, so stellt er sich die Gesundheit, leidet er Not, den Reichtum als das höchste vor. Im Gefühle der eigenen Unzulänglichkeit staunen manche Leute diejenigen an, die in hohen Worten ihnen Unverständliches reden. Von manchen wurde die Ansicht vertreten, es gebe neben der Vielheit der realen Güter noch ein anderes, ein Gutes an sich, das für jene alle den Grund abgebe, durch den sie gut wären.
Alle diese verschiedenen Ansichten zu prüfen würde selbstverständlich ein überaus unfruchtbares Geschäft sein; es reicht völlig aus, nur die gangbarsten oder diejenigen, die noch am meisten für sich haben, zu berücksichtigen. Dabei dürfen wir nicht außer acht lassen, daß ein Unterschied besteht zwischen den Verfahrungsweisen, die von den Prinzipien aus, und denen, die zu den Prinzipien hinleiten. Schon Plato erwog diesen Punkt ernstlich und untersuchte, ob der Weg, den man einschlage, von den Prinzipien ausgehe oder zu den Prinzipien hinführe, gleichsam wie die Bewegung in der Rennbahn von den Kampfrichtern zum Ziele oder in umgekehrter Richtung geht. Ausgehen nun muß man von solchem, was bekannt ist; bekannt aber kann etwas sein in doppeltem Sinn: es ist etwas entweder uns bekannt oder es ist schlechthin bekannt. Wir müssen natürlich ausgehen von dem, was uns bekannt ist. Deshalb ist es erforderlich, daß einer, der den Vortrag über das Sittliche und das Gerechte, überhaupt über die das staatliche Leben betreffenden Themata mit Erfolg hören will, ein Maß von sittlicher Charakterbildung bereits mitbringe. Denn den Ausgangspunkt bildet die Tatsache, und wenn diese ausreichend festgestellt ist, so wird das Bedürfnis der Begründung sich gar nicht erst geltend machen. Ein so Vorgebildeter aber ist im Besitz der Prinzipien oder eignet sie sich doch mit Leichtigkeit an. Der aber, von dem keines von beiden gilt, mag sich des Hesiodos Worte gesagt sein lassen:
Der ist der allerbeste, der selber alles durchdenket;
Doch ist wacher auch der, der richtigem Rate sich anschließt.
Aber wer selbst nicht bedenkt und was er von andern vernommen
Auch nicht zu Herzen sich nimmt, ist ein ganz unnützer Geselle.
Wir kehren nunmehr zurück zu dem, wovon wir abgeschweift sind. Unter dem Guten und der Glückseligkeit versteht im Anschluß an die tägliche Erfahrung der große Haufe und die Leute von niedrigster Gesinnung die Lustempfindung, und zwar wie man annehmen möchte, nicht ohne Grund. Sie haben deshalb ihr Genüge an einem auf den Genuß gerichteten Leben. Denn es gibt drei am meisten hervorstechende Arten der Lebensführung: die eben genannte, dann das Leben in den Geschäften und drittens das der reinen Betrachtung gewidmete Leben. Der große Haufe bietet das Schauspiel, wie man mit ausgesprochenem Knechtssinn sich ein Leben nach der Art des lieben Viehs zurecht macht; und der Standpunkt erringt sich Ansehen, weil manche unter den Mächtigen der Erde Gesinnungen wie die eines Sardanapal teilen. Die vornehmeren Geister, die zugleich auf das Praktische gerichtet sind, streben nach Ehre; denn diese ist es doch eigentlich, die das Ziel des in den Geschäften aufgehenden Lebens bildet. Indessen, auch dieses ist augenscheinlich zu äußerlich, um für das Lebensziel, dem wir nachforschen, gelten zu dürfen. Dort hängt das Ziel, wie man meinen möchte, mehr von denen ab, die die Ehre erweisen, als von dem, der sie empfängt; unter dem höchsten Gute aber stellen wir uns ein solches vor, das dem Subjekte innerlich und unentreißbar zugehört. Außerdem macht es ganz den Eindruck, als jage man der Ehre deshalb nach, um den Glauben an seine eigene Tüchtigkeit besser nähren zu können; wenigstens ist die Ehre, die man begehrt, die von seiten der Einsichtigen und derer, denen man näher bekannt ist, und das auf Grund bewiesener Tüchtigkeit. Offenbar also, daß nach Ansicht dieser Leute die Tüchtigkeit doch den höheren Wert hat selbst der Ehre gegenüber. Da könnte nun einer wohl zu der Ansicht kommen, das wirkliche Ziel des Lebens in den Geschäften sei vielmehr diese Tüchtigkeit. Indessen auch diese erweist sich als hinter dem Ideal zurückbleibend. Denn man könnte es sich immerhin als möglich vorstellen, daß jemand, der im Besitze der Tüchtigkeit ist, sein Leben verschlafe oder doch nie im Leben von ihr Gebrauch mache, und daß es ihm außerdem recht schlecht ergehe und er das schwerste Leid zu erdulden habe. Wer aber ein Leben von dieser Art führt, den wird niemand glücklich preisen, es sei denn aus bloßer Rechthaberei, die hartnäckig auf ihrem Satz besteht. Doch genug davon, über den Gegenstand ist in der populären Literatur ausreichend verhandelt worden.
Die dritte Lebensrichtung ist die der reinen Betrachtung gewidmete; über sie werden wir weiterhin handeln. Das Leben dagegen zum Erwerb von Geld und Gut ist ein Leben unter dem Zwange, und Reichtum ist sicherlich nicht das Gut, das uns bei unserer Untersuchung vorschwebt. Denn er ist bloßes Mittel, und wertvoll nur für anderes. Deshalb möchte man statt seiner eher die oben genannten Zwecke dafür nehmen; denn sie werden um ihrer selbst willen hochgehalten. Doch offenbar sind es auch diese nicht; gleichwohl ist man mit Ausführungen gegen sie verschwenderisch genug umgegangen. Wir wollen uns dabei nicht länger aufhalten.
Förderlicher wird es doch wohl sein, jetzt das Gute in jener Bedeutung der Allgemeinheit ins Auge zu fassen und sorgsam zu erwägen, was man darunter zu verstehen hat, mag auch einer solchen Untersuchung manches in uns widerstreben, weil es teure und verehrte Männer sind, die die Ideenlehre aufgestellt haben. Indessen, man wird uns darin zustimmen, daß es doch wohl das Richtigere und Pflichtmäßige ist, wo es gilt für die Wahrheit einzutreten, auch die eigenen Sätze aufzugeben, und das erst recht, wenn man ein Philosoph ist. Denn wenn uns gleich beides lieb und wert ist, so ist es doch heilige Pflicht, der Wahrheit vor allem die Ehre zu geben.
Die Denker, welche jene Lehre aufgestellt haben, haben Ideen nicht angenommen für diejenigen Dinge, bei denen sie eine bestimmte Reihenfolge des Vorangehenden und des Nachfolgenden aufstellten; das ist der Grund, weshalb sie auch für die Zahlen keine Idee gesetzt haben. Der Begriff des Guten nun kommt vor unter den Kategorien der Substanz, der Qualität und der Relation; das was an sich, was Substanz ist, ist aber seiner Natur nach ein Vorangehendes gegenüber dem Relativen; denn dieses hat die Bedeutung eines Nebenschößlings und einer Bestimmung an dem selbständig Seienden. Schon aus diesem Grunde könnte es keine gemeinsame Idee des Guten über allem einzelnen Guten geben.
Nun spricht man aber weiter vom Guten in ebenso vielen Bedeutungen wie man vom Seienden spricht. Es wird etwas als gut bezeichnet im Sinne des substantiell Seienden wie Gott und die Vernunft, im Sinne der Qualität wie wertvolle Eigenschaften, im Sinne der Quantität wie das Maßvolle, im Sinne der Relation wie das Nützliche, im Sinne der Zeit wie der rechte Augenblick, im Sinne des Ortes wie ein gesunder Aufenthalt, und so weiter. Auch daraus geht hervor, daß das Gute nicht als ein Gemeinsames, Allgemeines und Eines gefaßt werden kann. Denn dann würde es nicht unter sämtlichen Kategorien, sondern nur unter einer einzigen aufgeführt werden.
Da es nun ferner für das Gebiet einer einzelnen Idee auch jedesmal eine einzelne Wissenschaft gibt, so müßte es auch für alles was gut heißt eine einheitliche Wissenschaft geben. Es gibt aber viele Wissenschaften, die vom Guten handeln. Von dem, was einer einzigen Kategorie angehört, wie vom rechten Augenblick, handelt mit Bezug auf den Krieg die Strategik, auf die Krankheit die Medizin; das rechte Maß aber bestimmt, wo es sich um die Ernährung handelt, die Medizin, und wo um anstrengende Übungen, die Gymnastik.
Andererseits könnte man fragen, was die Platoniker denn eigentlich mit dem Worte »an sich« bezeichnen wollen, das sie jedesmal zu dem Ausdruck hinzufügen. Ist doch in dem »Menschen-an-sich« und dem Menschen ohne Zusatz der Begriff des Menschen einer und derselbe. Denn sofern es beidemale »Mensch« heißt, unterscheiden sich beide durch gar nichts, und wenn das hier gilt, so gilt es auch für die Bezeichnung als Gutes. Wenn aber damit gemeint ist, daß etwas ein Ewiges sei, so wird es auch dadurch nicht in höherem Maße zu einem Guten; gerade wie etwas was lange dauert deshalb noch nicht in höherem Grade ein Weißes ist, als das was nur einen Tag dauert. Größere Berechtigung möchte man deshalb der Art zuschreiben, wie die Pythagoreer die Sache aufgefaßt haben, indem sie das Eins in die eine der beiden Reihen von Gegensätzen einordneten und zwar in dieselbe, wo auch das Gute steht, und ihnen scheint sich in der Tat auch Speusippos angeschlossen zu haben.
Indessen, dafür wird sich ein andermal der Platz finden. Dagegen stellt sich dem eben von uns Ausgeführten ein Einwurf insofern entgegen, als man erwidert: die Aussagen der Platoniker seien ja gar nicht von allem gemeint was gut ist, sondern es werde nur alles das als zu einer Art gehörig zusammengefaßt, was man um seiner selbst willen anstrebt und werthält; das aber was diese Dinge hervorbringt oder ihrer Erhaltung dient oder was das Gegenteil von ihnen verhütet, werde eben nur aus diesem Grunde und also in anderem Sinne gut genannt. Daraus würde denn hervorgehen, daß man vom Guten in doppelter Bedeutung spricht, einerseits als von dem Guten an sich, andererseits als von dem was zu diesem dient. Wir wollen also das an sich Gute und das bloß zum an sich Guten Behilfliche auseinanderhalten und untersuchen, ob denn auch nur jenes unter eine einzige Idee fällt. Wie beschaffen also müßte wohl dasjenige sein, was man als Gutes-an-sich anerkennen soll? Sind es etwa die Gegenstände, die man auch als für sich allein bestehende anstrebt, wie das Verständigsein, das Sehen, oder wie manche Arten der Lust und wie Ehrenstellen? Denn wenn man diese auch als Mittel für ein anderes anstrebt, so wird man sie doch zu dem rechnen dürfen, was an sich gut ist. Oder gehört dahin wirklich nichts anderes als die Idee des Guten? Dann würde sich ein Artbegriff ohne jeden Inhalt ergeben. Zählen dagegen auch die vorher genannten Dinge zu dem Guten-an-sich, so wird man verpflichtet sein, den Begriff des Guten in Ihnen allen als denselbigen so aufzuzeigen, wie die weiße Farbe im Schnee und im Bleiweiß dieselbe ist. Bei der Ehre, der Einsicht und der Lust aber ist der Begriff gerade insofern jedesmal ein ganz anderer und verschiedener, als sie Gutes vorstellen sollen. Mithin ist das Gute nicht ein alledem Gemeinsames und unter einer einheitlichen Idee Befaßtes.
Aber in welchem Sinne wird denn nun das Wort »gut« gebraucht? Es sieht doch nicht so aus, als stände durch bloßen Zufall das gleiche Wort für ganz verschiedene Dinge. Wird es deshalb gebraucht, weil das Verschiedene, das darunter befaßt wird, aus einer gemeinsamen Quelle abstammt? oder weil alles dahin Gehörige auf ein gemeinsames Ziel abzweckt? oder sollte das Wort vielmehr auf Grund einer bloßen Analogie gebraucht werden? etwa wie das was im Leibe das Sehvermögen ist, im Geiste die Vernunft und in einem anderen Substrat wieder etwas anderes bedeutet? Indessen, das werden wir an dieser Stelle wohl auf sich beruhen lassen müssen; denn in aller Strenge darauf einzugehen würde in einem anderen Zweige der Philosophie mehr an seinem Platze sein. Und ebenso steht es auch mit der Idee des Guten. Denn gesetzt auch, es gäbe ein einheitliches Gutes, was gemeinsam von allem einzelnen Guten ausgesagt würde oder als ein abgesondertes an und für sich existierte, so würde es offenbar kein Gegenstand sein, auf den ein menschliches Handeln gerichtet wäre und den ein Mensch sich aneignen könnte. Was wir aber hier zu ermitteln suchen, ist ja gerade ein solches, was diese Bedingungen erfüllen soll.
Nun könnte einer auf den Gedanken kommen, es sei doch eigentlich herrlicher, jene Idee des Guten zu kennen gerade im Dienste desjenigen Guten, was ein möglicher Gegenstand des Aneignens und des Handelns für den Menschen ist. Denn indem wir jene Idee wie eine Art von Vorbild vor Augen haben, würden wir eher auch das zu erkennen imstande sein, was das Gute für uns ist, und wenn wir es nur erst erkannt haben, würden wir uns seiner auch bemächtigen. Eine gewisse einleuchtende Kraft ist diesem Gedankengange nicht abzusprechen; dagegen scheint er zu der Realität der verschiedenen Wissenschaften nicht recht zu stimmen. Denn sie alle trachten nach einem Gute und streben die Befriedigung eines Bedürfnisses an; aber von der Erkenntnis jenes Guten-an-sich sehen sie dabei völlig ab. Und doch ist schwerlich anzunehmen, daß sämtliche Bearbeiter der verschiedenen Fächer übereingekommen sein sollten, ein Hilfsmittel von dieser Bedeutung zu ignorieren und sich auch nicht einmal danach umzutun. Andererseits würde man in Verlegenheit geraten, wenn man angeben sollte, was für eine Förderung für sein Gewerbe einem Weber oder Zimmermann dadurch zufließen sollte, daß er eben dieses Gute-an-sich kennt, oder wie ein Arzt noch mehr Arzt oder ein Stratege noch mehr Stratege dadurch soll werden können, daß er die Idee selber geschaut hat. Es ist doch klar, daß der Arzt nicht einmal die Gesundheit an sich in diesem Sinne ins Auge faßt, sondern die Gesundheit eines Menschen, und eigentlich noch mehr die Gesundheit dieses bestimmten Patienten; denn der, den er kuriert, ist ein Individuum. / Damit können wir nun wohl den Gegenstand fallen lassen.
2.Kennzeichen und Erreichbarkeit der Eudämonie
Wir kommen wieder auf die Frage nach dem Gute, das den Gegenstand unserer Untersuchung bildet, und nach seinem Wesen zurück. In jedem einzelnen Gebiete der Tätigkeit, in jedem einzelnen Fach stellt sich das Gute mit anderen Zügen dar, als ein anderes in der Medizin, ein anderes in der Kriegskunst und wieder ein anderes in den sonstigen Fächern. Was ist es nun, was für jedes einzelne Fach etwas als das durch dasselbe zu erreichende Gut charakterisiert? Ist nicht das Gut jedesmal das, um dessen willen man das übrige betreibt? Dies wäre also in der Medizin die Gesundheit, in der Kriegskunst der Sieg, in der Baukunst das Gebäude, in anderen Fächern etwas anderes, insgesamt aber für jedes Gebiet der Tätigkeit und des praktischen Berufs wäre es das Endziel. Denn dieses ist es, um dessen willen man jedesmal das übrige betreibt. Gäbe es also ein einheitliches Endziel für sämtliche Arten der Tätigkeit, so würde dies das aller Tätigkeit vorschwebende Gut sein, und gäbe es eine Vielheit solcher Endziele, so würden es diese vielen sein. So wären wir denn mit unserer Ausführung in stetigem Fortgang wieder bei demselben Punkte angelangt wie vorher.
Indessen, wir müssen versuchen dieses Resultat genauer durchzubilden. Wenn doch die Ziele der Tätigkeiten sich als eine Vielheit darstellen, wir aber das eine, z.B. Reichtum, ein Musikinstrument, ein Werkzeug überhaupt, um eines anderen willen erstreben, so ergibt sich augenscheinlich, daß nicht alle diese Ziele abschließende Ziele bedeuten. Das Höchste und Beste aber trägt offenbar den Charakter des Abschließenden. Gesetzt also, nur eines davon wäre ein abschließendes Ziel, so würde dieses eben das sein, das uns bei unserer Untersuchung vorschwebt, und bildete es eine Vielheit, dann würde dasjenige unter ihnen, das diesen abschließenden Charakter im höchsten Grade an sich trägt, das gesuchte sein. In höherem Grade abschließend aber nennen wir dasjenige, das um seiner selbst willen anzustreben ist, im Gegensatze zu dem, das um eines anderen willen angestrebt wird, und ebenso das was niemals um eines anderen willen begehrt wird, im Gegensatze zu dem, was sowohl um seiner selbst willen, als um eines anderen willen zu begehren ist. Und so wäre denn schlechthin abschließend das, was immer an und für sich und niemals um eines anderen willen zu begehren ist.
Diesen Anforderungen nun entspricht nach allgemeiner Ansicht am meisten die Glückseligkeit, die »Eudämonie«. Denn sie begehrt man immer um ihrer selbst und niemals um eines anderen willen. Dagegen Ehre, Lust, Einsicht, wie jede wertvolle Eigenschaft begehren wir zwar auch um ihrer selbst willen; denn auch wenn wir sonst nichts davon hätten, würden wir uns doch jedes einzelne davon zu besitzen wünschen; wir wünschen sie aber zugleich um der Glückseligkeit willen, in dem Gedanken, daß wir vermittelst ihrer zur Glückseligkeit gelangen werden. Die Glückseligkeit dagegen begehrt niemand um jener Dinge willen oder überhaupt um anderer Dinge willen.
Das gleiche Resultat ergibt sich augenscheinlich, wenn wir uns nach dem umtun, was für sich allein ein volles Genüge zu verschaffen vermag. Denn das abschließend höchste Gut muß wie jeder einsieht die Eigenschaft haben, für sich allein zu genügen; damit meinen wir nicht, daß etwas nur dem einen volles Genüge verschafft, der etwa ein Einsiedlerleben führt, sondern wir denken dabei auch an Eltern und Kinder, an die Frau und überhaupt an die Freunde und Mitbürger; denn der Mensch ist durch seine Natur auf die Gemeinschaft mit anderen angelegt. Allerdings, eine Grenze muß man wohl dabei ziehen. Denn wenn man das Verhältnis immer weiter ausdehnt auf die Vorfahren der Vorfahren, auf die Nachkommen der Nachkommen und die Freunde der Freunde, so gerät man damit ins Unendliche. Doch davon soll an späterer Stelle wieder gehandelt werden.
Die Eigenschaft volles Genüge zu gewähren schreiben wir demjenigen Gute zu das für sich allein das Leben zu einem begehrenswerten macht, zu einem Leben, dem nichts mangelt. Für ein solches Gut sieht man die Glückseligkeit an; man hält sie zugleich für das Begehrenswerteste von allem, und das nicht so, daß sie nur einen Posten in der Summe neben anderen ausmachte. Bildete sie so nur einen Posten, so würde sie offenbar, wenn auch nur das geringste der Güter noch zu ihr hinzukäme, noch mehr zu begehren sein. Denn kommt noch etwas hinzu, so ergibt sich ein Zuwachs an Größe; von zwei Gütern ist aber jedesmal das größere mehr zu begehren. So erweist sich denn offenbar die Glückseligkeit als abschließend und selbstgenügend, und darum als das Endziel für alle Gebiete menschlicher Tätigkeit.
Darüber nun, daß die Glückseligkeit als das höchste Gut zu bezeichnen ist, herrscht wohl anerkanntermaßen volle Übereinstimmung; was gefordert wird, ist dies, daß mit noch größerer Deutlichkeit aufgezeigt werde, worin sie besteht. Dies wird am ehesten so geschehen können, daß man in Betracht zieht, was des Menschen eigentliche Bestimmung bildet