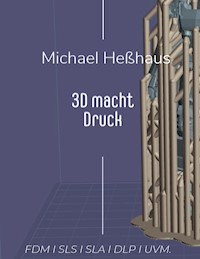Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Fear eats Light
- Sprache: Deutsch
"Noira" erzählt eine düstere, atmosphärisch dichte Geschichte, die tief in die komplexen Abgründe von Körper und Psyche eintaucht. Im Mittelpunkt stehen intensive Veränderungen, die mit inneren Konflikten und psychischer Zerbrechlichkeit verknüpft sind. Die Handlung verwebt spannende Thriller-Elemente mit einem Gefühl des Unbehagens und der Unsicherheit, wobei die Grenze zwischen Realität und wahrgenommener Wirklichkeit verschwimmt. Ohne zu viel zu verraten, führt "Noira" die Leser auf eine facettenreiche Reise durch Bedrohung, Verlust und das Ringen um Identität in einer Atmosphäre voller Spannung und beklemmender Eindrücke. Das Buch richtet sich an Leser, die sich für tiefgründige, psychologische Geschichten mit einem Hang zu Horror und intensiven Emotionen interessieren. Es ist eine Erzählung, die lange nachhallt und zum Nachdenken anregt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Erwachen
Stimmen
Namen
Labyrinth
Altar
Herz
Zerfall
Schatten
Abgrund
Erlösung
Rückkehr
Befreiung
Licht
Noira
Ramadi
Spalt
Riss
Zwischenraum
Abschied
ERWACHEN
Es gibt Tage, an denen das Grauen auf den Fußspitzen kommt, nicht als Blitzschlag, sondern als schleichende Verschiebung. Man fühlt sich, als wäre die Seele plötzlich zu nahe an die Haut gerückt, und alles ringsum schwingt, als hätte es Risse bekommen, in denen das Unbekannte lauert. Die Welt stimmt nicht mehr, und alles, was bleibt, ist das Wissen, dass etwas fehlt, ohne zu wissen, was. Kein Schmerz, keine Bilder – nur ein Zittern, das weiterkriecht, als hätte es keine Grenzen.
Ich öffnete die Augen, doch die Schwärze blieb. Kein Unterschied zu wach oder schlafend, nur eine Leere, die sich wie eine Haut eng um mich schloss. Ich wusste nicht, ob ich rief, ob ich atmete, ob mein Herz schlug. Ein dumpfer Schmerz – wie der Schatten eines Bruchs, weit hinten im Schädel. Die Kälte des Bodens zog mir das Leben aus den Gliedern, mein Atem schien zu laut, als hätte ich Angst, gehört zu werden. Vielleicht von mir selbst.
Ich bewegte die Finger, tastete durch Dreck und Stein, fand keinen Halt. Der Boden knirschte, feucht, modrig, mit einer Spur von Metall, die in meinen Mund kroch. An Blut erinnernd, aber ohne Gewissheit. Über mir hing die Decke, so tief, dass sie an meinem Scheitel klebte. Das Echo von Tropfen, irgendwo im Nichts. Der eigene Atem, der mir ins Gesicht zurückwabert.
Dann das Rascheln – kein Tier, keine Einbildung, vielleicht nur die Echos meines eigenen Hämmerns. Eine Bewegung, langsam, tastend. Nicht allein, nicht ganz. Eine Gestalt, verschwommen, zögernd, als würde sie sich prüfen, bevor sie glaubt, wach zu sein. Ihre Hand streckte sich mir entgegen, kühl, rau, suchend, und fand meine. Kein Wort, kein Blick, nur ein Druck, so leicht, dass ich ihn fast nicht wahrnahm. Ein Band aus Unsicherheit, das uns zusammenhielt, weil nichts anderes blieb.
Wir schwiegen, verharrten im Dunkeln wie zwei Echo in einem Brunnen. Die Fragen blieben zwischen uns stehen, ungesprochen. Wer bin ich? Wer bist du? Warum sind wir hier? Warum fragt niemand? Mein Kopf ein leeres Haus, in dem nur manchmal ein kalter Lufthauch durch die offenen Türen geht. Alles, was ich wusste, war, dass ich nichts wusste. Und dass allein schon das Gefühl, nicht allein zu sein, ein Anker war, der mir half, nicht ganz zu ertrinken.
Plötzlich riss eine Stimme die Stille auf – nicht laut, sondern eher wie eine feine Klinge, die durch Papier schneidet: „Bist du wach?“ Ich nickte, obwohl sie es nicht sehen konnte, spürte, wie ihre Hand in meiner zitterte, wie Angst sich zwischen uns ausbreitete. Ich wollte etwas sagen, aber meine Kehle war wie ausgedörrt, meine Stimme gab nur ein Krächzen zurück.
Mit letzter Kraft zog ich mich hoch. Jeder Muskel schmerzte, als hätte mich jemand geschlagen. Kälte überall, Feuchtigkeit, die durch die Lücken der Kleidung kroch. Die andere – eine Frau? Eher ein Mädchen. Ihre Augen fangen das schwache Licht auf, Pupillen im Zwielicht, unsicher, aufgerissen, suchend. Sie hält eine Taschenlampe, deren Licht so dünn ist, dass es fast nicht existiert. Es huscht über die Wände, moosüberzogen, uralt, eine Höhle aus Stein, die uns umschließt. Keine Fenster, keine Türen, nur zwei Gänge, die ins Unbekannte führen, und das leise Tropfen, das wie die Uhr eines Raums tickt, der uns vergessen hat.
Sie atmet stoßweise, bei jedem kleinen Geräusch zucken ihre Schultern. Sie ist zerbrechlich, aber in ihrem Blick steckt eine Kraft, die sie vielleicht selbst noch nicht kennt. Ich fühle ihre Unsicherheit, als wäre sie meine eigene, spüre, wie meine Gedanken schwer werden, voller Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Immer wieder das Kratzen, das irgendwo in der Finsternis kommt und geht, wie ein Warnsignal. Ich halte einen Stein fest, einen Stein, der mir Halt geben soll, obwohl ich nicht weiß, ob ich ihn jemals brauchen werde.
Sie klammert sich an mich, ihre Stimme kaum mehr als ein Hauch, als würde sie flüstern, ohne Stimme zu haben: „Wir müssen hier raus.“ Ich nicke, obwohl ich keinen Weg kenne, obwohl das Dunkel hinter uns zuwächst wie eine Wand. Wir stehen auf, ziehen uns gegenseitig hoch, stützen uns, wie zwei, die sich im Sturm beim Angeln an einer Klippe festhalten. Schritt für Schritt, immer tiefer in den Gang, immer weiter weg von dem, was wir hätten sein können.
Jeder Schatten scheint uns zu verfolgen, jedes Geräusch ein Hinweis auf etwas Unbekanntes, das wir nicht sehen. Ihr Schluchzen, beinahe unhörbar, schneidet mir ins Herz. Ich spüre die Angst, die zwischen uns wächst, als würde sie uns einwickeln und ersticken wie ein feuchtes Laken. Manchmal glaube ich, Stimmen zu hören, ein Flüstern aus den Wänden, Worte, die ich nicht verstehe, die wie eine Warnung klingen, aber vielleicht auch nur ein Trugbild sind. Das Herz pocht, die Luft ist schwer, als würde sie uns erdrücken.
Mit jedem Schritt wird die Dunkelheit dichter, kriecht in die Lücke zwischen uns, presst sich an unsere Haut. Die Kälte steigt, die Müdigkeit wird zur bleiernen Last, aber wir können nicht stehenbleiben. Irgendwo muss ein Ausgang sein, vielleicht ein Hinweis, ein Stück Erinnerung, das uns sagt, wer wir sind – oder waren.
Das leise Kratzen kommt und geht, ein Warnsignal, das keinen Namen hat. Ich mache die Finger locker um den Stein, löse mich wieder, lege ihn weg. Sie flüstert etwas, ein lautloses Wort, das ich nicht verstehe, aber es reicht, um zu wissen, dass Sie noch da ist, dass wir uns noch spüren, auch wenn die Dunkelheit uns auseinander zu reißen versucht.
Wir sind zwei Fremde, gefangen im Niemandsland zwischen Erinnerung und Vergessen, durch unsere Schwäche verbunden, durch unseren Willen, nicht aufzugeben. So zumindest fühlte ich es. Hinter der nächsten Biegung könnte alles anders sein – oder es bleibt, wie es ist, endlos, still, ohne Hoffnung. Ein Schauer läuft mir über den Rücken, als spüre ich, dass uns jemand beobachtet, ein dunkler Schatten, der uns folgt, als wäre er schon immer da gewesen.
Im Licht der Taschenlampe spiegeln sich ihre Augen, weit, dunkel, voller Leben, das sie nicht beherrscht. Es ist, als würde sie wissen, was ich nicht weiß, als hätte sie eine Ahnung, die sie mir nicht sagen kann.
Wir gehen weiter, Schritt für Schritt, vorbei an schimmerndem Wasser, das sich in Pfützen sammelt, an groben Steinwänden, die von Moos überzogen sind, durch Gänge, die sich endlos zu winden scheinen. Ich weiß nicht, wohin wir gehen, ob es einen Ausgang gibt, oder ob es überhaupt ein Ziel gibt. Aber wir müssen weiter, weil Stillstand schon Tod wäre. Immer wieder glaube ich, Stimmen zu hören, ein Flüstern aus dem Stein, fast unhörbar, fast wie ein Versprechen, das nie gehalten wird.
Das Band zwischen uns ist dünn, zerbrechlich, aber es hält. Die Angst begleitet uns, die Ungewissheit wird zu unserem Wegbegleiter. Vielleicht gibt es irgendwo ein Wort, das alles erklärt, ein Licht, das unseren Schatten vertreibt. Aber jetzt, in diesem Moment, bleibt uns nur eines: Schritt für Schritt zu gehen, immer tiefer in die Dunkelheit, und zu hoffen, dass das, was wir verlieren, nicht alles sein wird, was wir sind.
STIMMEN
Es gibt Stunden, in denen jede Stille anschwillt wie ein Fluss im Tauwetter. Dann werden Geräusche zu Gedanken und Gedanken zu Stimmen, die durch die eigenen Nerven geistern. In solchen Nächten wird Angst nicht von außen wachgerufen, sondern steigt aus dem eigenen Innersten, formt Echos, die sich nicht mehr von Wirklichkeit unterscheiden lassen. Wer geht, nimmt das Unbekannte mit – wer schweigt, hört es umso deutlicher.
Das fahle Licht der Taschenlampe gleitet zitternd über feuchte Steinwände, Schatten zucken, formen Fratzen, zerfallen, werden Teil der Tiefe. Es riecht nach Kälte, nach Moder, der unter der Haut bleibt. Die Stille ist so dick, dass jedes Geräusch zu schwer scheint: das leise Tropfen irgendwo vorn, das Stolpern dahinter, der fremde Atem an meinem Nacken, unregelmäßig, angespannt, fast so, als würde die Dunkelheit vor uns näher rücken, je mehr wir vor ihr fliehen.
Ihre Schritte sind kaum hörbar, doch ich spüre sie – ein Ziehen, ein unsichtbarer Faden, der sich von der Frau hinter mir um meinen Hals schlingt. Ihre Unsicherheit liegt wie Nebel im Gang, tastet sich aus, wird in jedem kleinen Griff in ihr Haar sichtbar: die Spitzen feucht, als hätte sie Angst geschwitzt, nicht Wasser aus der Luft aufgenommen. Einmal stolpert sie, ein lautloser Schrei, und ich bin sofort da, greife ihren Arm, spüre das Zittern, das die Dunkelheit provoziert.
„Es tut mir leid“, haucht sie, als wäre jede Silbe gefährlich. Die Dunkelheit hört zu, sie will kein Aufbegehren. Ich schüttele den Kopf – ein Zeichen, das sie wohl nicht sieht – und versuche, ein Lächeln zu formen, das sich in dieser Schwärze fremd anfühlt. „Wir schaffen das“, sage ich, doch selbst meine Stimme klingt, als spräche ich durch einen Filter aus alter Angst. Hoffnung verdampft an schwarzen Wänden, ehe sie den Mund verlässt.
Jeder weitere Schritt ist eine vorsichtige Machtdemonstration. Der Gang wird immer enger, der Sauerstoff dichter, als solle man durch jeden Atemzug ein Stück der eigenen Angst ausatmen. Sie hinter mir beginnt zu sprechen, zuerst leise, fast so, als müsse sie sich ihren Mut erst zuflüstern. Ihre Worte sind Erinnerungen – eine Kindheit unter Decken, Schatten, die nach ihr greifen, Geräusche, die größer werden, wenn man das Herz nicht mehr leiser bekommt.
Mit jedem Satz finden ihre Stimmbänder mehr Halt, jedes Bild wird zum Rettungsring: Geschichten, die Zuflucht bieten, während draußen kein Licht existiert.
Die Worte werden Teil von mir, legen sich wie ein Schal um meinen Nacken, wärmen einen Punkt, den ich fast vergessen hatte. Ich erzähle von meinem Vater, der Kälte, die ich erfuhr und die ich durch gefundene Wärme besiegte. Es ist fremd, Lichtfäden in die Finsternis zu werfen. Aber vielleicht braucht es genau das: sich gegenseitig Erinnerungen zu erzählen, bis aus Angst eine andere Form von Nähe wächst.
Plötzlich hält sie an, ihre Hand – klein, aber hartnäckig – hängt sich an meinen Ärmel, die Lampe tanzt in ihrer Faust, zeichnet Zickzackmuster ins Nichts. Ihre Augen bleiben an einem Punkt, den ich nicht erkennen kann, hängen. „Hast du das gehört?“ Flüsternd, aber scharf. Ich halte mein eigenes Atmen an, lausche: Tropfen, dann das Schaben, als würde etwas versuchen, durch den Stein zu kriechen. Mein Herzschlag rast, ihr Griff wird fester – ihre Angst wie ein Netz über meinem Brustkorb.
„Wir müssen weiter“, sage ich, aber auch meine Stimme ist jetzt dünn, flatterhaft, trägt nicht mehr. Wir hasten, das Licht taumelt über Stein, Schatten an den Wänden bewegen sich, als wären sie lebendig. Das Wispern wird zu einem Summen, das durch alle Ritzen zieht, feine Nadeln, irgendwo zwischen meinem Gehör und meinen Gedanken.
Sie zittert, ihr Atem überschlägt sich, klammert sich an meinen Arm, als könnte ich sie herausführen, als gäbe es dahinter mehr als nur die nächste Dämmerung. Ich erzähle weiter – Sonnenaufgänge, ein vertrautes Gesicht, Kaffee, Geräusche, die Hoffnung machen sollen, Gedanken aus einer anderen Welt. Meine Stimme wird zu einem Lied gegen das Zittern ihrer Finger.
Langsam lässt ihr Griff nach, ihre Atmung verlangsamt sich.
Ihr Blick fängt mich ein – da sind Dankbarkeit und Scham, eine Mischung aus „Ich habe Angst“ und „Bitte lass mich nicht los“. Sie sagt es schließlich leise, wie ein Geheimnis: „Ich habe Angst.“ Ich nicke, drücke ihre Hand. „Ich auch. Aber wir sind zusammen.“
Für einen Moment scheint das – wider alle Logik – zu genügen.
Unsere Schritte werden wieder gleichmäßiger. Die Dunkelheit bleibt, aber in ihrem Schlepptau sitzen jetzt zwei Stimmen, die einander Halt geben, wo vorher nur das Nichts war. Es ist keine Hoffnung, nur das Wissen: Ich bin nicht allein mit meinem Zittern.