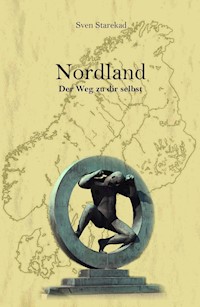9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Buch verbindet in einem spannendenden Abenteuerroman die atemberaubenden Eindrücke der nordischen Wildnis mit ihren Mythen und Legenden in authentischen Erlebnissen, die zu einer kritischen Reflexion unseres modernen Lebens anregen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sven Starekad
Nordland Auf vergessenen Wegen
Reiseaventüren eines Querdenkers.
Eine Revolte gegen die Moderne.
Impressum
Copyright 2022
Sven Starekad : „Nordland. Auf vergessenen Wegen. Reiseaventüren eines Querdenkers. Eine Revolte gegen die Moderne.“
Band 2: Finnland
Illustrationen: I.Lona, A.Toni, A.Melie
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN 978-3-347-87482-4(Softcover)
ISBN 978-3-347-87487-9 (Hardcover)
ISBN 978-3-347-87488-6 (eBook)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig.
Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen
Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Band 1
Schweden
Geheimnisvolles Königreich der Seen, Wälder und Schären
Band 2
Finnland
Stolzes Reich der hunderttausend Seen, Wälder und Weiten
Band 3
Norwegen
Sagenreiches Wikingerland zwischen Fjorden, Fjells und Faszination
Band 4
Die Färöer
Unentdeckte, sturmgepeitschte Inseln im Atlantik
Band 5
Island
Das Ende der Welt aus Feuer und Eis
Allen Edlen gebiet ich Andacht, Hohen und Niederen von Heimdalls Geschlecht.
Ich will Walvaters Wirken künden,
Die alten Geschichten,
Deren ich mich entsinne.
(Aus der Völuspa - Weissagung der Seherin)
Werde von der Lust getrieben,
Von dem Sinne aufgefordert,
Dass ans Singen ich mich mache,
Dass ich an das Sprechen gehe,
Dass des Stammes Lied ich singe,
Jenen Sang, den hergebrachten;
Worte schmelzen mir im Munde,
Es entschlüpfen mir die Töne,
Wollen meine Zung`entteilen…
(Aus der Kalevala)
Ich danke den Göttern, den Geistern und den Ahnen, die meine Hand beim Schreiben dieses Buches führten. Ich danke meiner Familie, meiner Frau, meinen Kameraden und der Natur in all ihren Erscheinungen durch die ich die Fährte meines Lebens finden und lesen lernte und die Spuren vergessener Wege wiederfand.
Band 2 Finnland
Stolzes Reich der hunderttausend Seen,Wälder und Weiten
Vorwort zum zweiten Band
Die allgemeine touristische Aufmerksamkeit, die Finnland entgegen gebracht wird, ist bei Weitem nicht mit der zu vergleichen, die Schweden oder Norwegen geschenkt wird. Ein Grund dafür liegt womöglich schon darin, das Finnland und das wird dich vielleicht überraschen, kulturell und sprachlich nicht zu dem allgemeinhin als vertrauter wahrgenommenen Skandinavien gezählt wird.
Bis heute scheint sich dieses Land irgendwie immer noch einer breiten öffentlichen Wahrnehmung zu entziehen. In jeder Hinsicht zu Unrecht wie ich finde, auch wenn ich diese Tatsache persönlich nie bedauert habe. Im Gegenteil, bei unseren Fluchten vor der Moderne und ihren sedierten Repräsentanten erwies sich das scheinbar unbegrenzte Reich der tiefgrünen Wälder, kristallklaren Seen und endlosen Weiten schnell als ein wahres Refugium, in das meine Jugendgefährten und ich viele Jahre immer wieder aufs Neue zurückkehrten.
Dass unsere Wahl nach all unseren schwedischen Reiseaventüren irgendwann auf Finnland fiel, hatte jedoch zunächst einen ziemlich banalen, vielleicht willkürlichen, obgleich aber mit einem Schlag uns alle überzeugenden Hintergrund. Dem zum Straßenatlas lesen verdammten Beifahrer war es mit zwei geöffneten Bierdosen in den Händen auf einer dieser brenzlig schaukelnden Fahrten mit akutem Achsenbruchrisiko über einen schwedischen Forstweg irgendwo im schwedischen Nirgendwo auf der Suche nach einer Gewässerannäherung für einen optimalen Zeltplatz langfristig unmöglich, gleichzeitig auch noch den Atlas mit aufgestützten Ellenbogen festzuhalten. Er musste sich, wohl deutlich früher als er erwartet hatte, plötzlich blitzschnell entscheiden, also folgte er instinktiv der inneren Vorgabe, dass das kostbare Hopfengetränk nicht verschüttet werden durfte. Auf dem Weg zum Fußraum fand der Atlas selbst eine von uns bisher unbeachtete Seite, die er uns nun nach dem Aufheben offenbarte.
Unser Blick fiel auf die mit Seen überzogene Landkarte des südlichen Finnlands. Hier schien es so viel Wasser zu geben, dass für Land kaum noch Platz war. Die ganze Seite war wie eine Einladung zu traumhaften Lagerplätzen an fischreichen Gewässern. Neugierig studierten wir alle Atlasseiten, die Finnland abbildeten, genauer. Mit in die grobe Maßstabsangabe getauchten Fingerlängen maßen wir ungefähre Entfernungen von der südlichen Küste zur riesigen finnischen Seenplatte bis hin zu den nordischen Hügellandschaften Lapplands nach. Die in Richtung Norden immer menschenleerer werdenden, unendlichen Weiten, die dieses Land versprach, waren schier unfassbar.
Wir waren sicher, hier musste es noch Wälder geben, die vielleicht noch nie zuvor von einem Menschen betreten worden waren, Landschaften, die seit ihrer Geburt unberührt vor sich hin träumten und Götter und Wesen, die unsere Zeit längst vertrieben hat.
Schon in diesem Moment der uns alle so sehr überraschenden Atlasoffenbarung wurden wir von der finnischen Seele in den Bann gezogen und ich glaube unsere Herzen hat sie nie wieder verlassen. Zu tief sollten die Eindrücke auf unseren Reisen durch dieses unvergleichlich urige Land werden, die dann in uns für ein ganzes Leben zurück blieben, zu tief gruben sich die Spuren ein, auf denen wir weiter zu uns zurück fanden.
Auch, jetzt noch, wo ich diese Zeilen schreibe, erfüllt mich eine tiefe Dankbarkeit für all die unvergesslichen Sommer, die ich in Finnland erleben durfte und für das, was sie aus mir gemacht haben.
Ich hoffe sehr, dass es mir auf den folgenden Seiten gelingen mag, dass auch dich die Strahlungskraft der finnischen Seele so sehr berührt und dich in deinem eigenen Leseabenteuer, die Spuren deines inneren Pfades weiter verfolgen und lang vergessene Wege wiederfinden lässt.
Maamme
Oi maamme, Suomi, synnyinmaa!
Soi sana kultainen!
Ei laaksoa, ei kukkula,
ei vettä rantaa rakkaampaa
kuin kotimaa tää pohjoinen.
Maa kallis isen.
Unser Land
O Heimat, Finnland unser Land
Kling laut du teures Wort!
Kein Land, so weit der Himmelsrand.
Kein Land mit Berg und Tal und Strand
Wird mehr geliebt als unser Nord,
Hier unser Väter Hort.
(Verse aus der finnischen Nationalhymne.
Schwedischer Originaltext von Johan Ludvig Runeberg, finnische Nachdichtung von Paavo Cajander)
Die zwei schönsten Dinge im Leben sind wohl die eigene Heimat und die erwanderte. Gibt die eigene Scholle uns von jeher Erdung und Halt, kann uns eine Reise die Möglichkeit geben, Gewohnheiten und Lebensweisen grundlegend zu überdenken, vielleicht sogar zu überwinden. Dann kehren wir als veränderte Menschen zurück.
Alle unsere Abenteuer im Norden haben uns auf eine sehr intensive Art und Weise spürbar verändert und ich glaube heute zu wissen, warum das so war. Sie führten uns immer wieder, aber jedes auf seine Weise zurück, zurück in ein Leben, von dem es in unserer Heimat nur noch eine blasse Erinnerung gibt.
Ich habe das gedanklich erst Jahrzehnte später erfasst, niemand von uns hatte seinerzeit je hinterfragt was hinter dieser gewaltigen Stimme stand, die meine Gefährten und mich immer wieder so unnachgiebig in den Norden rief. Niemand hatte ihn in all den Jahren je ausgesprochen, niemand seine unbändige Antriebskraft ergründen müssen und doch verband er uns alle, der sehnsüchtige Wunsch nach einem freien Leben in ursprünglicher Natur. Je unangetasteter diese war, desto attraktiver erschien sie uns. Der finnische Teil Nordlands ließ uns nun auf genau diesen Zufluchtsort hoffen.
Unsere Erwartungen sollten sehr schnell sogar noch übertroffen werden. Finnland schien tatsächlich all unsere lang gehegten Träume und wildromantischen Sehnsüchte zu erfüllen. Die südliche, noch eher dünne Bewaldung zwischen Kultivierung und Straßenverkehr wich sehr schnell ausgedehnten Riesenwäldern. Mit der Abnahme der Laubgehölze zugunsten der Nadelbäume wurden die Waldgebiete immer größer und dichter und die Landschaft immer einsamer. Beide Erscheinungen beruhen auf Hintergründen, die das Land der Sumpfmenschen, wie Tacitus es in seiner „Germania“ erstmals gegen Ende des 1.Jahrhunderts bezeichnet, vielleicht so einmalig machen. „Suomi“, der finnische Name des Landes, der wörtlich übersetzt tatsächlich Sumpf bedeutet, mochte wohl schon zu Zeiten der alten Römer und Germanen ein deutlicher Verweis auf die weitgehende Unberührtheit und Undurchdringlichkeit der Natur zwischen Finnischem und Bottnischem Meerbusen und dem noch lange Zeit weitestgehend unbekannt gebliebenem Lappland nördlich des Polarkreises gewesen sein.
Es ist kaum zu glauben, aber diese natureigene Ursprünglichkeit ist in weiten Teilen des Landes, als hätte sie sich weitere zweitausend Jahre der Zeit entzogen, bis in unsere Gegenwart erhalten. Finnland gehört immer noch zu denen am dünnsten besiedelten Ländern Europas und ist bis heute das dicht bewaldeste Land auf dem europäischen Kontinent. Auf einer Fläche, die etwa so groß ist wie die Bundesrepublik, leben gerade einmal um die fünf Millionen Einwohner und davon weit über die Hälfte in den Städten. Zudem konzentriert sich die Besiedlung des mit Abstand größten Bevölkerungsanteils fast ausschließlich auf den Süden und die Westküste. Zwei Drittel dieses nordischen Idylls besteht aus Wald, wobei man nicht der Annahme verfallen darf, dass das übrige Drittel menschlich geschaffenes Kulturland darstellt. Man denke nur an die langen Küstenstreifen im Süden und Westen, an die, einer Zählung zufolge schier unglaubliche Anzahl von sage und schreibe 187 888 Seen sowie an die schroffen Erhebungen vor allem im Nordwesten von bis zu 1000 Metern und an die überaus ausgedehnten Sumpflandschaften Lapplands, die von Natur aus eher waldarm sind.
Nun, wo ich versuche, die mir so wahnsinnig schwer fallende Wahl zu treffen, von welchen besonders beeindruckenden Erlebnissen und atemberaubenden Gegenden in Finnland ich dir als Leser berichten soll und welche Stationen all unserer Reisen ich wohl oder übel aussparen muss um den Rahmen dieses Bandes nicht zu sprengen, übermannt mich noch einmal, obwohl es mittlerweile so viele Jahre her ist, dass wir dieses Land wohl über alle seine Längen- und Breitengrade bereisten, in allen fühlbaren Tiefen meines Innersten, diese weite ursprüngliche Wildnis dieses Landes.
Auf der jetzt vor mir liegenden, in drei ungleich große Teile zerrissenen Autoilijan Tiekartta (Straßenkarte) von damals, zu deren Anschaffung wir uns irgendwann gezwungen sahen, nachdem der Atlas mit dem alles begann, uns zu oft in wahre Sackgassen geführt hatte, die einfach irgendwo im Nirgendwo endeten, uns aber mit seinem großzügigen Maßstab immer wieder Glauben gemacht hatte, von dort Anschlussstraßen zu erreichen, spüre ich, wie die Vergangenheit noch einmal zu mir zurückkehrt und die finnische Seele mich wieder ganz und gar ergreift.
Es fühlt sich gut an, so gut, dass ich anfange über der zerrissenen Karte zu träumen, es mich hinfort reißt in eine Welt, die mit jedem Zentimeter, den ich mit dem Finger auf der alten Straßenkarte weiter nordwärts wandere, wilder und rauer wird. Hinter mir versinken nach und nach die südlichsten Städte, schon bald darauf im Südosten sprengen tausende Seen das Land. Das Straßennetz wird weitläufiger und weitläufiger, bereits in Mittelfinnland umarmen mich die riesigen Wälder. Meine Erinnerungen tragen mich wieder über den Polarkreis und dann als die Verkehrswege und Besiedlungen auf der Karte sich vollends in einer Weite aus Flüssen, Seen und Wäldern verlieren, fühlt es sich für einen kurzen Moment wieder so an wie einst. Bevor mich eine traurige Sehnsucht heimsucht, spüre ich, wie eine tiefe, fast vergessene Glückseligkeit mich berührt, als mich mein Traum fest daran glauben ließ, ich wäre wieder kotitaloon (fin.zuhause).
An dieses Gefühl der Geborgenheit, eine Heimat in Freiheit gefunden zu haben, kann ich mich noch sehr gut erinnern. Es erfasste meine Gefährten und mich schon am Tag unserer Ankunft als wir bei Ristiina in die südöstliche finnische Seenplatte eintauchten. Die Atlasoffenbarung hatte ja in uns allen kühne Erwartungen produziert, aber niemand von uns hatte es bei dem Anlegen unserer Fähre in Helsinki für möglich gehalten, dass wir bereits so weit südlich auf so ausgedehnte freie Natur treffen würden.
Unsere Erfahrungen in Schweden für das Finden eines optimalen Lagerplatzes ließen uns gedanklich die Strategie wieder aufnehmen, kleinere Nebenstraßen abseits der großen Verkehrsstraßen auf der Karte auszukundschaften, die möglichst lange und dicht an Gewässern vorbeiführten. Das war hier nicht besonders schwer. Jede Straße durch die größte Seenplatte Europas führt früher oder später an einem Gewässer vorbei, viele enden auch einfach an einem der zahllosen Ufer. Darüberhinaus sind die wirklich großen Verkehrsstraßen wirklich überschaubar und es findet sich alle Nase lang eine mögliche Abfahrt auf eine kleine Nebenstraße, die einen tief in die Seenlandschaft hineinbringt. Hier stellte sich aber alsbald ein ganz anderes Problem, mit dem wohl auch niemand von uns gerechnet hatte. Es begründet sich und das kommt mir heute wie eine Ironie des Schicksals vor, in der weiten Unberührtheit der Natur, die wir uns so sehr gewünscht hatten, selbst. Wir folgten den Klein- und Kleinststraßen, die sich an den hunderten Seen vorbeischlängelten. Hin- und wieder waren wir sogar relativ sicher, den einen oder anderen Verkehrsweg, auf dem wir gerade fuhren, auf unserer Autokarte wieder gefunden zu haben. Wir konnten also in jeder Sekunde berechtigt darauf hoffen, dass sich ein Gewässer direkt vor unseren Augen auftat. Da führte eigentlich gar kein Weg daran vorbei. Aber da war nichts! Immer weiter tauchten wir in das riesige Seengebiet ein, aber nirgends gab es einen See!
Mit dem Kompass nordeten wir unsere Karte noch einmal neu ein. Danach erschien alles nur noch rätselhafter. Etliche bereits befahrene Straßen hätten uns längst immer und immer wieder ans Wasser führen müssen und jetzt, vorausgesetzt unsere erwogene Position stimmte, aber daran gab es durch die klar zu lokalisierende Straßenkreuzung vor uns eigentlich keinen Zweifel, hätte sich ein weitläufiger Teil des nördlichen Saimaa-Seengebietes direkt vor uns zeigen müssen. Aber hier war nur Wald. Wald so weit das Auge reichte und das reichte nicht besonders weit, denn die Bäume bildeten in einer breiten Ebene ohne nennenswerte Erhebungen schon die ganze suchende Erkundungsfahrt über eine dichte Mauer, die das Auge einfing und einen Überblick über weite Distanzen zu keinem Zeitpunkt zuließ. Wir mussten an etlichen Seen bereits vorbei gefahren sein, ohne auch nur einen von ihnen zu Gesicht bekommen zu haben. Mit einem Schlag wurden wir alle gleichsam an eine vor allem aus dem wilden Norden Schwedens vertraute Erinnerung zurückgeholt. Wenn das Erlebnis von einer unberührten Wildnis auch hier so dicht vor der Nase lag, gab es es eben doch nicht geschenkt. Auch hier musste es hart erkämpft werden. Das hieße hier wohl erst einmal sich mit dem Lagergepäck durch das dichte Unterholz und Sümpfe kämpfen zu müssen um in den Genuss kommen zu können, das sehnlichst erhoffte Ufer eines Wassers überhaupt sehen oder gar betreten zu können.
Nach all den Seen, die wir nie gesehen hatten, obwohl wir laut Karte so dicht an ihnen vorbei gefahren waren, glaubte keiner unserer Gefährten mehr daran, dass es Sinn machen würde, den Straßen in der Hoffnung auf einen bequemeren Zugang vielleicht noch bis in die Nacht zu folgen. Wir erinnerten uns, dass wir auch in der unberührten Natur Nordschwedens die allerschönsten Lagerplätze immer erst nach einer beschwerlichen Wanderung gefunden hatten. Insofern glaube ich, wurde schon die erwartete Herausforderung bereits unseres ersten Aufenthaltstages in Finnland sehr schnell zu einem außerordentlichen Motivationsschub, der wohl dafür verantwortlich war, dass das für nötig befundene Lagerinventar, einige Vorräte und natürlich unser Angelgeschirr in Windeseile in den Rucksäcken verstaut worden waren. Das Einschnüren meiner Schultern durch die Rucksackriemen und die ersten behäbigen Schritte unter der Last des Gepäcks ließen die vermisste Vertrautheit eines ganz bestimmten Schmerzes sofort zurückkehren.
Das im Takt seines Ganges klappernde, noch vom Ruß tiefschwarz eingefärbte Kochgeschirr meines Vordermannes holte mich zurück in die Erinnerungen an unsere Reisen durch Schweden, an all die Lagerfeuerabende, und quälende Hungertage, die mich so vieles gelehrt hatten.
In einem tiefen Atemzug mit geschlossenen Augen durchströmten sie mich wieder, die tausenden unvergleichlichen Gerüche des Waldes, die Aromen der Lebenskraft und der Heilung. Den letzten Meter der befestigten Straße hatte ich verlassen, keinen Blick ließ ich zurück. Der Weg vor mir wurde schwieriger und trotzdem leichter. Der Rucksack war schwer und doch hatte ich keine Last mehr auf den Schultern. Die Ketten der scheinbaren Abhängigkeiten und Notwendigkeiten unseres Alltags hatten sich wieder begonnen von meiner Seele zu lösen. Mein Geist fing langsam an, das zurückgekehrte freie Bewusstsein zu erfassen und schwang sich auf, die Grenzen des Sichtbaren zu durchbrechen und meinem Innersten die Gabe des Sehens zurückzubringen. Mein verblichenes Gemüt fand in all seine Farben zurück. Der Nihilismus trüber Tage wich einem fatalistischen Frohsinn. In den mächtigen Wurzeln vor mir erkannte ich sie wieder, die uralte Erdung in mir, die so viel älter war als ich selbst. In diesem Moment spürte ich wie sie in meinen Adern empor stieg, die archaische Kraft, die mich wieder selbst fühlen und atmen ließ. Erdgeister aus tiefen Mooshöhlen stiegen zu mir auf, schlafende Dämonen wurden in mir wach. Eine Lebensrune aus auferstandenem menschlichen Fleisch und Blut streckte ihre Arme dankbar in den Kronenhimmel. Aus seinen verzweigten Ästen glaubte ich, selbst zu mir herunter zu sehen und ich erkannte in mir den alten Vertrauten mit dem alten Glanz in den Augen, ohne den es in der Kälte der Entbehrung unter dem Schutt unserer Zeit so schrecklich einsam geworden war. Jetzt aber war ich glücklich, denn ich wusste, wir waren wieder heimgekehrt und zwar mit Leib und Seele!
Es brauchte sicher wieder einige Tage bis wir ganz und gar in den Rhythmus eines glücklichen Lebens in der freien Natur zurück fanden, wir unsere sinnlosen Gewohnheiten abgelegt hatten, Entbehrungen und ungewohnte, alles uns abfordernde Kraftanstrengungen über jeden Zweifel unseres Tuns erhaben waren, aber jetzt mit den ersten Schritten auf dem Waldboden war ich mir gewiss, dass wir dorthin zurückfinden würden.
Sehr bald würden wir wieder aus dem Weltzeitwinter unseres Alltags heraustreten und uns wiederfinden. Das Tor hatte sich schon jetzt geöffnet.
Dankbar war ich den Göttern, dass sie uns in dieses Land geführt hatten. Nirgendwo anders in Nordeuropa konnte man wohl so schnell den kultivierenden Spuren menschlicher Zivilisation entfliehen. Selbst wenn man an der südlichen Küste Finnlands anlandete, wie wir mit unserer Fähre in Helsinki, musste man sich nicht tagelang durch eine nicht abreißende umklammernde Urbanität und traurig zusammen geschrumpfte, entseelte Reste ursprünglicher Natur kämpfen – hier offenbarte sich die unberührte Wildnis bereits am Anreisetag. Zumindest wenn man von Helsinki gen Saimaa reist, lohnt es kaum auf der Fahrt dorthin, die dritte Dose Bier zu öffnen, so schnell ist man an einem Ausgangspunkt, von dem man eine aussichtsreiche Flucht in die seenreiche Natur antreten kann.
Genau diese Erwartung trieb auch uns vom ersten Moment an, als wir hier in die Wildnis aufgebrochen waren. Unsere Schritte über moosüberwucherte Steine aber führten uns erst einmal eine ganze Zeit lang weiter und weiter in einen dichten, dunklen Wald hinein. Die Nadelkleider der Bäume verschlossen den Himmel zunehmend bereits in den Höhen über uns. Schon bald ließen sie nur schwaches, schattiges Restlicht auf die Erde fallen. Nicht einmal ein Lichtkegel in weiter Ferne ließ auch nur ansatzweise unsere feste Annahme, doch jede Minute auf einen See stoßen zu müssen, berechtigt erscheinen. Erste Zweifel wurden laut und ich glaube, die waren auch dafür verantwortlich, dass mein Vordermann mit dem klappernden Kochgeschirr plötzlich ins Taumeln geriet.
Die permanent zurückpeitschenden Ästen vor ihm, die er nun wohl das dritte Mal in der vollen Breitseite durchs Gesicht gezogen bekam, hatten ihn jetzt, da die Zweifel ihn anfingen zu übermannen, zu einem ungehaltenen Fluchen veranlasst.
Zu lang war wohl für ihn die Zeit gewesen, in der wir die Eigenarten des Lebens in der Zivilisation und mit ihr ihre schreckliche Ungeduld, die uns immer wieder den Blick für das Wesentliche stiehlt, unweigerlich annehmen mussten, um ihn ihr zu überleben. Ihre Saat war so tief in ihm aufgegangen, dass er kaum noch zurückfand und schon jetzt nach wenigen Metern in dem unwegsamen Gelände seine dringlich benötigte Konzentration auf das, was unmittelbar vor ihm lag, durch selbstbemitleidende Frustration ersetzte. Das war für ihn wahrhaft fatal, denn bald schon konnte er sich dem festen Griff einer aus dem Boden herausgreifenden Wurzelhand nicht mehr entziehen. Über seinem Kopf schepperte während seines unbeholfenen Fallens das Kochgeschirr zusammen. Die sich von ihrer Rucksackbindung gelöste, rußgefärbte Bratpfanne, die die Finger in ein tiefes, hartnäckiges Schwarz hüllten, sobald man sie berührte, nahm sich jedoch noch ein wenig Zeit mit ihrer Landung. Erst als der gefallene Gefährte in voller Länge vor uns lag, schlug sie nach einem beachtlichen Flugbogen mit einem auffällig dumpfen, hohlen Klang auf dem Hinterkopf eines tief im Moos vergrabenen Gesichtes ein.
Sekunden einer beunruhigenden Regungslosigkeit verstrichen. Dennoch konnte sich irgendwie niemand so recht durchringen, sich seines so aufwendig aufgeladenen Gepäcks zu entledigen und sich zum so schmerzhaft Gestürzten herunter zu bemühen. Andererseits wollte wohl auch niemand, wenn es nicht unbedingt sein musste, die erhebliche Kraftanstrengung auf sich nehmen, sich mit der aufgeschnürten Last herunter zu knien um sich dann ebenso mühevoll wieder aufzurichten. Vielleicht würde der noch immer bewegungslos vor uns Liegende auch allein wieder auf die Beine kommen und dann wären ja all die Mühen vergebens gewesen.
Die Gesichter um mich herum ließen mich annehmen, dass alle in dieser Abwägung ausharrten und erst einmal abwarteten, dass ein anderer die Initiative ergriff. Das tat aber immer noch niemand. Die Möglichkeit, dass sich alsbald alle Besorgnis ohne eigene Mühen auflösen würde, wurde wohl noch für zu wahrscheinlich eingeschätzt. „Man, dachte ich, waren wir doch nach knapp einem Jahr in der Bequemlichkeit der Zivilisation bequem geworden“ und ich konnte mich selbst von dieser erschreckenden Erkenntnis nicht ausnehmen. Noch immer in einem regungslosen Warten festgehalten, verloren sich meine Gedanken in dem, was mich umgab. „Wie stark musste der Lebenswille der kleinen Sprösslinge, die überall aus dem Waldboden emporstiegen und mir hier und da gerade so bis an das Knie reichten sein, wie groß ihre Mühen sich zu behaupten, wohlwissend das sie bei der verdunkelnden Kronenmacht über ihnen, einen schier aussichtslosen Kampf ums Licht führten. Die Kinder dieses Nadelwaldes waren schon allein zu bewundern für ihren unbrechbaren Willen zum Leben.“
Zwei ineinander verwobene Kiefern vor uns hatten diesen Überlebenskampf auf die Spitze getrieben. Er hatte sie riesig werden lassen, weit überragten sie die anderen Bäume. In ihrem Schatten hatten sie einen fast vegetationslosen Kreis entstehen lassen. Ein plötzliches tiefes Rumoren der mächtigen Stämme aus einer aufgefangenen, für uns nicht spürbaren Windböe, ließ uns aufhorchen, unser stilles, regungsloses Warten durchbrechen, unsere Blicke vom Boden abwenden und in die schwankenden Kronen schauen. Aus den ächzenden Höhen fiel ein befreiendes Lied auf uns herab, ein eigentümliches Singen von Lebensfreude und Zuversicht, das alle Gedanken an die beschwerliche Wanderung durch den dichten Wald zerstreute.
Wohl nur ein Singschwan war im Stande einen so ausdrucksstarken Gesang mit so einem charakteristischen Wiedererkennungswert von sich zu geben. Die alten Lieder vor unserer Zeit erzählen, dass einst der Mensch die Kunst der Dichtung in seinem Gesang gefunden hat. Die Töne des Wasservogels, die so unbeschwert in das Innerste eindringen, legen diese Vermutung wirklich nahe.
Erst kurze, stoßartige, dann längere schrille, aber dennoch sanfte, zerbrechliche und gleichsam kraftvolle Schreie verbanden sich in einem vorbei fliegenden Moment zu einer Melodie von tief bewegender Harmonie, die in einer zurückkehrenden Stille wieder verebbte.
Das nachwehende Lied von nun klar bestimmbarer Wassernähe hatte den gefallenen Zweifler erweckt. Plötzlich stand er wie ausgewechselt hinter uns. Zwischen feuchten, breitflächigen Moosanhaftungen war ein erwartungsfrohes Lächeln und in seine Augen die alte Entschlossenheit zurückgekehrt. Jetzt, da wir den Schwan so deutlich gehört hatten, waren wir sicher, dass es nicht mehr weit sein konnte, zu unserem sehnlichst erwarteten See und mit ihm zu einem Lagerplatz, der uns vom ziehenden und zerrenden Gepäck befreien würde.
Der dirkäische Wasservogel hatte uns nicht betrogen, tatsächlich durchströmte uns eine angenehm kühle Seeluft bereits nach wenigen hundert Metern. Von einem auf den anderen Schritt löste sich ganz plötzlich der Wald und mit ihm sein dichtes Dunkel auf. An seine Stelle war ein morastiger, mit Schilf überwucherter Untergrund getreten in dem man sofort, wenn man Glück hatte, nur bis zu den Knöcheln versank. Ohne Frage, wir hatten Wasser gefunden, aber ein See war nicht zu sehen. Vielleicht befand er sich hinter der riesigen Schilfwand vor uns, aber das ließ sich nur vermuten, da dort ganz offensichtlich das Sonnenlicht ungehindert in eine Freifläche ohne Wald vordringen konnte, die von diesem Schilf begrenzt wurde, dass aber eben jeden Einblick verwehrte. Entschieden kämpften wir uns weiter und weiter auf eine Kiefer zu, die aus der dichten Ufervegetation herausragte. Sie war der einzige Baum, der es gewagt hatte aus seinem angestammten Territorium herauszutreten und dabei über viele Jahrzehnte sogar überraschend erfolgreich im nahezu aussichtlosen Überlebenskampf in der Wasserwelt gewesen war. Vor Jahren hatte aber wohl auch sie ihr jähes Ende finden müssen. Aus der Ferne sah es aus, als sei sie in einem, entwurzelndem, todbringenden Fallen erstarrt. Sie schien uns ein geeigneter, obgleich auch einziger Orientierungspunkt bei dem Durchwandern des weiten und hohen Vegetationsgürtels zu sein. Ich glaube, sie selbst war es auch, die uns antrieb, den unwirklichen Weg durch die meterhohe Schilfwand überhaupt anzutreten.
Schon bald reichte uns das Wasser bis zum Knie, kurz darauf bis zur Hüfte und schließlich bis zur Brust. Unsere ausgemachte Orientierungshilfe war spätestens zu diesem Zeitpunkt selbst für den Größten von uns im übermannenden Schilfwald nicht mehr zu sehen. Unsere schweren Rucksäcke trugen wir mit erhobenen, stützenden Armen auf dem Kopf. Die Last drückte uns mit jedem Meter tiefer in den nachgebenden Untergrund. Schließlich stand uns das Wasser bis zum Hals. Als ich mich noch einmal umsah, wurde mir klar, dass diese Höhenangabe des Wasserstandes doch eher ein allgemein angenommenes Durchschnittsmaß war. Unterschiedliche Körpergrößen und gewichtsbedingte Einsinktiefen mochten die Eintauchtiefe wohl erheblich variieren, wie ich an meinem doch eher begrenzt in der Höhe gebauten, aber dafür recht beleibten Gefährten, der sich hinter mir durch die Schilfwand kämpfte, beobachten konnte. Hin und wieder waren nur noch zwei Hände zu sehen, die in einem unsicheren Wanken einen Rucksack durch den Bewuchs pressten und ihn über der Wasseroberfläche tanzen ließen.
Ich kann heute gar nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, was uns immer tiefer und tiefer in den undurchdringlichen Schilfwald hineintrieb, spätestens als wir nahezu in ihm versanken, war es doch offensichtlich, dass das offene Wasser des vermuteten Sees für uns unerreichbar war.
Wenn ich jetzt zurück in die Bilder meiner Erinnerung finde, glaube ich auch, dass es eigentlich nahezu unmöglich gewesen ist, diese Wand aus dichtem, kräftigen Schilf mit so einem hohen Wasserstand, einem derartig nachgebendem Gewässergrund und dieser schweren Gepäcklast über eine so weite Distanz von mehreren hundert Metern in weitgehender Orientierungslosigkeit zu überwinden, aber irgendetwas gab uns damals so viel Kraft und Selbstvertrauen, dass kein Gedanke an eine Kapitulation aufkommen konnte.
Vielleicht war es das kaum hörbare, zarte Anschlagen der seichten Wellen an fernes Land, das uns Zuversicht gab, vielleicht kämpften wir aber auch einfach immer weiter, gerade weil jeder Schritt immer beschwerlicher wurde. Niemand spürte eine Lähmung seines Vorankommens, niemand die Wunden des schneidenden Schilfes in den Händen, aber wir fühlten wieder uns selbst.
Vielleicht war es tatsächlich die von der einsamen Kiefer inspirierte und auch einst von ihr gehegte Hoffnung auf eine bewohnbare Insel oder auf ein unberührtes, festes Ufer, die uns vorantrieb, aber heute kommt es mir so vor, dass unsere Lebenskraft und unser Drang, das Leben wieder in Muskeln und Fleisch zu spüren, so groß wurden, dass sie die Frage, in welchen zielorientierten Dienst sie gestellt werden sollten, ganz und gar verwarfen. Was so vorsichtig mit dem ersten Schritt im sumpfigen Wasser begann, hatte wieder eine alte Sehnsucht geweckt, die jetzt so stark in uns belebt worden war, dass wir jeden Gedanken an eine unmittelbare Zweckrationalität verloren und dadurch die Grenzen des körperlich Möglichen mit einer wiedergefundenen Leichtigkeit sprengten. Das Ziel war schon fast belanglos, aber der Weg sehnsuchtserfüllend geworden.
Auf einmal verfestigte sich der Untergrund, das dichte Schilf wurde lichter. Jeder Schritt hob uns ein kleines Stück weiter aus dem Wasser. „Aah, verdammt!“, ein lautes Platschen hinter mir erinnerte daran, wie glitschig der braun bealgte Stein unter uns war. „Oh ne nä, das gibt’s doch nich, verdammt noch mal“, fluchte es erneut hinter mir.
Das unkontrollierte Fallen meines kürzer geratenen Hintermannes hatte nun auch den von ihm über die ganze Watstrecke mit allergrößte Mühe trocken gehaltenen Rucksack ins nasse Element gezogen.
Ich kann nicht leugnen, dass eine gewisse Schadenfreude in mir aufstieg, bevor sie sich jedoch noch in einem Schmunzeln entladen konnte, erstickte sie in einem kurzen Erschrecken meines eigenen Ausrutschens. Es dauerte dann nur noch Sekunden bis wir uns alle mit ein- oder abgetauchter Gepäcklast wieder im Wasser einfanden.
Der Kontakt mit dem Felsen unter uns war nach dem Fallen offensichtlich recht unterschiedlich hart ausgefallen, doch irgendwann kehrte das Lachen auch in das schmerzverzerrteste Gesicht zurück. „Nicht ist so schön, als wenn der Schmerz nachlässt“, hörte ich es hinter mir murmeln. Seinen schwimmenden Rucksack mit einer vor sich hin blutenden Hand wieder einsammelnd, hörte ich mein Gegenüber antworten:„Nichts ist für die Ewigkeit“. Amüsiert musste ich darüber nachdenken, ob diese Rezitation eines gleichnamigen Musiktitels einer von uns damals noch sehr geschätzten, nonkonformen Musikgruppe, der ihm da wohl in den Sinn gekommen war, tatsächlich als eine Erwiderung gemeint war oder aber auf das bezog, was von seiner eigenen Hand übrig geblieben war.
Man sah davon ab, den sich aus dem Wasser schiebenden Felsen noch einmal zu beschreiten. Er konnte nur Stück für Stück robbend erklommen werden. Mit der schweren Last von vollständig durchtränkter Kleidung und Gepäck war das jedoch ein äußerst mühevolles Unterfangen.
In den Augen des Singschwans, der hier ja noch irgendwo sein musste, mochten unsere Bemühungen wohl doch sehr abenteuerlich ausgesehen haben. Vielleicht hegte dieser mit den Gegebenheiten der Seeufer so vertraute Wasservogel sogar ein wenig Mitleid in diesem sich ihm offenbarenden Bilde des Menschen von einem evolutionären Totalausfall. „Welch unbeholfene, unfähige Kreatur, die in keiner Region der Erde überleben kann, ohne sie umzugestalten. Und nun kriecht sie an deinem Ufer entlang, unbeweglich wie ein nasser Sack, die Menschlichkeit, die sich selbst zur Krone der Schöpfung erhoben hat.“ Als hätte der Schwan meine Gedanken gelesen, als wolle er meine trüben Worte über unser Dasein besänftigen, überflog er das Schilf, dass wir durchwatet hatten, senkte seinen Flug mit einem poetischen Gesang über uns und schenkte uns Gewissheit über dass was wir vorher nur erahnen konnten. Mit seinem charakteristisch leuchtend gelben Übergang vom Kopf zum Schnabel verriet er uns, dass er tatsächlich ein Singschwan war.
Plötzlich schien uns die Kraft seines mächtigen Flügelschlages, getragen von seinem Lied, erfasst zu haben. Mit einem letzten beherzten Heraufziehen hatten wir es plötzlich doch geschafft. Endlich spürten wir wieder festen Boden unter den Füßen.
Jetzt stand sie tief gebeugt vor uns, die tote, heimatlose Kiefer. Ihre Wurzeln waren aus einer verzweifelten Umklammerung des Steins gebrochen, ihre weiten morschen Verästelungen einer verblichenen Hoffnung krallten sich noch an einen kahlen unnachgiebigen Felsrücken, der sich, wie von einer Riesenhand abgeschliffen, steil aus dem Wasser schob. Ihre trockenen, ausgedörrten Kronenäste neigten sich weit über die letzten im leichten Wind spielenden Schilfköpfe vor dem offenen Wasser eines kleinen Sees. Ihr ganzes, einsames Leben war wohl ein einziger, hoffnungsloser Kampf gewesen, das Streben nach Licht hatte sie mit einer fremden Welt betrogen, sie hatte sich mit aller Kraft gemüht und gewunden, doch sie hatte nie einen erdenden Halt von Bestand gefunden.
Vom Felsen aus erschloss sich uns nun ein Blick auf den See. Er erreichte wohl kaum die fünf Ar, die das finnische Umweltministerium in Helsinki forderte um in die Gewässerregistrierung aufgenommen zu werden. Abgeschottet durch seinen breiten Schilfgürtel und ein weiteläufiges Moor auf der gegenüberliegenden Seite bot er dem Singschwan und seiner schnell ausgemachten Gefährtin ein traumhaftes Refugium. Als zu oft schienen die beiden hier wohl nicht einen menschlichen Besuch zu bekommen. Auf der vegetationslosen Felsinsel, die zum tieferen Wasser hin steil abfiel, hätten sie uns von der Mitte des Sees kaum übersehen können, dennoch zeigten sich das Paar in seinem Liebesgeturtel von unserer Anwesenheit vollkommen unbeeindruckt. Ihre Lieder von hingebungsvoller Leidenschaft tauchten das verborgene Kleinod in eine Symphonie von ansteckender Lebensfreude. Sie verstummte erst als Wind und Wellen zur Ruhe fanden und sich das Firmament begann wie an einem Nachmittag im Herbst in eine ganz seichte Dämmerung zu hüllen. Es war aber weder Herbst, noch war es nachmittags. Über dem Moor am gegenüberliegenden Ufer tauchten irgendwann die zarten Konturen des Mondes auf. Die erste finnische Nacht war über uns herein gebrochen. In dem Hauch eines nur getrübten Tageslichtes hatten wir sie sehr lange gar nicht bemerkt. Es dauerte auch noch einige Zeit bis sich tatsächlich ein erkennbarer dunkler Kontrast zum Tag einstellte und erst dann realisierten wir wirklich, dass es längst Nacht geworden war.
Mit ihrem Gesang waren auch die Singschwäne verschwunden, dafür aber hatte eine andere, sehr ungeliebte Kreatur nun die Hochzeit ihrer Aktivität gefunden. Sie hatte uns eigentlich schon begonnen zu pisacken, sobald wir den Wagen verlassen hatten, aber nun war ihre Anzahl so gewachsen, dass jede Gegenwehr nutzlos wurde. Jede offen sich ihnen darbietende Körperstelle wurde gnadenlos malträtiert. Selbst unsere Kleidung schien keinen zuverlässigen Schutz zu bieten. Sobald sich Hose oder Feldjacke durch unvermeidliche Bewegungen der Abwehrbemühungen zu dicht an die Haut pressten, wurden sie durchstochen. Es war nicht auszuhalten.
Stelle dir vor, du stehst nackt im Regen und jeder einzelne Tropfen auf deiner Haut ist eine Mücke, die ihren Stachel erbarmungslos in dein Fleisch treibt. Ich glaube, dieses Bild beschreibt ganz gut den wehrlosen Zustand, den man in einer finnischen Mückeninvasion erfährt.
Die quälende Plage trieb den einen früher, den anderen später irgendwann unweigerlich zurück ins Wasser. Das Abtauchen brachte immer wieder Sekunden einer tiefen Entspannung. Wie den Angreifern, so war auch uns jedoch gewiss, dass wir da wieder heraus mussten, wenn wir nicht die ganze Nacht im See verbringen wollten. Eine dichte tiefschwarze Mückenwolke tanzte im Mondlicht über uns und wartete beharrlich genau diesen Moment ab.
Ich musste an das erbärmliche Leiden der geschwächten Rentiere in Lappland denken, die abseits ihrer Herde auf einem qualvollen, langen Weg von den Mücken in den Tod getrieben werden. Als ich davon zum ersten Mal hörte, konnte ich mir das kaum vorstellen, jetzt, schon nach wenigen Minuten in der ersten richtig großen Angriffswelle dieser grausamen Geschöpfe, die meinen Kreislauf bereits spürbar ins Wanken brachte, erschien mir kaum noch ein Tod brutaler und gleichsam so langwierig wie dieser.
Es blieb nur die Flucht in die Zelte. Dafür mussten sie jedoch zuerst einmal aufgebaut und wir überhaupt auf dem glitschigen Felsen wieder mühevoll an Land zurückgerobbt sein. Beides geschah unter den erwarteten Qualen. Den lauernden blutrünstigen Kreaturen bescherten wir ein reichhaltiges Festmahl. Die Gegebenheiten des schmalen Felsrückens ließen bedauerlicherweise auch nur das Aufstellen eines der beiden mitgeführten Zelte ganz am Rand des zum Wasser abfallenden Felsens unter der sich bedrohlich neigenden toten Kiefer zu. Liegen konnte man aber auch in diesem nicht. Die vom Felsen dargebotene Ebene war einfach zu klein und so konnte man darin zu zweit nur in einem gebeugten Sitzen ausharren. Man musste jedoch darauf achten, dass man dabei das Zeltdach nicht berührte, kam dies vor, wurde es sofort von den Angreifern zielsicher durchstochen.
Die Lage der übrigen drei Gefährten war jedoch noch weit aus bemitleidenswerter, was mich zeitweise meine eigene Lage in einem deutlich angenehmeren Licht erscheinen ließ, als sie es tatsächlich war. Ihnen blieb nicht anderes übrig, als sich mit ihrer Zeltplane und ihrem Rucksackinhalt so gut es ging zu vermummen und in einer Felsspalte das Tageslicht zu erwarten. Ich hörte die ganze Nacht über, die drei immer wieder laut fluchen und unfreiwillig ins Wasser springen. Ich vermute, die Abdeckungstaktik da draußen war nicht allzu zuverlässig gewesen. Besonders wenn es einem der drei irgendwie gelungen war einzunicken, kam es wohl schnell vor, dass die ihn schützenden Textilien zu Gunsten der noch wach gebliebenen anfingen zu wandern. Obwohl wir diesen sich offenbar regelmäßig wiederholenden Vorgang im Zelt nicht sehen konnten, blieb er uns dennoch nicht verborgen. Jedes Mal erfüllte ein entnervtes Aufschreien eines unsanft Geweckten die Nacht, dass so laut war, dass es wohl in der ganzen Saimaa- Seenlandschaft zu hören war.
Mit dem letzten Gejammer, das mich mit einer nunmehr zittrigen Stimme der Verzweiflung endgültig aus dem Halbschlaf riss, drang bereits frühes Tageslicht durch die Zeltwand.
Das Klagelied verstummte. Plötzlich waren kräftige Axthiebe zu hören. Tief drang die Schneide in das zerberstende Holz. Ich glaubte fast den Windzug der geschwungenen Axt zu spüren. Einige Holzsplitter sprangen auf das Zelt. In meinem noch etwas benommenen Zustand wurde mir allmählich klar, dass die Axt hier auf diesem Felsen nur in einen einzigen Stamm geschlagen werden konnte. Nämlich in den der toten Kiefer über mir und meinem noch schlummernden Gefährten.
Meine Sinne hatten mich nicht betrogen. Als ich aus dem Zelt herauslugte, sah ich ihn über mir. Ein schrecklich entstellter, von der nächtlichen Qual wohl in den Wahnsinn Getriebener, stand auf der morschen Kiefer und schlug ohne Unterlass wie ein Berserker auf Stamm und Äste ein. Auch die anderen beiden, die mit ihm die Nacht draußen in der Mückenplage zugebracht hatten, waren kaum wiederzuerkennen. Augen, Nasen und Lippen, ja sogar die Finger, die immer wieder wie automatisiert nach den toten Ästen griffen, waren dick angeschwollen. Ihre Münder waren fest verschlossen, ihre wortlose Stille wurde durch das stumpfe Auf- und Ab ihrer Füße auf immer dem gleichen Weg begleitet, auf dem sie das abgeschlagene Holz einsammelten und auf einem immer größer werdenden Haufen aufschichteten. Der war bereits so riesig geworden, dass er die Wurzelreste der toten Kiefer verbarg und die Träger in regelmäßigen Abständen komplett dahinter verschwanden.
Ich spürte erneut Einstiche der blutsaugenden Tyrannen in meinem Gesicht. Sie hatten sich ganz offenkundig immer noch nicht zurückgezogen. Die arbeitenden Entstellten brachte dies jedoch nicht mehr aus der Ruhe. Sie machten ohnehin mehr und mehr den Eindruck als würde ihr Bewusstsein jede Wahrnehmung um sie herum verweigern, sobald sie nicht unmittelbar das Schlagen oder Sammeln von Holz betraf. Als der mit der Axt wütende jede Gefahr für sich und seine Begleiter verachtend sogar noch ein Stück weiter auf der bereits vor sich hin knarrenden Kiefer emporstieg und kurz darauf die ersten Äste auf dem Zeltdach landeten, wusste ich, dass es nicht mehr in meiner Macht stand, das Treiben zu unterbrechen. Etwas anderes hatte in dieser Nacht mehr und mehr die Kontrolle über meine Begleiter da draußen übernommen. Mein noch vor sich hin kauernder, schlummernde Gefährte und auch ich selbst mussten so schnell wie möglich unsere Mückenschutzzone verlassen.
Hinter dem Reisighaufen brüllte es auf geschundenen Lippen. „Jetzt machen wir diesen Scheißviehchern den Gar aus.“ Die Axthiebe verstummten und der Berserker sprang mit einem zufriedenen, wenn auch entstelltem Grinsen vom Baum. „Die schicken wir aufm direkten Weg nach Helheim“, lachte er höhnisch. Als ich mich mit meinem noch immer etwas neben sich stehenden Gefährten auf den Haufen zubewegte, verriet ein Knacken bereits, dass er entzündet worden war. Das ausgedörrte Nadelholz brannte unglaublich schnell in einer großen Flamme auf. Tatsächlich riss sie wohl einige der überraschten Blutsauger in den Tod. Ihre Artgenossen, die sich hatten retten können, zogen sich zurück. In einem Bannkreis des Feuers entstand eine Schutzzone, die uns alle spürbar entspannte.
Wie sich jedoch schnell herausstellte, trügte der Schein von einer grundsätzlichen Befreiung von den Plagegeistern. Geschützt vor ihnen blieb nur, wer seinen ganzen Körper unmittelbar am Feuer platziert hatte. Schnell stellte sich heraus, dass dabei eine liegende Position am wenigsten Angriffsfläche bot, vorausgesetzt man fand auf dem Stein eine Ebene. Nach einer Weile hatte jeder einen mehr weniger geeigneten Platz gefunden. Die angenehme Wärme des Feuers in der Morgenfrische nach der quälenden Nacht ließ uns nach und nach die Augen zufallen. Ein beginnendes leises Flüstern im Schilf verriet, dass der seichte Seewind langsam zurückkehrte. Als er das Wasser wieder zu kleinen Wellen formte, die vor uns an die steile Steinwand anschlugen, stürzten sich lodernde Flammen auf die gebrochene Wurzel, die nun weit aus dem zusammenfallenden, glutroten und knackenden Reisighaufen herausragte. In dem sich schnell verflüchtigenden Rauch, in der ihr morsches Holz aufging, verlor sich die einstige Erinnerung an den lebenslangen Kampf der Kiefer um Halt und Erdung.
In ihrem Vergehen ergriff sie mich mit bewegenden Gedanken. Vielleicht war es gar nicht von Bedeutung, wie lange wir leben und vielleicht auch nicht, wie angenehm wir dieses, uns geschenkte Leben führen, gewiss aber wurde mir, dass wir einzig und allein in dem was wir hinterlassen, Unsterblichkeit gewinnen können.
Oft fürchte ich mich, dass ein Erfühlen von dem was richtig ist, nicht in unsere Zeit zurück findet, aber noch mehr sorge ich mich um die Erinnerung, aus der es erwächst. Wenn wir sie verlieren, verlieren wir uns selbst. Unsere eigene Unsterblichkeit lebt doch aus der speisenden Wurzel unseres uralten Erbes, dass uns Verpflichtung und Erdung zu gleich ist.
Meine Gedanken fanden in die vergessenen Bilder einer Vergangenheit eines vom Leid gebeugten, aber ungebrochenen Volkes zurück.
Mit geschlossenen Augen sah ich es in den Flammen vor mir, archaische Jäger, die vor Jahrtausenden die ersten Fußspuren in die Sümpfe und Wälder Finnlands brachten. Woher sie einst kamen, verbargen die Söhne und Töchter der Kaleva in einem rätselhaften Schatten.
Die raue Heimat ihrer Gegenwart duldete keine Schwachen. In langen Wintern starben sie einen schrecklichen Tod. Am Leben blieben nur die Stärksten, sie machten das wilde Land zu Jötunheim, zum Reich gefürchteter Riesen.
Die Erde sog sich voll mit Blut, Schweiß und Tränen bis sie sich ihrem neuen Volk hingab für das, was es zum Leben brauchte. Undurchdringliche Sümpfe, dichte Wälder und Eis und Schnee schufen aus tausenden Jahren Hunger, Leid und Leere, Stärke, Weitsicht und Vereinigung. Kaum das es geboren war, drohte dieses Volk im Feuer zwischen Schweden und Nowgorod zu verbrennen. Die Flammen wüteten über Jahrhunderte. Immer wieder brannte nieder, was schwer errungen. Zäh waren die Menschen aus den Sümpfen, doch ihr Schicksal blieb grausam. Der Große Nordische Krieg fiel über die Heimat her und fraß seine Kinder. Wieder schienen Land und Volk verloren.
Fast tausend Jahre hatte die finnische Seele in Ketten gelegen, als die großen Reiche, die es unterjochten unter der aufgehenden Sonne einer neuen Zeit zerbrachen. Das geschundene kleine Volk fand seine Hoffnung wieder, seine Einigkeit hatte es in den Wirren der Jahrhundertwende jedoch verloren. Der Traum eines freien Finnlands ertrank im roten und weißen Blut seiner eigenen Söhne…
Ein knarrendes Ächzen zerriss die Stille. Erschrocken öffnete ich die Augen. Der letzte Wurzelstrang, der die längst gestorbene Kiefer vielleicht noch über Jahre in einer sich weit neigenden Schieflage gehalten hatte, war von den Flammen gefressen worden. Mit einem fürchterlichen Fauchen stürzte der Baum auf die Tiefe zu. Die unteren Äste, die beim Fallen noch mit dem Fels in Berührung kamen, wurden von seiner über Jahrmillionen geformten Unnachgiebigkeit gnadenlos zerschmettert. Was von ihnen übrig blieb, stieb durch die Luft und verlor sich beliebig in allen Himmelsrichtungen. Dann peitschte die mächtige Krone auf das Wasser und zerbrach Wind und Wellen. Noch einmal krachte es, die letzte Verbindung von Stamm und Wurzel war in einem aufgeschreckten Feuer mit abertausenden Funken endgültig durchtrennt worden.
Der gefallene Baum ragte nun weit in den See. Von der steilen Felskante unserer kleinen Insel senkte er sich über die letzten vereinzelten Schilfhalme hinweg bis zur Wasseroberfläche unter der sich ausladende Kronenäste im sumpfigen Untergrund vergraben hatten. Nachdem man einige störende Äste abgeschlagen hatte, erwies sich der Baum in dieser Lage als durchaus begehbar. Der morsche Stamm knackte zwar hin und wieder verdächtig, besonders wenn mehr als eine Person zur gleichen Zeit auf ihm herumturnten, dafür aber war er so glücklich gefallen, dass er wie ein Steg fest im Boden fixiert war. Mit ein wenig Geschick war es nun weitestgehend problemlos möglich sich zum oder in das Wasser zu begeben. Für ein Bad und vor allem auch als Zugang zum Wasser für unsere Nahrungsmittelversorgung durch die Angelei war dieser Baumsteg ein Geschenk. Falls es erneut notwendig sein sollte, konnte man sich nun auch ohne größere Umstände auf eine schnelle Flucht vor einer neuen Mückeninvasion begeben.
Der Gedanke war ungemein beruhigend und erst als er in unserer Freude über unseren Steg ausgesprochen wurde, fiel uns auf, dass die noch anwesenden Plagegeister sich auf ein deutlich erträglicheres Maß reduziert hatten. Rauchgeschwängerte Nebelschwaden hingen ihn der Luft, der zarte Wind vermochte nicht, sie aufzulösen. Feuchtes Schilf durch das sich die Flammen langsam hindurch fraßen, ließ die Felsinsel sogar zeitweise in einer Dämmerung versinken. Die Blutsauger hassten das Feuer. Solang es brannte und ordentlich qualmte, waren wir vor einer neuen großen Angriffswelle sicher. Ich konnte irgendwann sogar einzelne Exemplare beobachten, die kurz vor meinem nackten Oberkörper, der sich ihnen für eine leichte Blutentnahme darbot, wieder abdrehten.