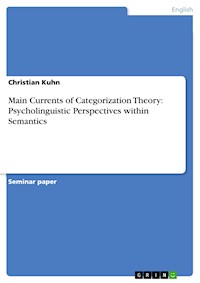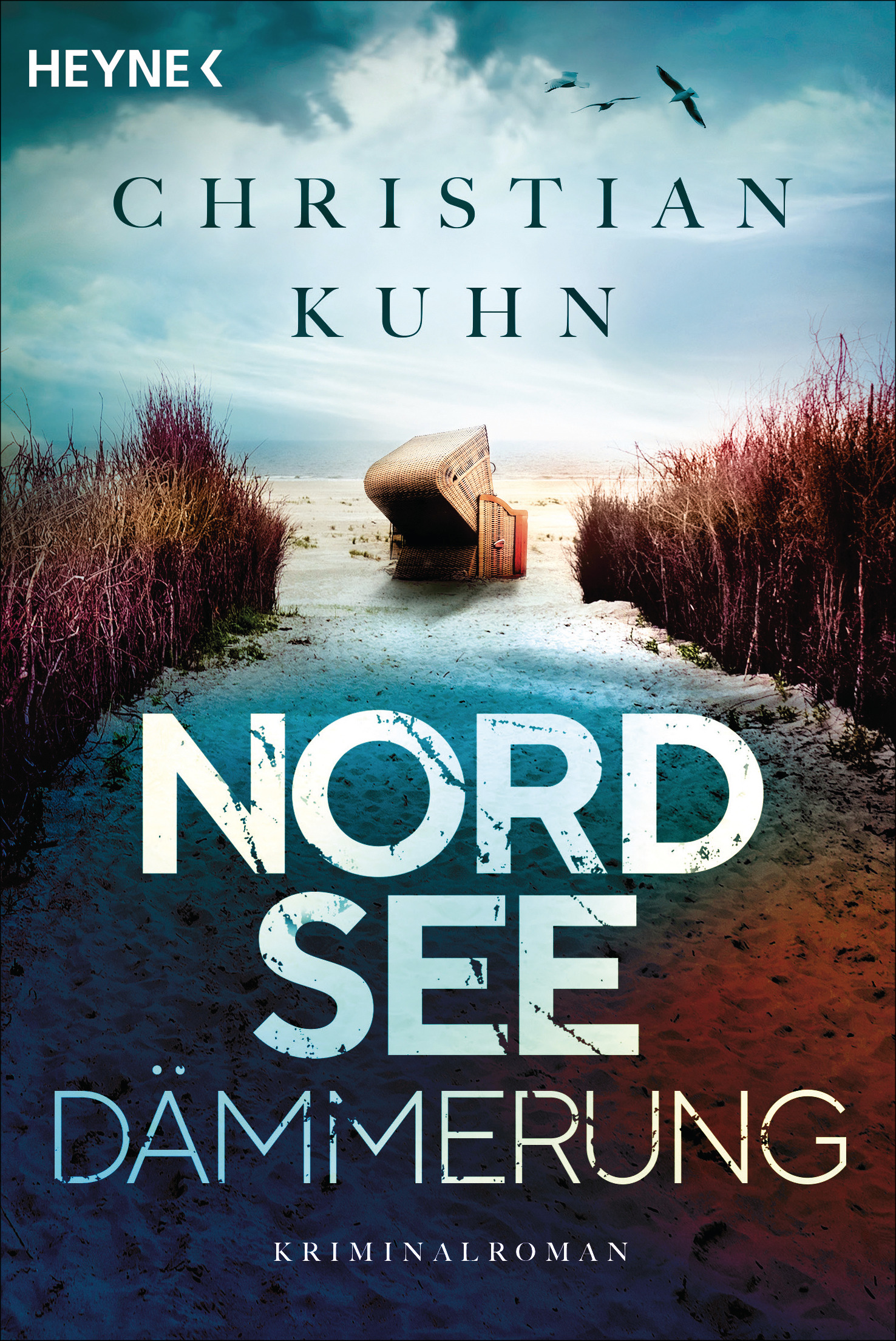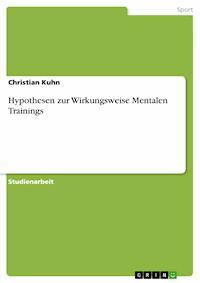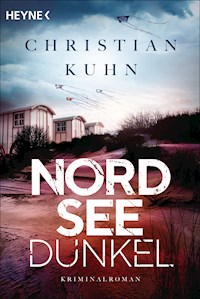
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tobias-Velten-Reihe
- Sprache: Deutsch
Kriminalhauptkommissar Tobias Velten hat sich eine Auszeit genommen. Statt in Berlin Verbrecher zu jagen, fotografiert er lieber Seevögel auf Norderney und führt im Auftrag eifersüchtelnder Eheleute gelegentliche Beschattungen durch. Doch dann wird ihm ein Auftrag angedient, der so gar nicht zum Inselidyll zu passen scheint: Die Tochter einer wohlhabenden Unternehmerfamilie wurde entführt. Velten soll sie um jeden Preis retten. Die Frage ist nur: Warum vertraut man ihm mehr als der Polizei? Nach und nach kommt Velten einem Geheimnis auf die Spur, das weitere Kreise zieht, als er sich jemals hätte vorstellen können …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Die Familie Toben kennt auf der Insel jeder. Ihnen gehören eine Galerie und der kleine Buchladen. Sie sind wohlhabend, bewahren über ihre genauen Vermögensverhältnisse jedoch Stillschweigen.
Als Erpresser die 19-jährige Tochter der Tobens in ihre Gewalt bringen, wendet sich die Familie in ihrer Verzweiflung an Tobias Velten. Der BKA-Ermittler hat eine längere Auszeit genommen, um die ostfriesischen Inseln zu erkunden. Anders als die Polizei ist er deshalb in der Lage, schnell und diskret die Ermittlungen aufzunehmen. Aber Velten kommt nicht nur dem Versteck der Entführer gefährlich nahe. Auch den finsteren Geheimnissen der Familie Toben ist er bald auf der Spur. Mit ungeahnten Folgen …
Der Autor
Christian Kuhn fuhr schon als Kind mit seiner Familie den Rhein hinab, um die Nordsee und ihre Inseln segelnd zu erkunden. Er liebt den rauen Charme der See, volljährigen Whisky und Geschichten, die in Erinnerung bleiben.
www.kuhnchristian.de
CHRISTIAN KUHN
NORDSEE
DUNKEL
KRIMINALROMAN
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 06/2021
Copyright © 2021 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Agentur
EDITIODIALOG, Dr. Michael Wenzel
Redaktion: Loel Zwecker
Umschlaggestaltung: Sandra Taufer, München,
unter Verwendung © Shutterstock.com
(Christian Szymala, Steffen Peters, Marijus Auruskevicius,
Serg64, Ivan Busic)
Karten U2/U3: ©mapz.com – Map Data: OpenStreetMap ODbL
Herstellung: Udo Brenner
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-26770-4V001
www.heyne.de
»Strandkorb 129«
Prolog
Montag, 15. April
07:15 Uhr
Kopfschmerzen, unruhiges Pochen hinter der Stirn, Felicitas Toben konnte kaum einen klaren Gedanken fassen. Sie lief am Fuß des Deiches entlang, es war Niedrigwasser. Zu ihrer rechten Seite hatte sich das Meer zurückgezogen und den Blick freigegeben auf braun-grauen Schlick, hinter dem Nebel war das Festland nur zu erahnen. Eine Gruppe Wildgänse blockierte den Weg vor ihr, Felicitas hielt gerade auf sie zu. Erst im letzten Moment hoben die Vögel schnatternd ab, gaben den mit weißem Kot übersäten Weg frei.
Sie erreichte den Fähranleger Norderneys, wo der morgendliche Betrieb bereits begonnen hatte. Die erste Fähre hatte gerade angelegt, vorsichtig huschte Felicitas durch eine Lücke in der langen Reihe von Autos und Lastwagen, die die Laderampen herunter- und auf die Straße rollten. Ihre Heimat wurde komplett vom Festland versorgt, sämtliche Güter mussten Tag für Tag hierhertransportiert werden.
Felicitas lief weiter den Kai entlang, an zwei Museumsschiffen und dem Seenotkreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger vorbei, bis zum Sportboothafen. Sie mochte die Geräuschkulisse: Ein Sirren lag in der Luft, erzeugt vom aufkommenden Wind, der die Wanten und Stage der Segeljachten vibrieren ließ, dazu das Flattern der Flaggen, das Klatschen der Wellen an den Hafenmauern, das gelegentliche Kreischen einer Möwe.
Von Norden zog eine schwarze Regenfront auf. Erste Böen, sie spürte den Wind in ihren Haaren. Sie blickte auf die Armbanduhr, deren Display Geschwindigkeit, zurückgelegte Strecke und ihren Puls anzeigte. Natürlich auch ihren Puls – deshalb musste sie ja dieses Ding tragen. Etwas mehr als vier Kilometer, die Hälfte war schon geschafft.
Schnell den Deich hoch und dann weiter ins Innere der Insel, zurück in die Stadt. Nieselregen setzte ein, vermischte sich mit dem salzigen Schweiß auf ihrem Gesicht. Sie folgte erst der Südstraße und dann der Jann-Berghaus-Straße. Auf der rechten Seite war eine lange Mauer aus roten Ziegelsteinen, dahinter lag der Inselfriedhof. Wahrscheinlich würde sie dort auch eines fernen Tages ihre letzte Ruhestätte finden. Heimat war etwas, dem man nur schwer entkommen konnte.
Dem Friedhof folgte der Busbahnhof, dann sah sie bereits den denkmalgeschützten Ziegelsteinbau ihrer ehemaligen Grundschule. Dort bog sie in die Schulzenstraße ein. Inzwischen goss es in Strömen. Trotz Kapuze und wasserabweisender Windjacke gab es keine trockene Stelle mehr an ihrem Körper, als sie bei ihrer Bäckerei ankam.
Ein Glöckchen klingelte, als sie die Tür öffnete. Das Ladenlokal war kleiner als ihr Wohnzimmer und bestand im Wesentlichen aus der gläsernen Bedientheke, in der das selbst hergestellte Gebäck ausgestellt wurde. Hinter der Bedienung, die gerade für den einzigen Kunden Brötchen in eine Tüte abzählte, lagen Brote in den Wandregalen. Weder Tische noch Stühle luden zum Verweilen ein.
»Hey, Fee, du bist aber früh dran. Wie immer?« Die Inhaberin kam aus der Backstube und schob sich an ihrer Hilfskraft vorbei.
»Hey, Sina. Ja, bitte ein Croissant und ein Brötchen.« Felicitas kramte aus der Hosentasche das abgezählte Kleingeld hervor und legte es direkt in die dargebotene Hand. »Was für ein Wetter.«
»Weißt du schon, wie du das trocken nach Hause bringen willst?«
»Vor allem schnell.« Sie lachte. »Tschüss.«
Nur noch ein letzter Sprint, dann erreichte sie die äußere Eingangstür ihres Hauses. An der Kamera unter der Decke blinkte es kurz grün, als sie den Flur betrat. Ein Klicken bestätigte, dass die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen war. Sie hängte die tropfende Jacke an die Garderobe, zog die Schuhe aus und entriegelte dann über den Fingerabdruckscanner die innere Tür, deren Holzoptik über die massive Panzerung hinwegtäuschte. In nassen Socken durchquerte sie den Eingangsbereich, an der zur Garage führenden Innentür vorbei. Mama würde bestimmt schimpfen, wenn sie die Wasserflecken auf dem Holzparkett sehen würde. Felicitas erwischte sich bei dem Gedanken, schnell mit einem Handtuch die Spuren abzutrocknen, schaffte es aber, ihn zu ignorieren.
Das Wanddisplay der Alarmanlage zeigte an, dass alle Systeme normal liefen. In der Küche legte sie die durchgeweichte Brötchentüte ab, na ja, mit einem Kaffee würde das Croissant schon noch schmecken, und entnahm dem Kühlschrank den vorbereiteten Smoothie.
Beim Betreten des Wohnzimmers regelten die Sensoren automatisch die Deckenleuchten auf das Maximum, der gläserne Couchtisch reflektierte das grelle Licht, das von den weißen Sofas noch verstärkt wurde. Aus den verdeckten Lautsprechern startete leise elektronische Musik. Hinter den bodentiefen Fenstern wartete ihr Garten auf sie, umschlossen von der zwei Meter hohen Ziegelmauer, die sie vor allen neugierigen Blicken schützte. Der Regen prasselte auf die schmale Terrasse, den weißen gusseisernen Bistrotisch und die beiden Stühle.
Felicitas öffnete beide Flügeltüren und trat hinaus, trank ein paar Schlucke von dem Smoothie, stellte das Glas auf den Tisch. Ging bis zur Mitte der Grünfläche, schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken, streckte die Hände weit nach oben, spreizte die Finger. Der Regen lief herrlich kühl an ihr hinunter, wirkte befreiend. Die Anspannung ließ nach, der Puls beruhigte sich, das Hämmern hinter der Stirn verschwand. Sie war klar, ganz klar. Alles war gut.
Im Wohnzimmer nahm sie die Armbanduhr ab, betrachtete die einzelnen Balken der Statusanzeigen, legte sie schließlich in die bereitstehende Ladevorrichtung. Das Prasseln der Regentropfen auf der Terrasse war bis hierhin zu hören. Sie ging weiter zum Badezimmer. Weiße Wand- und schwarze Bodenfliesen, metergroß. Schlicht, aber teuer. Einzeln schälte sie die eng anliegenden Sportsachen von ihrem Körper, ließ sie an Ort und Stelle liegen.
Im Spiegel betrachtete sie ihren Körper. Dünn, nicht dürr, sie hatte sich im Griff, das hatte sie die letzten Jahre gelernt. Ein kurzes Quietschen schallte aus dem Flur zu ihr hinüber. Wie eine Schuhsohle auf nassem Untergrund. Sie hielt die Luft an, horchte in das Haus hinein. Sekunden verstrichen.
Sie nahm das große Badetuch und wickelte es um ihren Körper. Langsam schritt sie vom Badezimmer zurück in den Wohnbereich. Am Display der Alarmanlage blinkte es gelb. Fehlermeldung, unbekannte Störung. Vorsichtig warf sie einen Blick ins Wohnzimmer. Leer. Ein Windzug fuhr durch die noch immer geöffnete Gartentür, wehte die weißen Vorhangschals beiseite.
»Keine Fehler!«
Die Stimme war hinter ihr. Sie spürte einen kalten Punkt an ihrem Nacken, ungefähr von der Größe eines Centstücks. Starr sah sie nach vorne. Es rauschte in ihren Ohren. Sie merkte, wie sie verkrampfte, ihr Atem flacher wurde. Keine Panik, zwang sie sich zu denken, sie wusste, was zu tun war.
»Das ist eine Entführung.«
Automatisch hob sie beide Arme, ganz langsam und vorsichtig, so wie es ihr stets beigebracht worden war.
1
Montag, 15. April
13:00 Uhr
Gras und Sand waren noch feucht, sowohl vom Tau als auch von den Regenfällen des Vormittages. Er schob sich behutsam an den Rand der Möwendüne. Zoomte auf das Ziel. Es hatte ihn nicht bemerkt, sah sich aber aufmerksam nach allen Seiten um. Schnell und energisch drückte er ab, immer wieder: das perfekte Fotomotiv. Ein Löffler, ein strahlend weißer Vogel, fast so groß wie ein Storch, inmitten seines Nestes, das wie ein Thron aus den flachen, dem Watt vorgelagerten Salzwiesen herausragte, perfekt ausgeleuchtet durch den hellen Schein der Mittagssonne.
In der unter Naturschutz stehenden östlichen Hälfte von Norderney, die als Ruhezone des Nationalparks Wattenmeer definiert und mehr oder weniger sich selbst überlassen war, brüteten bestimmt Zehntausende Vögel. Eine Urlandschaft, geprägt durch flache, dicht mit Sanddorn, Gräsern und Flechten bewachsene Dünen, moorartige Feuchtwiesen und Salzsümpfe. Der Zutritt war eigentlich auf einen durch Pfähle markierten Trampelpfad beschränkt, der von dem letzten Parkplatz am Ostheller zu dem Wrack eines Muschelbaggers am Ostende der Insel führte, einem bei Touristen beliebten Ausflugsziel. Aber wie überall fehlte es auch im Nationalpark an Personal, um das Verbot durchzusetzen.
Tobias Velten überflog auf dem Display der Kamera die Fotos des Tages. Der raue Charme dieser Landschaft faszinierte ihn, aber es gelang ihm nur selten, ihn auf Bildern festzuhalten. Er war gerne hier. Am liebsten früh am Morgen, wenn die Sonnenstrahlen die Ödnis Stück für Stück zum Leben erweckten, oder bei Regenwetter, wenn weit und breit um ihn herum keine Menschenseele zu sehen war. Nur die pure Natur, wir Menschen gehörten vielleicht gar nicht hier hin. Auf diese wandernde Sandbank in der Nordsee, durch eine Laune der Natur alle sechs Stunden abgetrennt vom Rest der Welt. Wie ein Paradies, das man besuchen, in dem man aber nicht bleiben durfte. Oder wie ein Gefängnis, das zeitweise geöffnet war.
Es wurde Zeit, den Rückweg anzutreten. Mit einem Seufzen verstaute Velten die Kamera in einem wasserdichten Beutel. Unter seinen Neoprenschuhen knirschte der Sand, als er die Düne hinabstieg, um zu seinem Kajak zu gelangen, das auf der dem Wattenmeer vorgelagerten Salzwiese auf ihn wartete. Ganz schön illegal, Herr Kriminalhauptkommissar. Der ist gerade nicht im Dienst, antwortete er sich selbst in Gedanken.
Nach ein paar Metern hatte er das kleine Boot bis zu einem wasserführenden Priel geschoben. Es wackelte kurz, als er einstieg, aber mit den ersten kräftigen Ruderschlägen stabilisierte es sich. Schwacher Gegenwind ließ leise Wellen gegen den Rumpf plätschern. Er ruderte langsam und stetig, in den Muskeln breitete sich eine angenehme Wärme aus. In den letzten Monaten hatte er Gefallen an dem neuen Sport gefunden. Nicht weit von ihm entfernt stieß eine Möwe durch die Wasseroberfläche, stieg danach mit ihrer Beute wieder hoch. Gedankenverloren betrachtete Velten die über ihn hinwegziehenden Wolken.
Nach zwanzig Jahren Dienst im Bundeskriminalamt hatte ihn vergangenes Jahr ein Einsatz auf die Nachbarinsel Juist geführt. Im Anschluss daran hatte er eine einjährige Auszeit genommen und war einfach dort geblieben, bis es ihn schließlich auf die größere Insel Norderney verschlagen hatte. Ende Juni würde seine Auszeit schon wieder vorbei sein, eine Verlängerung konnte er sich nicht leisten, seine finanziellen Reserven waren fast aufgebraucht. Tja, wieder arbeiten. Zurück ins BKA, zurück in den Polizeilichen Staatsschutz. Vielleicht würde es ihm guttun.
Es würde sicherlich viel zu tun geben. Soweit er das von der Insel aus mitbekam, war die Stimmung im Land weiterhin gereizt. Verschwörungstheorien kursierten in so hoher Zahl in den sozialen Medien, dass man ihnen kaum noch wirkungsvoll widersprechen konnte. Jeder gegen jeden, so kam es ihm vor. Angst vor Andersartigen verschmolz mit Aggression auf Andersdenkende, mit Neid auf Reichtum, Wut auf Großkonzerne und einem unspezifischen Hass auf die da oben. Das schien überhaupt der einzige gemeinsame Nenner zu sein, dieses Feindbild einer irgendwie bösartigen Elite, die je nach Ausprägung entweder das Volk wirtschaftlich ausbeuten, entrechten oder direkt austauschen wollte. Hier oben, in seinem selbst gewählten Exil, hatte er diesem ganzen Hass weitgehend entkommen können.
Velten passierte den Flugplatz der Insel, der durch einen kleinen Deich vor dem Wattenmeer geschützt war, und den aus roten Mauerziegeln gebauten Leuchtturm ungefähr in der Mitte der Insel. An Land wäre er ab hier deutlich schneller unterwegs gewesen, mehrere Busse pendelten regelmäßig in die Stadt, die den gesamten Westen der Insel ausfüllte. Aber auch auf dem Meer wurde es jetzt weniger anstrengend, der Scheitelpunkt der Flut war erreicht, die Strömung des ablaufenden Wassers unterstützte die müder werdenden Arme.
Die letzten Meter führten am Südstrandpolder vorbei. Ihn hatten einst die Nazis dem Meer abgetrotzt, eigentlich war der Platz damals für einen neuen Seefliegerhorst vorgesehen gewesen. Nach dem schnellen Sieg an der Westfront waren die Arbeiten jedoch kurz nach der Eindeichung zum Erliegen gekommen und auch nicht wieder aufgenommen worden, als die Westfront zurückgekehrt war. Anstatt Jagdbombern wohnten nun Graugänse hier, ein ziemlich akzeptabler Tausch.
Bei der Surfschule zog Velten das Kajak an Land, übergab es mitsamt der Ausrüstung den jungen Leuten, die den Laden hier führten, und schlüpfte in Turnschuhe, Jeans und Fleecepulli. Gemütlich bummelte er zurück nach Hause. Wahrscheinlich war er der einzige Bewohner Norderneys, der weder Auto noch Fahrrad besaß. Aber weder das eine noch das andere vermisste er.
Sein Briefkasten im Hausflur war bis auf die unerwünschte Werbung leer, wie immer. Sabine, die in dem Apartment im Erdgeschoss wohnte, sah ihm neugierig dabei zu, wie er die Prospekte im Papiermüll entsorgte. Zum Glück kam sie dieses Mal nicht zu ihm heraus, um Konversation zu betreiben. Zufrieden stapfte er in dem spärlich beleuchteten Treppenhaus nach oben. Vor einem Monat war die Glühbirne in der ersten Etage durchgebrannt, aber bisher hatte es noch niemand für nötig befunden, sie auszuwechseln. Er hörte ein Geräusch oben, vor seiner Tür. Langsam stieg er die nächsten Stufen hinauf.
Auf dem Treppenabsatz stand eine Frau, genau vor der Deckenleuchte, weshalb er blinzeln musste, um mehr als ihre Umrisse erkennen zu können. Eins fünfundsiebzig, schwarze Kurzhaarfrisur, wahrscheinlich Anfang vierzig, aber er war noch nie gut darin gewesen, das Alter zu schätzen. Sportliche Figur, körperbetonte schwarze Jeans, eng anliegende Regenjacke. Eine Polizistin, schoss es ihm durch den Kopf.
»Guten Tag. Mara Johansson. Sind Sie Herr Velten?«
»Ja, der bin ich.«
Wäre sie eine Polizistin, hätte sie ihre Amtsbezeichnung genannt. Also keine seiner zukünftigen Kolleginnen, beinahe war er ein wenig enttäuscht.
»Könnten wir kurz reden?« Sie sprach leise, Velten war sich sicher, dass man sie eine Etage tiefer bereits nicht mehr verstehen konnte. »Ich möchte Ihnen einen Auftrag anbieten.«
»Wollen Sie eben reinkommen?«
Er schloss die Tür hinter ihr. Seine Wohnung bestand im Wesentlichen aus dem Wohn- und Essbereich, in den eine gelbe Einbauküche aus dem letzten Jahrhundert gequetscht worden war, ein schmaler Bistrotisch mitsamt zwei Stühlen, eine Couch und ein Sideboard mit einem Fernseher drauf. Über eine schmale Leiter gelangte man zu dem halb ausgebauten Spitzboden, auf dessen Grundfläche genau ein Doppelbett passte. Hinter der einzigen Innentür versteckte sich das gerade einmal vier Quadratmeter große Bad. Etwas hilflos bot Velten die beiden Stühle als Sitzgelegenheit an.
Mara Johansson winkte dankend ab und blieb in der Mitte des Raumes stehen. Als sie den weißen Dreißig-Liter-Plastikeimer entdeckte, der am Ende der Einbauküche stand, huschte ein Grinsen über ihr Gesicht. Dann wandte sie sich ihm zu.
»Ich hoffe, Sie haben Zeit. Ich komme gleich zu meinem Anliegen: Meine Auftraggeber möchten Sie als Privatdetektiv engagieren.«
»Aha.«
Interessant, dass sich seine kleine Nebentätigkeit, wie er es nannte, schon so weit herumgesprochen hatte. Vor einem halben Jahr war er durch Zufall in Kontakt mit einer Privatdetektivin aus Norden, der nächstgrößeren Stadt auf dem Festland, gekommen. Sie hatte den Auftrag gehabt, einen Ehemann des Fremdgehens zu überführen. Er hatte sie unterstützen können, danach hatte sie ihm gegen ein paar bescheidene Tagessätze noch zwei weitere, ähnlich gelagerte Fälle vermittelt. Jedes Mal hatten die Auftraggeber mit ihrem Verdacht richtiggelegen. Traurig, auch wenn es grundsätzlich gut für das Geschäft war. Langweilige Aufträge, wenig Geld, aber immerhin leicht verdient. »Grundsätzlich habe ich noch Kapazitäten, ja. Wobei kann ich Ihnen denn helfen?«
»Sie würden Vollzeit benötigt werden. Es geht um die nächsten vier bis fünf Tage. Gegebenenfalls müssten Sie auch länger zur Verfügung stehen. Wir bieten Ihnen zweitausend pro Tag.«
Das war mehr, als er normalerweise veranschlagen würde. Weit mehr.
»Worum geht es denn?«
»Tut mir leid, das kann ich Ihnen hier noch nicht sagen. Aber wenn Sie grundsätzlich Zeit haben, dann würde ich Sie gleich Ihren Auftraggebern vorstellen. Dann erfahren Sie alles Wei…«
»Frau Johansson, ich bitte Sie. Etwas mehr Informationen brauche ich schon.«
»Es tut mir leid. Die Sache ist absolut vertraulich, in mehrfacher Hinsicht. Ich darf ihnen hier nicht mehr sagen. Das klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber … es tut mir leid. Hören Sie sich nachher alles in Ruhe an. Danach können Sie immer noch entscheiden, ob Sie den Auftrag annehmen oder nicht.«
Acht- bis zehntausend Euro. Vielleicht noch mehr. Und sie hatten noch gar nicht verhandelt. Andererseits war der Auftrag finanziell zu attraktiv, um keinen Haken zu haben.
»Okay. Und wie geht es jetzt weiter?«
Sie sah auf ihre Armbanduhr. »Wir haben jetzt Viertel vor drei. Wir treffen uns in einer halben Stunde im Hotel Preußenstern. Zimmer 412, oberste Etage. Ich werde vorfahren, Sie kommen nach.«
»Was soll das, Frau Johansson? Was sollen diese Spielchen?«
»Das ist alles andere als ein Spiel. Es tut mir leid, aber wir haben wirklich triftige Gründe. Bitte verstehen Sie, es ist besser, wenn Sie und ich nicht zusammen gesehen werden.« Sie legte in einem schmalen Fächer einige Fünfzig-Euro-Scheine auf den Tisch. »Nehmen Sie es als Zeichen, dass meine Auftraggeber diese Anfrage ernst meinen, oder sehen Sie es als eine Art Spesenpauschale. Sie können sie auf jeden Fall behalten, egal, wie Sie sich nachher entscheiden.«
Er nahm einen der Scheine in die Hand, er schien echt zu sein. Na ja, wenigstens mal anhören konnte er sich die Sache ja. Er war schon darauf gespannt, auf was das hier hinauslaufen sollte. Wenn das Ganze so schräg weiterlief, blieb ihm ja immer noch übrig, der Polizei den Tipp zu geben, sich diese Mara Johansson und ihre Geschäftspartner genauer anzusehen.
»In einer halben Stunde. Von mir aus, dann machen wir das so.«
»Danke.« Sein Besuch verabschiedete sich mit einem Lächeln, das er nicht entschlüsseln konnte. »Leisten Sie sich ein Taxi.«
2
Montag, 15. April
15:00 Uhr
Velten nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Es war seltsam ungewohnt, mal wieder in ein Auto einzusteigen. Der Taxifahrer trug ein rotes Baseballcap und eine Sonnenbrille und begrüßte ihn freundlich. Die Fahrt verlief zügig, jedenfalls kam es ihm so vor, aber das konnte auch daran liegen, dass er schon so lange nicht mehr gefahren war.
Womit auch immer Johanssons Auftraggeber ihn betrauen wollten, es klang nach einer großen Sache. Konnte er das überhaupt noch? Die kleinen Aufträge, die er die letzten Monate angenommen hatte, waren mehr oder weniger belanglos gewesen, eine nette Abwechslung. Aber das hier war anders, so viel ließ sich schon sagen. Es kribbelte wieder in den Fingerkuppen. Velten war gespannt, was ihn gleich erwarten würde.
In einem großen Bogen fuhren sie zunächst zum Hafen und dann in Richtung Stadtzentrum, an der Rückseite des Kurplatzes und am Schwimmbad vorbei, und bogen in den Damenpfad ein. Ehrwürdige Stadtvillen aus der Gründerzeit, teilweise zu offensichtlich hochpreisigen Appartements umgebaut, sowie Hotels für unterschiedlichste Preisklassen prägten das Straßenbild. Auf der linken Seite lugte eine Düne durch eine Baulücke, auf deren Spitze ein historisch anmutender Pavillon thronte, das Café Marienhöhe. Am Ende der Straße, am nordwestlichsten Punkt der Insel, hielt das Taxi direkt neben einem modernen, verschachtelt wirkenden Hotel. Dunkelrote Klinker, bodentiefe Fenster auf allen Etagen.
Velten bezahlte und gab ein großzügiges Trinkgeld. Der Concierge begrüßte ihn mit einem Nicken, beachtete ihn aber nicht weiter, als er direkt zu den Aufzügen weiterging. Zimmer 412 befand sich am rechten Ende eines schlichten, aber makellosen weißen Flurs. Durch das gläserne Dach flutete helles Tageslicht, ein Teppich dämpfte das Geräusch seiner Schritte.
Kaum dass er angeklopft hatte, öffnete Mara Johansson die Tür der Suite. Er folgte ihr in einen sehr aufgeräumt wirkenden Wohnbereich mit weißer Couchgarnitur und Glastisch. Riesige Fenster, eine großzügige Dachterrasse, man hatte Blick auf den Strand, das Meer und das östliche Ende von Juist, Letzteres war im Dunst des einsetzenden Nieselregens allerdings nur zu erahnen.
»Wir müssen noch kurz auf …«
»Bin schon da, Mara.« Aus der Tür zum Nebenzimmer trat eine Dame in einem beigefarbenen Hosenanzug, kombiniert mit rotem Schal. Energische Gesichtszüge, viele kleine Fältchen, kurze graue Haare, dezenter Goldschmuck. Vielleicht sechzig Jahre alt. Tatsächlich war sie ein wenig kleiner, als sie im ersten Augenblick auf ihn gewirkt hatte. In der linken Hand trug sie ein weißes Notebook.
»Alea Toben. Ich führe hier in der Maybachstraße eine Galerie, zusammen mit meinem Mann, der heute leider verhindert ist. Danke, dass Sie es einrichten konnten.« Sie hatte einen überraschend festen Händedruck. »Frau Johansson, meine Assistentin, haben Sie ja bereits kennengelernt.«
»Velten«, stellte er sich vor. Aber das wusste sie ja bereits.
Sie wies ihm einen Platz auf einem der Sofas zu und setzte sich ebenfalls. Über dem Tisch schwebte ein Kronleuchter. An den weißen Wänden hingen großformatige Drucke auf Acrylglas, abstrakte Motive, es waren Wellen in Großaufnahme, wie er auf den zweiten Blick erkannte. »Sehr beeindruckend«, begann er den Small Talk, der normalerweise üblich war.
»Meine Tochter ist entführt worden«, sagte Alea Toben. Er brauchte einen Moment, um die Information aufzunehmen. »Das … tut mir …«, begann er mit einer Antwort.
»Meine Tochter ist mein Ein und Alles«, unterbrach ihn Alea Toben. »Ich möchte, dass Sie mich und meine Familie im Umgang mit dieser Situation und bei der Kommunikation mit den Entführern unterstützen. Außerdem erwarte ich, dass Sie versuchen herauszufinden, wo meine Tochter gefangen gehalten wird. Sie sollen alles unternehmen, dass meine Tochter wohlbehalten zu uns zurückkommt. Das ist der Auftrag, den ich Ihnen anbiete. Nehmen Sie ihn an? Sie kennen die Konditionen.«
Mara Johansson schob ein DIN-A4-Blatt über den Tisch, auf dem, wie sie erklärte, das fixiert war, was sie ihm in seiner Wohnung zugesagt hatte. Der Vertrag war bereits unten rechts mit einer Unterschrift versehen.
»Warum ich? Eine Entführung ist Sache der Polizei.« Während er das sagte, wunderte er sich über sich selbst. Warum hatte er nicht einfach Ja gesagt? Weil die Frau über die Entführung ihrer Tochter sprach, als ob es sich um eine rein geschäftliche Angelegenheit handelte?
»Ich möchte zuerst Ihre Entscheidung hören. Wir haben alle nur begrenzt Zeit. Wenn Sie annehmen, werde ich Ihnen Ihre Fragen beantworten. Andernfalls ist dieses Gespräch beendet.« Alea Toben setzte sich, faltete die Hände, als wollte Sie ihm alle Zeit der Welt geben, obwohl das Gegenteil der Fall war.
Die Art und Weise, wie Personal behandelt zu werden, störte Velten. Eindeutig, sein Gegenüber war es gewohnt, Menschen zu kaufen. Anweisungen zu geben. Und der Auftrag war so allgemein formuliert, da musste noch etwas kommen. Andererseits, jemandem beim Umgang mit der Entführung der eigenen Tochter beizustehen, konnte man einen solchen Auftrag tatsächlich ablehnen? Außerdem bot sie zehntausend Euro. Für fünf Tage Arbeit.
»Einverstanden.« Er wusste, eigentlich hätte er das nicht einfach so akzeptieren dürfen. Aber er war neugierig geworden.
Alea Toben nickte, klappte das Notebook auf und tippte mit dem ausgestreckten Zeigefinger auf eine Taste. Ein in die Zimmerdecke versteckt eingebauter Beamer leuchtete auf, projizierte das Gesicht einer jungen, zwischen achtzehn und zwanzig Jahre alten Frau an die Wand. Leicht unscharf, füllte sie beinahe das gesamte Bild aus. Schwarze Haare, ernster Blick, unruhig, aber beherrscht. Unverkennbar Alea Tobens Tochter. Das Video startete. Die Frau blickte leicht links an der Kamera vorbei, schluckte, begann zu sprechen:
»Felicitas Toben befindet sich in unserer Gewalt. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Gegen zwei Millionen Euro in nicht durchnummerierten Fünfzig-Euro-Scheinen werden wir sie wohlbehalten freilassen. Halten Sie das Geld am Donnerstag, den 18. April, bereit. Weitere Anweisungen folgen. Machen Sie keine Fehler. Wenn Sie die Polizei einschalten, werden Sie Ihre Tochter nicht wiedersehen.« Sie blickte nach rechts, nach links, wieder nach rechts, mit fragendem Blick, die Kamera wackelte, dann fror das Bild ein.
Die Entführer hatten Felicitas Toben den Text vorlesen lassen. Eine untypische Vorgehensweise. Aber zielführend. So konnten sie beweisen, dass Felicitas noch lebte und die Botschaft mit Nachdruck vermitteln. Die Wirkung gerade auf die Eltern musste drastisch sein. Andererseits hatten die Entführer so riskiert, dass Felicitas neben der Botschaft bewusst oder unbewusst weitere Informationen hätte preisgeben können, ohne dass sie dies bemerkt hätten. Velten war sofort klar, dass er die Nachricht noch oft und intensiv analysieren würde.
»Dieses Video erhielten wir heute um 9:30 Uhr per E-Mail, von Fees privater E-Mail-Adresse. Ihr Smartphone ist nicht aufzufinden. Vielleicht haben die Täter dadurch Zugriff auf ihren Account«, sagte Johansson.
Oder auf ihr Passwort, das würde schon ausreichen, dachte Velten. Es war relativ simpel, im Internet über Onion-Routing seinen Standort und seine Identität zu verschleiern und damit anonym auf bestehende Accounts zuzugreifen. Der Besitz eines Handys oder anderer Endgeräte war dafür nicht nötig.
»Wann haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen? Beziehungsweise, wissen Sie bereits, wann sie zum letzten Mal gesehen wurde?«
»Die Videoaufnahmen der Überwachungskameras ihres Hauses zeigen, dass sie heute Morgen zuerst joggen war und im Anschluss daran um Viertel nach acht entführt wurde«, antwortete Mara anstelle ihrer Chefin. Sie hätten in Felicitas’ Haus aber alles unverändert gelassen, damit er sich selbst ein Bild machen könne.
»Viertel nach acht? Und das Video kam um 9:30 Uhr?« Zuerst die Entführung, der Rückzug in ein Versteck, danach musste das Video noch produziert und an die Tobens versandt werden. Es wäre zeitlich kaum möglich gewesen, Felicitas vorher von der Insel zu schaffen, davon abgesehen, dass die Entführer mit einem solchen Transport ein großes Risiko eingegangen wären, entdeckt zu werden. »Sie vermuten also, dass Ihre Tochter auf Norderney gefangen gehalten wird?«
»Ja. Davon gehen wir aus«, übernahm nun wiederum Alea Toben. »Das ist der Grund, weshalb wir Sie beauftragen. Wir haben drei Tage bis zur Lösegeldübergabe. Diesen Zeitraum möchte ich nicht ungenutzt verstreichen lassen. Versuchen Sie herauszufinden, wo Fee sich befindet. Wir unterstützen Sie, wo immer wir können.«
Velten war in Gedanken schon einen Schritt weiter. »Würden Sie denn im Zweifel das Lösegeld zahlen? Und, verzeihen Sie, dass ich frage, könnten Sie es überhaupt aufbringen? Zwei Millionen Euro?«
Die Höhe des Lösegelds war interessant, in vielerlei Hinsicht. Es musste zum einen für den Erpressten machbar sein, zum anderen das Risiko und den Aufwand einer Entführung lohnen. Und vor allem das Risiko, später von der Polizei gefasst zu werden: Die Aufklärungsquote bei erpresserischem Menschenraub lag bei um die neunzig Prozent. Und nicht zuletzt verriet es einiges darüber, wie viel die Entführer über ihr Entführungsopfer wussten.
»Der Betrag ist machbar. Wir würden es natürlich vorziehen, wenn Sie vorher erfolgreich wären.« Alea Toben sah ihn nicht an, sondern tippte etwas auf ihrem Notebook. Ihre Finger zitterten dabei. Am Ringfinger der rechten Hand funkelte ein eleganter, aber schlichter Ehering.
»Ganz grundsätzlich kann ich nur dazu raten, zumindest die Zahlung des Lösegelds vorzubereiten. Nicht nur im Interesse Ihrer Tochter, auch im Interesse der Ermittlungen, wenn wir bis dahin keinen Erfolg haben sollten.« Spätestens bei der Lösegeldübergabe, ob erfolgreich oder nicht, hinterließen die Täter auch bei noch so guter Vorbereitung so viele Spuren, dass es am Ende fast immer einen Fahndungserfolg gab. Spätestens dann, wenn die Polizei hinzugezogen wurde und mit der gesamten Macht und Erfahrung einer Ermittlungsgruppe arbeiten konnte. »Ich muss noch einmal nachfragen: Sie haben sich entschieden, nicht die Polizei einzuschalten, weil die Entführer das so gefordert haben?«
Alea Toben kam Frau Johansson zuvor, die ihm auch antworten wollte. »Ich möchte meine Tochter nicht in Gefahr bringen.«
Ein leerer Satz. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Polizei einzubeziehen, ohne dass dies nach außen erkennbar gewesen wäre. Diesen Fall hätten mit ziemlicher Sicherheit Spezialisten übernommen. Die Forderungen von Erpressern zu erfüllen hieß dagegen, sich ihnen auszuliefern. Hatten sie deshalb ihn angeheuert? Formal war er zurzeit nicht bei der Polizei. Damit hätten sie die von den Entführern aufgestellten Regeln nicht gebrochen, sondern nur gedehnt. Aber es ging hier nicht um formaljuristische Fragen, sondern um die recht unmissverständlichen Forderungen der Entführer, keine Nachforschungen durchzuführen. Nein, hier wurde ihm etwas verschwiegen. »Gibt es noch irgendetwas, was ich wissen sollte?«
Alea Tobens Blick war nicht zu lesen, als sie nach einigen Sekunden wieder das Wort ergriff. »Vertrauen gegen Vertrauen. Wir haben natürlich Erkundigungen über Sie eingeholt. Sie sind Einzelgänger, es gibt Leute, die bezeichnen Sie als sozial schwierig. Aber Sie haben einen passablen Ruf als Ermittler. Und Sie gelten als integer. Deshalb engagieren wir Sie. Wir vertrauen Ihnen. Versuchen Sie bitte, auch uns zu vertrauen.«
Eine freundliche Formulierung für: Tun Sie gefälligst, was ich Ihnen sage, und stellen Sie keine dummen Fragen! Sie war der Frage nicht nur ausgewichen, sondern hatte sogar davor gewarnt, sie ein zweites Mal zu stellen. Ich sollte den Vertrag vor ihren Augen zerreißen und gehen, dachte Velten. Sagen, dass sie und er einfach nicht zusammenpassen würden, die fünfhundert Euro Spesenpauschale auf den Tisch legen, versichern, dass er die Angelegenheit vertraulich behandeln werde, und gehen. Er tat es nicht. Warum auch immer, er wollte es nicht.
»Ich möchte mir als Erstes den Tatort ansehen«, sagte er. »Außerdem brauche ich das Video, die Bilder aller Überwachungskameras und ein paar gute, möglichst aktuelle Fotos von Felicitas. Und eine Liste von allen ihren Kontakten.«
»Das sollte kein Problem darstellen. Mara, lassen Sie Herrn Velten alles zukommen, was er haben möchte. Unterstützen Sie ihn bestmöglich.« Dann wandte Alea Toben sich ihm zu. »Ich würde mich jetzt gerne zurückziehen. Wir sprechen uns heute Abend. Bitte ermitteln Sie schnell, aber vor allem diskret. Vermeiden Sie es, unnötigen Staub aufzuwirbeln und die Entführer nervös zu machen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter unnötigen Risiken ausgesetzt wird.«
Sie reichte ihm die Hand, nahm ihr Notebook und verließ das Konferenzzimmer auf dem gleichen Weg, auf dem sie es betreten hatte. Kerzengerade, aber das Klacken ihrer hochhackigen Schuhe war unruhig, beinahe hektisch, und verriet, wie es eigentlich in ihr aussah. »Sofern es keine dringenden Erkenntnisse gibt, erwarte ich Ihre erste Einschätzung um 21 Uhr.«
3
Montag, 15. April
16:00 Uhr
Jeder Mensch reagiert anders auf Extremsituationen. Einige werden panisch, andere apathisch, manche aggressiv, andere suchen die Verhandlung, die meisten durchlaufen mehrere dieser Stadien. Jeder versucht, mithilfe von anderweitig erprobten Verhaltensmustern, so etwas Ähnliches wie Kontrolle über die Situation zu erlangen. Und Alea Toben zwang sich, eiskalt zu sein. Das war an sich nicht verwerflich. Was Velten irritierte, war die Tatsache, dass ihr das weitestgehend zu glücken schien.
Neben den vielen anderen Kleinigkeiten.
»Sie müssen mir jetzt bitte mal helfen«, wandte er sich an Mara Johansson. »Ich verstehe hier einige Sachen nicht: Felicitas Toben wohnt nicht in dem Haus ihrer Eltern, sondern in einem eigenen – das wiederum mit Überwachungskameras gesichert ist, auf deren Bilder sowohl ihre Mutter als auch Sie Zugriff haben?« In dem Satz war nicht nur eine Frage drin, sondern mindestens ein Dutzend.
»Ja.« Sie schien einen Moment lang darüber nachzudenken, ob sie direkt darauf eingehen sollte, entschied sich aber offenbar dagegen. »Gut zusammengefasst.«
»Ich formuliere es mal mit einem Wort: warum?«
»Ja. Es ist zugegebenermaßen ein wenig kompliziert.« Johansson erzählte, dass Felicitas bis zu ihrem Wechsel in die gymnasiale Oberstufe des Internats in Esens bei ihren Eltern auf Norderney gelebt hatte. »Letztes Jahr hat sie dann in Esens ihr Abi gemacht, ist wieder hierher zurückgekehrt, wusste aber nichts mit sich anzufangen. Eine Weile haben ihre Eltern sich das angeschaut. Und ihr dann schließlich finanziell unter die Arme gegriffen. Fee hat genau ein Faible – Bücher. Und mit der Hilfe ihrer Eltern führt sie nun einen kleinen Buchladen in der Friedrichstraße. Außerdem haben sie ihr ein Ferienhaus, das sie früher vermietet hatten, renoviert und an den heutigen Standard angepasst. Auch sicherheitstechnisch. Es ist in das gleiche Sicherheitskonzept eingebunden, das auch das eigene Haus der Tobens am Damenpfad schützt. Zufrieden?«
»Ein wenig.« Die Erklärung klang ganz plausibel. »Und wie kommen Sie ins Spiel?«
»Ich unterstütze die Tobens schon seit vielen Jahren. Eigentlich betreibe ich eine kleine Detektei hier um die Ecke. Die Tobens sind meine Kunden.«
»Okay.« Warum engagierten die Tobens dann nicht Johansson als Detektivin? Weil sie wahrscheinlich als Detektivin bekannt war, davon musste man ausgehen. Es ergab schon alles Sinn, was Johansson von sich gab. Aber es wirkte beinahe zu passend, zu glatt.
Mara Johansson räusperte sich. »Die Zutrittsberechtigungen für die beiden Objekte werden zentral verwaltet. Wir nutzen ein Fingerprint-Verfahren. Ich benötige ihre rechte Hand.« Sie ging zu einem der weißen Sideboards, öffnete die oberste Schublade und entnahm ihr ein Notebook sowie einen kleinen Kasten samt Sensortaste. Ein Fingerabdruckscanner, wie er auch für Reisepässe und Personalausweise eingesetzt wurde.
Velten war wie jedes Mal unbehaglich zumute, als er nacheinander die Finger auf den Sensor legte. Er erkannte das Gerät, es war von der neuesten Generation, die neben dem reinen Abbild der Papillarlinien auch dreidimensionale Tiefenmuster seiner Fingerkuppen erfasste. Sie galten als extrem sicher.
Johansson zeigte ihm den Bildschirm ihres Notebooks, auf dem der Grundriss eines Hauses und ein Konfigurationsmenü zu sehen waren. Zwei der drei Zugänge blinkten. »Dies ist das Haus von Felicitas Toben. Sie erhalten die Zutrittsberechtigung für den Front- sowie für den Garageneingang. Beide Zugänge sind durch Panzertüren und Überwachungskameras gesichert.«
»Was ist mit dem dritten Zugang, dem über die Terrasse?«
»Dieser ist nicht an das System angeschlossen. Das ist eine normale Terrassentür, wenn man vom Panzerglas absieht. Der Garten ist von außen nicht zugänglich. Zusammen mit den Nachbargärten bildet er eine Art Innenhof, der von den angrenzenden Häusern vollständig umschlossen wird.«
»Überwachungskameras?«
»Ja, eigentlich bei allen Zugängen. Nur … die Situation stellt sich leider sehr ungünstig dar. Der Gartenbereich wird zwar über Bewegungssensoren überwacht. Laut Sicherheitsprotokoll haben die Sensoren auch mehrere Bewegungen im Garten registriert, und zwar eine Viertelstunde nachdem Fee die Terrassentür geöffnet hatte. Aber die Kamera wurde nicht aktiviert, weil die Terrassentür weiterhin geöffnet war.«
Velten nickte. Eine Standardkonfiguration, die dazu diente, nicht selbst überwacht zu werden, wenn man sich in seinem eigenen Garten aufhielt.
Johansson atmete schwer aus. Es wirkte kurz so, als wollte sie noch mehr dazu sagen, sie unterließ es aber doch. »So, fertig. Ich habe Ihnen die Berechtigungen bis einschließlich Freitag eingerichtet.«
»Wer kann eigentlich alles das Haus von Felicitas Toben betreten?«
»Nur die Familie Toben, Sie und ich.« Johansson erklärte, dass sie zweimal wöchentlich Felicitas’ Haus aufsuche und sich dabei auch um anfallende Hausarbeiten kümmere. Velten rätselte, in welchem Verhältnis sie genau zu der Familie stand, verschob die Frage aber nach hinten. Alea Toben hatte sie als ihre Assistentin bezeichnet.
»Können Sie mir nun bitte die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen, auf denen die Entführung zu sehen ist?«
»Nur die Kamera aus der Garage hat etwas aufgezeichnet.«
Das Video startete, als die zur Garage führende Tür geöffnet wurde. Zu seiner Überraschung stellte Velten fest, dass es in Farbe war, er hatte eine Aufnahme in Schwarz-Weiß erwartet. Eine Frau trat ein. Sie war nur mit einem Handtuch bekleidet, ein dunkler Sack war über ihren Kopf gestülpt, der ihr bis über das Kinn reichte. Die Hände waren hinter ihrem Rücken verschränkt. Als sie sich für einen Moment unsicher nach hinten drehte, war zu erkennen, dass sie Handschellen trug. Ein breitschultriger Mann kam ins Blickfeld, er trug eine Clownsmaske, in der linken Hand hielt er eine Pistole. Der Entführer hatte eine Lederjacke an, Jeans und Stiefel. Er öffnete die hintere Tür des Wagens, versetzte Felicitas einen heftigen Stoß, sodass sie gegen die Einstiegskante stolperte und ins Innere fiel, drückte sie in den Fußraum und drapierte mit groben Handgriffen das Badetuch über ihr, bis sie nicht mehr zu sehen war. Anschließend verschwand er für wenige Sekunden im Haus, kam dann mit einigen Jacken wieder, mit denen er Felicitas weiter bedeckte. Er setzte sich auf den Fahrersitz und steuerte den Wagen aus der Garage. Die Aufnahme endete.
Johansson schluckte, dann räusperte sie sich. »Das Auto wurde bereits lokalisiert, es steht in einem kleinen Gewerbegebiet, wir haben es unberührt an Ort und Stelle stehen lassen, um auch dort keine Spuren zu beschädigen.«
Sie waren von dort in einen bereitstehenden Fluchtwagen umgestiegen und zu ihrem Zielort weitergefahren, natürlich. Vielleicht hatten sie sogar ein weiteres Mal das Fahrzeug gewechselt. Etwas in Johanssons Satz schwang noch in ihm nach. Sie hatte das Wort lokalisiert verwendet, nicht etwa aufgefunden oder Ähnliches.
»Die Sequenz ist nicht sehr lang. Wie sicher sind Sie, dass die Frau auf dem Video Felicitas Toben ist?«
»Zu hundert Prozent. Ich erkenne Fee, wenn ich sie sehe.« Die Antwort kam ebenso schnell wie überzeugend.
Der Mann hatte eine Clownsmaske angezogen. Also war er davon ausgegangen, dass ihn jemand erkennen konnte oder er von einer Überwachungskamera gefilmt werden konnte. Hatte er von den Kameras gewusst? Jedenfalls hatte er trotzdem den Überfall gewagt. Alleine. Eine solche Aktion auch bei aller Vorarbeit alleine und ohne Rückendeckung durchzuziehen war ein ziemlich waghalsiges Manöver. Ein Profi?
Irgendetwas hatte ihn an der Aufnahme irritiert. Velten trommelte mit den Fingern auf die Tischplatte, er wusste, da war was. Aber er kam nicht darauf.