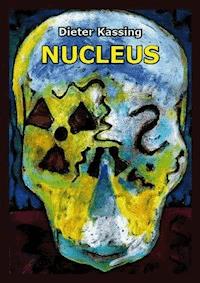
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Der Atomkern ist brandgefährlich und hoch explosiv. Das gleiche gilt für die Nuklearwirtschaft: Zwei Atommanager und ein Spitzenpolitiker kommen auf mysteriöse Weise ums Leben. Soweit die Realität. Die Journalisten des Energy Report rollen den Atomskandal auf, der Ende der Achtzigerjahre die deutsche Atomwirtschaft an den Rand des Untergangs gebracht hat. Was ist damals wirklich gelaufen? Gibt es Zusammenhänge mit den Todesfällen? Die Journalisten durchforsten die Akten der Polizei, der Geheimdienste wie BND, Stasi und Verfassungsschutz sowie die Protokolle der parlamentarischer Untersuchungsausschüsse. Bei ihren Recherchen werden sie von Dunkelmännern massiv bedroht. Denn in der Atomwirtschaft wird um Milliardengeschäfte gekämpft. Die Schlachtfelder sind Nobelherbergen, Edelrestaurants, Büros und Bordelle. Die Waffen sind schwarze Kassen im In- und Ausland, Scheinkonten und Schmiergelder. Und wer bei den Geschäften nicht mehr mitmachen will, riskiert sein Leben ... Das war damals so, und so ist es auch heute noch. Die Fiktion ist im wirklichen Leben angekommen. Ein spannender Tatsachenroman von aktueller Brisanz, der enthüllt und aufklärt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 728
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieter Kassing
NUCLEUS
Dieter Kassing, Jahrgang 1941, Journalist und Schriftsteller, arbeitete über viele Jahre im politischen Ressort von Tageszeitungen, im Bundesbildungsministerium in Bonn und danach als freier Korrespondent für verschiedene Rundfunkanstalten.
Fast 25 Jahre lang leitete er im Anschluss den von ihm gegründeten Bonner Verlag »Energie und Umwelt«. Der Verlag gab bundesweit erscheinende energiepolitische Magazine und Fachbücher heraus und veranstaltete nach der Wiedervereinigung Energie- und Umweltmessen in Leipzig. Dieter Kassing lebt mit seiner Familie in der Nähe von Bonn.
Dieter Kassing
NUCLEUS
Impressum
Die Deutsche Bibliothek- CIP Einheitsaufnahme
Dieter Kassing:
Nucleus
1. erweiterte Auflage
© 2013 by Umwelt-& Energiereport Verlag, Sankt Augustin
ISBN: 978-3-8442-7833-0
Umwelt- & Energiereport-Verlag
Sankt Augustin, Eichhörnchenweg 3
Telefon: +49-2241-8460106
Fax: +49-2241-8460648
E-Mail: [email protected]
www.dieter-kassing.de
Lektorat und Satz: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, Bonn
Titelbild: Alexander Kassing, Düsseldorf
vertr. durch Galerie Luis Campana, Berlin
Das gesamte Werk ist im Rahmen des Urheberrechtes geschützt.
Jegliche vom Verlag nicht genehmigte Verwertung ist unzulässig. Dies gilt insbesondere für die Verbreitung durch Film, Funk, Fernsehen und elektronische Medien sowie den auszugsweisen Nachdruck und die Übersetzung.
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Realität oder Fiktion?
Die wichtigsten Personen (fiktiver Teil)
Prolog
Staatsanwälte und Gerichte mauern
Anhang
Personenregister
Quellenverweise
Realität oder Fiktion?
Dieser Roman ist beides zugleich. Der Tatsachenteil ist typografisch, also in anderem Schriftbild, ausgewiesen. Die Dokumente und Quellen dazu finden Sie im Anhang- und Dokumententeil hinten. -
1987 kommt im Untersuchungsgefängnis Hanau ein führender Manager einer westdeutschen Atomenergie-Firma auf spektakuläre, überaus mysteriöse Weise ums Leben. Ein anderer wurde zuvor nachts von einem Zug in Hannover- Linden überfahren, tot auf den Gleisen gefunden. Beides ist Realität.
Im Roman ist das der Anlass für ein Team investigativ arbeitender Bonner Journalisten eines kleinen, unabhängigen Energie-Magazins, sich der Fälle anzunehmen. Je hartnäckiger und tiefschürfender ihre Recherchen sind, umso gefährlicher wird ihre Arbeit.
Bei der Atomwirtschaft geht es damals wie heute um Milliarden-Geschäfte. Die Unternehmen verhalten sich wie im Krieg. Der Boss eines Atomkonzerns herrscht wie ein Feldherr, seine Manager sollen Befehle befolgen wie Soldaten. Sie haben nicht zu fragen, sie sollen gehorchen. Ihre Waffen sind Schwarze Kassen im In- und Ausland, Scheinkonten, Schmiergelder.
Die Schlachtfelder sind Nobelherbergen und Edelrestaurants, Büros und Bordelle. Es geht um Aufträge mit horrenden Summen.
(Quelle u. a. Bericht des 2. Untersuchungsausschusses der 11. Wahlperiode des Deutschen Bundestages, Transnuklear/Atomskandal 25/90 Band 1 und 2) Ein Insider, der aussteigen will, begibt sich in Lebensgefahr.
Ein Politiker, der reden will, stirbt auf mysteriöse Weise in einer Badewanne.
Der hier beschriebene, akribisch recherchierte Fall ist der größte deutsche Atomskandal, der zum tief greifendsten Einschnitt in der Geschichte der deutschen Atomwirtschaft führte.
Dieser Tatsachenroman schildert das, was wirklich passiert ist und bis heute nicht bekannt wurde. Er nennt die Namen aus Politik und Wirtschaft, die damit verbunden sind, von 1987 bis heute. (Siehe auch Personenregister hinten! Die Namen der umgekommenen Manager wurden aus Rücksicht auf die Angehörigen im vorderen Teil geändert. Im Anhang werden sie kurz genannt.)
Der Tatsachenroman belegt, was damals alles dafür getan wurde, die heutige Angst vor einem möglichen nuklearen terroristischen Attentat sehr plausibel erscheinen zu lassen.
Akten verschiedener deutscher Landeskriminalämter, von Staatsanwälten, der DDR-Stasi und des BND untermauern dies. (Im umfangreichen Anhangsteil finden Sie die Dokumente und Quellenverweise, die die fiktive Story vorn und den im Schriftbild anders ausgewiesenen Tatsachenteil stützen. Die Quellenverweise vorne mussten aus technischen Gründen knapp gehalten werden.)
Ein äußerst spannender Stoff. Dokumente parlamentarischer Untersuchungsausschüsse aus Bonn, Brüssel und Wiesbaden sprechen darüber hinaus eine eigene, deutliche Sprache. (Siehe Anhang)
Noch mal: Die Recherchen spiegeln die Wirklichkeit, geben die Fakten wieder. Sie erscheinen in deutlich abgesetzter Schriftform. - Dieser Tatsachen-Roman, auch die Abläufe im sogenannten fiktiven Teil sind akribisch recherchiert worden. Das Buch ist übrigens im Mai 2012 bereits in gedruckter Form erschienen.
In der jetzigen, digitalen Form ist es stark erweitert. Im Anhangsteil habe ich meine Rechercheergebnisse seit Erscheinen des gedruckten Buches im Mai 2012 wiedergegeben. Habe beschrieben wie Staatsanwälte und Richter mauern. Der größte deutsche Atomskandal birgt noch immer größte politische Sprengkraft.
Sankt Augustin, im Dezember 2013
Dieter Kassing
Die wichtigsten Personen (fiktiver Teil)
Kurt Wedelmeyer, Gefängnisaufseher
Heins Genske, Untersuchungshäftling
Daniel Deckstein, Chefredakteur Energy- Report
Rainer Mangold, Redakteur des Energy-Report, Spitzname Schnüffel
Gerd Overdieck, Redakteur beim Enertgy-Report, der Spitzenschreiber des Blattes, mit dem Spitznahmen Grizzly wegen seiner Statur
Sabine Blascheck, stellvertr. Chefredakteurin, schweißt die Redaktion zusammen und ist nahe an Deckstein dran
Werner Brandstetter, Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt
Walter Mombauer, Chef des Kanzleramtes
Walter Meyer, Chef des BKA
Richard Grossmann, Chef des BND
Volkmar Wildhagen, Generalinspekteur der Bundeswehr
Bernd Conradi, Abteilungsleiter Krisenmanagement im Bundesinnenministerium und Freund von Daniel Deckstein
Bernd Wimmer, General, Leiter des NATO-Gefechtsstandes Uedem und Herr über das Geschehen am deutschen Himmel
Victor, russischer General, bekleidet bedeutende Position im Moskauer Verteidigungsministerium
Gennadij, sein Freund, macht für Victor die Schmutzarbeiten
Lensbach, Bundesinnenminister
Jürgen Steiner, deutscher Botschafter in Saudi Arabien
Prolog
Hanau, 15. Dezember 1987
Kurt Wedelmeyer stand an einem der vergitterten Fenster des Untersuchungsgefängnisses und betrachtete wohlwollend die dichten Schneeflocken, die aus den grauen, tief hängenden Wolken fielen. Der Aufseher freute sich darauf, mit seinen Kindern am Wochenende im Hanauer Wald Schlitten zu fahren.
Plötzlich, so als hätte er von irgendwo her einen lautlosen Befehl erhalten, wandte er sich mit einem Ruck um. Er senkte das Kinn auf die Brust und schloss die Augen. So verharrte er einen Augenblick. Um innerlich ganz ruhig zu werden, hielt er kurz den Atem an. Für die nächsten Schritte brauchte er seine volle Konzentration. Er durfte nicht den geringsten Laut erzeugen. Der Häftling, den er sich durch den Spion in der Zellentür ansehen würde, sollte auf keinen Fall merken, dass er kontrolliert wurde. Alle fünfundzwanzig Minuten sahen er oder einer der Kollegen nach dem Mann.
Wie eine Marionette stakste Wedelmeyer mit großen vorsichtigen Schritten zu der graugrünen Zellentür hinüber, hinter der er hauste, der Spitzenmanager von einer der Atomfirmen im Hanauer Atomdorf am Rande der Bulau. So weit sich Wedelmeyer erinnerte, war er der erste Manager einer Atomfirma, den sie jemals eingebuchtet hatten. Eingeliefert worden war er unter dem Namen Genske – sein wirklicher Name sollte aus vielerlei Gründen nicht bekannt werden. Genskes Unternehmen transportierte den atomaren Brennstoff für Deutschlands Atomkraftwerke. Daraus wurden auch Atombomben produziert.
Wedelmeyer heftete sein rechtes Auge an das Guckloch in der Zellentür. Geblendet von dem grellen, kalten Licht der Deckenstrahler kniff er es zusammen, riss es Sekundenbruchteile später wieder auf und erstarrte. Nur langsam setzte sein Gehirn immer mehr Teile des Datenstroms, den ihm sein Auge mit hoher Geschwindigkeit lieferte, zu einem unvollständigen Bild zusammen. Er lauschte angestrengt, um akustische Signale aufzunehmen. Vergeblich. Kein Ton drang an sein Ohr. Schließlich nahm sein Gehirn das grausige Stillleben wahr, das sich ihm bot.
Der Untersuchungshäftling Genske saß bewegungslos auf dem einzigen Holzstuhl in der Zelle. Der Teller mit dem Mittagessen stand unberührt vor ihm auf dem Tisch. Genskes Hinterkopf lehnte an der weiß getünchten Zellenwand. Seine weit aufgerissenen Augen starrten Wedelmeyer an. Der Mund stand offen – es sah aus, als schnappe der Atommanager nach Luft. Sein Oberkörper lag grotesk verdreht halb auf dem Tisch. Der linke Arm hing schlaff herunter. Der Ärmel des dunkelblauen Hemdes war weit hochgeschoben, sodass der blutverschmierte Unterarm zu sehen war, der einer großen, der Länge nach aufgeschlitzten Wurst, ähnelte. Aus der Wunde, deren Ränder auseinanderklafften, tropfte inzwischen kaum noch Blut auf das linke Bein der grauen Anzughose, auf der sich ein großer, nasser, dunkelroter Fleck gebildet hatte.
Instinktiv drückte Wedelmeyer auf den roten Knopf seines Alarmgebers an seinem Gürtel und griff mit zitternden Händen nach dem Schlüsselring, um den Schlüssel für die Zelle abzulösen. Dann fiel ihm ein, dass er ihn eben ja schon in der Hand gehabt hatte. Hatte er ihn vor Schreck fallen lassen? Er sah auf den Boden. Richtig, da lag er.
Er hob den Schlüssel auf, steckte ihn ins Schloss und drehte ihn mit einer hastigen Bewegung herum. Er ließ ihn im Schloss stecken und öffnete die Tür nur einen Spaltbreit und blieb im Türrahmen stehen. Falls etwas Unvorhergesehenes geschah, konnte er die Tür rasch wieder zuschlagen und den Schlüssel umdrehen.
So, wie Genske ihn ansah, musste der seinen letzten Blick auf dieser Welt zum Ausgang gerichtet haben. Was hatte er da gesehen? Hatte er noch in den letzten Sekunden seines Lebens nach einem Ausweg gesucht? Auf Hilfe gehofft? Oder war jemand hier in der Zelle gewesen? Was war vorher passiert? Wedelmeyer musste sich zusammenreißen, um nicht laut loszuschreien. Plötzlich kam ihm ein seltsamer Gedanke. Konnte es sein, dass Genske seinen Tod nur vortäuschte? Und wo, verdammt, blieben die Kollegen? Wedelmeyer hörte kein Fußgetrappel. Ihm fehlten ihre beruhigenden Rufe: »Kurt, bleib ruhig, wir sind schon da ...«
Da er dem Alarmgeber nicht so recht traute, hatte er seine alte Trillerpfeife immer noch in der Hosentasche bei sich und beschloss nun, zur Sicherheit noch mal Signal zu geben. Er warf einen kurzen Blick auf die Uhr – zehn vor eins. Er zog die Trillerpfeife heraus, steckte sie in den Mund und pfiff die geübten Alarmsignale. Die schrillen Töne hallten in den Gefängnisfluren wider. Aus den benachbarten Zellen schollen ihm die Protestrufe der anderen Häftlinge entgegen. Einige hämmerten mit ihren Kochgeschirren gegen die Zellentüren.
»Ich will raus ... eurem verdammten Puff!«
»Ruhe verdammt ... mal ...«
»Ihr Mörder ... umgebracht!«
»Du Wichser ... mich aufgeweckt!«
»... bin ich hier auf 'nem Kasernenhof oder was?«
Die Schreie und das Hämmern erreichten Wedelmeyer, als wären es Laute aus einer anderen Welt. In der Nähe hörte er einen der Häftlinge »Stille Nacht, Heilige Nacht« singen. Weihnachten. Gott ja, bis Weihnachten waren es ja nur noch wenige Tage!
Wedelmeyer schloss für einen kurzen Moment die Augen und dachte nach. Wenn die Kontrollen richtig eingehalten worden waren, musste der Atommanager vor einer halben Stunde noch gelebt haben. Und nun war er von jetzt auf gleich tot. Unfassbar. Im Unterbewusstsein vernahm Wedelmeyer schnelle Laufschritte auf dem Gefängnisflur. Seine Kollegen waren im Anmarsch.
Wie hatte das mit dem Genske überhaupt passieren können? Hatte der das selbst gemacht? Womit überhaupt? Der Aufseher öffnete die Augen und warf einen raschen Blick in die gut überschaubare Zelle. Er entdeckte nichts. Da lag kein Messer, auch keine Rasierklinge. Ein jäher Gedanke schoss ihm durch den Kopf: War es überhaupt Selbstmord?
Wieder warf er einen Blick auf den blutüberströmten Arm des Atommanagers. Für diesen Tag hatte sich Genskes Freundin angekündigt, wie Wedelmeyer in den Unterlagen gelesen hatte. Genske hatte sie gebeten, ihm neue Wäsche mitzubringen. Wer bittet denn um frische Wäsche und bringt sich gleich anschließend um?, dachte Wedelmeyer. Außerdem hatte die Hauptverhandlung unmittelbar bevorgestanden. Ihn überkam ein Verdacht.
»Genske«, sagte er laut mit erhobenem Zeigefinger, »du musstest sterben, weil du zu viel gewusst hast. Du solltest deine Geheimnisse mit ins Grab nehmen. Irgendwer hatte Angst, dass du vor Gericht eine Bombe auspacken könntest!«
***
»Wissen Sie schon, dass sich der Justizminister wegen dieser Sache eingeschaltet hat?«, fragte Oberstaatsanwalt Ulrich Winter empört und wedelte mit der Hand in Richtung von Genskes Zelle. Gemeinsam mit dem stellvertretenden LKA-Chef Volker Grund hatte er sich dort ein erstes Bild gemacht.
»Mensch, Kollege, was haben Sie denn erwartet?« Grund zuckte die Schultern. »Bei dem dicken Fall stehen die da oben doch alle unter höchstem Druck. Da bewegen wir uns auf ganz dünnem Eis. Wir beide«, sagte er und zeigte erst auf den Staatsanwalt und dann auf sich selbst, »und die da oben auch.«
Er streckte den Daumen in die Luft. Er schaute den Flur hinauf und hinunter und trat noch einen Schritt näher an den Oberstaatsanwalt heran, dessen rot angelaufener Kopf wie ein Granatapfel aus dem blütenweißen Hemdenkragen ragte.
»Ein Tritt in die falsche Richtung, und das Eis bricht ein!«, sagte er leise. »Ich bin sicher, dass die Sache hier von internationaler Bedeutung ist und der Minister ziemlich Druck von der Regierung bekommen hat. Vergessen Sie nicht, bei dem Mann da in der Zelle«, fuhr Grund fort und zeigte hinter sich, »bei dem Genske und auch ein paar anderen, besteht der Verdacht, dass sie den Stoff für die Bombe ins Ausland verschoben haben. Und falls wir bei unseren Ermittlungen feststellen, dass die Regierung da ruhig zugesehen hat oder sogar involviert war, kommt auf Deutschland einiges zu – Atomwaffensperrvertrag gebrochen und so weiter!« Grund schüttelte so heftig den Kopf, dass sein zwar längeres, aber schütteres Haar in Bewegung geriet.
»Mensch, Winter, das gäbe einen Riesenskandal!«
»Aber stellen Sie sich das bloß mal vor!«, schimpfte Oberstaatsanwalt Winter weiter. »Alles, was wir ermittelt haben, sollen wir sofort dem Minister oder seinem machtgeilen Staatssekretär auf den Tisch packen!«
Der Oberstaatsanwalt legte viel Wert auf Contenance, was er durch eine elegante äußere Erscheinung zu unterstreichen suchte. Sein eleganter dunkler Nadelstreifenanzug war maßgeschneidert. Es war selten, dass Winter – wie jetzt – außer Fassung geriet. Über seinem linken Arm lag ein leichter sandfarbener Mantel, von dem er nervös immer wieder nicht vorhandene Staubkörnchen abklopfte.
»Sie wissen ja, wen ich meine«, sagte er und stellte mit einer hektischen Bewegung seine Aktentasche auf dem Boden ab. »Und was heißt das? Wir müssen uns jetzt vor jedem Ermittlungsschritt vorher vom Minister die Genehmigung einholen! Außerdem haben er und der Staatssekretär in der letzten Sitzung darauf hingewiesen, dass nichts von unseren Ermittlungsergebnissen an die Presse durchsickern darf.«
»Aber das ist doch klar, Kollege Winter«, sagte Grund, »bei der Situation! Der Fall ist so bedeutend, da haben die doch die Hosen gestrichen voll. Und deswegen …« Er zögerte einen Moment. »Ich will Ihnen ja keine Angst einjagen. Ich sag's deshalb mal mit Chruschtschows bekanntermaßen zarten Worten. Sie kennen ja mein Faible für die klare Sprache dieses sowjetischen Schlitzohrs aus dem Bauernstand.« Grund setzte sein berüchtigtes, süffisantes Lächeln auf. »Wenn die Westmächte dem zu aufmüpfig wurden, drohte er immer damit, er werde die in Berlin ›an den Eiern packen‹.«
Die Augen des Oberstaatsanwalts wurden größer, sein Gesicht blasser. Mit starrem Blick und abweisender Miene musterte er den LKA-Mann, der in seiner ausgeleierten sandfarbenen Cordhose und dem abgetragenen Fischgrätsakko vor ihm stand.
»Begreifen Sie denn nicht?«, fragte Grund unbeeindruckt. »Die da«, er zeigte wieder mit dem Daumen nach oben, »die wollen am liebsten alles unter der Decke halten. Möglichst schnell die Leiche begraben. Weg damit und weiter, wie gehabt. Und das in diesem Fall möglichst schneller als schnell. Kollege Winter, wir beide kennen das doch zur Genüge. Aber diese Sache ist ja nun wirklich heikel ...«
»Das ist mir inzwischen auch klar«, sagte der Oberstaatsanwalt, der sich wieder gefasst zu haben schien. Sein Gesicht war nur noch leicht gerötet. »Aber wo kommen wir denn da hin!«
Grund trat einen Schritt zurück. »Herr Winter, Sie müssen sich vorstellen, dass unsere Atominteressen, also die Machtinteressen unseres Landes, berührt sind.«
Der Oberstaatsanwalt zuckte zusammen. »Nicht so laut, Herr Grund!«
Mit dem Zeigefinger vor dem Mund ließ er ein scharfes »Pst« hören.
»Das müssen doch nicht gleich alle mitbekommen«, flüsterte er und sah sich nach allen Seiten um.
Volker Grund sprach nun zwar ein bisschen leiser, aber in den angrenzenden Zimmern war seine Antwort immer noch zu verstehen.
»Schon bei dem Bisschen, was ich von dem Fall weiß, bin ich mir sicher, dass uns die Amis, Franzosen und Briten, wenn sie alles erfahren, wirklich alles, was hier gelaufen ist, an den Arsch packen. Und nun stellen Sie sich erstmal vor, wir bohren richtig tief und werden fündig!«
Er schüttelte den Kopf.
»Das war's dann, das schwör ich Ihnen. Dann können wir den ganzen Atomladen hier in Deutschland dichtmachen! Und nicht nur das. Wissen Sie was das für uns im Zweifel bedeutet, Kollege? Mit unseren Ermittlungsergebnissen hätten wir beide unser Land ans Messer geliefert. So sieht's aus!« Er machte eine Pause und fuhr mit einem schiefen Grinsen fort: »Glauben Sie wirklich, dass Sie dafür einen Orden kriegen? Oder befördert werden?«
Grund fasste den Staatsanwalt an der Schulter und sah ihm in die Augen.
»Ich denke, es wäre das Beste, wenn wir den Ball ganz flach halten. Ich werde jedenfalls meinen Jungs sagen: Grabt um Himmelswillen nicht zu tief! Das rate ich Ihnen und Ihren Leuten auch. Der Genske ist tot. War ein grausiger Tod, zugegeben. Aber wenn wir nun herausfinden, dass der sich gar nicht selbst umgebracht hat, sondern wegen irgendwelcher Machenschaften von irgendwem umgebracht worden ist, ändert das auch nichts mehr. Außerdem wurde mir zu verstehen gegeben, dass es ja auch für jeden da draußen verständlich wäre, wenn der Genske sich selbst …«, sagte Grund und machte eine Bewegung, als wollte er sich den Arm aufschlitzen. »Sie wissen schon, was ich meine. Bei den schweren Vorwürfen wär das ja wirklich kein Wunder.«
DIENSTAG
1
Bonn, Redaktion des Energy Report
Daniel Deckstein, Chefredakteur des Magazins Energy Report, nickte und legte den Entwurf für die neue Titelstory beiseite.
»Hervorragend geschrieben!«, sagte er und warf seinen beiden Kollegen Gerd Overdieck und Rainer Mangold, die ihm in seinem Bonner Büro gegenübersaßen, einen anerkennenden Blick zu. »Hm … einfach Zucker! Ich hätte ewig weiterlesen können.« Er machte eine nachdenkliche Pause, schüttelte den Kopf und fuhr mit Bedauern in der Stimme fort: »Ich wünschte, wir könnten das so stehen lassen. Das mit dem Staatsanwalt und dem LKA-Mann kann so bleiben, aber an der Beschreibung von Genskes Tod müssen wir grundsätzlich noch was ändern. Es sieht inzwischen so aus, als wäre der ganz anders zu Tode gekommen, als Sie es beschrieben haben. Ich bin froh, dass wir morgen diesen Gefängnisaufseher vor die Flinte kriegen. Am Nachmittag, oder, Gerd?«
»Aber nur Sie und der Alex. Der macht doch die Fotos.«
»Ach ja, Sudhoff fährt auch mit. Ich weiß nicht, warum, aber ich hab das Gefühl, dass wir morgen, wenn wir das Interview mit dem Wedelmeyer im Kasten haben, der Wahrheit ein gewaltiges Stück näher …«
»Da bin ich mir nicht mehr so sicher«, unterbrach ihn Overdieck. »Wenn man selbst der Aussage eines Oberstaatsanwalts nicht mehr trauen kann ...«
»Wir werden den Wedelmeyer mächtig löchern«, sagte Deckstein. »Wir quetschen dem alles aus den Rippen, was er über Genskes Tod weiß.«
»Wenn der Genske so zu Tode gekommen ist, wie wir bei unseren Recherchen von anderer Seite gehört haben, müssen wir aber auch noch woanders nachfassen«, sagte Overdieck, »und zwar ganz oben. Dann stellt sich auch erst recht die Frage, ob er das wirklich selbst gemacht hat. Egal, ob er so«, er machte mit der Rechten eine Bewegung, als wollte er sich den Arm aufschlitzen, »umgekommen ist, oder so.« Er deutete eine Bewegung an, als würde er sich eine Schlinge um den Hals legen.
»Das heißt, wenn er sich nicht selbst umgebracht hat, dann muss es Gründe dafür geben, warum er ermordet wurde«, erklärte Mangold und sah Deckstein an. »Um das rauszufinden, haben wir beschlossen, noch tiefer einzusteigen und die ganze Vorgeschichte aufzurollen. Also alles auf den Tisch zu packen, was die da an Dunkelgeschäften abgewickelt haben.«
»Ist uns ja auch bis jetzt ganz gut gelungen«, sagte Overdieck und lächelte Mangold zu. Er schätzte die journalistischen Qualitäten seines Kollegen und Freundes, der mehr als zehn Jahre bei internationalen Nachrichtenagenturen in London und Paris gearbeitet hatte. Overdieck wusste, dass Mangold sich dort mit großen Geschichten einen Namen gemacht hatte. Inzwischen eilte diesem der legendäre Ruf voraus, er habe die unglaubliche Begabung, Skandale förmlich zu wittern. Noch bevor überhaupt nur irgendjemand den Hauch eines unangenehmen Geruchs an irgendeiner Geschichte wahrgenommen habe, hieß es, stecke Mangold mit seiner empfindlichen Nase schon tief drin.
»Alles, was wir bisher recherchiert haben, deutet darauf hin«, fuhr Overdieck fort, »dass Genske sein Ableben nicht allein herbeigeführt hat. Vermutlich haben ihm bestellte Killer Hilfestellung geleistet.« Er sah Deckstein an. »Ich geb Ihnen einen Tipp: Wenn Sie morgen bei dem Wärter auf den Busch klopfen, fassen Sie ihn bloß nicht zu hart an. Solche Leute sind nach meiner Erfahrung häufig empfindsamere Naturen, als man denkt. Ich empfehle Ihnen, bei dem mit viel Fingerspitzengefühl vorzugehen. Erstmal abchecken, abtasten. Vielleicht steht er immer noch unter Druck. Und womöglich darf er auch gar nicht kundtun, wie es wirklich war.«
»Oh, Gerd, bei Fingerspitzengefühl und Abtasten wärst ja eigentlich du mit deinen zierlichen Pfötchen gefragt«, sagte Mangold grinsend und warf einen bedeutsamen Blick auf Overdiecks Hände, die er gern mit Schaufeln oder Bärentatzen verglich. »Aber dass der Mann eventuell auch heute noch unter Druck steht, halte ich auch für möglich.«
Deckstein hatte das Geplänkel schmunzelnd beobachtet. Trotz aller Frotzeleien verstanden sich Overdieck und Mangold sehr gut. Bei den Kollegen hatten sie ihre Spitznamen bereits weg. Overdieck mit seiner behäbigen, tollpatschigen Art war der »Taps«. Mangold, der ja für seinen Riecher bekannt war, hieß bei seinen Kollegen nur noch »Schnüffel«.
Neben Sabine Blascheck, der stellvertretenden Chefredak- teurin, waren Gerd Overdieck und Rainer Mangold Decksteins wichtigste Stützen in der Redaktion. Seit sie vor einigen Jahren zum Team gestoßen waren, bildeten sie alle gemeinsam ein unschlagbares Gespann.
Overdieck und Mangold stachen allerdings schon rein äußerlich hervor. Wer den beiden zusammen auf der Straße begegnete, musste unwillkürlich an das Komikerduo Pat und Patachon denken: Der kleine schmächtige Mangold wieselte mit schnellen Trippelschritten neben dem stämmigen Zweimetermann Overdieck einher. Dieser eilte trotz seiner Größe behände und beinahe elegant mit weiten Schritten über das Pflaster. Wenn Mangold seinem Kollegen unterwegs etwas sagen wollte, musste er zu ihm aufsehen. Deckstein hatte schon häufiger erlebt, dass Menschen stehen geblieben waren und den beiden lächelnd hinterhergeschaut hatten.
Overdieck hob die Hände. »Danke für die Blumen. Übrigens weißt du genau, dass ich gar keine Zeit habe mitzufahren. Ich muss an unserer Story weiterschreiben – morgen ist Deadline. Das erinnert mich daran, dass ich noch eine Menge Stoff von dir zu bekommen habe«, sagte er mit erhobenem Zeigefinger und verzog sein Gesicht zu einem breiten Grinsen.
»Reg dich nicht auf, mein Lieber, kriegst du ...«
Overdieck wandte sich wieder an Deckstein: »Bevor mich dieser Witzbold da unterbrochen hat, wollte ich nur kurz darauf hinweisen, dass Typen wie der Wedelmeyer oft schnell dichtmachen. Die haben ja nicht so häufig mit der Presse zu tun. Ein falsches Wort, und die sind eingeschnappt. Dann bekommt man nichts Vernünftiges mehr aus denen raus. Hab da so meine Erfahrungen.«
»Das glaub ich sofort«, spottete Mangold. »Ich ginge ja schon laufen, wenn ich sehen würde, dass so ein Zweizentnerschrank auf mich zugerollt kommt.«
Overdieck sah Deckstein an und schüttelte lachend den Kopf. »Ist ja eigentlich nicht zu glauben! Jetzt hat der Mann schon über vierzig Jahre auf dem Buckel und kann immer noch nicht schlucken, dass seine Eltern ihn als halbe Portion auf die Welt gebracht haben.«
Kaum hatte er den Satz zu Ende gebracht, traf ihn ein Keks
an der Schläfe. Overdiecks Bauch zitterte vor unterdrücktem Lachen. »Lass uns mal wieder ernst werden, Rainer«, sagte er und fuhr an Deckstein gewandt fort: »Ich bin sicher, Sie machen das schon. Wenn Sie den Wedelmeyer richtig anpacken, Daniel, können Sie aus dem eine Menge für uns rausholen. Schließlich hat er laut LKA-Unterlagen den Genske tot in seiner Zelle gefunden.«
»Aus meiner Sicht haben wir nur eine Chance, was Brauchbares von dem zu erfahren, wenn wir ihm mit gezielten Fragen auf den Leib rücken«, warf Mangold ein. »Vielleicht hab ich da noch was«, setzte er mit unergründlicher Miene hinzu.
»Mein Lieber, du riechst doch schon wieder was. Spuck's aus!«, sagte Overdieck.
»Mir ist da was durch den Kopf gegangen, Gerd. Kann ich aber noch nicht drüber reden. Muss erst noch ein bisschen rumtelefonieren. Und dann schiebe ich Ihnen, Daniel, noch ein paar saubere Fragen für das Interview rüber.«
»Okay, bin gespannt«, sagte Deckstein. »Solche Leute haben, glaub ich, oft Hemmungen, mit offiziellen Untersuchungsbeamten über ihre Entdeckungen und Gefühle zu sprechen. Und soweit wir inzwischen wissen, ist Wedelmeyer keiner dieser durchschnittlichen Schließer. Eher ein verhinderter Jurist. Obwohl er schon lange im Dienst ist, also auch erfahren, kniet der sich in die Fälle rein und liest alles darüber. Als erster eingebuchteter Manager aus einem Atomunternehmen war der Genske für ihn wohl ein ganz besonderer Fall. Das hab ich jedenfalls bei einem Telefonat mit Wedelmeyer herausgehört. Der sprudelte gleich los ...«
»Erstaunlich«, unterbrach ihn Overdieck. »Aber auch bei einigen Staatsanwälten, die wir gesprochen haben, war der Fall nach über zwanzig Jahren immer noch präsent. ›Es gibt so Fälle‹, hat der Leiter des Archivs in der Hanauer Staatsanwaltschaft zu mir gesagt, ›die merkt man sich, weil man damit rechnet, dass da irgendwann noch mal nachgefragt wird‹.«
»Wir hatten bei unseren Recherchen ja auch wiederholt den Eindruck, als hätte damals eine heimliche Hand die Ermittler an unsichtbaren Fäden zurückgehalten, damit sie nicht zu tief ermitteln«, sagte Deckstein nachdenklich.
»Die Leute erinnern sich zwar an den Fall, aber wenn wir irgendwo auftauchen, schlägt uns nicht gerade die reine Freude entgegen«, sagte Mangold. »Im Gegenteil, manchmal müssen wir froh sein, dass die uns nicht einen Eimer Wasser über den Kopf schütten, wenn wir uns vorstellen und erklären, um was es geht.«
Gerd Overdieck nickte heftig.
»Wenn das Interview mit dem Wedelmeyer gut läuft, erfahren wir vielleicht, ob die Branche oder alle, die da mitmischen, fähig sind, einen Mord in Kauf zu nehmen, um ihre Ziele nicht zu gefährden. Das, was wir bisher schon im Kasten haben und nach und nach veröffentlichen können, spricht ja eigentlich schon eine klare Sprache. Hat nicht der Richter in Hanau schon damals, als der Prozess gegen einen Mitarbeiter aus dem Umfeld Genskes lief, von mafiosen Strukturen gesprochen?«
Overdieck sprang plötzlich auf. »Ich kann's gar nicht erwarten, diesen coolen, aalglatten Atommanagern die Maske vom Gesicht zu reißen. Die erklären immer, sie hätten alles im Griff! Dabei wird gar nicht richtig klar, wie sie das eigentlich meinen!«
Mangold wusste, dass er seinen Kollegen bremsen musste,
egal wie. Sonst würde der sich weiter in Rage reden.
»Mensch, Gerd«, sagte er und setzte ein spöttisches Grinsen auf, »besser hätte ich es auch nicht formulieren können. Ich sag's ja immer, unser Taps kann sich von einer Minute zur anderen als eleganter ... Haudrauf entpuppen.«
Overdieck klopfte ihm lächelnd auf die Schulter. »Manchmal bist du so'n richtig netter kleiner Armleuchter.«
»Ich finde es zwar immer wieder unterhaltsam, Ihnen beiden zuzuhören«, sagte Deckstein, »aber die Zeit drängt. Ich muss die Unterlagen noch mal durchgehen, und Sabine will auch noch was von mir.«
»O.k., wir sind schon verschwunden«, sagte Mangold und stand auf. »Ich reich Ihnen nachher noch die Fragen rein.«
MITTWOCH
2
Hanau, Untersuchungsgefängnis
Deckstein saß rittlings auf dem einzigen Stuhl im Zimmer des Aufsehers Kurt Wedelmeyer. Das Sitzmöbel machte einen derart wackeligen Eindruck, dass der Journalist es zur Sicherheit mit der Rückenlehne nah an die Kante des kleinen Tisches gestellt hatte. Das gab ihm das Gefühl, nicht damit umkippen zu können. Aus dieser Warte hatte Deckstein das Aufnahmegerät, das auf dem Tischchen neben dem Teller mit Wedelmeyers Mittagessen stand, gut im Blick. Es würde ihm also nicht passieren, dass sie redeten und redeten und das Band stünde längst still. Häufigeres Reporterschicksal, als man glaubt. Alex Sudhoff hatte sich mit seiner Kamera hinter ihm aufgebaut.
Deckstein betrachtete das zerfurchte, graue Gesicht des Aufsehers, der ihm auf einem ausgeblichenen, durchgesessenen Sofa gegenübersaß. Seit über zwanzig Jahren tat Wedelmeyer hier im Hanauer Gefängnis Dienst. Seine Augen, die unruhig hin und her huschten, lagen tief in dunkel umschatteten Höhlen. Die Wangen waren eingefallen, die Lippen hatte er fest aufeinander gepresst. Er machte den Eindruck eines Mannes, auf dem ein gewaltiger seelischer Druck lastet.
»Ein paar Tage nach diesem schrecklichen Erlebnis mit Genske hatte ich zufällig wegen einer anderen Sache mit Doktor Gaibel zu tun. Das ist unser Gefängnisarzt«, erzählte Wedelmeyer. »Ich hab ihn gefragt, was eigentlich im Kopf und im Körper eines Selbstmörders passiert, nachdem der sich die Adern aufgeschnitten hat. Sitzt der dann da einfach so rum und sieht zu, wie ihm der eigene Saft rausspritzt?«
Mit einer raschen Bewegung, die Deckstein dem bisher eher träge erscheinenden Mann gar nicht zugetraut hätte, griff Wedelmeyer hinter sich und zog hinter seinem Rücken ein wabbeliges Ding hervor.
»Ich hab was vorbereitet, damit Sie sich mal so richtig vorstellen können, wie das mit dem Genske abgelaufen ist, meine Herren. Ich meine, dann fallen Ihnen sofort die richtigen Fragen ein.«
Wie bei einem Zauberer verschwand das rote wabbelige Ding plötzlich tief in dem weiten linken Ärmel von Wedel- meyers alter, durchgescheuerter Uniformjacke. Er streifte den Stoff hoch, und plötzlich schoss eine hellrote blutähnliche Flüssigkeit aus seinem linken Arm.
»Nicht! Lassen Sie das«, rief Wedelmeyer, als Deckstein den Teller mit dem Mittagessen wegziehen wollte. Das »Blut« spritzte über den Tisch, das Mittagessen und einen daneben liegenden Brief.
Mit einem Ruck wandte Deckstein den Kopf ab. Er hörte, wie es hinter ihm polterte, und spürte einen Ruck an seinem Stuhl. Er drehte sich um und sah, dass Alex Sudhoff vor Schreck seine Kamera losgelassen hatte. Sie war gegen Decksteins Stuhl geschlagen und baumelte jetzt am Riemen vor dem Bauch des Fotografen.
»Ih!«, gellte Alex' schriller Schrei durch den Raum.
Hoffentlich kippt der mir jetzt nicht noch um, dachte Deckstein,
»Nee, Herr Wedelmeyer«, rief Sudhoff, »dieses Blut im Mittagessen! Wie widerlich! So eine ekelige Sauerei!« Zugleich griff er wieder nach seiner Kamera und kniete sich mit einer geübten Bewegung hin. Immer wieder drückte er auf den Auslöser und schoss eine Serie Bilder von dem blutigen Stillleben.
Als Deckstein sich Wedelmeyer wieder zuwandte, sah er, dass inzwischen dunkleres »Blut« vom Tisch auf dessen Hose tropfte. Auf dem Boden hatte sich schon eine kleine Lache gebildet, die rasch größer wurde. Der linke Arm des Aufsehers hing wie eine rote blutige Wurst schlaff herunter.
»Und nun sitze ich hier und warte in aller Seelenruhe darauf, dass mir weiter das Blut rausläuft? Bis ich tot umfalle? Und dann hoffe ich auch noch, dass mich keiner entdeckt?« fragte Wedelmeyer ironisch und sah die beiden Journalisten an. »Das musste damals bei dem Genske ja alles zwischen zwei zeitlich engen Kontrollen passieren. Und der wusste natürlich nicht, wann die jeweils waren.«
In der Wärterzelle sah es inzwischen aus wie beim Schlachtfest. Je länger Deckstein Wedelmeyer mit seinem blutüberströmten Arm betrachtete, desto mehr verschwamm das Bild des Wärters vor seinen Augen. Stattdessen sah er den großen, schlanken, lebensfrohen Genske vor sich, wie er ihn von vielen Fotos und Schilderungen in Erinnerung hatte. Zugleich drang ihm immer klarer die Frage ins Bewusstsein: Sieht so ein Täter aus? Oder doch das geschlachtete Opfer? Ist das alles überhaupt so gewesen? Und wenn nicht, warum gibt sich Wedelmeyer so viel Mühe, uns vorzumachen, dass der Genske sich tatsächlich den Puls aufgeschlitzt hat?
»Also, der Doktor Gaibel«, erklärte Wedelmeyer weiter, »hat mir damals den medizinischen Ablauf eines Suizids geschildert. Mir kamen dabei immer wieder die Bilder von Genske in der Zelle hoch. ›Nach dem Schnitt‹, hat der Doktor gesagt, ›kommt zunächst der Moment, in dem man noch einmal richtig lebendig wird. Das Herz rast dann wie wild.‹ In diesem Augenblick, in dem man dann noch mal so richtig aufgekratzt und mobil wird, geben manche Selbstmordkandidaten ihre Absicht auf. Sie schreien rum, machen sich bemerkbar und werden oft noch gerettet.
Wenn man den Schnitt richtig gemacht hat, also längs und nicht quer, und die erste Phase hinter sich hat, kommt die zweite, und zwar ziemlich bald nach diesem Herzrasen. ›Sogar die erlebt man noch bei vollem Bewusstsein‹, hat der Gaibel mir weiter erklärt. ›Dann hat man schon richtige Schmerzen, denn der Körper versorgt nur noch das Gehirn, den Bauch, die Lunge und das Herz mit Blut. Beine und Arme schon nicht mehr. Und das kann sehr, sehr wehtun.‹«
Wedelmeyer machte eine Pause und fuhr dann nachdenklich fort: »Wenn das stimmt, was der Doktor mir erzählt hat – und es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln –, dann muss der Genske doch damals irre Schmerzen gehabt haben.«
Deckstein lauschte mit angehaltenem Atem und brannte darauf, dass der Aufseher weitersprach.
»›Wedelmeyer‹, hat der Gaibel mich in einem Ton angeschrien, als ginge es auf mein eigenes Ende zu. ›Wedelmeyer, wenn Sie nun Ihre dritte Suizid-Phase erreicht haben, macht langsam auch Ihr Gehirn nicht mehr mit.‹ Er hat mir dabei einen kurzen, kräftigen Klaps vor die Stirn gegeben. ›Die kleinen Blutgefäße, die Kapillargefäße, die die Nervenzellen mit den übrigen Blutgefäßen verbinden, werden jetzt nicht mehr richtig durchblutet. Sie schalten allmählich ab. Und dann stellt der Herzmuskel seine Arbeit ein. Danach schalten auch alle anderen Organe ab.‹« Wedelmeyer verstummte und schüttelte sich, als liefe es ihm noch in der Erinnerung kalt den Rücken herunter. Mit einem Mal beugte er sich so abrupt vor, dass das altersschwache Sofa ächzende Laute von sich gab. Eine Weile saß der Wärter regungslos mit zusammengezogenen Schultern da.
Deckstein stellte ihm keine Fragen, sondern wartete ab. Er will sich vor etwas wegducken, dachte er und nahm sich die Zeit, den Aufseher genauer in Augenschein zu nehmen.
Im kaltweißen Licht der Neonröhre stachen die »Blutspritzer« in dem von tiefen Furchen durchzogenen Gesicht hellrot hervor. Wedelmeyers an sich krauses Haar war durch die Mütze, die er eben noch getragen hatte, platt an den Kopf gedrückt worden.
Plötzlich kam wieder Leben in den Aufseher. Er straffte sich, stand auf und sagte: »Entschuldigen Sie, meine Herren, aber Sie werden verstehen, dass ich jetzt wieder arbeiten muss. Man wird mich bestimmt schon vermissen. Und ich muss mich ja noch umziehen.«
Als die drei Männer den Raum verließen, hielt Deckstein das eingeschaltete Tonbandgerät in der Hand. Er achtete darauf, dass das Mikrofon möglichst auf Wedelmeyer gerichtet blieb. Sie waren kaum auf dem Gang angekommen, als der Wärter unvermittelt stehen blieb.
»Noch mal kurz zu Genske ...«
»Das ist das Stichwort, Herr Wedelmeyer«, unterbrach ihn Deckstein. »Wir haben Hinweise darauf, dass das alles ganz anders abgelaufen ist.«
Der Aufseher sah ihn erschrocken an und schwieg. Die plötzlich eingetretene Stille wurde vom Klingelton eines Mobiltelefons unterbrochen.
Deckstein sah seinen Fotografen an. Doch Sudhoff schüttelte den Kopf und zeigte auf Wedelmeyer. Der Aufseher griff in seine Jackentasche, zog sein Handy hervor und sah auf das Display.
»Entschuldigung, meine Herren«, sagte er erstaunt. »Eigentlich ungewöhnlich. Ich werde hier sonst nie angerufen. Normalerweise funktioniert auch unser Störsender, damit die Häftlinge nicht einfach so mit ihren Handys ...« Er sah noch einmal auf das Display. »Die Nummer kenn ich nicht. Ich nehme aber mal schnell an ... Wedelmeyer, hallo?«
Gleich danach lief sein Gesicht rot an. Er reckte den Kopf, um den langen Gefängnisgang zu überblicken. Dann schrie er: »Wer sind Sie überhaupt? Woher wissen Sie ...? Was wollen Sie ...?« Er beendete das Gespräch und sah Deckstein direkt ins Gesicht: »Seien Sie bloß vorsichtig!«
»Was ist denn los, Herr Wedelmeyer?«
Der Aufseher versuchte, das Handy, das von der »blutigen« Vorführung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen war, wieder in seiner Jackentasche zu verstauen, griff aber aus Nervosität mehrmals daneben. Deckstein sah, wie seine rot verschmierten Hände zitterten.
»Da war so ein Kerl dran. Wollte seinen Namen nicht nennen«, murmelte Wedelmeyer und konzentrierte sich darauf, das Handy in der Außentasche seines zu weiten Jacketts zu verstauen. Schließlich schaffte er es. »Der meinte doch tatsächlich ...«
Er sieht aus, als verstünde er überhaupt nichts mehr, dachte Deckstein.
»Meine Herren, haben Sie bitte Verständnis, aber ich muss jetzt«, erklärte der Aufseher unvermittelt und zeigte in Rich-tung Ausgang. »Ich fürchte, dass sich da im Hintergrund was gegen Sie zusammenbraut«, fuhr er fort, während er mit schnellen Schritten voranging. »Ich geb Ihnen einen guten Rat: Passen Sie auf sich auf! Nicht, dass Ihnen auch noch was passiert!« Er wirkte tief beunruhigt.
Als sie vor dem Ausgangstor angekommen waren, drückte der Wärter neben der Tür auf verschiedene Zahlen. Innerhalb des großen Tores öffnete sich, wie von Geisterhand gesteuert, eine kleinere Tür. Grelle Sonnenstrahlen tasteten sich in das dunkle Viereck, als versuchten sie, Licht in das unheimliche Geschehen dahinter zu bringen.
Draußen schien eine andere Welt zu warten. Oder war das nur eine kurze Sinnestäuschung? Vielmehr ein Wunsch? Deckstein zog es ins Freie, in die warme Sonne, zu ihrem Auto. Er wollte möglichst schnell weg aus dieser grellen Sterilität der kalt ausgeleuchteten Gefängnisflure. Alex Sudhoff war schon auf dem Weg zu ihrem Wagen, als Deckstein im letzten Moment einfiel, was Rainer Mangold ihm aufgeschrieben hatte: Fragen Sie den Wärter unbedingt auch nach dem letzten Besucher in Genskes Zelle und nach der Akte zum Todesermittlungsverfahren.
»Sagen Sie mal«, sagte Deckstein und legte die Hand auf Wedelmeyers Arm. »Ich wollte Sie schon die ganze Zeit danach fragen, aber über diesen Anruf eben hab ich's vergessen. Hatte der Genske eigentlich Besuch? Irgendwelche Leute haben den doch bestimmt in der Zelle besucht. Und dann muss es da doch eine Akte geben, in der der Arzt die genaue Todesursache angegeben hat.«
»Sie meinen die Todesermittlungsakte? Gute Frage! Wo die steckt, weiß ich auch nicht. Aber da sind Sie schon auf dem richtigen Weg. Wenn Sie die in der Hand hätten, wüssten Sie eine ganze Menge mehr. Fragen Sie mal bei der Staatsanwaltschaft Hanau nach. Im Übrigen: Den Genske haben schon einige Leute besucht«, sagte der Aufseher. »Vernehmungsbeamte vom Landeskriminalamt, Staatsanwälte ... Wenn Sie die Besucherliste einsehen wollen, müssten Sie auch beim zuständigen Staatsanwalt anfragen, der hat die bestimmt noch in seinen Akten. Da gibt es einen ganz Netten, der auch an der Aufklärung des Falles beteiligt war. Ich kann Ihnen den Namen raussuchen. Schicke ich Ihnen.«
»Ich hab sie aus einem bestimmten Grund danach gefragt, Herr Wedelmeyer. Kann ja sein, dass wir da Namen von Leuten finden, die uns Hinweise auf Genskes mögliche Todesumstände geben. Besonders interessant wäre der Name des letzten Besuchers.«
»So ist es«, sagte Wedelmeyer in einem Ton, als wäre er nicht ganz bei der Sache. Er richtete sich kerzengerade auf und schob die Brust heraus. Das Jackett saß auf einmal stramm. Deckstein hatte den Eindruck, als stünde jemand hinter dem Aufseher und würde ihn mit einer Luftpumpe aufblasen.
Wedelmeyer sah an Deckstein vorbei. »Irgendwo müssen diese Schweine, die Sie und mich überwachen, doch stecken!«, flüsterte er und suchte mit den Augen die gegenüberliegende Häuserzeile ab.
»Vergessen Sie's, Herr Wedelmeyer. Das sind Profis. Die lassen sich bestimmt nicht sehen«, sagte Deckstein.
Kaum hatte er ausgesprochen, schoss hinter einem mittelgroßen Lkw, der auf dem Parkplatz vor den Häusern gestanden hatte, ein schwerer dunkler Mercedes mit quietschenden Reifen hervor. Zwei Männer mit dunklen Sonnenbrillen warfen einen kurzen Blick in Richtung des Gefängnistores, dann war der Wagen um die Kurve verschwunden. Es war so schnell gegangen, dass weder Deckstein noch Wedelmeyer das Kennzeichen erkennen konnten.
»Ich kann's nicht oft genug sagen: Seien Sie vorsichtig!«, sagte Wedelmeyer.
Deckstein verabschiedete sich mit einem kurzen Händedruck von dem Aufseher und ging mit schnellen Schritten zu dem Wagen, in dem Alex Sudhoff auf ihn wartete. Bevor er einstieg, wandte er sich noch einmal um und sah, dass Wedelmeyer ihnen noch mit sorgenvollem Blick nachsah, bis sich das Gefängnistor wie von Geisterhand gesteuert vor ihm schloss.
3
Bonn, Redaktion des Energy Report
Draußen wurde es bereits dunkel. Im Verlag des Energy Report, unweit der Bonner Oper, hüllten die italienischen Designerlampen Decksteins Büro in ein warmes Licht. Gerd Overdieck und Rainer Mangold hatten es sich im »italienischen Eck« bequem gemacht. Dieses von den Mitarbeitern mit untergründigem Spott so getaufte Ensemble im Büro des Chefredakteurs bestand aus drei leichten, schwarzen Ledersesseln und einer Zweiercouch. Produkte eines italienischen Nobeldesigners. Deckstein hatte seine Mitarbeiter zu sich gebeten, weil er ihnen von dem Interview mit Wedelmeyer und vor allem auch von dem seltsamen, irgendwie bedrohlichen Anruf berichten wollte.
Overdieck ließ seinen Blick durch den Raum wandern. »Ich muss schon sagen, Daniel, jedes Mal, wenn ich hier bei Ihnen sitze, fällt mir wieder auf, dass der Verleger aber auch wirklich die feinsten Teile in Ihr Büro gestellt hat«, sagte er. »Die sind derart fein und grazil, dass ich mich frage, ob er dabei auch an Leute wie mich gedacht hat.« Dabei wippte er mit seinen beinahe hundert Kilo ein paar Mal rauf und runter.
»Wenn Sie weiter hier so formidabel sitzen wollen, sollten Sie vorsichtiger mit dem Stück umgehen. Übrigens hat mir der Verleger diese schicken Teile erst hier reingestellt, nachdem ich ihn überzeugen konnte, dass wir Sie beide nur kriegen, wenn er für eine anständige Umgebung sorgt. Vorher haben wir hier auf Apfelsinenkisten gesessen«, sagte Deckstein und lachte. »Aber wir wollen fair sein, Gerd, Ihre Büros sehen auch nicht viel schlechter aus!«
»Ja, ja, stimmt schon. Ich muss zugeben, da kann man ganz gut darin leben«, räumte Overdieck ein und zwinkerte Mangold zu. »Ich benehme mich jetzt auch anständig«, fügte er schmunzelnd hinzu, »und setz mich richtig hin.« Mit einer vorsichtigen Bewegung richtete er sich gerade in dem Sessel auf und legte die Hände wie eine Novizin zusammengefaltet in den Schoß.
»Ich wollte eigentlich mit Ihnen nicht über unsere Büroausstattung diskutieren, sondern kurz berichten, wie das Interview gelaufen ist«, sagte Deckstein.
»Noch schnell ein Wort vorweg«, unterbrach ihn Overdieck. »Muss einfach sein.« Er drehte sich zur Seite und ließ seine Augen über die Bilder an den Wänden schweifen. »Wenn mich mein Eindruck nicht täuscht, wird Ihr Büro auch immer mehr zu einer Galerie für die, zugegeben, tollen Bilder Ihrer Tochter.«
»Da bringen Sie mich auf eine Idee, Gerd. Bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber wir sollten jetzt doch ...«
»Studiert sie eigentlich immer noch an der Kunstakademie in Berlin?«
Rainer Mangold stellte in dem Augenblick seine Kaffeetasse mit solch einem Schwung auf die Untertasse, dass es klirrte. Deckstein und Overdieck zuckten zusammen.
»Ach, komm, Taps, hör auf zu schleimen«, fuhr ihn Mangold unwirsch an. »Daniel hat doch gerade gesagt, dass es Wichtigeres zu besprechen gibt.«
»Kein Schleimen, Schnüffel. Du verstehst eben nichts von Kunst und ...« Overdieck kam nicht dazu, weiterzusprechen. Mangold hob die Hand auf eine Weise, die ihn sofort innehalten ließ.
»Was ist los, Rainer? Sie sind heute irgendwie komisch«, sagte Deckstein.
»Ja, ich weiß auch nicht. Diese ganze Geschichte, an der wir nun schon monatelang arbeiten, hinterlässt wohl bei mir ihre Spuren. Ich bin inzwischen fast süchtig nach Süßem«, erklärte Mangold.
»Nichts Neues für uns, Rainer«, spöttelte Overdieck.
»Ist aber wirklich so. Ich brauche mehr Nervennahrung als sonst«, sagte Mangold und fuhr an Deckstein gewandt fort: »Vor allem, wenn der Taps hier solche Sachen erzählt. Haben Sie nicht für einen ängstlichen Menschen noch ein paar Kekse hier rumliegen?«
»Mensch, ich dachte, du wolltest was Wichtiges sagen! Und überhaupt, du riechst doch sonst alles«, brummte Overdieck. »Da links, direkt vor deiner Nase, steht auf dem kleinen italienischen Designer-Glastisch eine ganze Schachtel.«
»Lass gut sein, Gerd«, sagte Deckstein. »Die letzten Monate waren wirklich ein Schlauch. Manch einer hätte uns für bekloppt gehalten, so wie wir an der Geschichte gearbeitet haben. Wie die Besessenen. Tag und Nacht, hätte ich fast gesagt.«
Deckstein gab den beiden einen kurzen Überblick über das, was der Aufseher gesagt hatte. Vor allem Wedelmeyers Darstellung, wie sich Genske umgebracht haben sollte, schilderte er ihnen ausführlich. Und dann kam er zu dem ominösen Anruf. »Wedelmeyer ist überzeugt, dass wir beobachtet und womöglich auch abgehört werden.
Der hat uns total nervös gemacht mit seinem Gehabe. Bevor wir nach dem Interview losgefahren sind, haben Alex und ich das ganze Auto nach versteckten Wanzen abgesucht.«
Mangold und Overdieck sahen sich betroffen an. Bevor sie etwas sagen konnten, klingelte das Telefon auf Decksteins Schreibtisch.
»Moment, ich geh mal gerade dran«, sagte Deckstein und hielt den Zeigefinger vor den Mund. Gleichzeitig nahm er das Gespräch auf dem schnurlosen Telefon an, das auf dem Beistelltisch neben ihm lag.
»Deckstein …, ach, Ulla, du bist es. Wer ist dran? Was sagst du, der ist ungehalten?« Er warf den beiden anderen einen bedeutungsvollen Blick zu. »Moment, ich stell gerade mal auf laut. Gerd und Rainer sollen mitbekommen, was der Würselen zu sagen hat. Okay, funktioniert. Jetzt kannst du durchstellen … Deckstein«, sagte er in die Sprechmuschel.
»Schön, dass ich Sie gleich erreiche, Herr Deckstein. Ich muss unbedingt mal mit Ihnen sprechen. Bei mir klingelt seit heute Morgen ununterbrochen das Telefon. Die Vorstände von unseren Mitgliedsfirmen rufen mich an und beschweren sich über Sie. Mein Gott, lassen Sie doch diese alten Kamellen ruhen!«
Overdieck und Mangold erstarrten. Sie hatten die Stimme erkannt – Matthias Würselen, der Präsident des Deutschen Atomvereins.
»Herr Mangold und sein Kollege, der Herr Overdieck, waren ja kürzlich auch bei mir und haben mir Löcher in den Bauch gefragt. Halt ich ja aus. Bei mir beißen die ja, wie Sie wissen, auf Granit. Aber seit Wochen, was sage ich, seit Monaten nerven die beiden nicht nur einige Vorstände unserer Mitgliedsfirmen mit ominösen Fragen zu diesem alten Skandal, auch aus Regierungskreisen gibt es immer wieder Anfragen. Die Leute wollen von mir wissen, ob da noch was auf sie zukommen könnte ...«
Deckstein spürte förmlich die Erregung des Präsidenten. Der schneidende Unterton überdeckte das Vibrieren in seiner Stimme nur unzureichend. »Sie wissen doch auch, wo Menschen arbeiten ...«
Würselen hielt inne und räusperte sich. Er musste bemerkt haben, dass er dabei war, sich zu verhaspeln. Schließlich hatte die Atomwirtschaft immer wieder betont, dass sie über ein absolut sicheres Konzept verfüge. Der Einzelne könne gar keine krummen Sachen machen. Ein wenig verbindlicher fuhr er fort: »Herr Deckstein, Sie machen doch ein professionelles, modernes Blatt. Wird auch bei uns in der Branche viel gelesen. Warum wollen Sie sich unbedingt den Ruf kaputtmachen? Der Skandal ist doch längst begraben, vergessen. Der modert ja schon richtig vor sich hin ...«
Deckstein ließ ihn nicht ausreden.
»Die Sache hat seit damals ihren üblen Geruch keineswegs verloren, Herr Würselen«, sagte er kühl. »Vergessen Sie nicht, da sind Menschen in Ihrer Branche auf brutale Art und Weise umgekommen. Ich frage Sie: warum? Weil sie zu viel wussten? Damals ist Bombenstoff verschwunden. Wohin? Nach Libyen, Pakistan und von da zu islamistischen Terrorgruppen? Bis heute will niemand aus Ihren Kreisen angeblich Genaueres wissen oder gewusst haben.«
»Das wurde doch alles aufgeklärt und ...«, warf Würselen ein.
»Aufklärung nennen Sie das?«, unterbrach Deckstein den Atomvereinspräsidenten. »Der Skandal wurde genau so wenig aufgearbeitet wie der von dem atomaren Zwischenendlager Asse. Keiner weiß so richtig, was es eigentlich sein oder werden soll. Erst heute, Herr Würselen, erst heute, nach mehr als zwanzig Jahren, kommt scheibchenweise zutage, dass in dem sogenannten Zwischenendlager in Niedersachsen kiloweise Plutonium, also Stoff für etliche Atombomben lagert, den Kontrollen entzogen und ...«
»Das behaupten Sie«, ging Würselen dazwischen.
»Nein, Herr Würselen, Sie wissen genau so gut wie ich, dass dies das Ergebnis der ersten stichhaltigen Bestandsaufnahme durch Experten ist. Das belegen auch die Unterlagen der Staatsanwaltschaft, die den Hanauer Atomskandal untersucht hat. Ich erinnere nur mal an Genske. Der Name sagt Ihnen noch was?«
»Aber natürlich. Das war doch der, der sich damals ...«
»Vielleicht wusste er auch nur zu viel. Aufgrund unserer bisherigen Rechercheergebnisse stellen wir uns die Frage, wie weit Ihre Branche geht, um ihre Ziele zu erreichen.«
Deckstein zog die Augenbrauen hoch und warf Overdieck und Mangold einen gespannten Blick zu.
»Ich habe gedacht, ich könnte Sie zur Vernunft bringen. Aber ...« Würselen legte auf.
»So nervös hab ich den Mann vielleicht das letzte Mal während der großen Anti-Atomkraft-Demos vor Jahren erlebt«, sagte Deckstein.
»Dieser scheinheilige Klugscheißer!«, empörte sich Over- dieck. Er schaukelte so vehement in seinem Sessel, dass Deckstein ihm einen um das Möbel besorgten Blick zuwarf. »Genske und Co. haben mit Wissen ihrer Bosse den Bombenstoff ins belgische Atomzentrum Mol geliefert. Nach allem, was wir bisher recherchiert haben, bin ich mir inzwischen ziemlich sicher, dass deren Chefs sogar die Strategie dafür entwickelt haben.«
»Und in Mol wurden die schon sehnsüchtig von den pakistanischen Atomwissenschaftlern erwartet«, ergänzte Deckstein. »Wie Sie wissen, kriegt die Atombombe aber erst mit Tritium die richtige Sprengkraft. Das haben die Hanauer auch dahin geliefert. Sabine und ich haben das recherchiert. Wir liefern diesen Teil zur Titelgeschichte dazu. Das war nicht nur ein ganz dickes, sondern auch ein ganz gefährliches Geschäft. Und über all das wusste der Genske zu viel. Auch deswegen sind wir uns sicher, dass mit Genskes Tod etwas nicht stimmt.«
Overdieck und Mayer sahen ihn entgeistert an.
»Waren die meschugge? Woher wissen Sie ...?«, fragte Mayer und tippte sich an den Kopf.
»Hinter dem Tritium waren damals auch einige Atommächte her«, erklärte Deckstein.
»Es ist einfach unfassbar«, empörte sich Mangold, »da taucht plötzlich irgendwo kiloweise Plutonium auf und keiner wusste vorher, dass es das gibt! Das hatte niemand in den Büchern. Und dann behaupten diese Kerle in Wien von der IEAO oder auch diese Atomkontrolleure von Euratom, ihnen entginge aber auch gar nichts! Zumindest die hätten wissen müssen, wie viel Plutonium ins Lager Asse gekippt worden ist!« Mangold war außer sich. »Für mich steht fest, dass die überhaupt keinen Durchblick mehr hatten!«
»Die hatten noch nie einen, Schnüffel«, sagte Overdieck ruhig. »Im belgischen Mol sind Unmengen Tonnen an atomarem ›Abfall‹ unbemerkt verschwunden. Das zumindest steht hundertprozentig fest. Dieser sogenannte ›Abfall‹ war mit angereichertem Plutonium und Uran versetzt und behaftet. Glaubst du denn, deshalb wäre auch nur einer von der Regierung oder der Atomwirtschaft im Karree gesprungen? Oder wie das HB-Männchen unter die Decke gegangen? Nicht einer! Dass diese Mengen in dunklen Kanälen, vermutlich in Pakistan, versickert sein könnten, hat niemanden dort aufgeregt. Die waren ausschließlich mit dem Herunterspielen und Vertuschen der ganzen Sache beschäftigt.«
4
Bonn, Redaktion des Energy Report
»Immerhin bringen wir die Dinge mit unserer nächsten Titelgeschichte ja endlich auf den Punkt«, sagte Sabine. Sie war ein paar Minuten zuvor hereingekommen und hatte die letzten Sätze mitgehört.
»Da wird unseren Lesern mal plastisch dargestellt, dass diese Sauereien von damals unserem Land heute den größten GAU bescheren, ja, dass sie es, wenn's ganz dicke kommt, in den Abgrund stürzen können. Ich hab hier noch einen Vermerk von unseren damaligen Brüdern aus Ostberlin, der das alles bestätigt. Daraus geht im Übrigen auch ganz klar hervor, dass die Stasi über alles im Bilde war, was hier ablief. Die hatte dabei jede Menge Hilfe von Fachleuten aus dem Westen. Was die schreiben, trifft voll auf den Hanauer Skandal zu.« Sie setzte sich und blätterte in den Unterlagen, die sie in der Hand hielt. »Ich zitiere mal:
›Zugleich wurde … von mehreren Sachverständigen festgestellt, dass es in der BRD keine Spaltstoff-Echtzeitüberwachung gegeben habe, dass der Sicherheitsgrad für die Entdeckung einer illegalen Spaltstoffabzweigung bei 90 bis 95 liege … So sei der Kenntnisstand der staatlichen Behörden über den tatsächlichen Spaltstoffbestand … bisher gering gewesen. Daher hätten die Behörden nach Bekanntwerden des Atommüllskandals nicht gewusst, welches Spaltmaterial sich wo und in welchen Mengen befand.‹«
»Da wurde doch an höchsten Stellen mit gezinkten Karten gespielt«, sagte Mangold und zuckte angewidert die Schultern.
Sabine nickte ihm zu. »Dann haben die in dem Vermerk auch noch darauf hingewiesen, ich zitiere noch mal: ›… dass die Betreiber von Nuklearanlagen mit Unterstützung der BRD-Regierung eine Intensivierung der Überwachungs- und Kontrollsysteme ablehnen‹. Da haben wir's! Es muss doch einen Grund geben, warum die so was abgelehnt haben.«
»Unsere Recherchen haben ergeben, dass der Genske eigentlich nur die Gallionsfigur war«, schaltete sich Overdieck ein. »Der hat zwar bei diesen tödlichen Geschäften mitgemischt, aber die Strategen saßen ganz oben. Noch mal, ich sage ganz oben! Was die damals abgezogen haben, riecht nach großem Geschäft. Da stand eine ausgefeilte Strategie dahinter. Ich bin sicher, selbst die in Bonn wussten, was da lief. Bezahlen musste nachher allerdings, neben ein paar anderen, der Genske ...«
»Mit einem grässlichen Tod.« Rainer Mangold malte ein Kreuz in die Luft.
»Aber wir wissen immer noch nicht genau, wie der umgekommen ist«, sagte Deckstein. »Unglaublich, dass es da grundlegende Widersprüche gibt. Ich werd den Eindruck nicht los, dass da eine Menge vertuscht worden ist. Ich bin mir sicher, dass auch der Tod eines bekannten Politikers und eines Topbankers in diesem Zusammenhang zu sehen sind. Und zumindest bei dem Tod des Politikers durften die wirklichen Hintergründe nicht bekannt werden.«
Deckstein sah in die überraschten Gesichter seiner Mitarbeiter.
»Parallel zu unserer Arbeit an der Titelgeschichte haben Sabine und ich eigene Recherchen gestartet«, fügte er hinzu. »Aufgrund unserer bisherigen Ergebnisse sind wir ziemlich sicher, dass wir am Ende unserer Titelstory den Schleier über den Tod von Uwe Barschel, dem damaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, zumindest ein gutes Stückchen weiter lüften können. Der Tod von Genske und von Barschel, um den geht es, würde in einem ganz anderen Licht erscheinen. Sobald wir fertig sind, werden wir Ihnen unsere Story zu den Tritiumgeschäften vorlegen, die da gelaufen sind«, schloss Deckstein mit einem Blick in die Runde der Kollegen. In Overdieck brodelte es.
»Diese Soldaten in Nadelstreifen sollte man ...« Weiter kam er nicht, denn Mangold übertönte ihn. »Soldaten in Nadelstreifen, Taps, das ist es doch!«, rief er.
»Nicht nur Würselen, das sind alles Soldaten in Nadelstreifen. Davon haben wir nicht nur in dieser Branche eine ganze Armee. Überall, wo es um Geschäfte geht, sind Mafiosi oder Soldaten an vorderster Front im Einsatz!«
Mangold sprang mit einem Ruck auf. Er stand stramm, salutierte mit einem martialischen Ausdruck im Gesicht und rief laut:
»Ich verlange blinden Gehorsam!«
Eine lange dunkle Locke fiel ihm in die Stirn und erhielt ihm den Ausdruck der wilden Entschlossenheit, als er sich wieder setzte. »Schnüffel, du musst unbedingt zum Kabarett«, sagte Overdieck grinsend.
»Stichwort blinder Gehorsam, Rainer, erinnern Sie sich noch an die Prozesse der Deutschland AG? Oder sind Sie deswegen drauf gekommen?«, fragte Deckstein.
»In einem der Prozesse gegen die besagte AG ist da doch noch eine pikante Sache bekannt geworden. Angeblich hat der oberste Feldherr des Unternehmens einen seiner Manager aufgefordert, er solle sich wie ein Soldat der Deutschland AG aufführen und den ihm erteilten Auftrag einfach ausführen. Der Mann hatte ihm gegenüber Zweifel an gewissen Korruptionsmethoden des Konzerns geäußert. Ich weiß noch genau, wie alle im Gerichtssaal bei diesem Satz den Atem angehalten haben.«
Overdieck schlug mit seiner riesigen Rechten auf die Lehne des Ledersessels. »Ich bin mir sicher«, verkündete er, »dass Würselen und Co. erstmal versuchen werden, unseren Verleger mit Anzeigen zu ködern.«
»Und als Nächstes werden sie vermutlich den einen oder anderen lieben Kollegen gegen uns in Stellung bringen!«, ereiferte sich Mangold.
»Klar, die Bosse werden denen kräftig was rüberschieben.« Overdieck machte eine Handbewegung, als zähle er Geldscheine. »Wie das alles gelaufen ist, darüber hat doch die taz gerade berichtet. Journalisten wurden zu aufwendigen Pressereisen eingeladen. Wissenschaftler wurden für gezielte Studien bezahlt. Politiker wurden für Lobhudelei auf die Atomkraft eingekauft. Die Atomlobby hat die Laufzeitverlängerung durch die schwarz-gelbe Regierung mit einer Agentur Jahre im Voraus minutiös vorgeplant. Gott sei Dank ist das jetzt endlich mal schwarz auf weiß belegt! Aber davon mal abgesehen, manche Kollegen werden aber auch einfach nur bissig, weil sie nicht verkraften können, dass unser kleines Magazin so eine Riesenstory an der Angel hat. Sie wissen doch, Kollegenneid ...«
Rainer Mangold hielt es wieder nicht in seinem Sessel. »Zusammen packen wir die doch an den ...« Er zögerte einen Moment, ordnete in Gedanken einige Locken. Dann erklärte er mit staatsmännischer Miene: »Wo wir die packen, das müssen wir noch im Ausschuss besprechen. Das haben wir noch nicht festgelegt.«
Overdieck war anzusehen, dass es ihm schwerfiel, ernst zubleiben. »Gut, machen wir. Verschieben wir die Entscheidung in den Ausschuss«, sagte er und kicherte in sich hinein.
Mangold hatte sich wieder hingesetzt. »Wir werden die schon an ihren empfindlichen Stellen treffen, Taps. Ich bin allerdings auch sicher, dass sich manch einer von den Kollegen auf unsere Seite schlagen wird, den wir bisher nicht zu unseren Freunden gezählt haben. Alte Erfahrung meinerseits ...«
»Ach, wenn wir uns nur um die lieben Kollegen Gedanken machen müssten«, spöttelte Overdieck. »Ich schätze mal, dass die Konzerne ganz gezielt eine ganze Armee von Soldaten im feinen Tuch gegen uns in Stellung bringen werden. Möglicherweise hat auch dieser geheimnisvolle Anruf bei dem Wedelmeyer damit zu tun.«
Er sah Deckstein an, der die Schultern zuckte. »Weiß man's, Gerd? Nach diesem Gespräch mit Würselen bin ich eigentlich auf alles gefasst.«
»Wart mal ab, Gerd, wenn diese Dreizentnerfigur von dem Essener Atomkonzern, hinter der sich die meisten Atombosse verstecken könnten, dir einen Besuch abstattet«, warf Mangold grinsend ein.
»Wenn der mit seinen über zwei Metern in deiner Bürotür steht, siehst du noch nicht mal dessen ganze wutentbrannte Visage im Türrahmen. Nur den verzerrten Mund mit den gebleckten Beißerchen hast du dann im Blick. In dem Moment wirst wahrscheinlich selbst du einsehen, dass es größere Mächte gibt als dich. Erinnere dich, Taps, ein Kollege von der ZEIT hat sinngemäß über den Mann geschrieben, wenn sich irgendwo auf der Welt ein Grizzly entschieden hätte, Mensch zu werden, dann sähe der so aus wie der, über den wir gerade herziehen.« In Mangolds Augen blitzte der Spott.
»Schnüffel, noch mal, ich hab doch eben schon gesagt, dass ich froh bin, dich nicht zum Gegner zu haben. Aber ich zähle natürlich auf deine Hilfe, wenn dieses Monster hier auftauchen sollte«, sagte Overdieck gutmütig. »Der wird nicht viel Freude an seinem Auftritt haben, wenn du den von hinten kräftig in die Wade beißt … Höher kommst du bei dem ja nicht!« Er brach in schallendes Gelächter aus.
»Bald ist Schluss mit lustig«, sagte Deckstein nachdenklich. Er zögerte einen Moment, bevor er weiter sprach, während ihn Mangold und Overdieck wieder mit ernst gewordenen Gesichtern ansahen.
»Mir ist da noch was ganz anderes zum Deutschen Atomverein eingefallen«, fuhr er fort. »Neulich hat doch ein Spitzenpolitiker der Atomausstiegspartei ein vernichtendes Urteil über diesen Club gefällt. Wenn ich mich recht erinnere, war der da sogar noch als Atomminister im Amt. Können Sie sich noch daran erinnern?«
Overdieck und Mangold schüttelten die Köpfe.
»Er hat den Verein als Propagandazentrale der Atomkonzerne bezeichnet«, sagte Deckstein, »die wie kaum eine andere Institution für das bewusste Verschweigen, Verdrängen und Verharmlosen der Gefahren, die mit der kommerziellen Nutzung der Atomenergie verbunden sind, stehe.« Er machte eine kurze Pause, bevor er weitersprach.
»Noch mal, es wäre ein schwerer Fehler, diese Leute zu unterschätzen. Der Würselen ist in der Politikszene hervorragend vernetzt. Und ein nicht unerheblicher Teil davon will den geplanten, totalen Atomausstieg möglichst noch verhindern. Auch die Atomunternehmen werden noch alle Register ziehen, bevor sie endgültig die weiße Fahne hissen. Deshalb bin ich absolut nicht sicher, ob es wirklich bei dem Beschluss des Bundestags bleibt, in den nächsten zehn Jahren auszusteigen. Ich gehe davon aus, dass das Desaster in Fukushima schon bald wieder vergessen sein wird.«
Overdieck senkte den Kopf und sagte nach einer Weile: »Ich hab lange überlegt, ob ich drüber sprechen soll. Ich hab diese Geschichten, die da früher immer wieder kursierten, nie so richtig ernst genommen. Hab gedacht, da will sich jemand wichtigtun und ...«
»Das ist mir alles viel zu geheimnisvoll, Taps. Wovon redest du?« unterbrach ihn Mangold.
Overdieck sah aus, als krame er in den Tiefen seines Gedächtnisses und müsse sich mühsam erinnern. »Weiß du nicht mehr? Während der großen Anti-Atomdemos wurde hinter vorgehaltener Hand immer wieder dieser Satz des bekannten Pariser Atompioniers mehr geflüstert als gesagt: ›Ils sont capables de tout!‹ Der Mann hatte inzwischen wohl Angst vor der eigenen Branche bekommen.«
»Ach, diese Geschichten meinst du«, sagte Mangold. »Klar erinnere ich mich: Sie sind zu allem fähig! Dieser Satz wurde ja erst richtig bedeutsam, als es zu einigen ominösen, ungeklärten Todesfällen gekommen war. Da sollen doch Autos von Atomgegnern manipuliert worden sein. Diese Todesfälle sind damals tatsächlich nie richtig aufzuklären gewesen. Beerdigt nach der Devise: Schwamm drüber.«
»Ich bin Ihnen dankbar, Gerd, dass Sie diese Geschichten zur Sprache gebracht haben«, sagte Deckstein. »So brauche ich das nicht mehr zu tun und Gefahr laufen, als Angstmacher zu gelten. Aber diese Erkenntnis gilt aus meiner Sicht auch heute noch: ›Ils sont capables de tout‹«, schloss er düster.
Als sich Mangold und Overdieck verabschiedet hatten, ging Deckstein auf Sabine zu.
»Noch Lust auf ein Gläschen Wein?«, fragte er und musterte seine attraktive Stellvertreterin. Sabines volles blondes Haar, das sie mal offen, mal hochgesteckt trug, umrahmte ein markantes Gesicht mit schmalen, sinnlich geschwungenen Lippen.
Sabine nickte. »Wäre gut, wenn wir das alles noch mal in Ruhe Revue passieren lassen.«
»Find ich auch. Wir fahren nach Hause, du stellst dein Auto ab und steigst bei mir ein«, schlug Deckstein vor. Beide wohnten in der Kölner Altstadt nur eine Straße voneinander entfernt.
»Hoffentlich hat die Katie noch ein Plätzchen für uns. Bis gleich! «, sagte Sabine, als sie in der Tiefgarage des Verlagsgebäudes in ihren schwarzen Mini stieg, und warf ihm eine Kusshand zu.
Als Sabine Blaschek und Daniel Deckstein den schummerigen, von Stimmengewirr erfüllten Schankraum ihrer Stammkneipe betraten, tönte ihnen der Hit eines jeden Abends hier entgegen, und sie fühlten sich sofort wie zu Hause. »Däm Jupp sing Frau Katie« war eine Eigenkomposition des jungen Pianisten mit den gegelten dunklen Haaren, der sein »Liedsche« gleich mehrmals am Abend vortragen musste. Es war in diesem Lokal raketengleich auf Rang eins hochgeschossen und zum meist gewünschten Song geworden.





























