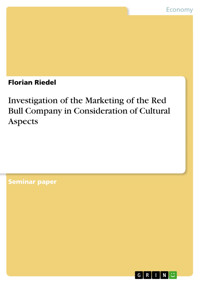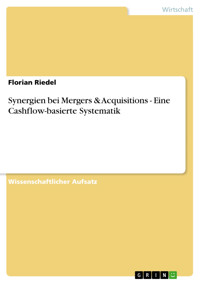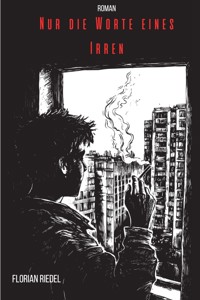
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Werdau, Sachsen – Dunkeldeutschland. Wo Naziparolen die Fassaden leerer Bauten zieren und Faschos durch die Straßen ziehen, muss sich Nico entscheiden: mitmachen, schweigen oder kämpfen? Sich entgegenzustellen bedeutet, alte Freunde zu verlieren und zur Zielscheibe zu werden. Doch wer das Unrecht ignoriert, macht sich mitschuldig. In der Tristesse der Kleinstadt findet Nico einen unerwarteten Mitstreiter. Aber neben dem Kampf gegen rechte Ideologien führt Nico auch einen stillen Kampf in sich selbst. "Nur die Worte eines Irren" ist keine Geschichte, die Mut macht. Dieser Roman liest sich wie ein Hilfeschrei aus einer ostdeutschen Kleinstadt, der uns zwingt, hinzusehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 161
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Florian Riedel
Nur die Worte eines Irren
Inhalt
Kapitel 0: Feuer
Kapitel I: Keine Liebe
Kapitel II: Wir gegen Alle
Kapitel III: Liebe
Kapitel IV: Alle gegen uns
Kapitel V: Asche
Impressum/Content Warnung/Danksagung
Kapitel 0: Feuer
Wen kümmert es, warum, wenn sich alle einig sind, dass es keinen Grund geben darf? Schlechtes erwächst aus schlechten Absichten, die kein Gehör finden dürfen. Manche will man nicht verstehen und manche sollen nicht verstanden werden. Besser ist es, man hört nicht zu, als dass giftige Zweifel gesät werden, welche die Illusion dieser goldenen Plastikwelt infrage stellen.
Wäre das Schlechte verhinderbar, würde man sich mit dem befassen, woraus es erwächst? Die Frage stellt sich nicht. Es ist einfacher, dem nicht in die Augen zu sehen, die Ohren zuzuhalten und statt zu verstehen, zu verachten. Solange dies jedoch so bleibt, werden noch viele als Irre abgetan werden müssen.
Und wenn ihr diesen Text lest, bin ich nicht mehr als Asche. Gekommen in Frieden, gegangen in Feuer. Jetzt seht ihr mich nur als irgendeinen Irren. Einer, der sich über die Grenzen des Erlaubten, des Vernünftigen hinweggesetzt hat, für den kein Verständnis mehr übrigbleibt, dessen Wort nichts wert ist und den es bedingungslos zu hassen gilt. Ein Irrer, der weder Grund noch Verstand besaß und bei dem es unausweichlich war, dass er so irre handelte, wie es eben Irre tun.
Nur zu gerne wollt ihr glauben, dass Verrückte einfach aus dem Boden sprießen. Niemand trägt Schuld, außer sie allein. Doch lasst mich euch zeigen, dass ihr Unrecht habt.
Ich habe gesehen, wie ihr weggesehen habt. Was ihr getan und nicht getan habt, in dieser Welt, in der das Irre zur Vernunft verklärt wird und alle, die nicht im gemütlich blinden Gleichschritt mitlaufen wollen, als lästiger Abschaum abgestoßen werden.
Mein Name war Nico R. - nur noch ein Name, der keine Person, sondern ein Monster beschreibt. Jemanden, der vielleicht mal Mensch war, doch seine Chance vertan hat.
Entsorgt meine verbrannte Leiche, findet meine Worte und verunglimpft, was ich niedergeschrieben habe. Doch auch wenn ihr mich für irre haltet, auch wenn ich nun nicht mehr als Asche bin, diese Worte werden bleiben, selbst wenn ihnen niemand glauben will.
Kapitel I: Keine Liebe
Das schwache Licht der Straßenlaternen bestrahlte den seichten Nieselregen, der auf die unbelebten Straßen der Stadt fiel. Hier in Werdau, dieser jämmerlichen Kleinstadt, musste man wohl froh sein, dass es nicht Pisse vom Himmel regnete. Die Tropfen brannten auf meinem Kopf wie Säure. Ich zog mir meine Kapuze über und suchte Schutz unter dem Dach einer ramponierten Bushaltestelle.
Eiskalt war es. Mit zittrigen Händen kramte ich meinen Pueblo-Tabak aus der Hosentasche und entzündete den halben Joint, der sich in meiner Tabaktüte versteckte.
Es war Anfang September. Vor einem Monat war ich achtzehn geworden und doch war ich noch hier, im sächsischen Hinterland, in Werdau, der Stadt, die ich nur ungern Heimat nannte. Nichts wollte ich mehr, als aus diesem Loch zu fliehen, doch wie gelähmt trat ich auf der Stelle. Wie sollte man auch wegkommen, wenn man von den Almosen seiner Eltern abhängig war, deren Horizont nur bis zum Nachbarort reichte? Für sie war es in Stein gemeißelt, dass ich deren kleine Welt nicht zu verlassen hatte, dass ich hier leben, arbeiten und sterben würde, wie auch ihre Eltern und deren Eltern davor.
Mein Joint schmeckte nach Pappe. Ich warf ihn auf den Boden und schaute an mir hinab. Zu meinen Füßen bildeten sich tausende kleine Flüsse in den Rissen des Asphalts. Sie flossen zusammen zu einer großen Pfütze, in welcher sich mein müdes Gesicht spiegelte. Mit Abscheu blickte ich mir in die Augen. Ich spuckte ins Wasser und meine Fratze zerfloss.
Der Regen legte sich. Langsam trat ich hinaus und wandelte die dunkle Straße entlang. Ich ging vorbei an leerstehenden Baracken. Aus dem Augenwinkel sah ich ein Hakenkreuz in schwarzer Farbe, unsauber an eine Fassade gesprüht. Es entzog sich fast schon meiner Wahrnehmung.
Die Graffiti an den Hauswänden ließen erahnen, wie die Menschen dachten, die dahinter wohnten. Es war kein Geheimnis, dass das Gespenst des Rechtsextremismus in den sächsischen Provinzen umging. Offensichtlich für alle, doch unsichtbar für die, die nicht daran glauben wollten.
Die Stadt war totenstill. Das Einzige, das verriet, dass hier noch Menschen lebten, waren die Scherben zersprungener Bierflaschen und die umgeworfenen Straßenschilder, die mir den Weg zur Linde ebneten.
Die Linde. Der Dorfclub von Werdau. Schon bevor man diese Spelunke betrat, nahm man sich vor, nie wieder hinzugehen. Schlechte Musik, geistlose Menschen und lieblos organisierte Events - aber das Einzige, das Werdau an einem Freitagabend bieten konnte.
Aus der Ferne hörte ich grölende Jugendliche, die sich den nötigen Pegel ansoffen, um in diesem Schuppen Spaß haben zu können. Das schrille Geräusch einer zerspringenden Flasche hallte durch die Häuserwände.
Abscheu breitete sich in mir aus. Nicht zuletzt gegen mich selbst, denn auch ich war wieder hier. Der Grund, warum ich mir dieses traurige Spektakel antat, saß eine Straßenbreite entfernt auf einem umzäunten Kinderspielplatz: zwei meiner Freunde, noch aus meiner Oberschulklasse, für die der freitägliche Lindebesuch und der dazugehörige Suff eine wöchentliche Tradition war.
Ich bog ein und ging den Zaun entlang. Da hörte ich bereits das laute Knattern von Dennis` Simson und erkannte Robin, der am Pfeiler eines Klettergerüstes lehnte. Seine Zigarette schnipste er lässig in den Sand.
„Ey, Linker!“, rief er mir zur Begrüßung entgegen, als ich den Platz betrat.
„Linker“, so nannten sie mich. Manchmal auch „Zecke“. Ein Spitzname, den mir Robin gegeben hatte, dieser fette Idiot. Etwas Originelleres hätte man von so einem geistlosen Mitläufer nicht erwarten können. Lustlos begrüßte ich ihn mit einem schwachen Handschlag.
Dennis, der auf seinem mit Freiwild-Stickern verzierten Moped saß, ließ sich die letzten Tropfen einer Sektflasche in den Rachen laufen. Durch seine geöffnete Jacke erkannte man den Schriftzug eines Thor-Steinar-Shirts.
Die guten Zeiten unserer langen Freundschaft schienen vorbei zu sein. Früher, als man die zerfallenen Baracken der Stadt erkundete oder auf dem Bolzplatz Elfmeterschießen übte, gab es noch keine Politik. Zumindest schien es so. Rassistische Witze zu reißen, den Hitlergruß zu zeigen oder das Hetzen gegen Schwarze waren nur kindliche Spielereien, bis sie ernst wurden. Es wäre eine Lüge, wenn ich behaupten würde, ich hätte nie mitgemacht.
Dennis setzte die Sektflasche ab, schmiss sie auf die Wiese und wischte sich die letzten Tropfen des Gesöffs mit dem Ärmel von den Lippen.
„Ich hoffe, du hast an Bier gedacht“, begrüßte er mich, schüttelte sich und spuckte angewidert auf den Boden. „Dieses Fotzengesöff kann ich mir echt nicht mehr antun.“
„Sorry, hab überall gesucht, aber hatte nichts mehr zu Hause“, antwortete ich.
„Was?“, mischte sich Robin augenblicklich wütend ein. Mit seinem massigen Körper drängte er sich vor mich. „Du bist doch schon wieder bekifft!“
Robin packte mich am Kopf, um mittels eines eindringlichen Blickes in meine Augen seine Vermutung zu bestätigen. Sofort befreite ich mich aus seinen schwitzigen Händen, worauf er nur mit Kopfschütteln reagierte.
„Warum rauchst du die ganze Zeit dieses Verliererkraut, statt mal ordentlich zu saufen? Wo bleibt deine ostdeutsche Tugend?“, fragte er in einem Ton, der klang, als würde er eine ernst gemeinte Antwort erwarten.
„So eine Scheiße“, murmelte Dennis genervt. „Ich kümmere mich darum, dass wir heute Abend etwas Spaß haben.“
Dennis zog sein Handy aus der Tasche, begann eine Nummer zu wählen und verschwand hinter dem Klettergerüst.
Angespannt setzte ich mich neben Robin auf die Tischtennisplatte. Auch wenn ich ihn nicht ansah, spürte ich die vorwurfsvollen Blicke, die er mir zuwarf. Ich wartete nur darauf, dass er seiner Verachtung durch stumpfe Parolen Ausdruck verleihen würde, aber etwas anderes erregte seine Aufmerksamkeit. Eine Gruppe angetrunkene Araber betrat laut lachend den Spielplatz und machte sich auf der Bank neben unserer Tischtennisplatte breit.
„Unser Land wegzunehmen, reicht denen wohl nicht?“, sagte Robin gehässig. „Jetzt bedrängen die uns auch noch hier. Diese Kanaken!“
„Was juckt`s dich? Die tun hier doch das Gleiche wie wir“, flüsterte ich, doch bereute zugleich überhaupt etwas gesagt zu haben.
Aufgebracht spuckte mir Robin Worte ins Ohr: „Das ist wieder typisch! Für uns scherst du dich `nen Dreck, aber Merkels Freunde verteidigst du? Dann stell dich doch zu Merkels-, oder eher, deinen Freunden!“
„Alter, was ist dein verdammtes Problem!“, fuhr es aus mir heraus.
Robin grinste mir entgegen. Genau das, mich zu provozieren, wollte er erreichen. Seinen wurstigen Zeigefinger setzte er mir direkt auf die Brust und schaute mir bedrohlich in die Augen.
„Du hältst dich für so schlau“, sagte er. „Du denkst, du bist ein besserer Mensch und vergisst, dass du nicht zu denen gehörst.“
Ich reagierte nicht. Darauf einzugehen hätte es nur noch schlimmer gemacht. Jedes Wort war wie Benzin, das die Flammen seiner Rage noch weiter in die Höhe trieb. Ich wusste, eine echte Diskussion konnte ich nicht erwarten. Oft genug hatte ich es versucht, doch jedes Argument prallte an Robins starrer Hülle ab. Bei seiner Einstellung ging es nicht um Fakten oder Meinung. Es ging um Identität und Macht. Statt ein Niemand zu sein, war er Deutschland. Der überlegene Deutsche, der mehr wert sei als alle anderen.
Der Abend war noch jung. Es war erst halb zehn, doch ich hatte schon genug. Ich fühlte mich fehl am Platz bei diesen Leuten, die vielleicht mal meine Freunde waren, mich aber behandelten, als wäre ich ihr kaputtes Spielzeug.
Zigarette für Zigarette steckte ich mir an, während sich Robin und Dennis um das letzte Bier stritten und dabei keine Gelegenheit ausließen, einen rassistischen Kommentar über einen der Araber zu machen. Aber ich schwieg. Ich ging nicht weg. Ich ertrug es.
Wortlos auf die Wiese starrend, saß ich auf der Tischtennisplatte, als sich mit dem lauten Quietschen der Bremspedale derjenige ankündigte, den Dennis wohl mit dem Handy kontaktiert hatte. Ich war überrascht, welche Gestalt dort von dem ramponierten Fahrrad abstieg.
Es war Johnny. Ein schwarzer Mann, etwa Mitte dreißig. Fast jeder in Werdau kannte ihn. Ob das sein echter Name war oder wie er wirklich hieß, wusste niemand. Alle nannten ihn nur Johnny, wie Johnny Knoxville, weil von ihm ein Video existierte, in dem er seinen Kopf hundertmal gegen eine Hauswand schlug.
Er sah beängstigend aus. Sein Kopf war kahlgeschoren und die Zähne in seiner Fresse waren entweder kohlschwarz oder ausgefallen. Alles in Allem wirkte er nicht wie ein Mensch, mit dem man sich streiten wollte.
Als Dennis und Robin ihn sahen, stürmten sie auf ihn zu.
„Sieg Heil!“, begrüßten sie sich fast synchron und Johnny begann, als wäre es das Normalste der Welt, über die „Kanaken“, die nur ein paar Meter von uns entfernt saßen, herzuziehen. Er bezeichnete sie als „ekelhaft“ und „schrecklich stinkend“ und forderte lauthals, man sollte alle in einen Flieger setzen und abtransportieren. Wohin und was mit ihnen geschehen würde, wäre ihm egal.
Johnny war in den Augen meiner Freunde nicht wie die anderen Migranten. Zwar war er schwarz, aber für sie fast schon Deutscher. Er war so etwas wie ein guter Ausländer. Vielleicht lag es daran, dass er gegen die „schlechten Ausländer“ hetzte, oder einfach daran, dass sie ihn kannten.
Als sich alle wieder beruhigt hatten, kramte Johnny etwas aus seinem Rucksack.
„Hier ist das Zeug, das ihr bestellt habt“, nuschelte er und drückte Dennis ein Tütchen in die Hand.
„Was ist das?“, fragte ich und beugte mich hinüber, um einen Blick zu erhaschen.
„Hey, hey, Kleiner! Das ist nichts für Zecken wie dich“, lachte Dennis, drückte mich beiseite und ließ das Baggy schnell in seiner Hosentasche verschwinden.
„Feinstes Speed“, lächelte mir Johnny mit seinem zahnlosen Mund entgegen, sodass mir der Gestank seines Atems in die Nase kroch.
Ich war fassungslos. Speed? Seit wann machten meine Freunde so etwas? Wieso pfiff man sich so einen Dreck rein, wenn man die eingefallenen Gesichter der Stadtjunkies kannte und gerade einem in seine toten Augen blickte? Mein Unverständnis und meine Abscheu mehrten sich, während Robin und Dennis weiter mit Johnny scherzten. Erst als dieser wieder auf sein Fahrrad gestiegen und hinter dem Tor verschwunden war, brachen die Worte aus mir heraus.
„Euer verdammter Ernst? Speed? Warum ballert ihr euch diese Scheiße?“, schrie ich Dennis an.
Der lehnte sich auf der Bank zurück, überschlug die Beine und wehrte jegliche Kritik ab.
„Das ist doch nur für besondere Anlässe“, meinte er. „Versteh doch auch mal ein wenig Spaß und zick nicht so herum, Linker! Schließlich hast du kein Bier mitgebracht und da mussten wir uns was anderes suchen, um den Kopf freizubekommen.“
Ich sah Dennis nur verständnislos an und schüttelte den Kopf.
„Sei nicht so ein Moralapostel“, rief er mir zu, während er auf der Tischtennisplatte die Line legte. „Was ist? Muss ich dir auch noch eine machen oder kiffst du wieder nur?“
Ich konnte es nicht fassen. Wenn Dennis` Bullenvater ihn jetzt sehen könnte. Als Dennis sich den Stoff durch die Nase zog, hatte ich genug. Prompt griff ich meinen Rucksack und verließ wortlos den Spielplatz. Robin und Dennis beachteten mich kaum. Sie waren mit anderem beschäftigt. Niemand versuchte, mich aufzuhalten. Zum Glück.
*
Der Weg nach Hause fiel mir schwer. Die kleine Wohnung im Obergeschoss eines Neubaus, in der ich mit meinen Eltern lebte, war für mich kein Rückzugsort mehr. Träge schleppte ich mich die Treppen hinauf. Vor der Tür, die in unser kleines Apartment führte, blieb ich kurz stehen, sammelte mich und atmete tief durch. Dabei war es, als würde ich bereits riechen, dass dahinter Streit in der Luft liegen würde.
Was ich auch tat, dem Anspruch meiner Eltern konnte ich nie gerecht werden. Bei jeder Begegnung fühlte es sich an, als wollten sie eine Gegenleistung, um mich lieben zu können. Sie weigerten sich, das zu sehen, was ich geleistet hatte und richteten ihren Blick nur auf das, was in ihren Augen nicht ganz perfekt war. Meine Wünsche und Träume belächelten sie. Das seien eben nur kindliche Spielereien, die nicht ernst zu nehmen waren. Hirngespinste, die vergehen würden, sobald ich endlich erwachsen wäre.
Ein zweites Mal atmete ich tief durch. Nun trennte mich nur diese hölzerne Pforte von der Wohnung, in der die Luft nach Spießigkeit und Bedrückung stank. Mir war klar, dass ich mich dahinter wieder mit Dingen auseinandersetzen musste, denen zu stellen ich mich nicht bereit fühlte.
Jetzt, nachdem ich meinen Abschluss in der Tasche hatte, sollte ich mich der Härte der realen Welt stellen, mir Gedanken über meine Zukunft machen, mir die wichtigen Fragen des Lebens stellen und meine sinnlosen Träumereien zugunsten vermeintlicher Rationalität verwerfen. Dabei hätte ich lieber meine Träume zu meiner Zukunft gemacht.
Noch ein letztes Mal atmete ich tief durch, dann drehte ich den Schlüssel im Schloss und trat ein.
Aus dem Wohnzimmer drangen die Geräusche des Fernsehers. Die Ansagen des Nachrichtensprechers übertönte das dumpfe Schnarchen meiner Mutter. Kurz schöpfte ich Hoffnung, dass ich unauffällig vorbeihuschen und in mein Zimmer verschwinden könnte, doch aus der Küche erklangen hastige Schritte.
„Nicht so schnell, Junge!“, hörte ich die Stimme meines Vaters hinter mir. Ich drehte mich um und sah, wie mein Dad, noch mit einem Geschirrtuch in der Hand, grimmig zu mir hinabblickte.
„Hast du deine Bewerbung schon geschrieben?“, fragte er, wahrscheinlich schon zum dritten Mal in dieser Woche.
„Ja“, log ich. „Morgen schick ich sie ab.“
„Also hast du noch nichts gemacht?“, schlussfolgerte mein Vater und verschränkte seine Arme. „Was soll denn aus dir werden? Es geht um deine Zukunft! Das kannst du nicht so schleifen lassen.“
Ich konnte ihn kaum ansehen, während er diese Worte sprach. Ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte, doch nur deshalb würde er nicht aufhören zu fragen:
„Was möchtest du denn arbeiten? Hast du dir darüber Gedanken gemacht?“
Ich hasste diese Frage, denn ich kannte keine Antwort darauf, die der Wahrheit und gleichzeitig dem entsprach, was mein Vater hören wollte.
Natürlich wusste ich, was ich machen wollte, was mein Traum war. Ich wollte Schriftsteller werden, um die Welt reisen, Kunst schaffen. Schon seit ich fünfzehn war, träumte ich von einem Leben außerhalb dieses erdrückenden bürgerlichen Trotts. Ein Leben, in dem ich mich nicht einsperren lasse von einer monotonen Arbeit oder einem immergleichen Ort, wo ich schreiben und über das berichten könnte, was ich erlebe, oder Fiktion schaffen kann. Heimlich verfasste Gedichte und Kurzgeschichten und gerade plante ich meinen ersten Roman, der allerdings niemals fertig werden sollte.
Meinem Vater hätte ich all das nicht sagen können. „Damit kann man doch kein Geld verdienen“ oder „Reisen kann man sich ohne Arbeit nicht leisten“, hätte er gesagt.
Er wollte, dass ich einen dieser normalen Jobs mache. Einen, in dem man sinnlose Dinge in der Fabrik herstellt. Einen, wo man von seinem Chef ausgebeutet wird oder besser noch der Chef ist, der andere ausbeutet. Hauptsache, wie alle anderen sein, Geld verdienen. Besser nichts Ungewöhnliches oder Brotloses wie Schreiben. In seiner Welt war das der einzige Weg zum Glück. Er glaubte diesen bestens zu kennen, obwohl er selbst nicht glücklich war. Es gab keine Alternative.
Einen Moment schwieg ich.
„Warum fängst du nicht in derselben Firma an wie dein Bruder?“, fragte mein Vater.
„Ach, hör mir auf mit meinem Bruder“, sagte ich und rollte mit den Augen.
„Warum? Schließlich hat der was auf die Beine gestellt?“
„Auf die Beine gestellt?“
„Besser, als hier herumzugammeln, wie du es tust.“
„Kannst du aufhören, mich mit meinem Bruder zu vergleichen!“
„Dein Gammlerleben, das du hier führen willst, werde ich sicher nicht mehr lange mittragen“, meinte mein Vater energisch.
Ich schwieg, doch mir war klar, dass sich die Situation dadurch nicht auflösen würde.
„Morgen mache ich mir Gedanken und dann bewerbe ich mich“, sagte ich, doch wusste bereits in diesem Moment, dass ich auch am morgigen Tag noch keine Antwort auf die Frage, was ich denn machen wollte, geben können würde. Es war klar, dass ich sie Tag für Tag mit einer neuen Lüge beantworten musste.
*
Niemand liebt mich. Jeden Morgen begleitete mich dieser quälende Gedanke. Nach dem, was meine Freunde oder Eltern taten und sagten, schien es, als hätte ich für die Person, die ich war, nicht einmal Akzeptanz verdient. Geliebt zu werden, das war etwas, das für mich vollkommen ungreifbar schien und dennoch wünschte ich mir nichts mehr als das.
Ich war besessen von dem Gedanken, die Person zu finden, die mir dieses Gefühl geben könnte, die mich so liebte, wie ich war. Vielleicht mag es naiv erscheinen, aber ich dachte, das wäre mein Allheilmittel. Das Pflaster für meine Seele, welches alle meine Probleme plötzlich lösen und aus mir einen glücklicheren Menschen machen würde.
In diesem Jahr hatte ich ständig Dates. Oft entstanden daraus nette Bekanntschaften.Jedoch endeten alle meine Liebesgeschichten gleich: immer mit einem Nein. Mit Enttäuschung. Mit dem Gefühl, niemand könnte mich lieben und dem Gedanken, ungenügend zu sein.
Diesmal sollte es anders werden. Optimistisch und aufgeregt startete ich in den Tag, an dem ich mich mit Emmy traf. Wir hatten uns schon zwei Mal gesehen, und ich war hin und weg von ihr. „Diesmal wird es sicher funktionieren“, hatte ich am Tag zuvor in meinem Tagebuch manifestiert.
Emmy wohnte in Zwickau, der kleinen Großstadt, nur ein paar Bahnhaltestellen von Werdau entfernt. Ich war nervös, als ich zum Bahnhof lief. Zuvor hatte ich, wie ein Idiot, eine halbe Stunde vor dem Spiegel gestanden, um ein passendes Outfit zu finden und mich schließlich für ein Shirt der Band We Butter the Bread with Butter entschieden. Darauf war ein blauer Dämon abgebildet, der Flammen auf die Erde spuckte.
Schaudernd betrat ich das verrottende Bahnhofsgebäude. Man konnte froh sein, dass diese Stadt wenigstens einen Bahnhof besaß, dank dem man schnell aus diesem Elendsdorf fliehen konnte. Dennoch kam man nicht umhin, sich vor Ekel zu schütteln, wenn man diese stinkende Ruine betrat.