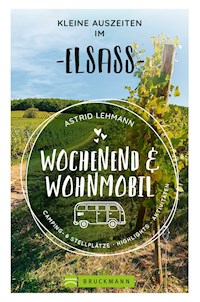Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Bretagne, Juni 1940. Deutsche Panzer rollen durch die Küstenstadt Vannes. Im Chaos der Invasion liegt die junge Anne-Marie in den Wehen und droht, bei der Geburt ihres Kindes zu sterben. Im Gefolge der Wehrmacht ist der frisch ausgebildete Arzt Helmut. Er rettet der jungen Mutter das Leben und im bretonischen Sommer kommen die beiden sich näher. Zur gleichen Zeit lebt der sechsjährige Emil mit seiner Familie auf einem abgelegenen Bauernhof im Nordschwarzwald fernab vom Krieg. Anne-Marie, Helmut und Emil, vom Schicksal verbunden, ahnen nicht, wie zerbrechlich ihr Glück ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 313
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astrid Lehmann
Nur ein kurzer Sommer
Roman
Zum Buch
Über Grenzen hinweg Bretagne, Juni 1940. Durch die Küstenstadt Vannes dröhnen die Motoren der heranrückenden Wehrmacht, während die junge Bretonin Anne-Marie in einem Klosterkrankenhaus bei der Geburt ihrer Tochter ums Überleben kämpft. Unter den deutschen Soldaten befindet sich der frisch ausgebildete Arzt Helmut, dem es in höchster Not gelingt, Mutter und Kind zu retten. Anne-Marie, wegen ihrer unehelichen Schwangerschaft von ihrer Familie verstoßen, und Helmut, vom Krieg traumatisiert, kommen sich näher, spenden sich Trost. Hat ihre Liebe inmitten dieses Wahnsinns eine Chance? Zur gleichen Zeit spürt der sechsjährige Emil wenig vom Krieg. Mit seinen Eltern lebt er auf einem abgelegenen Bauernhof in der Nähe von Baden-Baden. Er hilft der strengen Mutter bei der Landwirtschaft und lernt vom blinden Vater alles über die Natur, bis eine Katastrophe alles zerstört. 1962 lebt Emil in Freiburg. Noch immer leidet er unter den Folgen des Erlebten. Da stößt er auf Spuren eines Geheimnisses, das seine Familie mit der Bretagne verbindet.
Nach einer kurzen Kindheit in Frankreich und einer etwas längeren Jugend im Schwarzwald hat Astrid Lehmann auf drei Kontinenten in großen Metropolen gelebt und gearbeitet. Nach vielen Jahren in der Ferne ist die Autorin und Wildpflanzenpädagogin vor über fünfzehn Jahren in den Schwarzwald zurückgekehrt, wo sie ihre ganz persönliche Heimat gefunden hat. Am liebsten ist sie zu Fuß unterwegs, um ganz einzutauchen in die kleinen Schönheiten am Wegesrand. In der Natur sprießen auch die Ideen für ihre Geschichten.
www.astridlehmann.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Daniel Abt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © RolfSt / iStock.com
ISBN 978-3-7349-3212-0
Widmung
Für Günther
Du hast mir Flügel geschenkt, damit ich zu meinen Träumen fliegen kann.
Gedicht
Le dormeur du val
1870
C’est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.
Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,
Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.
Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :
Nature, berce-le chaudement : il a froid.
Les parfums ne font pas frissonner sa narine ;
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine
Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.
Arthur Rimbaud
französischer Dichter
(1854–1891)
Gedichtübersetzung
Der Schläfer im Tal
In einer grünen Mulde ein Bächlein singt,
das wild das Gras mit Silberstaub umhüllt.
Vom stolzen Berge glüht die Sonne,
ein kleines Tal, vom Strahlenglanz durchtränkt.
Ein junger Soldat, mit offenem Mund und hoher Stirn,
den Hals im kühlen Grün gebettet,
die Beine ausgestreckt, schläft blass
auf der vom Licht umrieselten Wiese.
Die Füße in den Wasserlilien, er ruht.
Ein Lächeln umzieht seinen Mund,
traurig, wie das eines kranken Kindes.
Natur, wiege ihn warm, ihm ist kalt.
Die Düfte riecht er nimmermehr.
Er schläft in der Sonne, seine Hand verharrt
ruhig auf der Brust,
aus der das Blut sich ergießt.
Erster Teil
Kapitel 1
Vannes, Bretagne 22. Juni 1940
Bernadette
»Mon Dieu, die Deutschen kommen. Pressen Sie, Mademoiselle, pressen Sie!«
Die weit ausgezogenen Spitzen der weißen Flügelhaube flatterten nervös umher, als hätte eine Möwe auf dem Kopf der Nonne Platz genommen und würde mit wildem Flügelschlag Angreifer abwehren wollen. Schwester Bernadettes glasige Glubschaugen traten noch weiter hervor und sprangen fahrig von einem Ende des Raumes zum anderen. In ihnen lag nackte Angst. Rastlos schaute die Nonne zur Tür, bekreuzigte sich hektisch und widmete sich wieder der Gebärenden, die apathisch auf dem Krankenhausbett lag.
Gestern Abend war das verschreckte Mädchen zu ihnen gekommen. Es bestand nur aus Knochen, bis auf den kugelrunden Bauch, den es fest umschlungen gehalten hatte. Bereits zu diesem Zeitpunkt hatten Wehen den Körper durchzuckt. Die junge Frau hatte sich gekrümmt und leise gewimmert. Auf die Frage, wo denn der Vater des Kindes sei, hatte sie angefangen zu schluchzen und den Kopf geschüttelt. Es gab keinen Vater. Zumindest keinen offiziellen. Schwester Bernadette seufzte laut, als sie über das schändliche Treiben nachdachte. Es waren schreckliche Zeiten, in denen sich die Sitten in Luft auflösten. Was hatte sie im vergangenen Jahr alles erleben müssen … Vor allem die letzten Wochen waren furchterregend gewesen. Es verging kein Tag, an dem nicht vom Vorrücken der deutschen Truppen berichtet wurde. Ausgerechnet im Marienmonat Mai hatten die germanischen Barbaren große Teile Frankreichs überrannt. Vor einigen Tagen hatten sie die Bretagne erreicht. Etwas mehr als einen Monat hatten sie gebraucht, um sich Frankreich einzuverleiben. Die französische Armee war geflohen, panisch und unkontrolliert. Maréchal Pétain hatte die Franzosen zur Niederlegung der Waffen aufgerufen. Welche Schmach!
Seitdem war der stete Strom von Flüchtlingen weiter angeschwollen. Ausgezehrte Frauen mit gepressten Lippen, verschreckte Kinder mit greisen Gesichtern, bucklige Alte mit schwankendem Gang. Manche von ihnen waren wandelnde Kleiderschränke, die alles am Leib trugen, was sie anzuziehen hatten. Ihr wertvollstes Hab und Gut stapelten sie auf Handkarren, die sie unter größter Kraftanstrengung hinter sich herzogen. Ein ganzes Leben in Bewegung. Wohin auch immer. Die Zukunft aller Franzosen war ungewiss.
Auf dem gepflasterten Hof der Krankenstation hatten die Nonnen eine Suppenküche eingerichtet. Tag und Nacht köchelte in einem großen Kessel auf einer behelfsmäßig zusammengemauerten Feuerstelle eine wässrige Gemüsesuppe, die den ausgehungerten und übermüdeten Menschen Kraft spenden sollte. Manche legten nur eine kurze Rast ein, andere schliefen einige Stunden an die Wand des Gebäudes gelehnt. Bevor sie sich zurück in den Strom der Flüchtlinge einreihten und weiterzogen, erzählten sie grausige Geschichten. So hatten die Nonnen erfahren, dass Rennes, die Hauptstadt der Bretagne, vor vier Tagen gefallen war. Man munkelte, dass am Vortag der Invasion ein höllischer Bombenangriff Hunderte von Menschen das Leben gekostet hatte. Die Zeitungen berichteten lediglich von wenigen Toten. Heute hatte sie die Schreckensnachricht erreicht, dass die Besetzung Vannes’ kurz bevorstand. Seit gestern wehte vorsorglich die weiße Flagge auf dem Glockenturm des Rathauses – noch bevor ein einziger Deutscher gesichtet worden war. Mit der Ankunft des Feindes war jeden Augenblick zu rechnen.
Zunächst hatte Schwester Bernadette angenommen, dass die Geburt schnell verlaufen würde, schließlich waren die Wehen am Vorabend bereits regelmäßig gewesen. Doch mit jeder Stunde, die vorangeschritten war, wurden die Krämpfe der jungen Frau schwächer und die Angst der Nonne wuchs. In der Nacht, als eine gespenstische Stille in den Gängen geherrscht hatte und die Luft elektrisiert zu sein schien, war sie sicher gewesen, dass mit der Geburt etwas nicht stimmte. Dann hatte das laute Donnern der deutschen Geschütze eingesetzt, das seitdem nicht mehr verebbt war. Jetzt warf die Sommersonne zu allem Überfluss ein zitronengelbes Licht über die Fachwerkstadt, als hieße sie die deutschen Eindringlinge willkommen.
Schwester Bernadette spürte eine Erschütterung. Der Boden vibrierte beständig und die Fensterscheiben fingen zu zittern an. Die Gedärme der Erde brodelten. Durch das Zimmerfenster konnte die Nonne auf den inneren Hof blicken, wo an langen Wäscheleinen Bettlaken hingen. Ein blütenreines Weiß, das im Wind flatterte und Frische verhieß. Wie absurd angesichts der Bedrohung, dachte Schwester Bernadette. Das Beben ließ nicht nach, zusätzlich vernahm sie laute Motorengeräusche. Rollten deutsche Panzer auf ihr Klostergebäude zu? Augenblicklich steigerte sich die Panik ins Unermessliche. Den Deutschen eilte ein grausamer Ruf voraus. Von brutaler Rücksichtslosigkeit war die Rede, von Plünderungen und der Belästigung junger Frauen. Sogar von der Erschießung von Zivilisten. Vor drei Tagen hatten sie einen Vater von sechs jungen Kindern erschossen. In der Nähe von Pontivy hatte der mutige Mann feindliche Truppen vorrücken sehen und die Soldaten mit Steinen beworfen. Wenige Sekunden später hatte er tot auf der Straße gelegen. Die Neuigkeit hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet und die Bevölkerung in Schrecken versetzt.
Die Gebärende schien von dem Grollen und den steten Erschütterungen nichts mitzubekommen. Nach endlosen Stunden des Leidens war sie am Ende ihrer Kräfte und gab kein Lebenszeichen von sich bis auf ein flaches Atmen, das ihre Brust leicht anhob und senkte. Sie war mehr tot als lebendig. Da half auch der liebevolle Blick nicht, den die heilige Muttergottes von ihrem erhabenen Sockel aus auf die Frau richtete. Voller Güte und Vergebung schaute sie auf die junge Sünderin herab.
Vom Flur her tönten hektische Schritte und aufgeregte Schreie.
»Mon Dieu, das müssen die Deutschen sein!«
Hastig griff sie nach den Schultern der Schwangeren und schüttelte den leblosen Körper.
Das Mädchen reagierte nicht.
Schwester Bernadette ließ den schmächtigen Leib los. Wie eine Feder senkte er sich auf das Bett. So leicht, so zerbrechlich. Mit der rechten Hand holte die Nonne aus und ließ eine Ohrfeige auf die Wange der jungen Frau sausen. »Pressen Sie, Mademoiselle! Als Sie sich vergnügt haben, waren Sie auch nicht so zimperlich!« Sie erkannte ihre eigene Stimme nicht. Schrill wie eine Pfeife. Die bissige Bemerkung hatte sie sich nicht verkneifen können. Trotz der Angst, trotz der Bedrohung.
Wieder ein Schrei vom Flur, von einer Nonne diesmal. Eine Tür schlug zu. Bernadette nahm ihren ganzen Mut zusammen, raffte ihre Kutte und blickte ein letztes Mal auf die Schwangere. Hier kann ich nicht mehr helfen, die junge Frau und das Kind sind verloren, redete sie sich in Gedanken zu. Sie bekreuzigte sich. Dann trat sie auf den Flur hinaus und blickte durch das Fenster an der Vorderseite des Gebäudes. Bilder zwangen sich gewaltsam in ihre Augen.
Zwei Panzer mit offenen Luken, die Panzerführer standen im Turm, eine Fülle an Motorrädern, eine Flut an Soldaten mit angelegten Gewehren. Die Szenerie unglaublich langsam, wie eingefroren. Da rannte Schwester Alphonsine ihr entgegen und fiel ihr in die Arme, zerbrach den Moment. Hinter ihr marschierte eine Handvoll deutscher Soldaten. Selbstbewusster Gang, dunkle Uniform, kalter Blick, das stolze Auftreten von Besatzern. Eine Armeslänge vor den beiden Nonnen blieben sie stehen.
»Wer hat hier die Verantwortung?« Der Mann hatte in tadellosem Französisch gesprochen. Lediglich ein leichter, harter Akzent verriet seine Herkunft. Seine Schirmmütze war ein wenig zur Seite geneigt, darunter schauten zwei Eiskristalle abwechselnd auf die Schwestern.
Schwester Bernadette schob Alphonsine beiseite, räusperte sich und antwortete: »Ich, Monsieur.«
Ihre schlimmsten Befürchtungen waren wahr geworden. Der Feind stand vor ihr. Die Dämonen waren aus der Hölle gekrochen und hatten in Form deutscher Soldaten ihre Welt eingenommen. Sie spürte, wie sich die kurzen Fingernägel ihrer gefalteten Hände in ihre Knöchel bohrten. Ihre Lider hatten sich erneut selbstständig gemacht und zuckten wild. Einen Herzschlag lang schloss sie die Augen und zwang sich zu atmen.
»Schwester …?«
Mit seiner Frage hatte er seine Augenbrauen gehoben, sie formten zwei Accents circonflexes. Eine aristokratische Arroganz umgab ihn. Er war es gewohnt zu kommandieren, nicht nur zu Kriegszeiten, schoss es Bernadette durch den Kopf. Er war ein hochgewachsener, schlanker Mann mit lang gezogenem Gesicht. An seiner Brust hing eine militärische Auszeichnung, die im Gleichtakt mit seinen Bewegungen baumelte.
»Bernadette«, murmelte sie und fügte rasch hinzu: »Ich bin für das Kloster verantwortlich.«
»Oberleutnant Döring. Arbeiten hier außer den Schwestern noch Ärzte? Oder anderes ziviles männliches Personal?« Der Orden wackelte.
»Nein, wir hatten zwei Ärzte, die uns … verlassen haben.« Bernadettes Gesicht verhärtete sich. Sie brauchte ihm nicht zu sagen, dass beide Ärzte jüdischer Abstammung waren und es vorgezogen hatten, sich ins freie Frankreich durchzuschlagen.
»Meine Männer werden das Kloster und die Krankenstation nach Feinden durchsuchen. Danach bitte ich Sie, alle Kranken in ein Zimmer zu verlegen. Wir werden ein Ausweichlazarett einrichten. Sie und Ihre Mitschwestern werden uns selbstverständlich helfen, die Verwundeten zu versorgen.«
»Das geht nicht, Monsieur! Männer und Frauen sind getrennt untergebracht. Wir können sie nicht gemeinsam in einen Saal legen. Außerdem haben wir eine Gebärende.« Sie presste ihre Ellenbogen gegen ihre Rippen, um das Zittern der gefalteten Hände zu unterdrücken. Sämtliche Luft hatte ihren Körper verlassen.
»Auf Ihre Empfindlichkeiten können wir leider keine Rücksicht nehmen. Einzig ich und meine Männer werden von nun an hier die Befehle erteilen. Haben wir uns verstanden, Schwester Bernadette?« Noch einmal hatten sich seine Augenbrauen zu kleinen spitzen Dächern erhoben.
Widerwillig nickte sie, und seine Brauen entspannten sich. Er drehte sich zu seinen Männern um.
»Heinrich übernimmt, Hauptmann Usedom erwartet mich. Wagner, Sie halten die Stellung hier. Sobald wir die Krankenstation durchforstet haben, verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick über die Kranken. Nicht dass sich ein französischer Soldat unter den Gebrechlichen versteckt. Wer nicht schwer verletzt ist, wird das Krankenhaus sofort verlassen. Berichterstattung beim Truppenarzt im Militärlazarett.« Sein Tonfall hatte einen scharfen Beiklang.
»Jawohl, Herr Oberleutnant.« Der Angesprochene war stehen geblieben, alle anderen waren ausgeschwärmt.
Schwester Bernadette hatte den jungen Mann bisher nicht wahrgenommen. Seitlich waren seine Haare kurz geschoren, oben schauten widerspenstige kurze braune Locken neben den Rändern seiner grauen Feldmütze hervor. Ein Junge, der besser bei seiner Mutter am Küchentisch sitzen und Kartoffeln schälen sollte, dachte die Nonne bei seinem Anblick. Seine dunklen Augen hatten eine ungewöhnliche Sanftheit, als hätten sie von der Härte des Krieges nichts gesehen. Eine runde Hornbrille verstärkte sein jugendliches Aussehen. Bernadette war verwundert. Bisher hatte sie sich die Deutschen immer blond, blauäugig und stählern vorgestellt.
Noch einmal richtete der Oberleutnant das Wort an Schwester Bernadette: »Zeigen Sie bitte unserem Hilfsarzt den Materialraum. Wir möchten eine genaue Liste über Medikamente und Verbandszeug. Danach gehen Sie mit ihm die Patienten durch. Auch da benötigen wir eine genaue Aufstellung, wer im Krankenhaus liegt. Name, Anschrift, Familienstand, Krankheit.«
Obwohl er sich höflich ausdrückte und seine Worte in einem erträglichen Ton vorbrachte, prasselten sie auf die Schwester ein. Sie waren schallende Ohrfeigen, die ihre Unerschütterlichkeit ins Wanken brachten. Die Zeiten hatten sich geändert.
Kapitel 2
Vannes, Bretagne
Helmut
Eine bleierne Schwere umhüllte ihn, das Ruckeln des Wagens umnebelte seine Sinne. Was hatte er heute erlebt? Sobald er das Krankenzimmer betreten hatte, hatten sich seine Nackenhärchen aufgestellt. Sofort war ihm bewusst gewesen, dass er schnell handeln musste. Jede Sekunde hatte gezählt. Zuvor waren die Nonne und er im Materialraum gewesen. An Schwester Bernadettes Schlüsselbund hing eine Vielzahl an Schlüsseln, die mit jedem Schritt geklirrt hatten. Fast blind hatte sie die richtigen herangezogen, nach und nach alle Schränke geöffnet und ihren wertvollen Inhalt preisgegeben. Mit Erstaunen stellte er fest, wie gut bestückt die Krankenstation war. Fein säuberlich einsortiert reihten sich Verbände, Kompressen, Desinfektionsmittel, Medikamente und chirurgische Instrumente aneinander. Schwester Bernadette legte ihre devote Haltung ab und verschränkte ihre Arme vor der Brust. Ihre Lippen wurden schmaler, bis nur ein dünner Strich davon blieb. Ihr Körper drückte mit jedem Zentimeter aus, wie wenig sie damit einverstanden war, dem Besatzer ihre Heiligtümer zu überlassen.
»Haben Sie bereits eine Materialliste?« Mit den Händen machte er erklärende Zeichen. Dann lächelte er und entschuldigte sich für seine mangelnden Sprachkenntnisse. Sein holpriges Französisch war seiner Unsicherheit geschuldet. Die Nonne schüchterte ihn ein, in ihrem Beisein fühlte er sich wie ein Klosterschüler, der dabei ertappt worden war, feuchte Papierkügelchen auf seine Kameraden zu spucken.
Sie schüttelte den Kopf, verengte die Augen und sah ihn prüfend an. Der Strich in ihrem Gesicht war länger geworden. Sie erinnerte ihn an eine Kröte. Vielleicht zweifelt sie daran, dass ich Arzt bin, kam es ihm in den Sinn.
»Sie sind Doktor?«
Er hatte sich nicht getäuscht. Auf sein Nicken hin griff sie ihn am Arm und schaute ihn eindringlich an. »Monsieur, die Liste kann warten. Eine Gebärende liegt im Krankenzimmer nebenan. Ihr Zustand ist kritisch.« Sie ließ ihn los und deutete mit den Händen den Bauch einer Schwangeren an.
Er hatte verstanden. Sie drehte sich um und forderte ihn auf, ihr zu folgen.
Die junge Frau lag versunken im Bett, ein weißes Laken bedeckte ihren dünnen Körper, aus dem sich der geschwollene Bauch wie ein Fremdkörper erhob. Sie war kreidebleich, ihre Lider saßen grau in tiefen Höhlen und verharrten bewegungslos. Eine aufgebahrte Tote.
Augenblicklich hatte er diese fast unkontrollierbare Angst verspürt, die den Raum bis zur Decke füllte und die Luft verdrängte. Seit Monaten war sie seine ungewollte Begleiterin. Immer wieder drängte sie sich ihm auf und ließ sich nur schwer vertreiben. Er hatte Angst, der Situation nicht gewachsen zu sein, Angst, als Arzt zu versagen. Er griff an seinen Kragen und öffnete den obersten Knopf, damit wieder Leben in seinen Körper strömen konnte. Er wusste, dass er sofort reagieren musste, und schüttelte die Lähmung ab.
Zunächst wusch er sich sorgfältig die Hände in der Schüssel, die auf dem Nachttischchen stand. Dann versuchte er, den Puls der Gebärenden zu ertasten. Schwach flatterte er, unregelmäßig. Schmetterlingsflügelleicht.
»Haben Sie ein Pinard-Rohr?« Seine Stimme versagte. Er räusperte sich und wiederholte seine Frage laut, ohne den Blick von der jungen Frau abzuwenden.
Die Nonne hatte ihm ohne Umschweife das Holzrohr gereicht, mit dem er die Herzschläge des Ungeborenen hören konnte. Er hatte das Laken weggezogen und das Hemd der Schwangeren hochgeschoben. Um die schwachen Herztöne zu vernehmen, hatte er genau hinhören müssen. Das leise Klopfen war ein Weckruf. Mit einem Mal hatte er dieses dringende Gefühl und war ganz der Arzt, den die Situation erforderte. Seine Gedanken hatten ihre Festigkeit wiedergefunden.
»Seit wann liegt die junge Frau hier? Wann haben die Wehen ausgesetzt?«
Er untersuchte die Schwangere kurz und stellte fest, dass das Ungeborene bereits tief in den Geburtskanal gerutscht war. Für einen Kaiserschnitt war es zu spät.
»Gestern Abend stand sie plötzlich vor der Tür. Da hatte sie regelmäßig Wehen. Irgendwann in der Nacht haben sie ausgesetzt. Wann genau, kann ich Ihnen nicht sagen. Vielleicht in den frühen Morgenstunden.« Entschuldigend fügte sie hinzu: »Wir sind nur noch zu dritt in der Krankenstation.«
»Kommen Sie, helfen Sie mir. Die Frau muss auf dem Boden knien und sich mit den Händen auf der Bettkante abstützen.« Er hatte einen befehlenden Ton angenommen, der keine Widerrede zuließ. Er galt vor allem ihm selbst, sollte ihm Mut zusprechen. Nachdem er der Nonne zugenickt hatte, legte er beide Hände unter die Brust der Schwangeren und zog ihren schlaffen Körper vom Bett. Anschließend hatte er der Schwester zu verstehen gegeben, was er von ihr forderte. Während er hinter der Schwangeren stehen und ihren Körper festhalten würde, sollte sie die junge Frau massieren, um auf diese Weise die Wehen zu fördern. Nach einer Zeit, die ihm wie eine Ewigkeit vorkam, spürten sie die ersten Kontraktionen. Zunächst zaghaft, dann immer stärker. Er schöpfte Hoffnung und ein fieberhafter Wille packte ihn, der sich wie heiße Wut anfühlte. Eine Wut auf das Leben, eine Wut auf die Zukunft. Diese Geburt musste einfach gut verlaufen, sie war ein Ausgleich für das Leid und die Schrecken, die er in den letzten Monaten hatte durchleben müssen. Notdürftig geflickte Körper, Luftröhrenschnitte, Schockbekämpfung, Notamputationen, er war sogar Zeuge einer Selbstverstümmelung geworden. Die hässlichen Folgen des Krieges. Sein kurzes Medizinstudium hatte ihn darauf nicht vorbereitet.
Von einem Augenblick zum anderen ging alles ganz schnell. Woher die junge Frau die Kraft nahm, wusste er nicht, aber nach wenigen heftigen Presswehen war das kleine Menschlein auf der Welt. Ein dünnes Ding voller Falten, kaum fünf Pfund wog es, dafür schrie es umso lauter. Als er das kleine Kind zum ersten Mal in den Armen hielt, glaubte er an ein Wunder. Er zählte zehn Finger. Glück durchfuhr ihn. Und Erleichterung, schließlich war es seine erste Geburt, sie traf ihn dazu völlig unvorbereitet. Erst da bemerkte er, wie entkräftet die Nonne und er waren. Für einen Atemzug schauten sie sich an. Das Licht der Anerkennung flackerte einen Moment lang in ihrem Blick. Es freute ihn. Gemeinsam versorgten sie die junge Mutter und ihr Neugeborenes. Schließlich ließ er beide in der Obhut der Schwester, um die anderen Kranken zu examinieren. Zu diesem Zeitpunkt waren sie bereits alle in einen großen Saal verlegt worden. Die Metallbetten reihten sich aneinander, dicht an dicht. Eine junge Nonne schritt mit ihm die Reihen ab und erklärte, was den einzelnen Patienten fehlte. Es fiel ihm schwer, diejenigen auszuwählen, die entlassen werden sollten. Doch Befehl war Befehl, er war Soldat und hatte sich den Weisungen des Oberleutnants zu fügen. Ein kleines Zahnrad in einer gewaltigen Maschinerie, mehr war er nicht. Schließlich hatte er sich für zwei Kinder entschieden, die von ihren Müttern bewacht wurden, und einen älteren Mann. Sie waren alle drei auf dem Weg der Besserung gewesen. Gegen Abend hatte er die restlichen Zimmer inspiziert und die nötigen Vorkehrungen getroffen, damit sie deutsche Soldaten aufnehmen konnten. Entgegen den Behauptungen seiner Vorgesetzten waren die Räume sauber gewesen. Immer wieder hatte man ihnen von der mangelnden Hygiene in Frankreich erzählt und er hatte sich auf schlimmere Zustände eingestellt. Die Einzelzimmer und Zellen waren ideal, falls im Militärlazarett eine Seuche ausbrechen sollte. Es befand sich nördlich der Innenstadt im beschlagnahmten Krankenhaus. Ihm war schleierhaft, welche Krankheitsfälle hier landen sollten.
»Die Einheimischen sind nicht glücklich darüber, dass sie uns einquartieren müssen.« Die Worte des Fahrers rissen ihn aus seinen Gedanken. Vielleicht war Helmut kurz eingenickt.
»Ich sagte, dass das Einquartieren bei der Bevölkerung auf Widerwillen stößt.«
Helmut nickte und rieb sich den Schlaf aus den Augen.
»Viele Hotels sind unbrauchbar und völlig verdreckt. In den Betten hüpfen die Wanzen. Da würden Sie nicht mal Ihren Hund reinlegen. Wir suchen nach einer geeigneten Unterkunft, um das Krankenhauspersonal unter ein Dach zu bringen. Vielleicht eine Kaserne oder eine Schule. In der Zwischenzeit werden viele Soldaten privat untergebracht. Für die Offiziere wurden die vornehmsten Häuser beschlagnahmt.«
Der Fahrer bog zu schnell um die Kurve. Helmut musste sich am Türgriff festhalten.
»Sie sind bei einer älteren Dame untergekommen, die allein in einem großen Anwesen lebt. Unweit des Klosters und nur einen Steinwurf vom Hafen entfernt. Sie Glücklicher! Ich muss mir einen Saal mit sieben anderen von uns teilen.« Der Fahrer drückte auf die Bremse und der Wagen kam mit quietschenden Reifen zum Stillstand. »Wir sind da.«
Mit dem Finger zeigte er auf ein hohes Steinhaus, das von Wohlstand zeugte und von der letzten Abendsonne angestrahlt wurde. Das Gebäude lag etwas von der Straße zurückgesetzt, ein Kiesweg führte zur Eingangstür. Sie war wie die Fensterläden und die Sprossenfenster in einem hellen Moosgrün gestrichen worden. Hinter dem Granithaus konnte Helmut einen Garten mit altem Baumbestand erahnen. Ihm schien es, als wäre eine Spitzengardine einen Wimpernschlag lang zur Seite geschoben worden.
»Sie müssen mich morgen nicht abholen. Ich werde zum Krankenhaus laufen.« Er hatte die Beifahrertür geöffnet und kletterte aus dem Mannschaftswagen. Kurz drehte er sich um, winkte dem Fahrer zum Abschied und lief auf dem knirschenden Kies zur Haustür. Auf Augenhöhe sah er eine bronzene Frauenhand, überzogen mit Patina. Bevor er nach dem Türklopfer greifen konnte, öffnete sich die Haustür. Vor ihm stand eine Erscheinung aus einem anderen Jahrhundert, gehüllt in bauschige Gewänder, klein und zierlich, dafür umso aufrechter. Eine Grande Dame, schoss es Helmut durch den Kopf. Sie hatte einen voluminösen Dutt auf ihrem Kopf drapiert, schwarz wie ihr Gewand. An ihrem Hals hingen lange Perlenketten, die bis zur Hüfte reichten. Sogar ihre Augen passten zu der Aufmachung, blauschwarz, gleich einem Gewitterhimmel.
Sie machte einen Schritt zur Seite und ließ ihn eintreten. »Ich habe Sie bereits erwartet. Kommen Sie herein.«
»Ich … Bitte entschuldigen Sie mein Eindringen, Madame.« Ihr selbstbewusstes Auftreten verunsicherte ihn. Unschlüssig blieb er vor der Haustür stehen und suchte seinen Einquartierungsschein in der Hosentasche.
»Schon gut. Sie haben sich diese Situation genauso wenig ausgesucht wie ich, nehme ich an.« Sie drehte sich um und begann, den langen Flur nach hinten zu schreiten. Ihre schwarzen Kleider raschelten.
Helmut trat schnell ein und schloss die Tür hinter sich. Der Hausgang war mit Möbeln vollgestellt und es roch angenehm nach Bienenwachs. Kleine Staubkörner tanzten im Licht der untergehenden Sonne und landeten auf Welten aus Porzellan. Mit Blumen verzierte Vasen, Schmuckdöschen, grazile Tänzerinnen, schlafende Katzen, nie in seinem Leben hatte Helmut so viel bunt dekorierte Keramik auf einmal gesehen. An den Wänden hingen Schmuckteller mit farbenfrohen Motiven. Röhrende Hirsche, Jagdgesellschaften und schwimmende Schwäne schauten auf ihn herab. Er fühlte sich erschlagen und fasziniert zugleich. Sahen alle französischen Häuser so aus?
Die Hausherrin war mittlerweile in einer geräumigen Küche angekommen, in dem ein überdimensionaler Herd stand. Der Tisch war für eine Person gedeckt. Sie blieb stehen und schaute zu ihm auf. »Ob wir wollen oder nicht, wir werden eine begrenzte Zeit miteinander leben müssen. Gegenseitige Rücksichtnahme und ein höflicher Umgangston würden uns dabei helfen.«
»Madame, es tut mir leid.« Ein Stammeln. Er war ein Eindringling und fühlte sich auch so. »Ich bin Arzt und verbringe die meiste Zeit im Krankenhaus. Ich werde kaum in Ihrem Haus sein«, fügte er entschuldigend hinzu.
»Soso. Arzt sind Sie. Wie mein verstorbener Mann.« Ein Glimmen schlich in ihre schwarzen Augen und Stille breitete sich aus.
»Madame, wenn Sie so freundlich wären, mir mein Zimmer zu zeigen. Ich fühle mich erschöpft und würde gerne schlafen.« Er hatte keinen Zweifel, dass seine roten Augen seinen Zustand längst verraten hatten. Sie brannten höllisch und er wollte sich nur noch zur Ruhe legen.
»Aber Sie haben noch gar nichts gegessen! Ich habe bereits für Sie gedeckt.« Ihre Worte purzelten ihm vor die Füße.
Verwirrt schaute er die kleine Person an. Er war auf Feindseligkeiten vorbereitet gewesen. Mit Fürsorge hatte er nicht gerechnet.
Sie nahm eine Suppenkelle und tauchte sie in den Kochtopf, der auf dem Herd stand. Da nahm er endlich den würzigen Geruch wahr, der der gusseisernen Kasserole entströmte und durch die Küche waberte. Seine Gastgeberin füllte einen tiefen Teller randvoll, stellte ihn auf einem Tablett ab und legte die Brotscheiben gemeinsam mit dem Käsestück vom Tisch hinzu.
»Kommen Sie, Monsieur. Ich zeige Ihnen das Zimmer.«
Die burgunderroten Bodenfliesen waren ihm vorhin nicht aufgefallen. Sie führten in einem hübschen Muster zu einer geschwungenen Holztreppe, die nach oben führte. Die Grande Dame schritt voran, er artig hinterher. Auch der obere Flur war vollgestellt mit Möbelstücken. Kommoden, Beistelltische und weitere Gegenstände, deren Funktionen er nicht kannte. Ein buntes Sammelsurium voller Geschichten und Erinnerungen. Am Ende des Ganges betrat die Dame ein kleines Zimmer, das im Gegensatz zum Rest des Hauses geradezu schlicht wirkte. Ein Bett, ein Schrank, ein Tisch und ein Stuhl, alles aus dunklem Holz. Die Hausherrin stellte das Tablett auf den Tisch und ging zur Zimmertür.
»Das Bad befindet sich gegenüber. Gute Nacht, Monsieur.« Die Madame löste sich in ihren schwarzen Roben auf und verschwand.
Die vielen Emotionen vibrierten in Helmut nach und wühlten ihn auf. Unmöglich konnte er jetzt essen, geschweige denn die Geschehnisse einsortieren. Er legte sich in voller Uniform auf das knarzende Bett. Ehe ihn der Schlaf mitnahm, huschten flackernde Bilder in seine Gedanken. Geschwungene Flügelhauben. Tanzende Porzellanfiguren. Schwarze Gewänder. Klirrende Schlüssel. Das Schreien eines Neugeborenen. War es ein Junge oder ein Mädchen? Er vermochte es nicht mehr zu sagen. Morgen … morgen würde er nachfragen.
Kapitel 3
Vannes, Bretagne
Helmut
Ein schriller Schrei, gefolgt von einem lauten Lachen.
Helmut schreckte aus dem Tiefschlaf hoch, dabei stieß er sich in dem zu kurzen Bett den Kopf an der Kante. Hatte er den schneidenden Ruf nur geträumt? Er rieb sich die Schläfe und versuchte, seine Augen zu öffnen. Der tiefe Schlaf hatte sie fest zugeklebt, er musste mehrmals blinzeln, um das Tageslicht zu sehen.
Das Zimmer lag in der schönsten Morgensonne. Ein leichter Lufthauch wehte durch das geöffnete Fenster. Er hatte nicht bemerkt, dass es gestern Abend offen gestanden hatte, und in seiner Müdigkeit hatte er die Gardinen nicht zugezogen. Dunkelgrün und schwer hingen sie an den Seiten und rahmten die Außenwelt ein. Erneut eine schrille Lachsalve. Es war eine Möwe, die den Morgen verkündete. Wie spät es wohl sein mochte?
Gerädert richtete Helmut sich auf. Seine Uniform war zerknittert. Sogar die Stiefel hatte er angelassen. Er schüttelte den Kopf über sein Versäumnis, ansonsten war er sehr ordentlich. Langsam drangen die gestrigen Ereignisse zurück in seine Gedanken. Er hatte die vorangegangenen zwei Tage nicht geschlafen.
Sein Blick wanderte durch das kleine Zimmer und blieb am Tisch hängen. Auf der kalten Gemüsesuppe hatten sich kleine Fettaugen gebildet, die auf der Oberfläche schwammen und ihn anschauten. In diesem Moment bemerkte er, wie hungrig er war. Mit den Händen drückte er sich von der Bettkante hoch, stand auf und ging zum Tisch. Er nahm den Löffel und tauchte ihn in die bunte Suppe. Selbst kalt war sie köstlich. Er konnte Karotten, Rüben, Lauch und Kräuter herausschmecken, kleine weiße Fischstücke schwammen ebenfalls in der Brühe.
Keine fünf Minuten dauerte seine Mahlzeit, er aß alles, sogar das harte Brot. Eilig machte er sein Bett, schloss das Fenster und nahm das Tablett in die Hand.
Nachdem er sich im Bad gewaschen hatte, ging er nach unten. Von der Wand grüßten ihn die fröhlichen Gesellschaften auf den Tellern. Sie begleiteten ihn bis in die Küche.
Er blieb im Türrahmen stehen und schaute einer Frau zu, die mit dem Rücken zu ihm geschäftig am Herd hantierte. Mit der einen Hand schüttelte sie eine schwere Bratpfanne, mit der anderen griff sie nach einem Kochlöffel. Es zischte und brutzelte. Wie die Hausherrin war auch sie nicht sehr groß, dafür hatte sie breite Hüften und kräftige Oberarme. Eine geblümte Schürze spannte über ihrem Leib.
»Guten Morgen, Madame.« Er hatte sich geräuspert, bevor er sie begrüßte. Schließlich wollte er sie nicht erschrecken. Es hatte nicht geklappt. Mit einem spitzen Schrei zuckte sie zusammen, die Pfanne knallte scheppernd auf die Herdplatte.
»Haben Sie mich erschreckt!« Erbost funkelte sie ihn an. »Madame schläft noch. Ich bin die Haushälterin.« Jedes Wort warf sie ihm wie einen Vorwurf an den Kopf.
»Bitte entschuldigen Sie. Ich gehe sofort.« Er stellte das Tablett auf den Küchentisch. Ohne ein weiteres Wort an ihn zu verschwenden, wandte sie sich wieder ihrem Kochhandwerk zu. Ein kleiner Küchendrache, dachte Helmut, ehe er nach draußen trat.
Spontan beschloss er, nicht den direkten Weg zur Krankenstation einzuschlagen, sondern erst zum Hafen zu laufen und entlang des Kanals in die Klinik zu gehen. Er wusste, dass Vannes am Ende einer Bucht lag. Vom lang gezogenen Hafen aus gelangte man zunächst zu einem weiten Binnenmeer, bevor man den offenen Ozean am Horizont erblicken konnte. Vielleicht würde er es heute Abend schaffen, zu diesem Binnenmeer zu laufen.
Am Hafen angekommen blieb er einen Augenblick stehen und schaute den bunten Fischerbooten zu, die sich sanft im Wasser wiegten. Möwen saßen auf den Masten, warfen ab und an ihren Schrei in die Luft und ließen ihren Vogeldreck auf die Welt unter ihnen fallen. In der Ferne konnte er die Weite des Binnenmeers erahnen. Tief atmete er den salzigen, fischigen Duft ein.
Er drehte sich um und sah die Kirchturmspitze, an der er sich orientieren musste, um zur Innenstadt zu gelangen. Er spürte, wie die Menschen ihn anschauten, und glaubte, die Ablehnung in ihren Blicken zu fühlen. Sie brannte auf seinem Rücken. Ab und an kamen ihm uniformierte Wehrmachtssoldaten entgegen, die nach einem zackigen »Heil Hitler!« weiterzogen. Alle hatten ihre Aufgaben.
Am Ende des Hafens durchschritt Helmut ein altes Stadttor, das zur Innenstadt führte. Er war verwundert, das geschäftige Treiben auf den Straßen zu sehen. Angesichts der Ereignisse hatte er erwartet, dass das Leben zum Stillstand kommen würde. Doch die Bevölkerung schien ihren Besorgungen mutig nachzugehen. Aus der Bäckerei drang ein appetitlicher Geruch, während von der Metzgerei lautes Schlagen ertönte. Vor einer Käserei fegte ein junges Mädchen die Straße. Die Cafés waren voller Menschen, und aus einem Bistro, das mit seiner roten Vertäfelung an einer Ecke lag, drangen die verlockenden Töne einer Sängerin. Sie sang von Liebe. Der Wirt stand am Türrahmen und rieb mit einem Küchentuch ein Weinglas blank. Einen Atemzug lang hielt er in seiner Bewegung inne und verfolgte Helmut mit den Augen, bevor er sich wieder seinem Glas zuwandte.
Helmut drehte um, bog hinter dem Stadttor rechts ab und lief entlang der Hafenstraße bis zur Krankenstation. Seinen Weg säumten hübsche Fachwerkhäuser. Dunkler Granit trug das bunte Fachwerk. Mal grün oder rot, mal gelb oder blau, die frohen Töne färbten die Stadt. Manche Häuser standen schief, und Helmut wunderte sich, wie sie die Jahrhunderte überdauert hatten, ohne einzustürzen. Bei manchen ragte das hölzerne Obergeschoss hervor, von Stelzen getragen. Helmut hatte nie zuvor ein so entzückendes Stadtbild gesehen und war augenblicklich begeistert. Hier sah es anders aus als im Schwarzwald. Heller, bunter, fröhlicher. Eigenartig, sinnierte er, man hält seine Heimat für den Nabel der Welt und stellt verwundert fest, wie schön es woanders ist. Zu gerne wäre er in Friedenszeiten hergekommen.
Er erreichte das Klostergebäude und nickte den zwei jungen Landsern zu, die Wachdienst hatten. Als er den Eingangsbereich betrat, rannte ihm Schwester Bernadette entgegen, gefolgt von einer jungen Nonne. Die Oberschwester sah makellos aus, ihr Habit grau und faltenlos, ihre Haube schneeweiß und gestärkt. Hatte sie überhaupt geschlafen?
»Wir haben eine Frau mit entzündeten Schleimhäuten und gelblichen Ablagerungen. Ihr Hals ist zugeschwollen und sie hustet. Das Atmen fällt ihr schwer. Ich befürchte, dass ihre Entzündung ansteckend ist. Ich habe sie vorsorglich von den anderen Kranken getrennt. Sie waren ja nicht da.« Der letzte Satz war eine Anklage. Das anerkennende Licht, das gestern in ihrem Blick geflimmert hatte, war erloschen.
»Gut. Ich schaue mir die Kranke gleich an.«
Ein langer Tag erwartete ihn. Sie waren im besetzten Frankreich nicht nur für die Gesundheit der deutschen Truppen verantwortlich, sondern mussten auch die Zivilbevölkerung ärztlich versorgen, um jeden Seuchenausbruch zu vermeiden.
Am Nachmittag war es so weit: Mit dem ersten Krankentransport wurden zwei Soldaten eingeliefert, die einen schweren Verkehrsunfall gehabt hatten. Das Militärlazarett hatte sie geschickt. Der eine hatte sich eine Brustkorbfraktur zugezogen, während der Beifahrer einen Schädelbruch erlitten hatte. Kurze Zeit später wurde ein junger Mann eingeliefert, bei dem eine Nachamputation erforderlich gewesen war. Eine hässliche Eiterung hatte sich an seinem Stumpf entwickelt, die sich langsam an seinem Bein hochgefressen hatte. Trotz seiner flehentlichen Bitten hatten die Kollegen vom Militärkrankenhaus nicht länger warten können und ihm ein weiteres Stück seines Beins abgenommen.
Nun sollte Helmut ihn versorgen. Die Wunde stank immer noch erbärmlich. Der Eiter hing ihm in der Nase, während er den Verband wechselte. Der Soldat tat ihm entsetzlich leid. Eine junge Frau wartete daheim auf ihn. Er hatte einen großen Hof in Mecklenburg, den er bewirtschaften musste. Wie sollte er das schaffen mit einem Bein?
Um auf erfreulichere Gedanken zu kommen, beschloss er, bei der jungen Mutter vorbeizuschauen. Nach einem kurzen Klopfen trat er in das Zimmer. Das Baby lag auf dem Bauch der Frau, sie streichelte zärtlich sein Haar. Sie hatte ihn für eine Sekunde angeschaut und sich von ihm abgewendet, nun blickte sie demonstrativ aus dem Fenster.
Ihr Verhalten verunsicherte ihn und er hielt einen Herzschlag inne.
»Madame, ich möchte Ihnen zur Geburt Ihres Kindes gratulieren.«
Er erhielt keine Antwort, was ihn erstaunte. Immerhin war die Entbindung am Ende gut verlaufen. Er erwartete keinen Dank, aber eine kleine Geste der Anerkennung hätte ihm gutgetan. Die Zeiten waren unsicher, das begriff er, doch stand nicht jede Geburt für einen Neuanfang und barg einen Schimmer Hoffnung in sich?
Er trat näher an ihr Bett. Sie sieht in mir nicht einen Arzt, sondern den deutschen Feind, kam es ihm in den Sinn.
»Ein Kind erscheint im frohen Familienkreis;
zartes Glück erweckt jubelnde Bekundung;
und sein leuchtender Blick
lässt alle Augen strahlen.«
Die erste Strophe des Gedichts von Victor Hugo war ihm spontan eingefallen. Vor Jahren während seines Medizinstudiums hatte er es gelesen.
In dem Moment schrie das kleine Kindlein. Die Frau drehte den Kopf und wandte den Blick auf das Bündel auf ihrem Bauch. Da bemerkte Helmut die Tränen, die an ihren Wangen herunterliefen. Sie blickte zu ihm auf. Ihre Augen glichen silbergrauen Perlen, die feucht glänzten, eingerahmt von goldbraunem Haar. An den Schläfen hatten sich Locken aus ihrem Zopf gelöst. Ihre Lippen zitterten. Sie sah zerbrechlich aus, ein Sperling mit gebrochenen Flügeln.
»Bitte gehen Sie, Monsieur.« Eindringlich schauten ihn die Perlen an, groß waren sie.
Er fühlte sich aufgewühlt und berührt zugleich. Ohne ein weiteres Wort drehte er sich um und verließ fluchtartig das Krankenzimmer. Hatte er mit dem Gedicht einen Fehler begangen? Draußen stieß er fast mit Schwester Bernadette zusammen, die Verbandsmaterial auf einem Tablett transportierte. Sie war stehen geblieben und musterte ihn.
»Bitte entschuldigen Sie. Ich … ich war soeben bei der jungen Mutter. Sie weint. Wissen Sie, warum?« Er konnte seine Verwirrung nicht verbergen.
»Sie ist nicht verheiratet, Monsieur. Une fille-mère, eine ledige Mutter! Ich habe ihr nahegelegt, ihre Tochter zur Adoption freizugeben.« Da war er wieder, der lange Strich, der ihr Gesicht entstellte und ihre Missbilligung zum Ausdruck brachte.
»Möchte sie es denn?« Er hatte beobachtet, wie zart die junge Mutter den Kopf ihres Kindes gestreichelt hatte.
»Nein, natürlich nicht. Aber glauben Sie mir, es ist das Beste für Frau und Kind. Die Tochter kann unmöglich bei der Mutter aufwachsen. Wenn Sie mich nun entschuldigen würden, Ihre verwundeten Kameraden benötigen meine Aufmerksamkeit.« Das Krötengesicht schritt an ihm vorbei. Die Schlüssel klirrten.
Helmut fühlte eine Enge in seiner Brust. Laufen, er wollte laufen, bis er endlich das Meer schmecken konnte und der Wind seine Gedanken aufwirbeln würde. Es war spät geworden, doch das Licht würde den Tag noch einige Stunden erhellen. Ihm war aufgefallen, dass hier, am westlichsten Zipfel Frankreichs, die Sonne später unterging als in seiner Heimat und dass das Abendlicht allem einen besonderen Glanz verlieh.
Zunächst lief er zum Hafen und entlang des Kanals bis zur Pointe des Émigrés