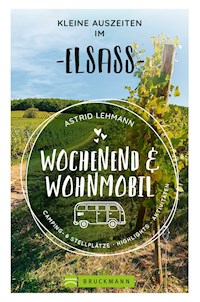Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Schwarzwald, 637 n. Chr.: Die junge Heilerin Frida lebt gemeinsam mit ihrem Stamm inmitten der Natur. Heilige Bäume und Naturgötter bestimmen ihr Leben. Doch als Mönche in den Wald kommen, läuft Fridas Zuhause Gefahr, durch eine Welt voller Vergeltung und Schuld zerstört zu werden. Denn die Heiden sollen zu Gott finden - koste es, was es wolle. Als immer mehr Alamannen den neuen Glauben annehmen, gerät Fridas Welt ins Wanken und sie begibt sich in Lebensgefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 390
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astrid Lehmann
Die Heilerin vom Schwarzwald
Historischer Roman
Zum Buch
Rune und Kreuz Zwei Welten treffen aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Frida, eine jung verwitwete Heilerin, lebt mit ihrer kleinen Tochter und ihrem Volk friedlich im tiefsten Schwarzwald. Doch die Tage des harmonischen Zusammenlebens im Einklang mit der Natur und ihren Göttern scheinen gezählt, als der Mönch Rupert mit seinen zwölf Mitbrüdern vom Landesherzog in den Wald geschickt wird. Das alamannische Leben droht vollkommen auf den Kopf gestellt zu werden. Denn die Mönche haben eine Mission. Sie sollen ein Kloster errichten und die Bevölkerung zum richtigen Glauben führen. All den Widrigkeiten der scheinbar unbezähmbaren, rauen Wildnis des Schwarzwalds zum Trotz gelingt es Rupert nach und nach, das Interesse der Heiden zu wecken und sesshaft zu werden. Nur Frida lässt sich von der neuen Glaubenswelt und den Verlockungen nicht blenden – und zieht damit nicht nur den Hass Ruperts auf sich …
Nach einer kurzen Kindheit in Frankreich und einer etwas längeren Jugend im Schwarzwald zog es Astrid Lehmann hinaus in die Metropolen dieser Welt. Vor über zwölf Jahren kehrte sie mit ihrer Familie in den Schwarzwald zurück, wo sie im Wolftal ihre ganz persönliche Heimat gefunden hat. Nach Stationen in der Vertriebswelt und dem Tourismus arbeitet sie heute als Autorin und Wildpflanzenpädagogin. Naturverbunden und abenteuerlustig genießt sie die einzigartige Naturlandschaft des Schwarzwalds und ist begeistert von seinen Traditionen, Bräuchen und Sagen.
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Fabienne Rieg
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Bildes von: © https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Master_of_the_Ore_Landriani_and_Giovan_Battista_de_Lorenz_-_Gian_Giacomo_Trivulzio_with_Saint_Hieronymus_in_the_Book_of_hours_of_Gian_Giacomo_Trivulzio_-_Google_Art_Project.jpg
ISBN 978-3-8392-7604-4
Widmung
Für Günther, Heiler meiner Welt, für Emilie und Louise, Zauberinnen meines Lächelns, und für meinen Vater, Schamane meiner Erinnerungen
Klösterliche Stundengebete
Matutin: 2.00 Uhr
Laudes: Bei Tagesanbruch, ca. 4.00 Uhr
Prim: 6.00 Uhr
Terz: 9.00 Uhr
Sext: 12.00 Uhr
Non: 15.00 Uhr
Vesper: 17.00 Uhr
Komplet: 18.00 oder 20.00 Uhr
Je nach Orden und Kloster variieren die Uhrzeiten.
Prolog
Sie liebte diese besondere Stunde. Die Zeit, die zwischen der Nacht und dem Tag lag, zwischen der Dunkelheit und dem Licht. Die Zeit, in der noch ein leichter Dunst die Welt verhüllte und ein Versprechen in sich barg. Es war ein Moment ohne Wirklichkeit, in dem eine wohltuende Stille regierte.
Die Tiere der Nacht hatten sich schon zur Ruhe gelegt, während die tagsüber munteren noch schlummerten. Nur ab und an hörte man den Ruf eines Waldkauzes. Dieser Moment gehörte ganz ihr. Keine Sorgen, die ihre Gedanken trübten, keine Versprechen, die sie erfüllen musste. Es war eine Zeit des Innehaltens, die ihr das Gefühl vermittelte, allein zu sein auf dieser Welt. Doch sie täuschte sich.
Inzwischen hatte sie den Bachlauf erreicht und schaute dem schäumenden Wasser zu, das einen großen Stein umspülte. Ein sanfter Nebelschleier stieg vom Bachbett empor, die erste Helligkeit des Tages durchbrach die feuchte Luft und hüllte die Lichtung in ein unwirkliches Licht. Sie kniete sich hin. Mit der einen Hand hielt sie ihren Zopf fest, mit der anderen stützte sie sich im Wasser ab. Dann führte sie ihren Mund an die Wasseroberfläche, trank reichlich, nahm gierig das frische Nass auf. Sie stand auf, machte einen großen Schritt und hüpfte auf den Stein, der aus dem Wasser ragte. Sie setzte sich, tauchte ihre bereits kalten Füße in das frostige Wasser und ließ ihre Beine in die Eiseskälte gleiten. Es prickelte angenehm auf ihrer Haut, wie kleine, stechende Nadeln, die ihre Beine belebten.
Als sie die Kälte nicht mehr aushielt, zog sie ihre Füße aus dem Wasser. Sie fühlte sich erfrischt und frei in der Einsamkeit des frühen Morgens.
Sie ahnte nicht, dass ein Augenpaar sie beobachtete und jede ihrer Bewegungen hungrig in sich aufnahm.
1. Kapitel
637 nach Christus Februar, ein Tag vor dem vollen Mond,Südschwarzwald
Die Wunde sah schlimm aus, der ganze Fuß war blutverschmiert. Der Junge musste schreckliche Schmerzen haben. Vorsichtig legte sein Vater ihn auf Fridas Tisch, der links neben der Tür in ihrer kleinen Hütte stand, da, wo es am hellsten war.
»Lass die Tür offen«, bat Frida den stämmigen Mann und öffnete den Holzschieber, der im Winter die Fensteröffnung bedeckte, damit sie zusätzliches Licht hatte.
Frida versuchte, die aufkommende Panik zu unterdrücken. Sie musste schnell handeln, der Junge verlor viel zu viel Blut. Er war schon ganz bleich und hatte seine Augen fest verschlossen, ließ nur noch ab und an ein leises Stöhnen verlauten.
Behutsam spülte Frida den Fuß mit klarem Wasser aus, wiederholte den Vorgang einige Male, bis sie die offene Stelle sehen konnte. Sie war tief.
Um die Blutung zu stoppen, nahm Frida eine Leinenbinde und drückte sie fest auf die Wunde, bevor sie ein weiches Lederstück darauflegte und das Ganze mit einer Tiersehne verband. Ohne den Blick von dem Jungen zu wenden, fragte sie: »Wie ist das passiert?«
Der Vater des Jungen sah angsterfüllt auf seinen Sohn hinab und knetete nervös seine Mütze in den Händen. »Er hat mit seinen Freunden im Wald gespielt. Sie sind bis zur Lichtung gelaufen, obwohl er weiß, dass er das nicht darf. Dort ist er in eine Tierfalle getappt. Giselo, der Älteste der Gruppe, hat mich geholt. Wir sind sofort zu dir geeilt.«
Frida drehte sich zu dem Holzbrett an der Wand, auf dem aneinandergereiht mehrere Tongefäße unterschiedlicher Größe standen. So schlicht sie auch aussahen, so wertvoll war ihr Inhalt an sorgsam ausgewählten Wildpflanzen: Blätter, Blüten, Rinden und Wurzeln.
Nach kurzer Überlegung entnahm sie den Töpfen einige Wurzelstücke und getrocknete Kräuter. Konzentriert legte sie sie auf einen ausgehöhlten flachen Stein und zerrieb sie mit einem länglichen Stößel, einem schweren Granitstein mit abgerundetem Ende. Ein würziger Duft verbreitete sich in der verrauchten kleinen Hütte.
Vorsichtig schüttete sie das Pflanzenpulver in den Kessel mit heißem Wasser, der über der offenen Feuerstelle mitten in ihrer Behausung hing. Mehrere Minuten rührte sie mit einem Holzlöffel in dem Pflanzengebräu. Dann nahm sie einen Schöpflöffel voll und goss diesen in ein Trinkgefäß.
»Sobald der Heiltrank abgekühlt ist, werde ich deinem Jungen zu trinken geben. Der Sud wird ihn stärken. Er hat eine Menge Blut verloren und muss viel schlafen.«
In der Zwischenzeit hatten sich einige Menschen vor ihrer Hütte versammelt. Wahrscheinlich wartete auch ihre kleine Eila draußen, die mit den Kindern ihrer Schwester Ava gespielt hatte.
Frida blendete die Stimmen vor ihrer Behausung aus und richtete ihre ganze Aufmerksamkeit auf das, was jetzt kommen würde. Behutsam legte sie ihre Hand auf den Arm des Jungen und schloss ihre Augen. Sie wurde ganz ruhig, von außen drang kein Geräusch in ihr Inneres. Sie vernahm nur das Rauschen des Bluts und die innere Wärme des Jungen.
Und da geschah es: Sie spürte den Strom, der sie beide durchfloss, ein Lebensfluss, der von dem Jungen auf sie überging und ihr leise verkündete, dass er seine Kräfte wiederfinden und heilen würde. Woher sie diese Intuition besaß, wusste Frida nicht, sah diese Gabe jedoch als Geschenk an.
Sie merkte, wie ihre innere Anspannung nachließ. Ihr Blick suchte das sorgenvolle Gesicht des Vaters des Jungen und sie lächelte ihm beruhigend zu.
»Habe keine Angst, der Fuß deines Jungen wird heilen, er wird wieder laufen können und stark sein wie ein Bär.«
Die Erleichterung des Vaters war spürbar, auch er war die ganze Zeit über angespannt gewesen. Er hatte unentwegt auf seiner Unterlippe gekaut. Als er jetzt davon abließ, konnte man die tiefen Spuren erkennen, die seine oberen Schneidezähne hinterlassen hatten.
»Er muss einige Tage bei mir bleiben. Bitte lege ihn auf das Fell. Drei Tage nach Vollmond kannst du ihn abholen. Deine Frau kann morgen nach ihm schauen.«
Behutsam hob der Vater den Jungen vom Tisch und legte ihn sanft auf Fridas Schlafstatt, die hinter dem Tisch in der linken Ecke des Raumes stand.
»Danke, Frida, ich bin so froh, dass du da bist.«
Langsam trat der Vater aus der kleinen Hütte.
Frida schaute ihm nach.
Der Anblick rief tief vergrabene Erinnerungen in ihr wach. Mit einem Mal stockte ihr der Atem, sie glaubte, plötzlich zu ersticken. Wie Nebel, dicht und zäh, breitete sich das Gefühl langsam in ihrem Inneren aus, strahlte in sämtliche Glieder und legte sich schwer auf ihr Herz. Sie versuchte, gegen die aufkommenden Tränen anzukämpfen.
Es war drei Jahre her, seit ihr Mann seinen Wunden erlegen war. Ihm hatte sie nicht mehr helfen können, das hatte sie gespürt. Zu spät hatten die Krieger ihn zurückgebracht. Seine Wunde am Bein hatte sich entzündet und wie ein Fieber seinen ganzen Körper durchflutet.
In diesem Moment kam Eila auf sie zugestürmt und drückte sich fest an ihre Mutter. »Mama, was ist passiert?«
Frida ging in die Knie und umschloss ihre kleine Tochter mit beiden Armen. Ein warmes Gefühl breitete sich in ihr aus, sie spürte nur noch unendliche Liebe und Dankbarkeit und der Nebel zog sich zurück.
Eila war ihr ganzer Stolz. Von ihrem Vater hatte sie die blonden Locken, doch die Augen waren die ihrer Mutter. Schwungvoll geformt wie die einer Wildkatze standen sie leicht auseinander und hatten die Farbe einer Haselnuss. Auch ihr besonnenes und ruhiges Gemüt hatte sie von Frida geerbt, ebenso wie die Gabe zu heilen. Trotz Eilas jungen Alters konnte Frida es schon spüren. Ihr kleines Mädchen würde eine Heilerin werden, wie sie und viele Frauen ihrer Familie vor ihr. Die Vierjährige interessierte sich bereits sehr für die Heilkunst ihrer Mutter und begleitete sie oft in den Wald, um Pflanzen und Beeren zu sammeln und Vorräte für den Winter anzulegen.
Frida drückte Eila noch mal fest an sich, bevor sie die Umarmung lockerte und ihre Tochter ernst ansah. »Wiga ist im Wald in eine Tierfalle getappt. In der Nähe der Lichtung. Ihr wisst, dass ihr nicht dorthin gehen dürft.« Eila machte ein betretenes Gesicht, während Frida fortfuhr. »Er wird jetzt einige Tage bei uns bleiben, bis er wieder zu Kräften kommt. Wir werden ihm zu trinken geben und gut für ihn sorgen.«
»Können wir dann morgen den Frühlingsanfang gar nicht feiern?« Ängstlich schaute Eila ihre Mutter an.
Schon seit Tagen war Eila aufgeregt. Endlich sollte nach den dunklen und kalten Monaten der Winter vertrieben werden und mit ihm der Schnee, der alles Leben zum Erstarren gebracht hatte. Nach der langen, entbehrungsreichen Zeit war das Frühlingsfest eine willkommene Abwechslung. Schaurige Tiermasken, die von den Männern getragen wurden, laute Gesänge und wilde Tänze würden die Kälte vertreiben. Das ganze Dorf würde sich versammeln, kräftig feiern, und das Licht wieder über die Dunkelheit siegen. Dann endlich würde der Frühling kommen und seine grüne Decke über ihre Siedlung ausbreiten. Frische Kräuter und die ersten zarten Baumblätter würden ihre kargen Mahlzeiten ergänzen.
Der Winter hatte ihre Vorräte trotz bewusster Einteilung wie jedes Jahr stark ausgedünnt. Nur noch etwas Hafer, Gerste, Haselnüsse und wenige getrocknete Beeren und Pilze hingen fein säuberlich in Netzen an einem der Dachbalken befestigt. Dort waren sie vor den Mäusen und anderem Ungeziefer am sichersten geschützt. Einen eigenen Speicher wie die anderen Familien im Dorf besaß Frida nicht. Sie lebten nur zu zweit in ihrer kleinen Hütte und der Platz reichte ihnen aus.
»Doch, das werden wir. Wir müssen nur regelmäßig nach Wiga schauen.«
Eila war sichtlich erleichtert und blickte zu dem schlafenden Jungen. Er war nur ein wenig größer als sie.
Frida legte einige Holzscheite auf das offene Feuer und kochte in einem kleinen Topf einen Gerstenbrei mit der Milch ihrer Ziegen. Sie würzte ihn mit einer Handvoll getrockneter Brombeeren und ließ ihn vor sich hin köcheln. In der Zwischenzeit befreite sie den Tisch, auf dem Wiga gelegen hatte, vom Schmutz und stellte die nun fertige Mahlzeit darauf. Eila tauchte sofort ihren Holzlöffel in die warme Speise.
»Vorsicht, du verbrennst dich noch«, mahnte Frida.
Ihre kleine Eila war immer hungrig und verschlang ihr Essen dementsprechend hastig. Beide löffelten sie nun abwechselnd den Brei, der sie von innen wärmte. In ihrem Häuschen war es trotz des prasselnden Feuers ungemütlich kalt geworden.
Nach dem Abendmahl verpflegte Frida die beiden Ziegen, die mit ihnen unter einem Dach wohnten. Ihr Platz befand sich hinter der Feuerstelle. Dort hatte sie eine Lehmwand eingezogen, an deren rechtem Ende eine kleine Tür angebracht war, die sich nur notdürftig verschließen ließ und in den hinteren Stall führte. Wenn es sehr kalt war, ließ Frida die Tür offen stehen und trennte den Bereich mit einem einfachen Haselnusszaun ab, sodass die Tiere ihrer kleinen Behausung in den Wintermonaten etwas Wärme schenken konnten, jedoch nicht frei herumliefen. Ihr kleines Haus samt Stall war zwar keine zehn Schritte lang und fünf Schritte breit, doch es war ihr eigenes kleines Reich. Sobald der Schnee schmolz, würden die Ziegen ihre Tage wieder draußen verbringen, gemeinsam mit den Tieren der anderen Dorfbewohner, bewacht von den Kindern der Siedlung.
Frida und Eila schauten noch einmal nach Wiga, gaben ihm ein weiteres Mal zu trinken und legten sich dann mit ihren Schaffellen neben ihn auf die Schlafstatt.
Noch war er ganz ruhig, doch das Fieber würde bald kommen, dessen war sich Frida sicher. Ihre kleine Eila kuschelte sich dicht an sie und forderte sie wie so oft auf, ihr die Geschichte ihrer Vorfahren zu erzählen.
»Die Geschichte kennst du doch schon. Die habe ich dir so oft erzählt«, lachte Frida.
Doch Eila liebte die Erzählung. War es die Geschichte selbst oder die betörende Stimme ihrer Mutter? Sie wusste es nicht so genau, aber sie mochte dieses allabendliche Ritual nicht missen. Ihre Mutter war eine wunderbare Erzählerin, deren spannende Geschichten von der faszinierenden Götterwelt ihres Volkes handelten, von wilden Tieren und furchtbaren Geistern. Und immer nahmen sie am Ende einen glücklichen Verlauf.
Frida schmunzelte ob der Hartnäckigkeit ihrer Tochter und gab schließlich nach. Sanft strich sie Eila übers Haar und begann mit leiser, ruhiger Stimme zu erzählen.
»Unser Volk kommt von weit her, von einem Land im hohen Norden. Dort gibt es noch größere Wälder als hier, endlose Weiten ohne Berge mit vielen Birken, dem Baum, der unserer Frühlingsgöttin gewidmet ist. Luftig und flatternd sind die Blätter der Birken, sanft tanzen sie im Wind und haben ihre ganz eigene Melodie. In jungen Jahren ist die Rinde der Birke weiß und rein, da ist sie am schönsten. Später ähnelt ihr Stamm einer weisen Frau mit faltigem Gesicht. Die Birke erzählt uns eine Geschichte von der Freude des Frühlings und des Lichts. Sie steht für das Helle, das Lebendige und den Neuanfang. Deswegen feiern die Menschen den Frühling, die Hochzeit zwischen Himmel und Erde, unter dem Blätterkleid der Birke. Im Land unserer Vorfahren jedoch hielt der Frost des Winters lange an. Es wurde immer kühler und das Leben schwerer. Die Ernte wurde knapp und unsere Ahnen litten immer öfter Hunger. Und so zogen sie los, in Gruppen, auf eine weite Reise über das endlose Land. Sie überquerten viele Flüsse und mussten hohe Berge überschreiten. Furchtlos wanderten sie in den Süden, der Wärme entgegen. Unsere Götter haben sie begleitet und vor den Gefahren auf einer so langen Reise beschützt. Bis sie schließlich vor vielen Jahren in unseren schwarzen Wald kamen und sich hier niederließen.«
»Hast du da schon gelebt?« Eila sah ihre Mutter mit großen Augen an.
Mit einem leisen Lächeln auf den Lippen schüttelte Frida den Kopf. »Nein, das war vor meiner Zeit, sogar vor der Zeit meiner Mutter und Großmutter. Aber so wird es erzählt.«
»Mama, du hast vergessen zu erzählen, dass viele unserer Krieger gestorben sind. Das musst du noch erzählen«, freute sich Eila darüber, die Geschichte in die Länge ziehen zu können.
»Also gut. Auf der langen Reise in den Süden musste unser Volk nicht nur gegen die Naturgewalten ankämpfen, gegen herbstliche Wirbelstürme und gewaltige Schneemassen, gegen den peitschenden Regen und die unerträgliche Hitze, nein, es wurde auch immer wieder von mordenden Kriegerbanden überfallen. Oft mussten sich unsere Kämpfer verteidigen, sich und ihre Familien. Viele unserer tapferen Krieger sind auf der langen Reise gestorben. Nun sind sie in Walhall, dem Ruheort der gefallenen Kämpfer, und blicken auf uns herab. Und jedes Mal wenn wir ein Fest feiern, danken wir unseren Vorfahren und laden sie ein, daran teilzunehmen. So wird es auch morgen sein. Der Schamane wird auf dem Friedhof räuchern und sich mit ihnen verbinden. Nun schlafe, meine Eila, es ist spät geworden. Der große Vogel wacht über unseren Schlaf.«
2. Kapitel
Überlingen am Bodensee
»Rupert, du genießt mein vollstes Vertrauen und das unseres Frankenkönigs.«
»Ich danke dir für deinen Glauben und verstehe deine Erwartungen, Gunzo. Doch ich möchte nicht in den dunklen Wald zu einer Handvoll wilder Germanen mit verwerflichen Sitten. Es sind Ungebildete, die rohe Wollstoffe auf nackter Haut tragen. Sie leben in fensterlosen, verrauchten Verschlägen und verehren ihre blutrünstigen Götzen. Meine Mission ist es, möglichst viele Menschen zu erreichen und sie mit der Liebe Christi zu erleuchten. Das kann ich am besten in den Städten verwirklichen. Im Schwarzwald sollen nur wenige Heiden leben, das lohnt sich nicht. Mit deiner Unterstützung möchte ich weiter in den Osten ziehen, zu größeren Siedlungen.« Rupert war lauter geworden als üblich. Sonst gab er sich gegenüber dem Landesherzog stets ruhig und besonnen. Doch dieser hielt heute gegen ihn.
»Gerade diese wilden Heiden benötigen deine Unterstützung. Wir haben größte Schwierigkeiten, sie auf den rechten Pfad zu bringen. Und du bist der richtige Mann dafür. Unser Frankenkönig wird langsam ungeduldig.«
Gunzo saß nah am Feuer auf einem dick mit Fellen bestückten Stuhl. Es war sehr kalt an diesem Februarmorgen, seit Monaten bedeckte ein eisiger Frost Überlingen und schien sich in seinem Haus ausgebreitet und in jeder Ecke festgesetzt zu haben. Das Gebäude entsprach sowieso nicht seinen Ansprüchen und war in jeder Hinsicht nicht standesgemäß für seine Aufgabe als Landesherzog. Überall zog es in diesem Haus. Seine Knochen schmerzten und seine Gelenke waren entzündet, die Kraft des jungen Mannes hatte ihn verlassen. Auf tagelange Ritte im Regen, auf Streitigkeiten und Machtkämpfe konnte er verzichten. Er sehnte sich zusehends nach Wärme, Wohlbefinden und Frieden.
Wenn er Rupert für seine Idee gewinnen und ihn in den Schwarzwald schicken könnte, könnte er dem Frankenkönig schnell von Erfolgen berichten und sich angenehmeren Dingen zuwenden. In Gedanken war er schon bei dem schweren Eichenfass, in dem ein herrlicher Wein reifte, dunkel und trocken, so wie er ihn liebte.
Doch Rupert zeigte sich störrisch, er forderte sein ganzes Argumentationstalent.
»In großen Siedlungen Menschen zu erreichen, ist einfach. Dort haben die Germanen unsere christlichen Werte größtenteils verstanden. In unerschlossenen Gegenden das Wort Gottes zu verkünden und Menschen zu begeistern, erfordert Fingerspitzengefühl, höchste Beharrlichkeit und einen Scharfsinn, den ich nur dir zutraue. Diese schwierige Aufgabe sollst du übernehmen. Denke an deinen Auftrag: peregrinatio pro Dei amore, ziehe aus Liebe zu Gott in fremde Länder. Zu diesen Wilden ist noch kein Mönch vorgedrungen. Das ist eine echte Herausforderung!« Weiße Atemwolken begleiteten seine Worte.
Rupert war ein viel gereister Geistlicher. Vor etlichen Jahren war er von einer großen Insel im Nordwesten gekommen, um die frohe Botschaft des Herrn in entfernte Länder zu tragen. Gemeinsam mit zwölf weiteren Brüdern war er in einem wackligen Holzboot über das stürmische Meer gerudert und im Reich des Frankenkönigs angekommen. Viele der Siedlungen, die er auf seinen Wegen aufsuchte, hatten bereits den christlichen Glauben ihres Königs angenommen, auch wenn die Menschen nach wie vor ihre heidnischen Götter verehrten. Das war Rupert ein Dorn im Auge, für ihn gab es keine Kompromisse. Er sah es als seine göttliche Berufung, die heidnische Götterwelt ganz aus dem Leben der Germanen zu vertreiben. Bisher hatte er sich in weitläufigen Siedlungen und Städten aufgehalten, nur dort konnte er möglichst viele Menschen erreichen. In den Kirchen und auf den großen Plätzen des Reichs hatte er gepredigt, Zweifel gesät und mit Hoffnung gelockt, ein fanatisches Blitzen in den Augen. Er hatte vorgehabt, weiter in den Osten zu ziehen, entlang des großen Sees. Jedoch bot ihm Gunzos Auftrag die Möglichkeit, etwas zu erreichen, was bisher noch niemandem gelungen war. Würde er es tatsächlich schaffen, auf bisher wildem Territorium den christlichen Glauben zu etablieren und ein Kloster zu gründen? Sein Name würde in Ewigkeit strahlen.
Rasch wog Rupert die Vorzüge und Nachteile ab. Letztendlich reizte ihn die schwere Aufgabe der Bekehrung mehr als alles andere. Müßiggang ist ein Feind der Seele, das war eines seiner vielen Prinzipien. Er müsste seine Pläne, in den Osten zu ziehen, verschieben. Doch so einfach sollte es Gunzo nicht haben, vor allem weil Rupert ahnte, dass die Beweggründe des Landesherzogs niederer Natur waren. Gunzo ging es nicht darum, den wahren Glauben zu etablieren, sondern darum, vor seinem König gut dazustehen.
Gunzos Katze, ein dicker, runder Tiger, trottete in diesem Moment gemächlich auf die beiden Männer zu, umschlich zunächst laut schnurrend die Beine des Landesherzogs und setzte dann zum Sprung auf dessen Schoß an. Dort angekommen, machte die Katze einen beeindruckenden Buckel, sträubte ihr Fell, schaute feindselig in Ruperts Richtung und fauchte ihn böse an.
Mit einer Zärtlichkeit, die man dem mächtigen Landesherzog gar nicht zugetraut hätte, strich er seinem Haustier über das Fell. »Ist sie nicht hinreißend? Na, meine Süße, hast du mich vermisst?«
Das Tier wandte sich Gunzo zu, schnurrte, bezirzte ihn, warb um seine Gunst und streichelte ihn mit seinem dicken Schwanz, um ihm dann das Gesicht zu lecken. Als hätte sie zwei Gesichter, dachte Rupert. Angewidert betrachtete er die Katze, die genauso aufgedunsen und rot war wie ihr Gönner.
»Sie ist so reizend, nicht wahr?« Gunzo liebkoste entzückt sein Haustier und schaute in Ruperts Richtung.
»In der Tat, reizend!«
Rupert hasste Katzen. Sowieso waren alle Tiere für ihn Lebewesen zweiter Klasse, Kreaturen, die Gott nur erschaffen hatte, damit sie den Menschen dienten und ihnen nützlich waren. Wieder wandte sich die Katze ihm zu und sah ihn aus ihren funkelnden Augen an, ein hinterlistiger Blick, so schien es Rupert zumindest. Dann drehte sie sich um die eigene Achse, ließ sich auf Gunzos Schoß nieder und rollte sich genüsslich schnurrend ein. Die Hierarchien waren geklärt. Sie hatte gezeigt, wer die Herrscherin im Hause des Landesherzogs war. Um das Tier nicht weiter anschauen zu müssen, verfiel Rupert in eine gebückte Gebetshaltung. Nach einer Weile richtete er sich auf, öffnete die Augen und blickte direkt in das Gesicht des Landesherzogs. Alles an ihm war rot: von den feinen Äderchen, die sich wie ein filigran gewebtes Netz auf den Wangen und den Nasenflügeln ausbreiteten, über seine Augen, die Rupert an die Fische erinnerten, die er bei der Überquerung über das große Meer gesehen hatte, bis hin zu seinem roten Umhang.
Rupert räusperte sich. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass es im schwarzen Wald so dunkel ist, dass Ackerbau und Viehzucht nur unter schwersten Bedingungen möglich sind. Das sind keine guten Voraussetzungen für eine Klostergründung.«
»Mit der Erlaubnis unseres Königs darfst du den Wald großzügig roden und ein Kloster nach deinen Vorstellungen gründen. Überlege doch! Eine klösterliche Stätte als Zentrum des Glaubens, die deinen Namen tragen wird. Langfristig könnte sogar eine Klosterschule entstehen, in die Adlige ihre Söhne senden. Das wäre ein großer Erfolg für dich. Das Land im Südschwarzwald habe ich dir auf der Karte eingezeichnet.« Gunzo setzte seine protestierende Katze auf dem Boden ab, bevor er sich erhob und Rupert an einen großen Tisch winkte. Dort lag ein aufgerolltes Dokument. Gunzo deutete auf eine darauf eingezeichnete gestrichelte Linie. »Du gehst zunächst immer den Rhein entlang. Ab diesem Zufluss immer Richtung Nordosten.« Er spürte, dass Rupert trotz der vorgebrachten Einwände angebissen hatte und sich für die schwere Aufgabe begeisterte. Auch wenn er sich noch skeptisch zeigte.
»Für diese Aufgabe benötige ich zwölf Männer, keine sechs. Wenn es unser Auftrag ist, die frohe Botschaft des Herrn im Schwarzwald zu verkünden, dann sollte ich, wie Jesus es mit seinen Aposteln tat, mit zwölf Mann in den Schwarzwald ziehen. Ich brauche auch einen guten Schmied und einen Zimmermann unter den Mönchen.«
»Nun gut, die sollst du bekommen. Du darfst dir die besten Männer aussuchen. Für die Rodungen und den Bau stelle ich dir einen Freibrief aus. Sobald die Wege trocken sind, sollst du aufbrechen.«
Gunzo war sichtlich erleichtert und wollte schnell zu einem Schluss kommen. Zwar hatte er Ruperts Forderung nach zwölf Mann nachgegeben, doch war er froh, dass der Mönch überhaupt in den Schwarzwald ging. Zum einen würde er sicherlich schon bald seinem König die Konvertierung des Südschwarzwalds verkünden können, zum anderen war ihm Ruperts asketische Lebensweise lästig. Streng mit sich selbst, forderte dieser von seinen Mitmenschen die gleiche Lebenseinstellung, die aus Verzicht, Buße und Gebet bestand. Eine Mischung aus unausgesprochenem Vorwurf und blanker Verachtung ihm gegenüber lag immer öfter in Ruperts Blick und hinterließ bei ihm ein Gefühl des Unwohlseins. Gunzo fiel es schwer, Verzicht zu üben, feines Essen und gute Weine versüßten ihm das Leben. Der Alkohol, gerade in dieser zugigen Behausung, wärmte ihn von innen und ließ ihn manche Sorge vergessen.
Mit einer Handbewegung deutete er Rupert zu gehen. Dieser befolgte den Befehl des Landesherzogs mit einem kurzen, tiefen Nicken und verließ den Raum.
Endlich konnte Gunzo sich ein Glas von dem vorzüglichen Rotwein einschenken lassen, den ihm sein Frankenkönig Dagobert als Geschenk überlassen hatte.
Obwohl sie noch ein Kind war, hatte er es geschafft, seine Tochter Fridiburga mit dem ebenfalls jungen Sohn Dagoberts, Sigibert, zu verloben. Das war eine gewinnbringende Verbindung. Ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus, das kurzzeitig seine geröteten Augen erhellte und ihn seine schmerzenden Gelenke vergessen ließ. In einigen Jahren würde das Brautpaar vor den Altar schreiten. Erleichtert lehnte sich Gunzo auf der dick gepolsterten Lehne seines Stuhls zurück und rief nach seinem Diener. Alles würde gut werden.
3. Kapitel
Tag des Vollmonds, Südschwarzwald
In den frühen Morgenstunden war das Fieber gekommen. Immer wieder hatte Wiga im Schlaf gestöhnt und wirre Laute von sich gegeben. Frida hatte ihm einen fiebersenkenden, schmerzlindernden Trank gemacht und löffelweise eingeflößt. Eila war ebenfalls wach geworden. Nun schlief sie wieder fest in ihr Schaffell eingewickelt neben dem Jungen.
Frida hatte gehört, wie die Männer des Dorfes noch im Dunkeln aufgebrochen waren. Gestern Abend hatten sie in dem für die Männer vorgesehenen, mit Haselruten abgesteckten Bereich rund um die alte Eiche am Waldrand ihr Jagdritual abgehalten. Der heilige Baum mit dem ausladenden Kronendach umhüllte ihr Volk mit seinem grünen Mantel und bot ihnen seine jahrhundertealte Weisheit. Er trug das Gedächtnis ihrer Vorfahren in sich und schenkte ihnen Schutz und Geborgenheit, Wissen und Erfahrung. Die mächtige Eiche überragte alle anderen Bäume der Siedlung. Ihr Stamm war von ungeheurer Dicke, rissig von den Falten der Erinnerung. Im Laufe der Zeit hatte sie sich in der Mitte gespalten und ein Loch gebildet. Genau dort, in ihrem Innersten, im pochenden Herzen des Baumes, hatten die Männer ihre Opfergaben für Donar abgelegt, ihren mächtigen Wettergott.
Der alte Schamane hatte die Runen, Stäbe aus Buchenholz mit eingeritzten Schriftzeichen, geworfen und anschließend gedeutet. Dabei hatte das Tierzeichen, FEHU, bei jedem Wurf oben gelegen. Ein gutes Omen.
Der weise Mann hatte einen Trank zu sich genommen und mit seiner ruhigen Stimme den Gesang eingeleitet. Der Kelch war reihum gereicht worden, die Männer hatten in den Gesang eingestimmt. Mit mächtigen Hirschgeweihen in den Händen hatten sie ihren rhythmischen Tanz aufgeführt und sich mit den Tieren des Waldes verbunden.
Ab diesem Zeitpunkt hatten sie gewusst, wo sich das beste Jagdrevier befand, und sich mit Anbruch der Morgendämmerung auf den Weg dorthin gemacht.
Frida hatte eine besondere Bindung zu dem Schamanen. Sie achtete nicht nur seine Weisheit und seinen Weitblick wie jeder andere im Dorf, sondern verspürte eine tiefe Verbundenheit mit ihm; die schmerzliche Erfahrung des Verlusts eines geliebten Menschen. Der Schamane hatte vor vielen Jahren seinen einzigen Sohn verloren. Seitdem lebte er sehr zurückgezogen und war tagelang im Wald unterwegs. Fridas Mutter, eine angesehene Heilerin, war ebenfalls viel zu früh gestorben. Die etwas ältere Ava und Frida waren gerade alt genug gewesen, um für sich selbst zu sorgen. Ihren Vater hatten sie nicht gekannt. Und so war der Schamane nicht nur Fridas Freund und Vertrauter, sondern auch ihr Lehrmeister geworden. Oft ging sie zu ihm, wenn sie Rat suchte. Niemand hatte ein derart ausgeprägtes Wissen über die Pflanzen- und Tierwelt wie der weise Mann. Doch er lebte fernab des Dorfgeschehens in seiner eigenen Welt und war oft tagelang nicht ansprechbar.
Deswegen hatte Frida die Funktion der Dorfheilerin übernommen. Die schamanischen Rituale waren jedoch trotz seiner Abkehr ihm vorbehalten. Nur er hatte die Fähigkeit, mit der Anderswelt zu kommunizieren, einem geheimen Ort der Weisheit und der Erleuchtung, zu dem allein er Zutritt hatte. Keiner wusste, wie alt er war, auch er nicht. Er war klein und drahtig, hatte langes weißes Haar und einen ebenso weißen Bart. Seine blau leuchtenden Augen beeindruckten Frida, zwei Bergseen voller Weisheit, Besonnenheit und Freundlichkeit. In sie konnte man eintauchen, sich fallen lassen und sich in ihnen geborgen fühlen. Sie wünschte, die anderen Männer im Dorf wären ebenso ruhig und umsichtig, wie er es war. Sicher, sie waren tapfere Mannsbilder, gute Jäger und mutige Krieger, wenn sie für ihren Herzog in eine Fehde aufbrechen mussten. Doch hatten die meisten von ihnen ein hitziges Temperament. Anstatt ihrem Handwerk nachzugehen oder ihren Frauen bei der Feldarbeit zu helfen, waren sie lieber auf der Jagd oder in irgendwelche Raufereien verwickelt. Vor allem nach Festlichkeiten, bei denen sie gerne und viel tranken. Am schlimmsten war Walram, der Ehemann ihrer Schwester Ava, der mächtigste Mann im Dorf. Er hatte ein großes Wohnhaus, mehrere Nebengebäude, sogar ein eigenes Webhaus und viele Nutztiere. Doch er war streitsüchtig und unberechenbar, vor allem wenn er getrunken hatte. Nicht selten hatte Ava seine Schläge zu erdulden.
Ein erneutes Stöhnen riss Frida aus ihren Gedanken.
Sie eilte zum Schlafplatz. Wiga war aufgewacht und schaute sie mit fiebrigem Blick an. Er zitterte am ganzen Körper. Beruhigend sprach sie auf ihn ein. »Es wird alles gut. Ich gebe dir zu trinken und dann schauen wir uns deine Wunde an.«
Auch Eila war mittlerweile wieder wach, sie wirkte ganz verschlafen. Frida fachte das Feuer an und legte ein Schaffell neben die Feuerstelle. Behutsam setzte sie den Jungen auf dem weichen Fell ab. Er stöhnte leicht. Nachdem sie ihm etwas zu trinken eingeflößt hatte, löste sie vorsichtig das blutverkrustete Leinentuch von der Wunde. Die Stelle war rot und stark angeschwollen, eine gelbliche Flüssigkeit trat hervor. Sie spürte, wie der Fuß pochte.
Besänftigend strich sie dem Jungen übers Haar, forderte ihn auf, noch mehr zu trinken, und wandte sich ab, um in ihren Tontöpfen nach den Zutaten zu suchen, die sie im Kopf hatte.
Mit entzündungshemmenden Kräutern, Harz und Fett stellte sie eine Salbe her, die sie mit größter Vorsicht auf die Wunde strich. Dann verband sie Wigas Fuß mit einem frischen Leinentuch, diesmal mit weniger Druck. Zufrieden betrachtete sie ihr Werk. In einigen Tagen würde die Schwellung zurückgegangen sein und die Heilung einsetzen. Vorsichtig legte sie den Jungen wieder in ihr Bett und bereitete das Morgenmahl zu.
Sie hatten gerade ihren Brei zu sich genommen, als die Männer zurückkamen. Man konnte sie unmöglich überhören, lauthals verkündeten sie ihren Jagderfolg. Eila sprang aus der Hütte und vermeldete wenig später ganz aufgeregt: »Mindestens ein Reh und zwei Wildschweine.« Sie war sichtlich erfreut. Heute endlich war das große Frühlingsfest. »Darf ich zu Ava?«
Fridas Schwester hatte vier Kinder. In den ersten Jahren ihrer Heirat mit Walram war jedes Jahr ein Kind gekommen. Und mit jeder Geburt war Ava müder und kraftloser geworden. Bei der letzten Niederkunft hatte sie viel Blut verloren. Eine erneute Schwangerschaft schien nicht möglich. Für Ava war dies ein Segen, für ihren Mann jedoch ein großes Ärgernis. Er wünschte sich noch viele Kinder, vor allem Söhne und damit tapfere Kämpfer. Das bereitete Frida zusehends Sorgen.
»Ja, du kannst mit deinen Vettern draußen spielen. Ava hat für das Fest viel vorzubereiten. Kümmere dich um den kleinen Hardo, das wird für deine Tante eine Hilfe sein.«
Frida selbst würde sich ihren Aufgaben in ihrer eigenen Hütte widmen. Gestern hatte sie mit den Frauen der Siedlung vereinbart, dass sie bei Wiga bleiben würde. Zumindest solange das Fieber noch hoch war. Sie würden ohne ihre Hilfe das Fleisch ausnehmen müssen. Im Gegenzug flocht Frida in der Zwischenzeit allen Frauen einen Haarkranz aus den grünen Zweigen der Tanne, Symbol der Lebenskraft und der Hoffnung. Die Pflanzen dafür hatte sie bereits gestern gesammelt. Sie liebte diese ruhige Arbeit, konnte dabei mit ihren Gedanken ganz bei sich sein. Oft dachte sie an ihren Ehemann, der so anders gewesen war als die Krieger aus dem Dorf. Sicher, auch er war ein mutiger Kämpfer gewesen und war mit den Männern seiner Siedlung in die Fehden ihres Landesherzogs gezogen. Doch war er mit Frida stets liebevoll umgegangen und hatte eine harmonische Beziehung mit ihr geführt.
Ein zaghaftes Rufen vor ihrer Hütte holte sie aus ihren Träumereien in die Wirklichkeit zurück.
»Komm rein, Berta, dein Junge wird sich freuen. Es geht ihm schon besser.«
Hand in Hand schlenderten Frida und Eila in der Abenddämmerung zur Dorfmitte. Vereinzelt tanzten Schneeflocken wie von Zauberhand vom Himmelszelt herab und legten sich sacht auf den gefrorenen Boden. Fridas braune Haare waren kunstvoll frisiert. In regelmäßigen Abständen hatte sie Falkenfedern in den dicken Haarzopf gesteckt, der Tannenkranz thronte auf ihrem Kopf.
Dick eingepackt in ihren Schaffellen erreichten sie das Fest. Ein meterhohes Feuer erleuchtete die Dämmerung und rundherum waren einige Bänke aufgestellt. Überall standen oder saßen die Dorfbewohner in kleinen Gruppen zusammen. Es war eine fröhliche Stimmung, die Freude des Fests vereinte sich mit den Erwartungen an den baldigen Frühling und das Erwachen der Natur.
Von Weitem erblickte Frida ihre Schwester Ava, die neben Ida, der Frau des Töpfers, saß. Angeregt unterhielten sich die beiden Frauen miteinander. Frida gesellte sich zu ihnen, während Eila zu ihren Freundinnen stürmte. Halbherzig Avas und Idas Unterhaltung lauschend, schaute sie entspannt in das Feuer. Es war ein herrlicher Abend, auf den sie sich mindestens genauso sehr gefreut hatte wie ihre Tochter.
Auf einmal wurde sie von hinten gepackt, zwei kräftige Arme schlangen sich um ihren Brustkorb und hoben sie abrupt hoch. Noch bevor sie sich umdrehen oder schreien konnte, wusste sie, wer hinter ihr stand. Es war Wolf, Avas Schwager. Der Angreifer biss in ihr Ohrläppchen und raunte: »Du gefällst mir, Frida.«
Sie überlegte fieberhaft, wie sie sich wehren sollte, und versuchte, sich aus seiner Umklammerung zu befreien, doch sein Griff wurde nur noch fester. Er lachte. Der Geruch des Alkohols stieg ihr in die Nase und ihr wurde übel. Hilfe suchend schaute sie sich um, doch von den Anwesenden nahm niemand ihre Bedrängnis wahr. Sogar ihre Schwester blieb auf der Bank sitzen und beobachtete Wolfs Treiben aus sicherer Entfernung. Wolf genoss ein hohes Ansehen in der Siedlung und niemand gab seinen trunkenen Annäherungsversuchen allzu viel Aufmerksamkeit. Es war kein Geheimnis, dass er sich Frida zur Frau wünschte. Schließlich waren sie beide jung und die einzigen in ihrer Siedlung ohne Lebenspartner. Alle gingen davon aus, dass sie früher oder später zueinander finden würden, das war nun mal der natürliche Lauf der Dinge. Fridas Ablehnung verstand Wolf nicht und führte sie auf ihr weibliches Wesen und den Wunsch, umworben zu werden, zurück.
Vor wenigen Wochen hatte er seine Frau und das erste gemeinsame Kind bei einer schwierigen Geburt verloren. Sie waren bereits einige Jahre verheiratet gewesen, doch sie hatten lange auf eine Schwangerschaft warten müssen. Das hatte Wolf seiner Frau übel genommen und seine Verärgerung hatte sich mit der Zeit in Verachtung gewandelt. Über ihren Tod und den des gemeinsamen Kindes hatte er sich deshalb schnell hinwegtrösten können und schon bald Frida als seine neue Partnerin auserkoren. Sie konnte sich glücklich schätzen, so dachte er zumindest. Mit seiner blonden Mähne, seinen blauen Augen und seinem muskulösen Körper war er sehr von sich und seiner Manneskraft überzeugt. In seiner simplen Gefühlswelt reichten diese Eigenschaften aus, um eine Frau zu beglücken. Seine Zeit verbrachte er sowieso am liebsten mit den anderen Männern der Siedlung. Stundenlang bereitete er sich auf kriegerische Auseinandersetzungen vor, die vielleicht nie stattfinden würden, und begoss seine Übungen mit würzigem Bier.
»Wolf, hör auf zu bändeln, wir führen jetzt den Tiertanz auf«, rief ein sichtlich genervter Walram seinen Bruder zur Ordnung.
Da ließ ihr Peiniger von ihr ab, drehte sich weg und rannte lachend zu den Männern. Ohne sich noch einmal umzusehen, rief er ihr laut und für alle hörbar zu: »Frida, nach dem Tanz machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben!«
Ihr war die Lust am Feiern gänzlich vergangen. Sie wünschte sich nur noch sehnlichst den Schutz ihrer kleinen Hütte herbei. Noch bevor der Tiertanz enden würde, würde sie nach Hause gehen und sich um Wiga kümmern, ihre Tochter konnte mit Avas Kindern weiterspielen. So würde sie wenigstens heute einem weiteren Annährungsversuch entfliehen.
Die Männer zogen mit ihren schaurigen Tiermasken und Fackeln zur Dorfmitte, umrundeten das meterhohe Feuer. Furcht einflößende Bärenmasken, Wolfsgesichter mit fletschenden Zähnen und Hirsche mit beeindruckenden Geweihen drehten ihre wilden Runden. Trotz ihrer getrübten Stimmung konnte sich Frida dem Spektakel nicht entziehen, zu faszinierend war das berauschende Schauspiel. Die Männer kreisten singend um das Feuer, die Frauen klatschten und johlten. Eine Trommel wurde rhythmisch geschlagen, immer lauter, immer schneller, wie ein Wirbel, der sich unwetterartig auf die Siedlung entlud. Und über alldem stieß der Schamane mit seiner dunklen, tiefen Stimme kräftige, markerschütternde Laute aus. Ein lautes Heulen, wie ein Wolf, in das alle Bewohner begeistert mit einstimmten, bis zur Ekstase und völligen Erschöpfung. Die Zeit der Finsternis und der dunklen Geister, der Kälte und der ruhenden Vegetation würde bald ein Ende finden, Helligkeit und Wärme würden siegen, wie jedes Jahr.
Frida nutzte den Moment, um sich unbeobachtet zurückzuziehen, und ging schnellen Schrittes in ihre Hütte. Auf den Rest der Festlichkeiten konnte sie verzichten. Die Dorfbewohner würden noch stundenlang am Feuer zusammensitzen, gemeinsam essen und aus ihren Trinkhörnern ein Bier nach dem anderen trinken. Das Fest, das mit dem aufsteigenden Vollmond begonnen hatte, würde sich erst mit der Morgendämmerung des nächsten Tages auflösen. Am Ende würde es, wie immer, einige Raufereien geben, an die sich am nächsten Morgen niemand erinnern würde. Zeugen der durchzechten Nacht waren einzig die blauen Augen und Prellungen, die sie am nächsten Tag behandeln durfte.
4. Kapitel
März 637, Südschwarzwald
»Es reicht nicht, wir haben Hunger, Pater.« Erschöpft lehnte sich Markus vor und stützte seine Arme auf den Knien ab. Es war schon früh dunkel geworden an diesem tristen Abend. Seit Tagen waren sie unterwegs, auf einem schmalen Pfad entlang des großen Flusses. Rupert hatte ihnen erzählt, dass der Rhein hoch oben im Norden ins Meer mündete, welches einen wochenlangen Ritt entfernt war. Der Rhein ergoss sich dort in das eisige, salzige Wasser, das mit seinen hohen Wellen die Unendlichkeit bedeckte. Dieser Gedanke war einfach unvorstellbar.
Am Anfang waren die Brüder noch in der vitalisierenden Aufbruchsstimmung gewesen, hatten sich über die Abwechslung und die vor ihnen liegenden Abenteuer gefreut. Nur wenige Männer ihrer Gruppe hatten je die Grenzen Überlingens verlassen. Und wenn doch, so war die Reise höchstens nach Konstanz gegangen. Dementsprechend eifrig und abenteuerlustig waren sie gewesen.
Doch mit jedem Tag schwanden ihr Optimismus, ihre Freude an der Reise und ihre Energie ein bisschen mehr. Zum einen rationierte Rupert ihre Mahlzeiten, obwohl sie anstrengende körperliche Arbeit leisteten, zum anderen regnete es seit Beginn ihres Aufbruchs. Der schwere Leiterwagen sank immer wieder im Schlamm ein und musste mit vollem Körpereinsatz befreit werden. Mehrere Brüder zogen von vorn, einige Männer von hinten, während die übrigen Holzbretter unter die Wagenräder schoben. Kaum war die Prozedur überstanden, konnten sie wieder von vorne anfangen. Zu Hilfe kamen ihnen die zwei Pferde, die vor den Leiterwagen gespannt waren. Doch selbst die einst stolzen Kaltblüter sahen mittlerweile kraft- und mutlos aus, von den Mühen geschwächt.
Der anfänglich starke Regen hatte sich nach einigen Tagen in ein Nieseln verwandelt. Dafür hatte sich dichter Nebel ausgebreitet, der die Flussaue mit seinem undurchdringlichen Schleier in einen grauen Mantel hüllte und ihnen die Sicht versperrte. Es war unmöglich zu erahnen, was hinter dem Flusstal lauerte. Ab und an durchbrach eine Silhouette die Nebelbrühe, zeigte sich bedrohlich der Gruppe, nur um innerhalb von Sekunden wieder von der trüben Feuchtigkeit verschluckt zu werden. So schnell, dass man gerade noch erahnen konnte, dass es sich nur um einen Baum gehandelt hatte. Doch hinter jedem Nebelschleier, hinter jedem Schatten vermuteten sie Wegelagerer, die ihre mitgebrachten Schätze rauben wollten. Wie einfach wäre es, wehrlose, halb verhungerte Mönche zu überfallen, die einen schwer beladenen Leiterwagen mit sich zogen?
Noch furchtbarer als Wegelagerer war jedoch die unbekannte Tiefe des Waldes. In das dunkle Nichts drangen weder Licht noch Wärme. Es bestand nur aus Finsternis und Kälte, war Herberge der Dämonen und bösen Geister, die unheilvolle Zauber bereithielten.
Der Nebel durchdrang ihre klammen Kleider, legte sich auf ihre Haut und kroch ihre Knochen empor. Ihre eisigen Körper und steifen Glieder ließen ihre Zuversicht schwinden. Jetzt kam noch der Hunger hinzu.
Eine trübe Stimmung hatte sich in der Gruppe ausgebreitet. Der Einzige, dem der Nebelschleier, die feuchte Kleidung und die rationierten Mahlzeiten nichts anzuhaben schienen, war Rupert, der sie unerbittlich weitertrieb. Bereits vor dem Sonnenaufgang zog die Gruppe tagtäglich nach einem ersten kurzen Lobgesang los. Nur die regelmäßigen Stundengebete unterbrachen den monotonen Marsch und schenkten den Mönchen Momente der Ruhe. Anstatt mittags ein wärmendes Feuer zu entfachen, eilten sie im Gleichschritt weiter. Abends gönnte Rupert ihnen eine längere Verschnaufpause, bei der sie eine karge Mahlzeit einnahmen.
Verbittert dachte Markus an das harte Brot und die Zwiebel, die sie jeden Abend erwarteten. Alle Männer waren hungrig und wünschten sich eine warme Speise. Doch niemand hatte sich getraut, Rupert darauf anzusprechen. Bis jetzt. Markus fürchtete, dass einige Mitbrüder es nicht bis zum Ziel schaffen würden, sollte es bei diesem Tempo und dem kläglichen Essen bleiben. Nun hatte Markus seinen ganzen Mut zusammengenommen und schaute hoffnungsvoll auf Rupert.
Dieser schmetterte seine Bemerkung jedoch unerbittlich ab. »Nur durch Verzicht können wir unsere Gedanken sammeln und frei für Gottes Wort werden. Am Sonntag können wir wieder üppiger essen.«
Betrübt blickte Markus auf den Boden. »Üppig« bestand für Rupert aus einer zusätzlichen Ration Brot, sonst nichts.
»Außerdem sind wir fast am Ziel angelangt. Ich denke, dass wir morgen an dem Zufluss ankommen werden, an dem sich die Weggabelung befindet. Danach werden wir uns in nordöstlicher Richtung halten. Ein bis zwei weitere Tage Marsch und wir werden das versprochene Land erreicht haben.«
Markus betrachtete verstohlen seine Mitbrüder. Keiner von ihnen regte sich. Alle saßen sie um den Leiterwagen herum und waren zu erschöpft, um auf Ruperts Aussagen zu reagieren.
»Nun lasst uns beten und Gott für den heutigen Tag danken. Er hat uns auf unseren Wegen beschützt und vor dem Bösen in dieser unwirtlichen Wildnis bewahrt.« Mit einer ausschweifenden Armbewegung zeigte Rupert auf die Nebelwand, sprang abrupt auf und forderte seine Mitbrüder auf, es ihm gleichzutun. Woher er diese Energie hatte, verstand Markus nicht. Seit Anfang der Reise strotzte er vor Tatendrang. Morgens war er der Erste, der zügig aufstand und energisch losmarschierte, ohne auch nur eine Spur von Ermüdung zu zeigen. Wenn das Rad des Wagens im Schlamm steckte, war Rupert sofort zur Stelle und packte beherzt mit an. Nachts war er es, der seine Mitbrüder zum Stundengebet weckte. Klein und drahtig von Statur, strahlte er eine ungeheure Kraft aus. Das war ohne Zweifel allen Mitbrüdern ein Rätsel. Untereinander austauschen konnten sie sich nicht, nur wenige Worte und Blicke waren möglich, ohne dass Rupert es mitbekam. Denn während des stundenlangen Laufens waren Gespräche untersagt, sie beteten oder sangen, um sich zu Gott zu erheben.
Müde richteten sich nacheinander alle Mönche auf. Markus half Dominic auf die Beine, der sich am Fuß verletzt hatte. Sein Knöchel war stark angeschwollen und schmerzte bei jedem Schritt. Sofort läutete Rupert mit seiner melodiösen Stimme die Gebete ein. Wie lange sie da standen und beteten, konnte Markus nicht sagen. Es schien, als wären einige Mitbrüder beim Beten eingeschlafen. Nach einer gefühlten Ewigkeit vernahmen sie die erlösenden Worte Ruperts. »Amen. So lasst uns jetzt schlafen gehen.«
Manche Brüder sanken einfach zu Boden, ohne sich vor dem Regen zu schützen oder sich zuzudecken. Einige von ihnen krochen unter den Leiterwagen oder lehnten sich an einen Baumstamm. Von irgendwoher durchbrach ein leises Schluchzen die nächtliche Stille, ab und an übertönt von den Rufen eines Waldkauzes.
Am nächsten Morgen traute Markus kaum seinen Augen. Der dauernde Nieselregen hatte aufgehört und die Helligkeit des Nachthimmels versprach freundliches Wetter. Noch leuchteten Sterne in der unendlichen Dunkelheit über ihm, doch zum ersten Mal seit Tagen fühlte er den anfänglichen Eifer wieder aufkeimen.
Hoffnungsvoll schaute Markus auf das Himmelszelt. Von Anfang an war klar gewesen, dass die Reise und der Auftrag nicht einfach werden würden. Zum Wesen der Kirche gehörte nun mal, alles zu verlassen und Christus nachzufolgen. Und nur durch Härte, Verzicht und Anstrengung konnten sie Gott ihre wahre Liebe bezeugen. Sie hatten den Regen gemeistert, ihren Hunger beherrscht, und das, was vor ihnen lag, möge es noch so ungewiss und gefährlich sein, würden sie auch schaffen. Ein winziges Licht der Zuversicht flackerte in seinem Inneren. Wie Rupert war Markus aus Überzeugung Mönch, doch ein hoher Idealismus beseelte seinen Glauben. Da, wo für Rupert fanatischer Ehrgeiz an erster Stelle stand, war für Markus der Auftrag der Nächstenliebe das Ziel. So war er zum Wortführer seiner Mitbrüder geworden.
Ein leises Stöhnen ließ ihn aufhorchen. Konzentriert hörte er in die Dunkelheit der frühen Morgenstunde hinein. Da, erneut ein Wehklagen, das vom Waldrand kam und unmöglich von einem wilden Tier stammen konnte. Leise erhob sich Markus und bewegte sich in die Richtung, in der er das Geräusch vermutete.
»Wer ruft da?«, fragte er flüsternd in das Dämmerlicht.
Als Antwort bekam er nur ein erneutes Stöhnen. In wenigen Schritten war er bei Johannes und kniete sich zu ihm nieder. Er spürte die Hitze des Bruders, ohne ihn anzufassen. Johannes musste hohes Fieber haben, er glühte trotz der Kälte des Morgens.
»Ich bringe dir Wasser und informiere den Pater«, flüsterte Markus seinem Mitbruder zu und lief zu Rupert.
Der war schon aufgewacht und bereitete sich auf die morgendliche Laudes, die den Anbruch des Tages feiert, vor.
»Pater, Bruder Johannes hat hohes Fieber. Er liegt unter dem großen Baum am Waldrand.« Markus deutete mit dem Finger in die Dunkelheit. »Ich bringe ihm zu trinken.«
»Bitte bringe ihn zur Laudes, dann sehen wir weiter.«
Markus füllte seinen Becher mit frischem Wasser und lief hinüber zu Johannes. Nachdem dieser wenige Schlucke getrunken hatte, forderte Markus ihn zum Aufstehen auf: »Komm, der Pater wartet auf uns.«
»Ich kann nicht.« Nur leise ertönte Johannes’ Stimme.
»Du musst. Schließlich wird der Pater keine Pause dulden und wir können dich hier nicht zurücklassen. Ich helfe dir.«
Mühsam und auf Markus gestützt stand Johannes torkelnd auf. Ihm war schwindlig und es kostete ihn große Anstrengung, einen Fuß vor den anderen zu setzen. Langsam machten sich die beiden auf den Weg zu den anderen Brüdern, die in der Zwischenzeit alle aufgewacht waren und sich um Rupert versammelt hatten. Besorgt musterte Dominic den kranken Mitbruder und sprach Rupert an: »Pater, ich kann nach Bruder Johannes schauen. Vielleicht kann ich ihm helfen.«
In Überlingen hatte Dominic dem infirmarius