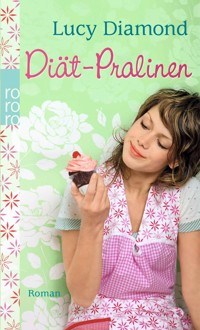9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ink.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
DER BESTSELLER AUS GROSSBRITANNIEN
Becca und Rachel sind keine richtigen Schwestern. Nur Stiefschwestern, wie Rachel stets betont. Tatsächlich könnten die beiden unterschiedlicher nicht sein: Während der erfolgreichen Rachel das Glück nur so zufliegt, schlittert Becca von einer Katastrophe in die nächste. Aber dann ist Rachel plötzlich verschwunden. Und Becca lässt alles stehen und liegen, um sich um Rachels Familie zu kümmern. Doch als sie Rachels vermeintlich perfektes Leben betritt, wird schnell klar, dass hier nichts ist, wie es scheint. Sie macht sich auf die Suche nach Rachel und lüftet nach und nach die Geheimnisse ihrer Schwester, die sie auch ihr eigenes Glück überdenken lassen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 581
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
TitelZu diesem BuchWidmungKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Kapitel 28Kapitel 29Kapitel 30Kapitel 31Kapitel 32Kapitel 33Kapitel 34Kapitel 35Kapitel 36Kapitel 37Kapitel 38Kapitel 39Kapitel 40Kapitel 41Kapitel 42Kapitel 43Kapitel 44Kapitel 45Kapitel 46Kapitel 47Kapitel 48Rezepte aus dem RomanDer Geburtstagskuchen der JacksonsWendys bösartige BananensmoothiesJanices walisische KekseBeccas AufmunterungspfannkuchenDanksagungDie AutorinImpressumLUCY DIAMOND
Nur einen Herzschlag entfernt
Roman
Ins Deutsche übertragen von Frauke Meier
Zu diesem Buch
Becca und Rachel sind keine richtigen Schwestern. Nur Stiefschwestern, was vor allem Rachel nie vergisst zu betonen. Tatsächlich könnten sie unterschiedlich er nicht sein. Ein liebender Ehemann, Kinder, eine steile Karriere – die erfolgreiche Rachel scheint alles zu haben, wovon Becca immer geträumt hat, während diese von einer Katastrophe in die nächste schlittert. Doch als Becca die Nachricht erhält, dass Rachel plötzlich verschwunden ist, lässt sie dennoch alles stehen und liegen. Sie macht sich auf den Weg nach Birmingham zu Rachels drei Kindern. Aber als Becca die Tür zum vermeintlich perfekten Leben ihrer Schwester aufstößt, wird schnell klar, dass hier nichts so ist, wie es scheint. Rachels Mann ist vor Monaten ausgezogen, und im Büro hat man seit einer Ewigkeit nichts mehr von ihr gehört. Becca beschleicht die dunkle Vorahnung, dass ihrer Schwester Schlimmes widerfahren sein muss. Sie macht sich auf die Suche nach einer Frau, die ihr selbst viel ähnlicher zu sein scheint, als sie dachte, und je näher sie Rachels Geheimnis kommt, desto deutlicher wird, dass einem das Glück oftmals näher ist, als man erwartet!
Dieses Buch ist für Lizzy und Caroline,
in Liebe und Dankbarkeit
KAPITEL 1
»Wir erreichen in Kürze Manchester Piccadilly Station. Von dort haben Sie Anschluss an Züge nach London Euston, Liverpool Lime Street und Edinburgh International. Der Zug hält in etwa zwei Minuten in Manchester Piccadilly Station. Alle Passagiere bitte aussteigen.«
Als der Zug den Bahnsteig erreichte, brach im Waggon hektisches Treiben aus: Taschen wurden aus den Gepäckfächern über den Sitzen gezerrt, eselsohrige Zeitungen auf den Plätzen zurückgelassen, Telefone in Taschen verstaut. Rachel Jackson war bereits einen Schritt weiter, stand in der Schlange vor der Tür und stolperte gegen eine Gepäckablage, als der Zug hart abgebremst wurde und ruckartig zum Stehen kam.
»Manchester Piccadilly, hier ist Manchester Piccadilly. Bitte alle aussteigen. Alle Passagiere bitte aussteigen.«
Das war’s. Sie hatte es geschafft. Adrenalin strömte durch ihren Körper, als die Türen entriegelt wurden und sich der Strom der hektisch drängenden Passagiere auf den Bahnsteig ergoss. Wie benommen folgte sie der Menge und merkte kaum, dass jemand ihr seinen Koffer an die Beine rammte. Hallo Manchester, dachte sie beim Aussteigen. Ich bin hier, weil ich ein paar Antworten brauche. Hast du welche für mich?
Verglichen mit Hereford kam ihr der Bahnhof riesig vor, ein höhlenartiges Gebilde, dessen Dach auf einem komplizierten Gitternetz aus Trägern und Streben ruhte. Um sie herum hallte die Stimme aus der Lautsprecheranlage. Es war Anfang Juni, und während der morgendlichen Fahrt zur Schule hatte es ausgesehen, als würde bald fahler Sonnenschein durch die Wolken sickern, doch nun war die Luft kalt, und Rachel zog den blassgrauen Cardigan fester um den Leib, als sie inmitten der anderen Reisenden den Bahnsteig hinunterging. Ihre Nerven kribbelten. Nun, da sie hier war, fühlte sie sich überfordert. Ihr Vorhaben kam ihr plötzlich so ungeheuerlich vor, es erschütterte sie mit der ganzen Gewalt zunehmend lauter und stärker werdender Trommelschläge. Wollte sie die Wahrheit überhaupt noch erfahren?
Ja, ermahnte sie sich eisern und schritt voran. Ja, das will ich. Nach all den Lügen, die ihr vorgesetzt worden waren, musste sie es wissen. Sie musste das durchziehen.
Vor den Drehkreuzen staute sich die Menge. Murren wurde laut. Eine Gruppe japanischer Touristen schien die Fahrkarten verloren zu haben, und ein älteres Paar versperrte den anderen Durchgang, weil ihr Einkaufstrolley an der elektronisch gesteuerten Schranke hängen geblieben war. Der Unmut war ansteckend, und Rachel spürte, wie ihr eigener Zorn zunahm. Kommt schon, kommt schon. Beeilt euch. Wenn sie noch lange hier herumstand, würde sie es sich womöglich doch noch anders überlegen. Sie musste in Bewegung bleiben, musste ihre Entschlossenheit behalten.
Endlich war sie an der Reihe. Mit klammen Fingern zog sie ihr Ticket durch und trat in die Haupthalle, in der bunter Trubel herrschte. Es wimmelte von Menschen, die Koffer schleppten, in Telefone bellten und zu ihren Zügen eilten. Eine Frau auf mörderisch hohen Highheels und mit einem Aktenkoffer rannte Rachel beinahe über den Haufen, scheinbar ohne es wahrzunehmen, denn sie hielt kaum inne. Ein Klingelton dröhnte aus den Lautsprechern, Mütter zerrten ihre kleinen Kinder mit sich, eine Gruppe skandinavisch aussehender Teenager mit riesigen Rucksäcken und beneidenswert gebräunten Beinen beugte sich eifrig diskutierend über eine Karte.
Rachel hatte das Gefühl, klein, still und anonym in der Masse unterzugehen, während sie nach Schildern Ausschau hielt, die ihr den Weg zum Ausgang und zum Taxistand weisen konnten. Meilen entfernt von den grünen Hügeln und dem Ackerland, das ihr Zuhause umgab, war hier niemand, der sie kannte oder auch nur ahnte, dass sie diese Reise gemacht hatte. »Ein Meeting«, hatte sie nur vage zu Sara von gegenüber gesagt, als sie sie gebeten hatte, Luke und Scarlet am Nachmittag von der Schule abzuholen. »Ich bin spätestens um fünf zurück.« Nur eine Stippvisite. Vom Zug aus hatte sie angerufen, um sich zu vergewissern, dass Violet an diesem Tag bei der Arbeit war. »Ja, sie ist da, ich stelle Sie durch«, hatte eine nette Dame zu ihr gesagt, aber Rachel hatte sofort mit wild klopfendem Herzen aufgelegt. Nein. Nicht am Telefon. Es musste von Angesicht zu Angesicht stattfinden, denn sie wollte der Frau in die Augen blicken und sich die ganze Geschichte anhören.
Oh Gott. Es war so beängstigend. Was würde Violet ihr erzählen?
Vielleicht sollte sie erst noch einen Espresso trinken, überlegte sie beim Anblick eines nahen Coffeeshops, von dem ein verlockender Duft von Zimt, Kaffee und Vanille ausging. Immerhin hatte sie mehr als genug Zeit, und sie konnte etwas brauchen, das sie dazu brachte, sich den letzten Ruck zu geben, den sie vielleicht noch brauchte. Ein Schluck kräftigen Kaffees, dann wäre sie bereit, mit dem Herumeiern aufzuhören, in ein Taxi zu steigen und diese Sache hinter sich zu bringen Pack es an, Kleines, wie ihr Dad zu sagen gepflegt hatte.
Sie stellte sich in der Schlange an. In ihrem Kopf herrschte wieder einmal ein wildes Durcheinander kummervoller Gedanken, die alle um den Zeitungsbericht kreisten, den sie entdeckt hatte. Und bei dem Gespräch nach der Bestattungsfeier für ihren Vater, mit dem diese ganze verworrene Geschichte angefangen hatte. Hat Ihr Vater … mich je erwähnt? Nun wünschte sie, sie wäre Violet nie begegnet. Und plötzlich kam es ihr überaus unbesonnen vor, dass sie hergekommen war. Was, wenn das alles gar keinen Sinn hatte?
Aus ihren Gedanken gerissen zuckte sie zusammen, als eine männliche Stimme hinter ihr sagte: »Entschuldigen Sie, Verehrteste?«
Während sie sich überrascht umwandte, packte auf der anderen Seite jemand ihre Handtasche. »Hey!«, schrie sie und versuchte hastig, die Tasche festzuhalten, aber im nächsten Moment versetzte ihr jemand von hinten einen Stoß, und sie verlor das Gleichgewicht und fiel, fiel, fiel …
Ihr blieb gerade genug Zeit, um vage wahrzunehmen, dass ihr die Handtasche entrissen wurde und jemand davonrannte, ehe sie mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Dann wurde es schwarz um sie.
»Sie ist was? Verschwunden?«, wiederholte Becca am Telefon und wandte sich von ihrer Mitbewohnerin ab, die am anderen Ende des Sofas saß und an den Saiten einer Laute herumzupfte. Meredith gehörte einer Gruppe an, die sich dem Lebensstil des Mittelalters verschrieben hatte, und verbrachte die meisten ihrer Wochenenden in dem entsprechenden Outfit. Das Lautespiel war ein neuer und unwillkommener Nebenaspekt ihres Hobbys. »Sagen Sie das bitte noch mal«, bat Becca und legte ihr angebissenes Stück Pizza weg, um sich besser auf das Gespräch konzentrieren zu können.
»Fünf Uhr, hat sie gesagt«, erklärte die Anruferin ein wenig atemlos und ziemlich ungehalten. »Fünf Uhr spätestens! Und jetzt geht sie nicht an ihr Telefon, die Kinder haben keine Ahnung, wo sie sein könnte … Ich meine, das passt einfach nicht zu ihr, nicht wahr? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Soll ich die Polizei rufen? Bei Ihnen ist sie nicht, oder?«
All diese Informationen zu verarbeiten, die wie ein Sperrfeuer auf sie einprasselten, fiel Becca nicht leicht, ganz besonders, solange Meredith unmelodisch vor sich hin musizierte. »Nein, bei mir ist sie nicht«, entgegnete sie, stand vom Sofa auf und ging durch den Raum zum »Küchenbereich«, wie ihr Vermieter die Kochnische recht euphemistisch genannt hatte. Mit der freien Hand fegte sie ein paar Toastkrümel von der Arbeitsplatte und gelobte im Stillen, morgen gründlich sauber zu machen. »Ich weiß nicht …«
»Na ja, es war Mabels Idee, dass wir Sie anrufen, das ist alles. Ich wusste einfach nicht, bei wem ich es sonst versuchen könnte! Wie es scheint, werden die Kinder nun wohl etwas länger als geplant bei mir sein, nur wollten Alastair und ich eigentlich ausgehen, und ich – ach, entschuldigen Sie, das ist mein Mann. Wir haben die Theaterkarten schon vor einer Ewigkeit besorgt, und ich weiß nicht, ob der Babysitter mit drei weiteren Kindern neben meinen beiden zurechtkommt. Außerdem können sie hier sowieso nicht schlafen. Alastair hat das Gästezimmer mit seiner Sportausrüstung belegt. Ich habe ihm gesagt, er soll das Zeug wegräumen, mehrfach, aber Sie wissen ja, wie Männer sind …«
Becca hielt das Telefon ein Stück vom Ohr weg. Die Frau – Sara, hatte sie gesagt? Oder Sandra? – hatte eine schrille Stimme und sprach sehr laut. Außerdem schien sie fähig zu sein, ununterbrochen zu reden, ohne zwischendurch Luft zu holen. Beeindruckendes Lungenvolumen, dachte sie und legte die gebrauchten Teebeutel neben die Spüle. »Ja«, sagte sie, als doch endlich eine Pause eintrat. Nach all dem wusste sie nicht recht, was sie sonst sagen sollte. Es war ja schön und gut, dass ihre Nichte Mabel der Frau ihren Namen genannt hatte, aber Becca hatte Rachel seit über einem Jahr nicht mehr gesprochen. Die Beziehung zwischen ihr und ihrer Stiefschwester war nicht unbedingt so symbiotisch wie die siamesischer Zwillinge.
»Also, was meinen Sie, wann können Sie hier sein?«
Woah. Ohne Vorwarnung war Sara plötzlich zum Kern der Sache gekommen. »Dort sein? Was meinen Sie, warum …?« Mist. War das ihr Ernst? Beccas Schicht im White Horse begann in vierzig Minuten, und sie hatte noch nicht einmal ihren Tee getrunken, ganz zu schweigen davon, sich einigermaßen anständig zurechtzumachen.
»Mabel fand, wir sollten Sie anrufen. Sie wären die beste Wahl. Weil Sie doch zur Familie gehören und so. Sie sagte, sie kann sich um die beiden Kleinen kümmern, bis Sie hier sind. Sie kommen aus Birmingham, richtig? Dann könnten Sie innerhalb von … nun, in ungefähr einer Stunde in Hereford sein? Oder in anderthalb Stunden? Das dürfte klappen.«
»Na ja, theoretisch, aber …« Aber ich habe einen Job in einer stickigen Kneipenküche, in der ich heute Abend zu arbeiten habe, und, noch wichtiger, die Kinder kennen mich kaum. Sie verzog das Gesicht und wünschte sich, die Frau hätte nicht gesagt, dass Mabel sie für die beste Wahl hielt. Becca war von jeher anfällig für Komplimente. Ein nettes Wort, und sie fiel auf alles und jeden herein.
»Gott sei Dank! Ich sage es den Kindern. Mabel! Deine Tante ist unterwegs, okay? Nur für den Fall, dass eure Mum sich noch mehr verspätet.«
»Einen Moment«, versuchte Becca zu protestieren. Die Frau war wie eine Dampfwalze. Warum regierte sie nicht längst das ganze Land?
»Also, soll ich noch warten, ehe ich die Polizei rufe? Die werden mir wahrscheinlich sowieso sagen, dass ich erst vierundzwanzig Stunden abwarten soll, oder? Und sie ist ja eine erwachsene Frau. Es wird sie schon niemand entführt haben oder so was. Oje, das hätte ich nicht sagen sollen. Ich glaube, Luke hat mich gehört. Mach dir keine Sorgen, Schatz! Mummy geht es gut! Wahrscheinlich … ach, du weißt schon. Sie ist eben mit etwas anderem beschäftigt.«
Becca starrte zum Fenster hinaus auf die Hauptstraße vor dem Haus und ließ den Monolog, der in einem scheinbar unaufhaltsamen Strom durch das Telefon hallte, über sich ergehen. Das letzte Mal hatte sie Rachel vor dreizehn Monaten bei der Beerdigung ihres Dads gesehen. Damals hatten sie sich – gestelzt und floskelhaft – über das Büffett und den Ablauf des Gottesdiensts unterhalten. Becca war zu spät gekommen, der Verkehr war der reinste Albtraum gewesen. Beständig Entschuldigungen murmelnd hatte sie sich durch den Gemeindesaal ihren Weg zu Rachel bahnen müssen, die sie mit einem Blick empfangen hatte, der so vorwurfsvoll gewesen war, dass sich Becca sogar bei der bloßen Erinnerung noch die Fußnägel kräuselten. Ihre Nichten und ihren Neffen hatte sie sogar noch länger nicht mehr gesehen – eineinhalb Jahre, schätzte sie; Weihnachten bei Mum und Dad. Luke musste fünf gewesen sein, dunkles Haar, umwerfende schwarze Wimpern, die veilchenblaue Augen umrahmten, und schüchtern gegenüber jedem mit Ausnahme seiner Mutter. Nicht einmal Lawrence, Rachels sanfter, selbstsicherer Mann, konnte ihn aus der Reserve … Augenblick mal.
»Einen Moment«, sagte sie erneut, dieses Mal aber lauter. Natürlich, danach hätte sie gleich fragen sollen. Es war verrückt, dass sie sich schon so lange unterhalten hatten, ohne dass sie gefragt hatte. »Wo ist denn Lawrence? Kann er nicht die Stellung halten, bis Rachel zurück ist?«
Plötzlich schwieg Sara, und eine sonderbare, angespannte Stille trat ein. »Lawrence?«, wiederholte sie dann mit einem nervösen Lachen. »Nun ja … Lawrence ist Ende letzten Jahres ausgezogen. Sie haben sich getrennt. Wussten Sie das nicht?«
KAPITEL 2
Einige Stunden zuvor
»Hallo, können Sie mich hören? Ich glaube, sie kommt zu sich, Jim. Können Sie mich hören, Schätzchen?«
Rachel schlug die Augen auf und starrte direkt in das Gesicht einer Frau, deren maisblondes Haar zu einem seitlichen Zopf geflochten war und die eine grüne Uniform trug. Himmel, ihr Kopf tat weh. Hämmerte, als wollte er platzen. Der Geschmack von Blut lag auf ihrer Zunge, metallisch und warm, und der Geruch eines Desinfektionsmittels kribbelte in ihrer Nase. Was um alles in der Welt …?
»Na also! Hallo, ich bin Cathy, Rettungssanitäterin, und wir sind auf dem Weg ins Krankenhaus. Erinnern Sie sich, was passiert ist?«
Sie lag auf einer schmalen Pritsche und konnte einen Motor hören. Krankenwagen, dachte sie benommen. Ihr Kopf schmerzte. Ihr Kinn auch. Unfähig, den Vorgängen um sich herum einen Sinn abzuringen, schloss sie die Augen wieder. Nur ein seltsamer Traum. Schlaf einfach weiter. Das war das, was sie ihren Kindern immer sagte, wenn sie mitten in der Nacht erwachten.
»Sie waren bewusstlos, meine Liebe. So, wie es sich angehört hat, wurden Sie niedergeschlagen. Ein paar Strolche haben sich im Bahnhof Ihre Handtasche geschnappt und sind geflüchtet. Erinnern Sie sich?«
Die Frau sprach mit einem nördlichen Akzent, wie Rachel benebelt erkannte. Wie in Coronation Street. Dads Lieblingssendung. Was war das noch – Handtasche? Bahnhof? Das ergab keinen Sinn. Wo war ihre Handtasche überhaupt? Sie hatte ihre Schlüssel in der Handtasche. Die brauchte sie doch, um ins Haus zu kommen. Schlüssel zur Tür. Tür zum Schlüssel. Wie war das noch?
»Wir bringen Sie jetzt ins Krankenhaus, weil Sie mehrere Minuten bewusstlos waren und Ihr Gesicht ziemlich was abbekommen hat, ja? Versuchen Sie, stillzuhalten. Können Sie mir Ihren Namen verraten?«
Rachel blinzelte. Ihr Name. Ja. Sie versuchte, den Mund zu öffnen, um der Frau zu antworten, doch ein sengender Schmerz breitete sich in ihrem Kinn aus, und sie brachte lediglich ein Stöhnen zustande. Ihr Gesicht pulsierte. Ihr ganzer Körper tat weh. Und da war ein unerbittliches, hohes, durchdringendes Klingeln in ihren Ohren. War das ein Traum? Es musste einer sein. In Wahrheit lag sie wohlbehalten zu Hause im Bett, und das alles war nur ein eigenartiger Traum. Schlaf weiter.
»Okay, vergessen wir das erst mal. Wir sind beinahe da«, hörte sie die Frau sagen. Ihre Stimme schien aus weiter Ferne zu kommen, so, als wäre sie am anderen Ende eines Tunnels oder auf der anderen Seite einer belebten Straße. Rachel dachte an die Titelmusik von Coronation Street und daran, wie ihr Vater immer die Treppe hinaufgerufen hatte, wenn die Sendung begonnen hatte. Die traurigen Klänge. Die rote Katze im Vorspann, die immer an einer Wand entlangtapste. Sie hatte sich mit Dad in behaglichem Schweigen auf das alte braune Sofa gekuschelt und eine Cola getrunken, während er sich an einen Whisky Mac gehalten hatte.
Und dann wogte die Schwärze wieder auf und hüllte sie ein, und alles andere verschwand einfach.
»Wir sind kurz nach halb zwölf vor Ort eingetroffen. Man berichtete uns, die Dame sei im Bahnhof von ein paar Taschendieben zu Boden gestoßen worden. Sie hat keinen Ausweis, und wir kennen ihren Namen nicht. Als wir dort ankamen, war sie laut Zeugen schon seit einigen Minuten nicht ansprechbar. Allerdings ist sie im Krankenwagen kurz zu sich gekommen, wirkte aber verwirrt. Verdacht auf einen Bruch des Kiefers und möglicherweise des Wangenknochens. Ihr Handgelenk ist eindeutig gebrochen …«
Die Frau redete wieder. Sie hatte eine volltönende, freundliche Stimme und einen reizenden Akzent. Rachel fragte sich, wer wohl die arme Frau war, über die sie sprach, ehe sie mit Schrecken erkannte, dass sie diese Frau sein musste. Panisch riss sie die Augen auf und versuchte, sich zu orientieren. Ärzte, Schwestern, die blonde Frau in Grün, alle beugten sich über sie wie Figuren aus einem Albraum.
»Hallo«, sagte einer der Ärzte, als er sah, dass sie wach war. Er war drahtig, hatte braune Haut, einen rasierten Schädel und sanfte braune Augen. »Wie heißen Sie, können Sie uns das sagen?«
Wieder klappte sie den Mund auf und versuchte zu sprechen, doch auch dieses Mal erlitt sie rasende Schmerzen, die ihr die Luft nahmen, als hätte sie einen Stromschlag erlitten. »Uh …«, war alles, was sie herausbrachte. Warmes, salziges Blut klebte an ihren Lippen.
Rachel, wollte sie sagen. Ich bin Rachel. Als sie die Worte dachte, lichtete sich die Schwärze, die ihren Kopf ausfüllte, ein wenig, so wie Rauch, der sich allmählich auflöste. Mutter von Mabel, Scarlet und Luke, daran erinnerte sie sich, und sie ordnete jede kleine Erkenntnis wie die Teile eines Puzzles. Neununddreißig Jahre alt, Geburtstag am fünften November. Dads kleines Feuerwerkskind, wie er immer gesagt hatte.
»Keine Sorge, wir geben Ihnen etwas Morphin, das lindert die Schmerzen«, sagte jemand, und sie schloss die Augen und fühlte sich ausgezählt und machtlos. Sie begriff immer noch nicht, was sie hier machte. Wenn es darum ging, was passiert war und wie sie in diese Lage geraten war, klaffte ein Loch in ihrer Erinnerung, bodenlos und leer. Was immer vorgefallen war, blieb ein Mysterium. Sie erinnerte sich vage, dass die blonde Frau etwas über einen Bahnhof gesagt hatte, aber wo?
Das Merkwürdigste war, dass die Leute alle mit einem Akzent aus dem Norden sprachen, bis auf die Krankenschwester mit den dunklen Locken, die in einem breiten Glasgow-Dialekt zu ihr sagte: »Achtung, gleich piekst es!« (Von wegen, es piekst, dachte Rachel, bemüht, nicht aufzuschreien. Das war eher ein brutaler Stich.) Ihr war, als wäre sie in eine andere Welt versetzt worden. In eine verworrene, schmerzhafte Welt, in der nichts einen Sinn ergab.
Dann spürte sie, wie sich das Morphin einen Weg durch ihren Körper bahnte, während sie geröntgt und untersucht wurde, und es fühlte sich an, als würde sie ganz langsam durch Wasser sinken; tiefer und tiefer hinab in den Ozean. Die Ärzte sprachen leise und gerade außer Hörweite miteinander. »Spüren Sie das?«, fragten sie und stupsten hier und piekten da. »Wie ist es damit? Oh, sie ist wieder weg.« »Hallo? Können Sie mich hören? Ich bin Geraldine, die Assistenzärztin, und ich muss ihnen ein paar dumme Fragen stellen. Erinnern Sie sich an Ihren Namen?«
Natürlich erinnerte sie sich an ihren Namen! Sie war doch kein Idiot. Sie war eine Mutter, eine Ehefrau. Oh, einen Moment. Eine Exehefrau. Mist. Das war alles so ein Durcheinander. Wie spät war es überhaupt? Sie musste los, um vor drei ihre Kinder abzuholen; Mabel war inzwischen alt genug, um allein oder mit ihren Klassenkameraden nach Hause zu gehen, aber Scarlet und Luke holte sie immer noch jeden Tag von der Grundschule ab. Ihre Gesichter schwebten wie in Wasser durch ihr getrübtes Bewusstsein; sie mussten krank vor Sorge sein, wenn sie nicht dort wäre. Wo ist Mum?
Die Vorstellung erfüllte Rachel mit Panik, und sie zwang sich, sich durch den Morphinnebel zu kämpfen. »Meine Kinder«, versuchte sie zu der Frau neben ihrem Bett zu sagen, aber ihre Stimme funktionierte nicht, und die Laute kamen verzerrt und falsch über ihre Lippen. Es war entsetzlich. Wie ein zutiefst verstörender Traum. Hatte sie einen Schlaganfall erlitten? Warum war alles so sonderbar? Helft mir!, versuchte sie mit den Augen zu sagen. Hilfe!
»Sie sollten vorerst nicht versuchen zu sprechen«, riet ihr die Frau sanft. »Ich fürchte, Sie haben sich den Unterkiefer und den Wangenknochen gebrochen, und Sie haben eine riesige Beule am Kopf. Wir nehmen an, dass Sie auch eine Gehirnerschütterung haben, wenn Ihnen also alles etwas seltsam vorkommt, dann ist das der Grund.« Während Rachel das Gesicht der Frau anstarrte, verdreifachte es sich, und jede Version zeichnete sich durch die gleichen grünen Augen und die gleichen Lippenbewegungen aus. Als würde sie es durch ein Prisma betrachten. Eines dieser Spielzeuge für Kinder mit den funkelnden bunten Steinchen am Ende. Teleskop – nein. Periskop – nein. Dieses Ding eben. Wie hieß es noch? Das Wort war außer Reichweite entschlüpft. Denk nach, Rachel. Denk nach!
»Uhh«, stöhnte sie zur Antwort. Das entwickelte sich allmählich zu ihrer Standardäußerung.
Sie wurde auf einer Trage durch hell erleuchtete Korridore geschoben. Lichter flackerten über ihrem Kopf. Nachtclubs, dachte sie. Stampfende Musik. Heimgehen und sich in die Schuhe von Stiefmutter Wendy übergeben. Ich bin zutiefst enttäuscht von dir, Rachel!
Wendy, dachte sie zusammenhanglos. Sie waren nie miteinander zurechtgekommen. Du bist nicht meine Mum!, hatte sie bei jedem Streit gebrüllt. Und … Oh. Etwas machte Klick in ihrem Kopf. Das Bild eines kalten Bahnsteigs drang in ihr Bewusstsein. Sie hatte in ihren schicken, drückenden Schuhen dagestanden, hatte mit der Fahrkarte in der Hand gewartet. Manchester Piccadilly, intonierte eine Stimme. Bitte alle aussteigen.
Ich bin hier, weil ich ein paar Antworten brauche.
Schrecken ergriff Besitz von ihr, als sie den Zusammenhang herstellte. Sie war in Manchester. So war das. Manchester! Weit entfernt von zu Hause, weit entfernt von ihren Kindern. Wer holte sie von der Schule ab, wenn sie in Manchester war? Es war, als müsste sie bei dem Versuch, einen klaren Gedanken zu fassen, durch Sirup waten, doch dann tauchte eine verschwommene Erinnerung an einen Wagen voller Stimmen auf; Saras Kinder, dachte sie und runzelte die Stirn. Ja – und Sara würde im Gegenzug Scarlet und Luke abholen. Aber wie sollte Rachel nun von hier aus wieder nach Hause kommen? Sara würde sie umbringen, wenn sie nicht wie vereinbart bis fünf zurück wäre – sie würde sie buchstäblich mit ihren perfekt manikürten Händen erwürgen.
Ein Schluchzen löste sich aus ihrer Kehle, und sie versuchte, sich in eine sitzende Position aufzurichten. Sie musste nach Hause. Sie musste jemandem sagen, er möge Sara anrufen!
Die Schaukelbewegung der Trage hörte auf, und eine Krankenschwester tauchte neben ihr auf. Die Frau aus Glasgow, dachte sie, als sie die dunklen Locken erkannte. »Also schön, Liebes, bleiben Sie einfach liegen, genau«, sagte sie beschwichtigend. »Wir sind auf dem Weg zur Station. Dort machen wir es Ihnen bequemer, einverstanden? Jetzt schließen Sie für eine Weile die Augen und versuchen Sie, sich auszuruhen.«
Unter ihr klickte etwas, und dann drehten sich die Rollen leise quietschend; die Trage bewegte sich wieder. Die Decke sauste schwindelerregend über ihr vorbei, und die Leuchtstoffröhren hinterließen in ihrem Kopf orangefarbene Spuren, wann immer sie die Augen schloss. »Gut so, meine Liebe, schlafen Sie ein bisschen«, schwebte die Stimme der Schwester aus der Ferne herbei. »Sie müssen sich gar keine Sorgen machen.«
KAPITEL 3
Becca packte eine Reisetasche – genauer gesagt, sie warf einen Slip und ihre Zahnbürste in eine Einkaufstasche von Sainsbury’s –, rief ihren Boss Jess im White Horse an und gab vor, an einer ekligen Magenverstimmung zu leiden. »Es tut mir … so … leid«, ächzte sie ins Telefon. Sie hatte sich in ihr Schlafzimmer zurückgezogen, da Meredith immer noch die Eröffnungstakte von »Greensleeves« ermordete, und nun hockte sie auf dem Bett und gab sich Mühe, möglichst krank und schwach zu klingen. »Ich habe mich die letzten zwei Stunden ständig übergeben«, fuhr sie mit heiserer Stimme fort. Als Zugabe würgte sie ein bisschen. »Ich kann heute Abend nicht arbeiten. Tut mir echt leid.«
Jeff, der Wirt, war ein breitschultriger, grauhaariger Wolverhampton-Wanderers-Fan und verfügte zu Beccas Pech über einen untrüglichen Bockmist-Detektor. »Ahh«, machte er mit seiner tiefen, grollenden Stimme, und sie stellte sich vor, wie er zweifelnd die Augen zusammenkniff. »Das ist ja sonderbar, denn Nick hat gesagt, er hätte dich so gegen fünf diesen Nachmittag aus dem Pizzarella kommen sehen. Kommt und geht, diese Magenverstimmung, was?«
So ein Mist! Nick, der verdammte Spitzel! Das war dieser schmierige Assistant Manager, der sein ganzes Leben damit zu verbringen schien, in den Angelegenheiten anderer Leute herumzuschnüffeln und dem Rest der Bar alles darüber zu erzählen. Darin lag eines der Probleme, in einer winzigen Wohnung über einem Wettbüro an einer Hauptstraße zu wohnen, nur ein paar Hundert Meter von dem Pub entfernt. Jeder schien alles über sie zu wissen.
»Das … war ich nicht«, entgegnete Becca lahm und schnitt ihrem Spiegelbild eine Grimasse. Peinlich.
»Ich sage dir was«, erwiderte Jeff und verzichtete darauf, ihr zu widersprechen. »Nimm dir heute Abend frei, ja? Und morgen auch. Und am Tag danach. Und an allen darauf folgenden. Hast du verstanden, was ich sage? Ich kann diese Ausreden nicht brauchen, darum geht es. Ich brauche Mitarbeiter, auf die ich mich verlassen kann, keine Spinner und Drückeberger. Bis dann.«
Beccas Mund klappte vor Empörung auf, als er auflegte, und dann entwich die Luft in einem langen, verzweifelten Seufzer aus ihrer Lunge. »Toll«, murmelte sie und schob die Füße in ihre Sportschuhe. »Ich bin gefeuert worden, ist das zu fassen?«, brüllte sie Meredith zu. Genau das, was sie gerade überhaupt nicht brauchen konnte. Da versuchte man, jemandem einen Gefallen zu tun, und das kam dabei heraus. Und bei ihrem Glück würde sie vermutlich den ganzen Weg nach Hereford fahren, nur um festzustellen, dass – ach, tut mir leid – Rachel doch da war, und alles wäre umsonst gewesen, nur irgendeine blöde Verwechslung oder der Akku von ihrem Telefon war leer gewesen. Ganz bestimmt. Einfach fabelhaft.
Meredith blickte auf, als Becca ins Wohnzimmer zurückkam. Sie hatte die Laute weggelegt (eine kleine Gnade) und beugte sich nun über ein kryptisches Kreuzworträtsel in der Tageszeitung. »Was? Du wurdest gefeuert?«
Becca erklärte ihr kurz, was los war, und Meredith blinzelte sie verdattert an. »Ich wusste überhaupt nicht, dass du eine Schwester hast«, sagte sie. Meredith hatte zwei Schwestern – eine älter, die andere jünger –, und sie trafen sich regelmäßig, um sich experimentelles Theater anzusehen oder in billigen italienischen Restaurants zu Abend zu essen und darüber zu debattieren, wie unvernünftig ihre Eltern doch wären.
»Wir stehen uns nicht so nahe«, murmelte Becca, eine Aussage, die zweifellos ein geeigneter Kandidat für die Untertreibung des Jahres war. Sehnsüchtig beäugte sie die Reste der Pizza – ebenjener, die ihr unbeabsichtigt die Kündigung eingebracht hatte – und entschied sich doch dagegen. Kalorien, ermahnte sie sich im Stillen. Außerdem wäre sie umso schneller wieder daheim, je schneller sie sich nun auf den Weg machte, also schnappte sie sich ihre Schlüssel, verabschiedete sich und ging hinaus.
Wollte man die Beziehung zwischen Becca und Rachel in kurzen Worten zusammenfassen, wäre die Aussage »Es ist kompliziert« ein guter Anfang. Becca war ein Jahr alt gewesen – moppelig und immer noch weitgehend kahl, von ein paar karottenroten Löckchen abgesehen (die Kamera log bedauerlicherweise nie) –, als ihre alleinerziehende Mutter Wendy Rachels alleinerziehenden Dad Terry kennengelernt hatte. Die beiden hatten sich verliebt und binnen eines Jahres geheiratet. Bingo: eine brandneue Familie, ob es dir gefällt oder nicht.
Becca war natürlich noch zu jung, um irgendetwas von den eher heiklen Anfängen dieser Patchworkfamilie mitzubekommen. Solange sie sich erinnern konnte, hatte sie gewusst, dass Terry nicht ihr biologischer Vater war (diese zweifelhafte Ehre fiel einem Charmeur namens Johnny zu, der die Szene schon lange verlassen hatte), aber das machte ihr nichts aus. Terry war im wahrsten Sinne des Wortes ihr innig geliebter Dad, und damit hatte es sich. Aber für Rachel, die neun Jahre älter war, war genau das ein Quell enormer Missgunst geworden. »Er ist mein Dad«, zischte sie Becca zu, wenn die darum bettelte, dass er sie trug oder ihr eine Geschichte vorlas, oder wenn sie, als sie älter war, versuchte, einen Zehner von ihm zu schnorren.
»Es ist genug von mir für euch alle da«, hatte Terry dann stets leichthin eingeworfen; doch rückblickend erkannte Becca, wie sehr das alles Rachel zu schaffen gemacht haben musste. Für Becca mochte sich so gut wie nichts geändert haben, als sie eine Stiefschwester bekam, aber für Rachel hatte das nicht nur zur Folge gehabt, dass sie ihren geliebten Vater teilen musste, sie war auch aus ihrer Position als verhätscheltes Einzelkind vertrieben und auf die der widerwilligen großen Schwester gesetzt worden; die vernünftige, gute Tochter, die keine Schwierigkeiten machte und herumzickte, im Gegensatz zu der stürmischen, trotzigen Becca. Es war leicht zu erkennen, wie sich allmählich das Fundament einer tiefen Verbitterung bildete und jahrzehntelang wachsender Groll allmählich vor sich hin simmerte. Ein Groll, der sich zum allerersten Mal entladen hatte, als Wendy und Terry in die Flitterwochen gefahren waren und Rachel offenbar verlangt hatte, dass sie schon nach einer einzigen Nacht zurückkehrten.
Schneller Vorlauf, fast dreißig Jahre später, und die beiden Stiefschwestern könnten kaum unterschiedlicher sein. Rachel war der schöne Schwan, die leibhafte Erfolgsgeschichte der Familie mit ihrer glücklichen Ehe (auch wenn das vielleicht inzwischen Vergangenheit war), ihren süßen kleinen Kindern, ihrer tollen Karriere, dem großen Haus und den eleganten Kleidern. Becca hatte schon früh begriffen, dass es keinen Sinn hatte, mit solch einem Musterbeispiel der Vollendung zu konkurrieren und folglich ihre Abschlussprüfung gebührend vermasselt, eine ganze Reihe zum Scheitern verdammter Beziehungen geführt, war ein bisschen herumgereist und mehrfach in ihr Elternhaus zurückgekehrt, wenn ihr das Geld ausgegangen war. Außerdem hatte sie sich an diversen Berufswegen versucht, ohne je an irgendetwas hängen zu bleiben. Da fragte man sich doch, wie sehr die Familiendynamik die jeweiligen Lebenswege der Töchter beeinflusst haben mochte. Wäre Rachel auch so erfolgreich gewesen, hätte es keine Becca gegeben, die sie übertrumpfen musste? Hätte Becca ihr Leben so verpfuscht, wäre sie nicht das Nesthäkchen gewesen, diejenige, der man immer die Verantwortung abgenommen hatte und die mit allem durchgekommen war, wenn sie ihre Eltern nur aus großen Augen angeblickt hatte?
Wie dem auch sei, sie waren die, die sie waren, und das Wort »Schwester« hatte seit Terrys Tod beinahe jegliche Bedeutung verloren. In erster Linie war er derjenige gewesen, der die Familie zusammengehalten hatte. Als sich seine Beerdigung ihrem tränenreichen Ende genähert hatte, hatte man beinahe hören können, wie sich unter den drei Hinterbliebenen ein Riss auftat, der Rachel auf der einen Seite von Becca und ihrer Mutter auf der anderen trennte. Entfremdet, so nannte man es doch, wenn Familienangehörige nicht mehr miteinander sprachen. Und genauso verhielt es sich. Die Stiefschwestern waren einander entschlüpft, aus den Augen, aus dem Sinn. Nun mussten sie niemandem mehr vormachen, sie würden einander mögen oder kämen miteinander zurecht. Bis zu diesem Abend und diesem Telefonanruf, der Becca zwang, die Kluft zu überbrücken.
Der Wagen sprang beim ersten Versuch an – immer ein Bonus –, und sie fuhr los und zeigte dem White Horse den Stinkefinger in der Hoffnung, der neugierige Nick würde sie sehen. Lebewohl, Jeff, cheerio, ihr nörgelnden Gäste, bis dann, beschissene Küchenausstattung, hasta la vista, Brian, der Küchenchef, der eigentlich immer wütend war, zumeist wegen des unterdurchschnittlichen Personals. Wieder eine Brücke abgebrochen, wieder eine Tür, die sich für sie geschlossen hatte. Nicht, dass es ihr Traum gewesen wäre, den Rest ihres Lebens in einem Pub Gemüse zu putzen – ganz und gar nicht –, aber dort zu arbeiten hatte immerhin ihr Portemonnaie ein wenig gefüllt und sie fünf Abende pro Woche aus ihrer Wohnung geholt. Nicht mehr und nicht weniger, aber das war nun auch vorbei.
Inzwischen waren ihr all ihre Freunde weit voraus. Kometenförmige Karrieren. Hochzeiten. Babys sogar, während Becca immer noch wie eine Looserin herumkrebste und es mit dreißig noch nicht schaffte, wenigstens einen Job im Pub zu behalten. Sie konnte die Sorge nicht verdrängen, dass sie für immer und ewig in dieser Spur feststecken mochte: pleite und ohne irgendeinen Lebensentwurf, gezwungen, sich auf Dauer eine winzige Wohnung mit einer Frau zu teilen, deren Lebensglück darin bestand, Repliken von Schilden für die Nachstellung mittelalterlicher Schlachtenspektakel zu bemalen. Das Schlimmste war, dass die Leute angefangen hatten, sie zu behandeln, als wären sie ein Paar. »Wie geht es Meredith?«, pflegte ihre Mum sich allzu liebevoll zu erkundigen, wann immer sie miteinander sprachen. »Oh, und deine – Meredith, richtig? – kannst du natürlich auch mitbringen«, hatte eine Freundin erst letzte Woche in Bezug auf eine bevorstehende Party gesagt. (»Natürlich« hatte Becca mit so etwas nicht gerechnet. Natürlich? Seit wann war irgendetwas an ihr und Meredith »natürlich«?) Sogar eine Hochzeitseinladung für Becca + Meredith hatten sie kürzlich erhalten, als könnten sie nur ein Paar sein, zwei einsame alte Jungfern, vom Schicksal dazu bestimmt, auf ewig zusammenzubleiben. Es war bestimmt nur noch eine Frage der Zeit, bis jemand den Namen Beredith aufbringen würde. Bitte nicht!
Egal. Der Schlüssel zu allem war, optimistisch zu bleiben. Die Hoffnung nicht aufzugeben, dass etwas Positives hinter der nächsten Ecke wartete, und jede Gelegenheit, die sich bot, beim Schopf zu packen. Pack es an, Kleines! Das hatte ihr Dad immer gesagt. Wie sehr sie wünschte, er wäre immer noch da und könnte das jetzt zu ihr sagen oder mit ihr in den Pub gehen und ihr eine seiner Lebensweisheiten vortragen. Du bist in der Blüte deines Lebens, Kleines! Du kannst alles schaffen!, das würde er ihr sagen und mit dem Zeigefinger in der Luft herumstochern. Worauf wartest du? Geh da raus und stürz dich ins Abenteuer!
»Ich versuche es, Dad«, murmelte sie, als sie vor einer Ampel langsamer wurde. »Ich versuche es wirklich.«
Es war schon eine Ironie, dass er, der den größten Teil seines Lebens in der Automobilbranche gearbeitet hatte (erst jahrelang als Ingenieur in Longbridge und später in der örtlichen Fordwerkstatt) ausgerechnet unter den Reifen eines Transporters gestorben war – noch dazu unter denen eines verdammten Ford Transit. Der war in einer 20-Meilen-Zone um eine unübersichtliche Kurve gebraust, auf den Bürgersteig gerast, hatte einen Fußgänger (Dad) überfahren und war gegen einen Laternenpfahl gekracht. Liebling, es ist wegen Dad, er hatte einen Unfall, konnte sie ihre Mum immer noch am Telefon schluchzen hören. Der Fahrer hatte getrunken und die Kontrolle verloren; er war wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung mit Todesfolge zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Aber kein Urteil konnte wiedergutmachen, dass man ihnen Dad in einem einzigen entsetzlichen Moment genommen hatte; eine dunkle Blutlache auf dem Bürgersteig, das nutzlose Jaulen der Sirene eines Krankenwagens, das durch die Straße hallte. Zu spät.
Wie auch immer, es hatte keinen Sinn, darüber zu grübeln. Dabei kam nichts Gutes heraus.
Während sie darauf wartete, dass die Ampel umschaltete, fuhr sich Becca mit einer Hand durch das Haar. Schon jetzt fühlte sie sich unsicher bei dem Gedanken, dass sie ihrer Stiefschwester begegnen würde. Im Gegensatz zu Rachel mit ihrem fügsamen blonden Bob hatte Becca leuchtend kupferrotes Haar – ja, genau, fuchsrot –, wallend und wild, voller Locken, die wie verrückt in alle Richtungen wogten. Rachel hatte auch einen zarten Knochenbau und die Figur einer Sportlerin, wogegen Becca … dergleichen nicht hatte. »Wie sehr sich die Mädchen doch unterscheiden«, hatte eine besonders schonungslose Tante einmal angemerkt, als Becca noch jede Menge Babyspeck mit sich herumgeschleppt hatte, und dabei war ihr Blick von Beccas fettgefüllten Rettungsringen zu Rachels zahllosen, glänzenden Lauftrophäen auf dem Kaminsims geschossen – in gerade einer verdammten Sekunde.
Heute war der Unterschied noch deutlicher. Seit ihr Dad gestorben war, hatte Becca sich mit Salzchips, süßen Teilchen und gebuttertem Toast getröstet und Pfunde angehäuft. Die Arbeit in einer Pubküche, in der sie ständig Käsebröckchen oder knusprige Baguettes naschen konnte, hatte das ihre dazu beigetragen. Innerlich bereitete sie sich auf den Abscheu vor, der sich im Gesichtsausdruck ihrer Stiefschwester niederschlagen würde, auf das unaufrichtige »Du siehst … gut aus«, von dem doch jeder wusste, dass es nur ein synonymer Ausdruck für »Du siehst … fett aus« war. Ach, was auch immer. Das prallte doch von ihr ab.
Der Verkehr war nicht so schlimm, während sie den Schildern zur Autobahn folgte und versuchte, sich daran zu erinnern, wie alt die Kinder jetzt waren. Mabel musste inzwischen dreizehn sein, denn sie war ein paar Monate nach Beccas siebzehntem Geburtstag auf die Welt gekommen, zu einer Zeit, in der Babys noch eine Million Meilen von ihrem Radar entfernt gewesen waren. Scarlet hatte sich drei Jahre später dazugesellt, und Luke … er musste jetzt, schätzungsweise, sechs oder sieben sein. Sie hatte ein schlechtes Gewissen, weil sie das Alter der Kinder nicht sofort präsent hatte; das zeigte nur, wie wenig sie in den letzten Monaten an sie gedacht hatte. Rachel hatte ausreichend deutlich gemacht, dass sie mit Becca und Wendy nichts weiter zu tun haben wollte, und das zu akzeptieren und zuzulassen, dass die Mauer des Schweigens immer höher und höher wurde, schien der einfachere Weg zu sein.
Trotz allem war sie neugierig auf das Wiedersehen, umso mehr im Licht der paukenschlagartigen Neuigkeit, dass Lawrence und Rachel sich getrennt hatten. Sie bekam das immer noch nicht in den Kopf. Wussten Sie das nicht?, hatte die Frau am Telefon gefragt. Nein, sie hatte keine Ahnung gehabt, sondern einfach angenommen, dass in Rachels wundervollem Leben alles seinen üblichen rosigen Gang genommen hätte. Man stelle sich das vor, dachte Becca und biss sich auf die Lippe. Bedachte sie jedoch, was passiert war, als sie dem Ehemann ihrer Schwester das letzte Mal begegnet war, sollte sie vielleicht gar nicht so überrascht sein.
Rachel wohnte in der einen Hälfte eines vornehmen grau verputzten viktorianischen Doppelhauses in einer ruhigen Vorortstraße. Es war die Art von Straße, in der die Leute ihre Hecken säuberlich stutzten und jeden Sonntag ihr Auto wuschen. Als Becca ihren schnaufenden, rostigen Ford Fiesta vor dem Haus parkte, konnte sie sich des Gefühls nicht erwehren, dass sie durch ihre bloße Ankunft bereits das Niveau der Nachbarschaft absenkte. Dann fiel ihr auf, dass kein anderer Wagen in Rachels Einfahrt stand. War ihre Schwester noch immer nicht zurück?
»Hallo. Lange nicht gesehen!«
Mabel öffnete ihr die Tür, und Becca sah an dem flüchtigen Aufflackern von Hoffnung in den Zügen ihrer Nichte, dass sie gehofft hatte, Rachel wäre mit einer Entschuldigung oder einer Erklärung zurückgekommen, und alles würde wieder seinen segensreich normalen Gang nehmen. Ihre Miene verfinsterte sich augenblicklich, doch sie zog die Tür weit auf. »Hi«, sagte sie höflich. »Komm rein.«
Jesus, war das Mädchen plötzlich groß geworden! Becca erkannte sie kaum wieder. Mabel, die zwar barfuß war, aber immer noch ihre Schuluniform trug, war inzwischen fast so groß wie Becca, hatte graue Augen wie ihre Mutter und eine türkisfarbene Strähne in dem langen blonden Haar. In beiden Ohren waren zwei Ohrlöcher, und ihre Nägel waren bis auf das Bett abgekaut. Ihr schwarzer Faltenrock war schief hochgerollt und beulte sich über dem Bund, und an ihren Ärmeln prangten Tintenflecke. Das war nicht so ganz das bezopfte Püppchen, mit dem Becca gerechnet hatte.
In der großzügigen Diele mit den cremefarbenen Wänden lag ein hellbeiger Teppich, der auch eine Treppe auf der linken Seite bedeckte. Alles war natürlich sehr geschmackvoll: ein großer Spiegel mit einem goldenen Rahmen an einer Wand, Schwarz-Weiß-Bilder der Familie an einer anderen, Schuhe, die ordentlich in einem Weidenkorb lagen. Schau, Becca, so leben erwachsene Menschen, dachte sie, darum bemüht, ihre gemeinen, neidischen Gedanken zu verdrängen, als sie eintrat und ihre Nichte umarmte. »Hi, Schatz. Wie es aussieht, ist sie also noch nicht zurück, richtig?«, fragte sie. Hmmm. Beunruhigend. Becca war so sicher gewesen, dass Rachel zurückgekommen war, während sie sich durch den zähen Verkehr auf der Worcester Road gequält hatte, und ihre Stimmung war immer griesgrämiger geworden dank ihrer Überzeugung, dass sich das alles als bloßes Missverständnis erweisen würde, als falscher Alarm. Nun, da sie hier war und feststellen musste, dass sie falsch gelegen hatte, wusste sie nicht recht, was sie sagen sollte.
Ehe Mabel antworten konnte, erklang von oben hoffnungsfrohes Gebrüll. »Ist Mummy wieder da?«
Ein Junge im Pyjama tauchte am Kopf der Treppe auf, lutschte am Daumen und umklammerte mit der anderen Hand das Geländer, als er zu ihnen hinabstarrte. Luke: wirres dunkles Haar, auffallende Wangenknochen und dünne Arme und Beine. Im Hinblick auf gesellschaftlich geforderte Höflichkeiten war er unverkennbar noch nicht so weit entwickelt wie seine Schwester, denn kaum erkannte er Becca, da sackten seine Schultern herab, und er verzog sich wieder ins Bett, ohne auch nur Hallo zu sagen. Verständlich.
»Hi, Luke«, rief ihm Becca nach, als er davonging. Von irgendwoher im Haus konnte sie das Schrammeln einer Violine hören – das musste Scarlet sein, die das Geigenspiel übte. Sie sah Mabel an, die verlegen mit den Schultern zuckte.
»Nein, sie ist noch nicht wieder da«, bestätigte das Mädchen ihre Vermutung. »Er ist ein bisschen durcheinander.« Sie senkte die Stimme. »Seit die Nachbarin den Löffel abgegeben hat, denkt er ständig ans Sterben. Er sagt dauernd, dass er glaubt, Mum wäre auch gestorben. Das ist, als wäre er davon besessen oder so was. Was natürlich so richtig lustig ist und genau das, was wir gerade hören wollen. Jaaah.«
Zwar entlockte der Sarkasmus ihrer Nichte Becca ein Lächeln, doch zum ersten Mal seit Saras Anruf verspürte sie nun auch ein Kribbeln von Furcht, das ihr über den Rücken lief. Es war beinahe acht Uhr abends, und es kam ihr sehr seltsam vor, dass noch immer niemand etwas von ihrer Schwester gehört hatte. Soll ich die Polizei rufen?, hatte die Frau auf der anderen Straßenseite gefragt, ehe sie irgendetwas über Entführung gefaselt hatte – und nun schien Luke zu glauben, dass seine Mum gestorben war. Becca schämte sich, dass sie die Angelegenheit so auf die leichte Schulter genommen hatte, dass sie mürrisch hergefahren war, sauer wegen des Verlusts ihres Jobs und der Spritkosten. Denn dass Rachel so lange verschwunden blieb, und das ohne eine Erklärung in Form einer SMS oder eines Anrufs, passte so gar nicht zu ihr. Irgendetwas musste da mächtig schiefgegangen sein.
Sie legte den Arm um Mabel. »Mach dir keine Sorgen«, sagte sie in gespielt heiterem Ton. »Ich bin sicher, es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Ich wette, sie wurde nur aufgehalten, oder ihr Akku ist leer oder so was in der Art. Bestimmt taucht sie jede Minute wieder auf.« Eine zu lange Pause trat ein, während sie beide den melancholisch-sägenden Klängen der Violine lauschten, die sich anhörten, als wollten sie das Elend musikalisch begleiten. Dann ergriff Becca erneut das Wort, bemüht, so unbekümmert wie möglich zu klingen: »Wo ist überhaupt Scarlet? Und habt ihr alle genug gegessen? Ich kann euch Pfannkuchen machen, wenn ihr wollt.«
»Pfannkuchen?« Abrupt brach das Geigenspiel ab, und ein Kopf schoss aus einem Zimmer heraus. Es war Scarlet. Ihr Haar war zu ordentlichen braunen Zöpfen geflochten, und auf ihrer sommersprossigen Nase thronte eine Brille mit rechteckigen Gläsern. »Scheiße, ich liebe Pfannkuchen. Hi, Tante Bee.«
Bei dem Wort »Scheiße« zog Becca eine Braue hoch, beschloss aber, nichts dazu zu sagen. Stattdessen lächelte sie. »Hi, Schönheit. Du spielst toll.«
»Die Melodie habe ich selbst komponiert«, antwortete Scarlet und folgte Becca in die schicke taupefarbene Küche. (Rachel hatte bestimmt eine Treuekarte von Farrow & Ball.) »Es heißt: ›Komm zurück, Harvey, ich vermisse deine seidigen Ohren‹.«
Becca blinzelte verwirrt. »Wer ist Harvey? Dein Freund?«
Mabel murmelte kichernd »Na klar«, während Scarlet das Kinn vorreckte. »Das ist unser Hund«, entgegnete sie finster. »Zumindest war er es, bis Dad ihn uns weggenommen hat.«
»Oh«, machte Becca und schämte sich für ihren lahmen Witz. »Das ist traurig.« Draußen setzte die Dämmerung ein, und der Himmel färbte sich gelblich-grau, als würde es bald regnen. Dunkelheit senkte sich über den Garten, aber sie konnte immer noch eine Schaukel erkennen und ein Trampolin und weiße Rosen, deren Blüten im Gesträuch schimmerten.
»Ja«, sagte Scarlet und tippte ein Tischbein mit dem Fuß an. »Das ist ein verdammter Albtraum. Er schreit, wenn wir ihn besuchen, weißt du. Er schreit wirklich, weil er uns so vermisst. Aber Dad hat gesagt, er wäre sein Hund, und es wäre nur fair, wenn er bei ihm bliebe, weil Mum schließlich uns behalten würde. Die haben sich mächtig gezofft.«
Aua! »Du Arme«, antwortete Becca. »Und der arme Harvey.«
»Ja«, sagte Scarlet wieder. »Armer Harvey, denn der muss jetzt mit der Waliser-Oma und Dad leben. Das ist echt scheiße.«
Lawrence war zu seiner Mum zurückgegangen? Becca erinnerte sich vage an eine alte Megäre mit unnachgiebigen Zügen, die in Marineblau eisern der Hochzeit beigewohnt hatte, ohne sich auch nur ein Lächeln abzuringen, und plötzlich tat ihr der Hund ebenso leid wie die Kinder. Die Geschichte hatte kein gutes Ende genommen.
»Und wir Armen, denn wir müssen uns Scarlets Geigenspiel anhören«, kommentierte Mabel herzlos. »Wenn du ganz viel Glück hast, spielt sie dir noch eines ihrer anderen Stücke vor«, fuhr sie fort und wich aus, als ihre Schwester versuchte, sie zu treten. »Mein Lieblingslied ist ›Mum und Dad, ich hasse euch‹. Oder – wie heißt noch das neue? ›Ich bin die Finsternis‹. Das ist so etwas wie ein musikalisches Armageddon. Geigageddon. Au!«, schrie sie, als Scarlets Fuß doch noch Kontakt zu ihrem Schienbein bekam. »Lass das, du Schwachkopf.«
Okaaaay, dachte Becca und holte sich Mehl, Eier und Milch, während die Mädchen sich in eine hitzige Streiterei hineinsteigerten. So ist das also, ja? Offensichtlich war es an der Zeit, Rachels Familie neu zu bewerten, sie aus der perfekten Hochglanzmagazinwelt, in der sie in ihrer Erinnerung gelebt hatte, herauszuholen und um einen Teenager mit blauen Haaren, einen schüchternen, verängstigten Jungen und einen geigespielenden Hitzkopf zu erweitern, der derzeit versuchte, seine Schwester zu verprügeln – und natürlich um einen fehlenden Gatten samt Hund. Offenbar war die Familie doch nicht ganz so perfekt.
»Hey! Leute!«, flehte sie die Mädchen an, während sie Mehl in eine Rührschüssel siebte. »Pfannkuchen, wisst ihr noch? Wer will die Eier aufschlagen?«
Eier waren nicht das Einzige, was hier zerbrechen konnte, dachte sie, als Scarlet mit einem letzten bösen Blick in Mabels Richtung zu ihr kam, um ihr zu helfen. Binnen fünf Minuten nach ihrer Ankunft waren die Brüche innerhalb des Familiengefüges bereits erschreckend offensichtlich geworden. Komm nach Hause, Rachel, wo du auch bist, dachte sie, als Mabel wutschnaubend den Raum verließ. Deine Kinder brauchen dich. Komm nach Hause!
KAPITEL 4
Allmählich kehrten einige Erinnerungsfetzen zu Rachel zurück, beinahe, als leuchtete man mit einer Taschenlampe in einen dunklen Raum und risse hier und dort ein paar Stücke aus der Finsternis. Vage erinnerte sie sich nun daran, im Bahnhof von Manchester angekommen und in der Schlange vor dem Coffeeshop von hinten geschubst worden zu sein, während eine andere Person sich ihre Tasche geschnappt hatte; das Gefühl eines harten Aufpralls, dieser Sekundenbruchteil voller Angst und Schrecken, ehe es dunkel geworden war. Danach war da nichts mehr, bis sie im Krankenwagen wieder zu sich gekommen war, ganz gleich, wie sehr sie auch in den schattigen Tiefen ihres Gedächtnisses herumstocherte. Zimt, Kaffee, Vanille, dachte sie benebelt. Und dann, bumm, auf dem Boden, bewusstlos.
Seit man sie ins Krankenhaus gebracht hatte, war sie physisch zusammengeflickt worden, mental jedoch nicht: Die Notärzte hatten ihr gebrochenes Handgelenk grob eingegipst, ihr den Kopf verbunden und sie mit Morphin versorgt. Morgen würde man ihren Kiefer verdrahten und ihr Handgelenk operieren. Es gab also vieles, worauf sie sich freuen durfte. Lolz, wie Mabel wohl mit todernster Miene sagen würde.
Trotz des gebrochenen Kiefers und des Blutes, das aus ihrer Lippe sickerte, und trotz der zermürbenden Schmerzen, die ihr das Gefühl gaben, sie müsse in Ohnmacht fallen, war es ihr am späten Nachmittag immerhin gelungen, den Leuten zu sagen, dass ihr Name Rachel war. Als sie die Laute stockend herausgebracht hatte und die nette Krankenschwester aus Glasgow geantwortet hatte: »Rachel? Rachel! Okay, toll«, war ihr das wie ein gewaltiger Fortschritt vorgekommen. »Sie sind also Rachel. Das ist wunderbar. Wie steht es mit Ihrem Nachnamen?«
Und es wurde total unheimlich. Sie öffnete den Mund zu einer Entgegnung, aber da war nichts, keine Antwort, also starrte sie die Schwester nur entsetzt an, während ihr Geist hartnäckig stumm und leer blieb. »Ich …« Das war einfach lächerlich. Ihr eigener Name. Er lag ihr auf der Zunge und war doch außer Reichweite. Komm schon, Rachel! Du kennst doch deinen eigenen Nachnamen!
Die Schwester musste die Panik in ihren Augen gesehen haben, denn sie tätschelte ihr besänftigend die Hand. »Keine Sorge. Sie haben eine Gehirnerschütterung, das ist alles. Das kommt alles wieder. Ich nehme an, Sie können sich im Moment auch nicht an irgendeine Telefonnummer erinnern, nicht wahr? Irgendjemand wird sich Sorgen um Sie machen.«
Eine Telefonnummer – ja. Auf jeden Fall. Sie wäre vor Erleichterung beinahe in Tränen ausgebrochen bei dem Gedanken an einen Telefonanruf, an einen Arzt oder eine Schwester, die zu Hause anriefen, um ihren Kindern zu sagen, was los war. Hoffentlich hatte Sara alles unter Kontrolle. Rachel war nicht gerade mit ihr befreundet, aber was sein muss, muss sein, wenn man alleinerziehend war. Sie hoffte, Sara würde das verstehen.
Die Schwester lauschte erwartungsvoll auf eine Telefonnummer, wie Rachel plötzlich bewusst wurde, und sie gab sich alle Mühe, mit ihrem kaputten Mund die notwendigen Laute zu bilden. »Nol«, fing sie mit erstickter Stimme an. »Wei-wei-eing.« Allein die Vorstellung, dass sie Sprache all diese Jahre für selbstverständlich gehalten hatte. Man öffnete einfach den Mund, und schon kam sie hervor, lange Wortketten, mit denen man jeden noch so trivialen Gedanken artikulieren konnte. Und nun, nach einem kräftigen Stoß, einem einzigen Sturz, war es plötzlich eine Herkulesaufgabe, sich verständlich zu machen.
Und dann passierte es schon wieder. Es war so merkwürdig, als würde ihr Gehirn sich verkrampfen und mitten im Gedanken blockieren. Sie runzelte die Stirn, schloss die Augen, um sich besser konzentrieren zu können, aber alles, was in ihr Bewusstsein drang, waren Zahlen in allen Formen, Größen und Farben, die wie ein Karussell durch ihr Gehirn kreisten. Plötzlich wurde ihr übel.
»Weiter«, ermunterte die Schwester sie, und Rachel schlug die Augen wieder auf. Der ganze Raum um sie herum schien zu taumeln. »Wie lautet die nächste Zahl?«
Gute Frage. In ihrem Kopf herrschte inzwischen gähnende Leere. Sämtliche Ziffern hatten sich in weite Ferne verzogen. Es war, als würde sie wie wild in einem dunklen, leeren Raum etwas suchen, das nicht da war. Sie konnte sich nicht erinnern. Sie konnte sich einfach nicht erinnern.
»Keine Sorge«, sagte die Schwester noch einmal. »Ich finde es schon an guten Tagen schwer genug, mich an meine eigene PIN zu erinnern. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, wenn ich so einen Schlag wie Sie an den Kopf bekäme. Entspannen Sie sich einfach. Lassen Sie sich Zeit. Und in einer Weile versuchen Sie es noch einmal.«
Sie hatte es versucht – immer wieder –, aber die korrekte Ziffernfolge wollte sich einfach nicht offenbaren, sondern geriet ständig durcheinander. Die einzelnen Zahlen ordneten sich in ihrem Geist immer wieder neu an, wenn sie versuchte, sich auf sie zu konzentrieren. Auch an Saras Nachnamen konnte sie sich nicht erinnern. Wie war das? Fitzgerald? Irgendetwas Nobles. Fauntleroy. Forbes. Denk nach, Rachel. Denk nach! Aber alles, was aus den schattigen Tiefen in ihr Bewusstsein aufstieg, waren die Gesichter ihrer Kinder – Wo ist Mum? –, und sie taumelte in einen Zustand der Panik, in dem die Ziffern nur noch weiter fortrückten. Was geschah mit ihren Kindern, wenn sie sich bis zum Abend nicht gemeldet hätte? Würde Sara sie bei sich behalten? Lukes Lippen würden zittern, und er hätte Angst. Scarlet wäre sehr still und würde ihre Furcht unterdrücken. Mabel würde zweifellos versuchen, aufmüpfig darüber hinwegzugehen. »Kinderschutzalarm!«, pflegte sie theatralisch zu sagen, wann immer sie Rachels Erziehungsstil für unzureichend hielt (was oft der Fall war). »Ich rufe ChildLine an!«
Moment mal – nein. Ihr kam eine neue Idee. Würde Mabel Lawrence anrufen? Sie schauderte bei dem Gedanken, er könnte auftauchen und die Kinder in seine Obhut nehmen. Auweia, hörte sie ihn beinahe auf seine affektierte Art sagen. So sieht das also aus, wenn jemand als Mutter ungeeignet ist. Warte nur, bis mein Anwalt das erfährt.
Tränen traten in ihre Augen und rannen ihr in die Ohren. Denk nach, Rachel. Denk nach! Denn mit jeder Minute, in der sich ihr Gehirn in Nebel hüllte, zog sich Luke immer weiter in sich selbst zurück, nagte Scarlet an ihren Fingernägeln, tat Mabel, was sie konnte, um cool zu erscheinen, während ihre aufsässige Fassade allmählich dünner wurde …
»Hey, ganz ruhig, es ist alles in Ordnung.« Die Schwester war wieder da. Rachel hatte ihr Zeitgefühl vollends verloren, zusammen mit jeglichem Gespür dafür, was außerhalb der Wände um sie herum geschehen mochte. War immer noch derselbe Tag? War es schon Nacht? Die Schwester tupfte ihr sanft mit einem Taschentuch die Augen ab, und Rachel musste sich schwer zusammenreißen, um sich nicht einfach bei ihr anzulehnen und lauthals zu heulen. »Was machen die Schmerzen? Ich kann die Morphindosis noch etwas erhöhen, wenn es nötig ist.«
Rachel nickte. Die Schmerzen waren immer noch unerträglich. »Ja bitte«, brachte sie mit ihren geschundenen Lippen hervor. Ich bin Rachel, wiederholte sie in Gedanken, als ihr Geist unter dem Einfluss der Droge, die sich ihren Weg durch ihren Blutkreislauf bahnte, noch mehr ins Trudeln geriet. Ich bin Rachel, und ich muss nach Hause. Ich muss mich nur erinnern, wie …
KAPITEL 5
Inzwischen versuchte Becca in Rachels Küche bei einem ganzen Berg fluffiger amerikanischer Pfannkuchen mit einer großzügigen Portion Zuckerrübensirup und Erdbeermarmelade (»Mum würde ausflippen, wenn sie das sähe«, bekannte Scarlet ebenso begeistert wie schuldbewusst) herauszufinden, wie es zu dem völlig untypischen Verschwinden ihrer Schwester gekommen sein mochte. »Also, sie hat euch heute Morgen wie üblich zur Schule gebracht, richtig? Wisst ihr noch, ob sie euch erzählt hat, was sie später vorhatte? Wo sie hinwollte?«
Die Mädchen wechselten einen Blick. »Sie war heute komisch drauf«, besann sich Mabel. »Schlecht gelaunt und irgendwie schnippisch.« Sie verdrehte ihre Augen mit dem ganzen Weltschmerz eines gewöhnlichen Teenagers. »Als wäre das etwas Neues.«
»Sie hat mit mir geschimpft, weil ich Milch verschüttet habe«, berichtete Scarlet und leckte sich die klebrigen Finger ab. »Und als sie gesehen hat, dass noch was von gestern in meiner Brotdose war.«
»Sie hat irgendetwas auf dem Laptop nachgesehen«, erinnerte sich Mabel. »Und dann musste ich los, und sie so, oh Gott, ist es schon so spät? Wir müssen uns beeilen!« Die gehauchte und zugleich schrille Art, mit der sie die Stimme ihrer Mutter imitierte, war schon beinahe grausam, wie Becca erschrocken feststellte.
»Und dann hat sie mich und Luke zur Schule gebracht, und wir mussten auch Henry und Elsa mitnehmen, weil ihre Mum uns später abholen sollte und sie getauscht haben«, berichtete Scarlet und verzog das Gesicht. »Elsa ist so verdammt nervig, Gott!«
»Sonst noch irgendwas?«, hakte Becca nach.
Scarlet dachte nach, den Kopf schief gelegt, während ihre zarten dunklen Brauen unter dem angestrengten Stirnrunzeln näher zusammenrückten. »Eigentlich nicht. Als sie uns alle abgesetzt hat, hat sie gesagt: ›Denkt daran, dass Sara euch nach der Schule mitnimmt, aber ich bin vor der Teestunde zurück und hole euch ab.‹ Nur hat sie das nicht getan.« Sie biss in ihren Pfannkuchen, und ein Klecks Marmelade landete auf der weißen Bluse ihrer Schuluniform. »Ups.«
»Hmmm«, machte Becca. »Also schien das heute … ein ganz normaler Tag zu sein?«
»Jep«, bestätigten beide Schwestern im Chor.
»Und sie hat den Wagen genommen, nehme ich an? Er steht jedenfalls nicht draußen.«
Scarlet versuchte, die Marmelade von ihrer Bluse zu lutschen, hielt aber inne, um zu antworten: »Normalerweise gehen wir zu Fuß zur Schule, aber heute Morgen haben wir das Auto genommen«, erzählte sie, »weil Mum meinte, sie hätte es eilig.«
Autounfall, dachte Becca augenblicklich, und ihr wurde übel, als sie sich unwillkürlich vorstellte, wie Bremsen kreischten und ihre Schwester wie eine Lumpenpuppe durch die Windschutzscheibe eines zerbeulten Autos geschleudert wurde. Sie schüttelte den Kopf, um die Bilder zu vertreiben. Andererseits … hätte es einen Autounfall gegeben, dann hätten sie doch inzwischen längst von der Polizei davon erfahren, nicht wahr? Man hätte das Kennzeichen überprüft, und irgendjemand hätte sich gemeldet, uniformierte Beamte auf der Schwelle, die Mütze in der Hand, düstere Mimik …
Sie stand vom Tisch auf und machte sich daran, Pfanne und Rührschüssel abzuwaschen, damit die Mädchen die Panik nicht sehen konnten, die sich auf ihren Zügen niederschlug. »Vielleicht hat sie einen Platten«, mutmaßte sie, bemüht, die Ruhe zu wahren. »Eure arme Mum! Ich wette, sie wird die Schnauze gestrichen voll haben, wenn sie endlich wieder da ist.« Die Finger, die die Spülbürste hielten, zitterten; sie war noch nie eine gute Lügnerin gewesen. »Wie auch immer, ich bin sicher, sie kommt bald wieder. Ich sage ihr, dass sie noch nach euch sehen und euch einen Gutenachtkuss geben soll, wenn sie zu Hause ist, okay?«
Später, als Stille im Haus eingekehrt war, saß Becca in dem aufgeräumten (und sehr beigen) Wohnzimmer ihrer Schwester und beobachtete die Zeiger der kleinen schiefernen Kaminuhr, die auf neun Uhr wanderten, auf neun Uhr dreißig, auf zehn. Anderswo in dieser Straße zogen nette kleine Familien die Vorhänge zu und begaben sich zur Ruhe. Hier, im Hause Jackson, schwieg das Telefon. Die Haustür war fest verschlossen, und auf der Straße waren keine Autoscheinwerfer zu sehen, die sich dem Grundstück genähert hätten.
Becca und ihre Stiefschwester mochten einander nicht gerade nahestehen, dennoch wusste sie instinktiv, dass das nicht Rachels Art war. Organisiert, kontrolliert, leistungsfähig – das war Rachel. Während Beccas Leben tendenziell von einem Scherbenhaufen zum nächsten schleuderte, hatte Rachel Kinder, Verantwortung, dieses hübsche Haus in einer gehobenen Nachbarschaft: mit anderen Worten, ein angemessenes Erwachsenenleben, in dem man sich wohlfühlen konnte. Becca sah sich auf der Suche nach irgendwelchen Hinweisen im Zimmer um, und ihr Blick fiel auf eine Vase mit weißen Rosen auf einem Beistelltischchen, deren seidige Blüten einen zarten Duft verströmten. Leute, die vorhatten, einfach abzuhauen, würden sich wohl kaum die Mühe machen, Blumen zu schneiden und in Vasen zu stellen, oder? Also, wo war sie?
Inzwischen war es draußen dunkel; sie hoffte, die Kinder konnten trotz der außergewöhnlichen Situation schlafen. Sie kannte sie nicht gut genug, um zu beurteilen, ob sie sich untypisch verhielten, ob Mabel immer so bissig war, wenn es um die Fahrkünste ihrer Mum ging (»Ich wette, sie hat sich verfahren. Sie kann nicht einmal eine Karte lesen, ganz zu schweigen davon, irgendwo einzuparken, ohne einen Nervenzusammenbruch zu bekommen.«), und ob Scarlet auch sonst ihre Tür halb offen und das Licht im Badezimmer brennen ließ, ob sie ihre Schuluniform schon abends für den nächsten Tag bereitlegte, oder ob das nur ihre Art war, sich vorzumachen, dass alles unter Kontrolle wäre. Die armen Mädchen! Sie hielten sich wacker, aber die Besorgnis stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Genau wie Becca.
Bevor sie zu Bett gegangen war, hatte Mabel zögerlich gesagt: »Ich hoffe, es war in Ordnung, dass ich Sara deinen Namen gegeben habe. Es ist nur … Dad ist nicht da, und Grandma – Waliser-Oma – würde sowieso einen Riesenaufstand machen und über Mum herziehen.« Sie zuckte mit den Schultern und wirkte plötzlich sehr verlegen und viel jünger. »Ich dachte einfach an den Hochzeitstag von Grandad und Wendy, an dem du so nett zu mir warst, weißt du?«
Beccas Herz schmolz dahin angesichts der Verlegenheit des Mädchens. »Ich bin froh, dass du an mich gedacht hast«, sagte sie und erinnerte sich vage, wie sich Mabel ihr bei diesem Hochzeitstag anvertraut hatte, irgendwas wegen eines fiesen Klassenkameraden, der sie schikaniert hatte. Es war schön zu hören, dass ihre Nichte diesen Moment im Kopf behalten hatte; dass Mabel in ihr eine Retterin sah, jemanden, der ihr helfen konnte. Also gab es wenigstens einen Menschen in der Familie, der glaubte, Becca wäre wenigstens ansatzweise zu etwas zu gebrauchen.