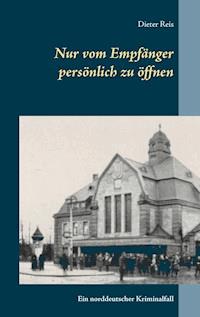
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Spätherbst 1951 schockierte ein brutaler Mordanschlag, wie es ihn in dieser Form bis dahin noch nie gegeben hatte, die Menschen in ganz Deutschland. Selbst die Medien im europäischen Ausland und in den USA berichteten darüber. In dem vorliegenden Band wird in Romanform der spektakuläre Kriminalfall nachgezeichnet, bei dem mehrere Menschen in Bremen und in Eystrup im Landkreis Nienburg den Tod fanden oder schwer verletzt wurden. Handelte es sich bei dem Anschlag um einen Angriff anarchistischer Kreise, die damit die neue Ordnung der Bundesrepublik treffen wollten? Oder war es das Werk eines verwirrten Einzeltäters, der mit ungewöhnlichen Mitteln egoistische Ziele verfolgte? Nach annähernd zweiwöchiger fieberhafter Fahndung und dank Hunderter von Hinweisen aus der Öffentlichkeit gelang es einer 60-köpfigen Sonderkommission der Kriminalpolizei, Licht in diesen dubiosen Fall zu bringen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meinen Kindern und Enkelkindern
Arne, Jan, Stephan
Adrian, Anton, Marvin
Zu diesem Buch
Im Spätherbst 1951 schockierte ein brutaler Mordanschlag, wie es ihn in dieser Form bis dahin noch nie gegeben hatte, die Menschen in ganz Deutschland. Selbst die Medien im europäischen Ausland und in den USA berichteten darüber.
In dem vorliegenden Band wird in Romanform der spektakuläre Kriminalfall nachgezeichnet, bei dem mehrere Menschen in Bremen und in Eystrup im Landkreis Nienburg den Tod fanden oder schwer verletzt wurden.
Handelte es sich bei dem Anschlag um einen Angriff anarchistischer Kreise, die damit die neue Ordnung der Bundesrepublik treffen wollten? Oder war es das Werk eines verwirrten Einzeltäters, der mit ungewöhnlichen Mitteln egoistische Ziele verfolgte?
Nach annähernd zweiwöchiger fieberhafter Fahndung und dank hunderter von Hinweisen aus der Öffentlichkeit gelang es schließlich einer 60-köpfigen Sonderkommission der Kriminalpolizei, Licht in diesen dubiosen Fall zu bringen.
Die Namen der beteiligten Personen wurden, mit Ausnahme erwähnter Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, geändert.
Inhaltsverzeichnis
Montag, 10. April 2006
Donnerstag, 29. November 1951
Freitag, 30. November 1951
Montag, 3. Dezember 1951
Mittwoch, 5. Dezember 1951
Steckbrief des Attentäters
Donnerstag, 6. Dezember 1951
Freitag, 7. Dezember 1951
Samstag, 8. Dezember 1951
Montag, 10. Dezember 1951
Dienstag, 11. Dezember 1951
Februar 1952
22. – 25. April 1952
Montag, 10. April 2006, spätabends
Zum zeitgeschichtlichen Hintergrund
Montag, 10. April 2006
Der Tag versprach nichts Gutes. Gegen 9 Uhr verließ Artur Rosenberg sein Haus, eine Jugendstilvilla in einer begehrten Wohnlage Hannovers, um seinen täglichen Morgenspaziergang durch die nahe Eilenriede zu machen. Das ausgedehnte Wald- und Naherholungsgebiet im Herzen der Stadt bot ihm hierfür die allerbesten Voraussetzungen.
Anders als in früheren Zeiten begleitete ihn seine Frau seit einigen Wochen nicht mehr bei seinen morgendlichen Gängen. Anfangs hatte er sich gegen den Gedanken gesperrt, sich künftig allein auf den Weg zu machen. Wegen seiner angegriffenen Gesundheit – seit Monaten litt er unter massiven Kreislaufproblemen – hätte er seine Frau auch weiterhin gern in seiner Nähe gewusst. Die Bewegung an frischer Luft war ihm andererseits jedoch so wichtig, dass er darauf nicht verzichten mochte.
Den sich lang hinziehenden, kurvenreichen Weg durch den Wald erlebte er an diesem Morgen weniger einladend als noch vor Tagen. Der Himmel war bewölkt, und nur an wenigen schnell wechselnden Stellen brach sich die Sonne für kurze Augenblicke Bahn. Es war ein Bild, wie es sich ihm regelmäßig um diese Stunde bot: Jogger, Radfahrer auf dem Weg zur Arbeit, hier und dort schnellen Schrittes vorbei eilende Erwachsene, in der Ferne das Summen von Automotoren – Vertrautes, das ihm heute dennoch irgendwie fremd erschien.
Obwohl er sich durchaus an der Schönheit der Natur erfreuen konnte, fehlte ihm an diesem Morgen der Blick dafür. Die Flut der Eindrücke perlte an ihm ab. Stattdessen drängten sich ihm andere Bilder und Gedanken auf: Warum waren die Verantwortlichen beim Fernsehen gerade auf seinen Fall gestoßen? Was hatte sie veranlasst, „die Geschichte von damals“ – oft bediente er sich dieser verharmlosenden Umschreibung dessen, was vor mehr als 50 Jahren geschehen war – zum Gegenstand abendlicher Unterhaltung zu machen? Wie würde er selbst den für den Abend im „Ersten“ vorgesehenen Film verkraften? Würden Freunde und Nachbarn, die nichts von seiner Vergangenheit wussten, ihn wiedererkennen? Sollte er sich das Ganze überhaupt ansehen?
Gedanken wie diese kreisten in seinem Kopf, fern jeglicher Entspanntheit, auf die es ihm bei seinen morgendlichen Unternehmungen doch so sehr ankam. Je mehr sie Besitz von ihm ergriffen, desto abweisender, ja feindlicher erlebte er an diesem Morgen die Welt um sich herum.
Es überkam ihn ein Gefühl von absoluter Verzweiflung und unbändiger Wut zugleich. Hatte er nicht ausreichend für seine Taten gebüßt, und hatte er nun nicht Anspruch darauf, endlich in Ruhe gelassen zu werden?
Sein Blutdruck stieg, er merkte es an den beginnenden Kopfschmerzen, die ihn regelmäßig in Stresssituationen überfielen. Angespannt und unsicher, was da am Abend wohl auf ihn zukommen würde, bog er in einen der Seitenwege ein, um den Rückweg anzutreten.
„Schon zurück?“, war die knappe Reaktion seiner Frau Hanna, die ihren Mann routinemäßig erst eine gute Stunde später, dann zu ihrem gemeinsamen zweiten Frühstück, zurück erwartet hatte.
„Ist es wegen heute Abend?“, kam sie ohne Umschweife auf das Problem zu sprechen, das sie beide seit Wochen belastete. „Wäre es nicht gerade deswegen besser gewesen, du würdest dich ausdauernder an frischer Luft bewegen und dich ablenken?“
„Du magst ja Recht haben.“
Mehr war ihm im Augenblick nicht zu entlocken. Hanna merkte, dass es in dieser Situation besser war, ihn mit seinen Gedanken allein zu lassen. Sie konnte es akzeptieren, dass er sich wortlos in das Lesezimmer im Obergeschoss zurückzog. Hier würde er für sich allein über das, was ihm seit Tagen durch den Kopf ging und sich zu einem immer größeren Berg aufzutürmen schien, nachdenken können. Gern hätte sie jedoch die quälenden Gedanken mit ihm geteilt. Aber anders als in früheren Zeiten, in denen sie über Alltagsprobleme und Sorgen immer offen hatten miteinander reden können, erlebte sie ihn jetzt als verschlossen und in sich zurückgezogen. Ihre vorsichtigen Versuche, die beobachtete Änderung seines Verhaltens anzusprechen, wehrte er beharrlich ab.
Ihr kamen Augenblicke in Erinnerung, wie er ihr bei ihren ersten Besuchen im Gefängnis begegnet war. Ungläubig und unsicher hatte er auf ihr Angebot reagiert, ihn in Abständen zu besuchen und mit ihm über das zu reden, was ihn bewegte. Den Kontakt zu ihm hatte sie bald nach seiner Verurteilung aufgenommen. In der „Hannoverschen Presse“ und in den Kino-Wochenschauen war ausführlich über seinen Fall berichtet worden. Anfangs hatten die Berichte und Bilder bei ihr nur ein flüchtiges Interesse an dem „Tango-Jüngling“ geweckt – wegen seines Gangs und seiner Kleidung hatte ein Zeitungsreporter ihn so charakterisiert. Bald darauf fasste sie jedoch den Entschluss, diesen jungen, gut aussehenden Mann persönlich kennen zu lernen. Nach ersten Briefkontakten, bei denen die Gefängnisleitung den Inhalt der eingegangenen Schreiben und der Antwortbriefe sorgfältig kontrollierte, wurde beiden die Möglichkeit zu einer persönlichen Begegnung eingeräumt.
Schon bald danach saßen sie sich für eine halbe Stunde im Besucherraum der Haftanstalt gegenüber. Artur bereitete es zunächst sichtlich Mühe, mit der neuen, ungewohnten Situation klar zu kommen. Worüber sollte man mit einer unbekannten Person reden? Was waren ihre Beweggründe, sich für einen Strafgefangenen zu interessieren, der noch für Jahrzehnte hinter Gefängnismauern leben musste? Ein persönliches Gespräch, ein offener Gedankenaustausch konnte unter diesen Umständen kaum in Gang kommen. So geriet die erste Begegnung zu einer oberflächlichen, von beiden Seiten als anstrengend erlebten Kontaktaufnahme mit noch ungewissem Ausgang.
Doch die Besuche fanden schon bald eine Fortsetzung. Sie boten ihm eine willkommene Abwechslung im grauen Anstaltsalltag, besonders nachdem man ihn in ein Zuchthaus verlegt hatte.
Aus den Monaten hinter Gittern wurden Jahre. Inzwischen waren die regelmäßigen Begegnungen zu einem festen Bestandteil im Leben beider geworden, der ihre Beziehung mit der Zeit spürbar enger werden ließ. Zunehmend kreisten ihre Gedanken und Gespräche auch um die Frage, wie es eines Tages, nach der Haftverbüßung, weitergehen könnte.
Einen echten Hoffnungsschimmer bedeutete es für Artur, als ihm eines Tages in Aussicht gestellt wurde, das Gefängnis als Freigänger für einige Stunden am Tag verlassen zu können. Damit würde für beide der Weg frei sein, so hoffte er, sich außerhalb der Gefängnismauern zu treffen und Pläne für eine gemeinsame Zukunft zu schmieden.
Bevor es jedoch dazu kam, war noch ein Rückschlag zu verkraften gewesen. Eine überstandene Operation, bei der Artur ein gutartiger Hirntumor entfernt worden war, hatte die Aussicht auf regelmäßige künftige Freigänge zunächst wieder in einige Ferne gerückt. Gesundheitliche Gründe waren am Ende dann wohl aber doch ausschlaggebend dafür gewesen, ihn im Rahmen einer Generalamnestie des Niedersächsischen Ministerpräsidenten nach 22-jähriger Haftverbüßung im Zuchthaus Celle in die Freiheit zu entlassen.
Nun stand ihm das bedrückende Geschehen, das vor mehr als 50 Jahren zu seiner Verurteilung geführt hatte, erneut vor Augen. Der Gedanke, noch einmal mit dem düstersten Kapitel seiner Vergangenheit konfrontiert zu werden, versetzte ihn in äußerste Unruhe. Er kannte zwar den Inhalt des Filmes nicht, aber er musste befürchten, noch einmal mit belastenden Details, die Polizei und Justiz in akribischer kriminalistischer Kleinarbeit zu Tage gefördert hatten, konfrontiert zu werden.
Andererseits konnte er sicher sein, dass sein Name dabei nicht genannt wurde, hatte er diesen doch bald nach seiner Entlassung aus der Haft ändern können. Auch auf seinen jetzigen Lebensmittelpunkt, eine Villa in einem vornehmen Stadtteil Hannovers, könne der Film, so war er überzeugt, keinerlei Rückschlüsse zulassen.
Nach quälenden Stunden, in denen er mal still in sich zusammen gesunken in seinem Kaminsessel saß, mal rastlos in den Räumen des Hauses umher irrte, versank er vor dem Fernseher im Wohnzimmer in einen tiefen, aber unruhigen Schlaf.
Als er aufwachte, zeigte die Uhr 21:10. In wenigen Minuten würde der Film „Post vom Tango-Jüngling“ beginnen.
Er schaltete den Fernseher ein.
Donnerstag, 29. November 1951
I
Eystrup an der Weser. Innerhalb weniger Stunden war der Name des kleinen Dorfes an der Mittelweser überall im Lande bekannt. Zeitungen und Rundfunk meldeten in dicken Lettern und Sondersendungen ein Verbrechen, das es in dieser Form im Nachkriegsdeutschland bislang nicht gegeben hatte.
Was verbarg sich hinter der spektakulären Meldung?
Am Morgen dieses grauen Novembertages deutete nichts darauf hin, dass sich etwas Außergewöhnliches im Dorf ereignen würde: Die Menschen zogen es vor, bei dem unfreundlichen Spätherbstwetter in ihren Häusern zu bleiben. Hin und wieder passierte eines der wenigen in der Gegend zugelassenen Autos die stillen Straßen des Ortes. Berufstätige, die ihren Arbeitsplatz in den nahen Kreisstädten Nienburg und Verden hatten, waren bereits mit dem Zug unterwegs. In der Dorfschule hatte der Unterricht begonnen.
Der Postbetriebsassistent Heinrich Kleeberg wusste, was ihn an diesem Tag erwartete. Es war Rentenzahltag und hunderte, zumeist ältere Dorfbewohner würden vorbeikommen, um sich ihre Rente auszahlen zu lassen. Wie jedes Mal zum Ende eines Monats wurde dieser Tag von vielen Menschen im Dorf herbeigesehnt, bereitete es doch den allermeisten großeMühe, mit der bescheidenen Rente einen ganzen Monat auszukommen. Das galt erst recht, wenn damit, wie in diesem Fall, zusätzliche Weihnachtseinkäufe bestritten werden mussten.
Beim Gang zum Postamt ging es den meisten jedoch um mehr, als nur die monatliche Rente abzuholen. Immer traf man auf dem Wege dorthin oder in der Schalterhalle gute Bekannte und konnte mit ihnen eine Weile plaudern. Geschichten aller Art, Aktuelles über Personen und Ereignisse, kurz gesagt: der neueste Dorfklatsch wurde hier binnen kurzer Zeit „umgeschlagen“. Mit einem „Stell dir nur vor …“ fand man, zu Hause angekommen, stets interessierte Zuhörer.
Als Heinrich Kleeberg das Postamt öffnete, wartete bereits ein gutes Dutzend Dorfbewohner darauf, eingelassen zu werden. Minuten später konnte Kleeberg mit der Auszahlung beginnen, weil er, wie immer, schon am Vortage alle notwendigen Vorbereitungen getroffen hatte. Die benötigten Listen lagen geordnet vor ihm, die über Nacht im Tresor aufbewahrte Kassette mit Barbeträgen stand jetzt griffbereit. Am Nachbarschalter hatte der Postamtsleiter Degenhard damit begonnen, Postkarten und Briefmarken zu verkaufen, mit denen sich einzelne Besucher nebenbei eindeckten. Den nach und nach eintreffenden Selbstabholern händigte er die für sie bestimmten Postsendungen aus.
Mit einem flüchtigen „Moin, Gerlinde!“ begrüßte Kleeberg seine Tochter, die soeben die Schalterhalle betreten hatte. Auch sein Sohn Wilhelm saß an seinem Platz hinter dem Schalter dicht neben ihm. Als Post-Jungbote war er damit beschäftigt, die Briefe und Postkarten zu sortieren, die er gleich im Dorf austragen würde. Heinrich Kleeberg war stolz auf seine beiden Kinder, denen es gelungen war, einen sicheren Arbeitsplatz im Dorf zu finden – durchaus keine Selbstverständlichkeit in einer noch spürbar unter den Kriegsfolgen leidenden Zeit.
Als jüngster Büroangestellten der örtlichen Marmeladenfabrik war es Gerlindes Aufgabe, die tägliche Post für ihre Firma abzuholen, an diesem Tage neben mehreren Briefen und einigen Drucksachen auch eine sperrige Papprolle, die sich nicht, wie die übrige Post, in der mitgebrachten Aktentasche unterbringen ließ. Schnell hatte sie die Briefsendungen in ihrer Tasche verstaut, das rollenförmige Paket klemmte sie sich unter den Arm.
In dem Augenblick, als sie sich zur Tür wandte, passierte es.
Der ohrenbetäubende Knall war überall im Ort zu hören. Anwohner der umliegenden Straßen rissen ihre Fenster auf, hielten verstört Ausschau nach der Ursache des explosionsartigen Lärms. Andere stürmten aus ihren Häusern, rannten die Straße entlang in Richtung der vielstimmigen Hilferufe, die aus der Umgebung des Postamtes herüberschallten.
Was mochte da wohl passiert sein?
Den Ankommenden bot sich ein Bild des Grauens. Blutüberströmte, schreiende Menschen liefen verstört auf der Straße herum. Mit schmerzverzerrten Gesichtern standen andere wortlos zwischen Trümmerteilen – Türen, Fenstern, Dachteilen – unfähig, den Hinzueilenden irgendetwas zu erklären.
Der Blick durch die große Türöffnung – die Eingangstür selbst war auf die Straße geschleudert worden – offenbarte das gesamte Bild der Katastrophe. Eine gewaltige Detonation musste sich im Inneren des Postamtes ereignet haben. Zerborstene Wände, herunterhängende Kabel, herumliegende, kaum identifizierbare Teile der Büroeinrichtung, alles mit einer dicken Staubschicht überzogen, verstellten fast vollständig den Blick auf das Allerschlimmste: Am Boden lag reglos der Körper einer jungen Frau. Es war Gerlinde Kleeberg, sie war tot. Die Wucht der Explosion hatte sie zu Boden geschleudert, ihr tiefe Platzwunden zugefügt und Teile ihrer Kleidung durch den Raum gewirbelt. Neben ihr hockte ihr Vater, selbst schwer verletzt, und hielt die Hand der toten Tochter. Ein Bild des Grauens für alle Herbeigeeilten, die den Mut hatten, einen Blick durch die offene Tür in das Innere des Raumes zu werfen.
Nur wenige Minuten vergingen, bis die Feuerwehr und Beamte der örtlichen Polizei eintrafen. Das erschütternde Bild vor Augen, stockte ihnen der Atem. Sofort war klar, dass ärztliche Hilfe und der Rettungswagen des Roten Kreuzes angefordert werden mussten. Der Leiter des örtlichen Polizeireviers entschied angesichts des Ausmaßes der Katastrophe, unverzüglich die vorgesetzten Dienststellen in Hannover, die Landeskriminalpolizei und den zuständigen Staatsanwalt zu verständigen.
Letzterer reagierte prompt. „Bitte tragen Sie dafür Sorge, dass das gesamte Gelände um das zerstörte Gebäude hermetisch abgeriegelt wird. Bis zu meinem Eintreffen vor Ort ist allen Anwesenden strikt zu untersagen, das Gebäude zu betreten.“ „Selbstverständlich, Herr Oberstaatsanwalt“, weiter kam der Anrufer nicht, da am anderen Ende bereits aufgelegt war.
Nur eine knappe halbe Stunde später fuhr der Staatsanwalt in seinem Dienstwagen vor. Ein kurzer Blick genügte ihm, um zu erkennen, dass hier etwas Ungeheures geschehen war. Sprachlos verharrte er einen Augenblick vor dem Trümmerfeld, das den Weg in das Innere des Gebäudes verstellte. Um in das Haus zu gelangen und sich ein Bild vom Ausmaß der Zerstörungen zu machen, nutzte er schließlich den Hintereingang des Postgebäudes.
Auf seine Frage nach Zeugen fand sich unter den Verletzten eine ältere Frau, die leichte Schnittwunden am Kopf davongetragen hatte. Sie stand spürbar unter Schock und hatte allergrößte Mühe, den Hergang der Ereignisse zu schildern. Aus bruchstückhaften, wenig geordneten Mosaiksteinchen entstanden ganz allmählich die Konturen des unfassbaren Geschehens: Im Schalterraum des Postgebäudes, so die Zeugin, habe sich kurz nach 8:30 Uhr ein wahres Höllenspektakel ereignet. Inmitten der Anwesenden sei es plötzlich zu einer heftigen Detonation gekommen, deren Druckwelle Menschen und Einrichtungsgegenstände wie Spielzeugfiguren durch den Raum wirbelte. Sie selbst sei gegen die Schalterabsperrung geschleudert worden und habe noch sehen können, wie ein greller Feuerschein die Tochter des Postbeamten umgab. Ob da möglicherweise das Paket explodiert sei, das die junge Frau unter dem Arm trug? Für diese habe es keine Rettung mehr gegeben. Aber auch die Mehrzahl der übrigen Anwesenden habe schwere Schnittwunden und Prellungen an Kopf und Armen erlitten.
Einem älteren Mann, der über heftige Schmerzen in beiden Ohren klagte, schienen von der Druckwelle die Trommelfelle geplatzt zu sein.
Doch was war die wirkliche Ursache der Explosion? Konnte man der Schilderung der verstört wirkenden Augenzeugin Glauben schenken?
Ein explodierendes Postpaket, so etwas hatte es bisher noch nirgendwo gegeben. Hing das Ganze nicht doch mit der größeren Geldauszahlung an diesem Tage zusammen? Hatten die Täter irgendwo im Postamt eine Bombe versteckt und sie jetzt zur Detonation gebracht?
Um 12.40 Uhr verbreitete die Deutsche Presseagentur DPA die folgende Meldung:
„Auf das Postamt Eystrup wurde ein Sprengstoffanschlag verübt ... Es besteht die Möglichkeit, dass das Attentat einen Raub der zur Rentenauszahlung in dem Postamt lagernden Geldbeträge ermöglichen sollte."
2
Die Redaktionskonferenz der „Bremer Nachrichten“ war pünktlich zu Ende gegangen. Der neue Chefredakteur, Dr. Arnold Fuchs, hatte die Gespräche wie immer umsichtig und zügig geleitet. Es fiel ihm leicht, den fachlichen Diskurs mit seinen Kolleginnen und Kollegen zu führen, denn bis zu seiner Berufung zum Redaktionsleiter vor wenigen Monaten hatte er selbst diesem Kreis als Verantwortlicher für das Ressort „Innenpolitik“ angehört.
Im Mittelpunkt der Aussprachen stand ein weiteres Mal die Ausweitung des Koreakrieges, der nun schon mehr als ein Jahr andauerte. Durch die eskalierenden Bombeneinsätze auf beiden Seiten mit hohen Opferzahlen gerieten die Kriegsparteien immer stärker in den Fokus und die Kritik der Weltöffentlichkeit. Eine halbe bis eine Million Menschen war bislang bei diesen massiven Luftangriffen ums Leben gekommen, und ein Ende der Kriegshandlungen war nicht absehbar.
Auch den vor Wochenfrist gestellten Antrag der Bundesregierung, die Kommunistische Partei Deutschlands zu verbieten, galt es für den Politikteil der Zeitung aufzubereiten. Auf die zwischen den politischen Parteien der Bundesrepublik kontrovers geführten Auseinandersetzungen zu dieser Frage musste reagiert werden. Zudem hatte man sich mit der von Presseorganen und dem Staatsrundfunk der „DDR“ geführten Kampagne gegen das Parteienverbot auseinander zu setzen. Reichlich Diskussionsstoff lieferten ebenso die in den Medien verbreiteten Positionen und Meinungen zu diesem Thema.
Geschickt hatte Fuchs es verstanden, die Informationen und Argumente zu diesem Komplex zu bündeln und den Tenor für Berichterstattung und Kommentar herauszuarbeiten.
Schnell waren die Informationen und Meinungen über das geplante neue „Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit“ ausgetauscht. Und im Auslandsteil sollte wie an den Vortagen wiederum ausführlich über die Überschwemmungskatastrophe in Oberitalien berichtet werden, wo der Po in einem unvorstellbaren Ausmaß das Land überflutet hatte.
Zufrieden mit den Ergebnissen verließ Dr. Fuchs nach gut zwei Stunden den Konferenzraum. Ein Blick auf die Uhr sagte ihm, dass es Zeit sei, sich eine kurze Mittagspause zu gönnen.
Etwa eine halbe Stunde war vergangen, als er sein Arbeitszimmer betrat, das unmittelbar neben dem großen Konferenzraum lag. Er hatte nach der Übernahme seiner leitenden Position damit begonnen, seinem Arbeitsplatz durch einige Kleinigkeiten an den Wänden und in den Regalen eine persönliche Note zu geben. Die Porträtaufnahmen des Bundeskanzlers Konrad Adenauer und des Bundespräsidenten Theodor Heuss hatte er von seinem Vorgänger übernommen. Anerkennung ihrer Arbeit und Respekt vor den führenden Köpfen der jungen Bundesrepublik hatten ihn schon vor längerem bewogen, der CDU beizutreten.





























