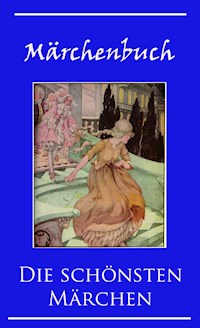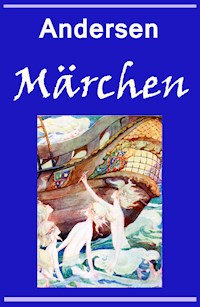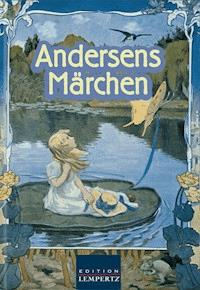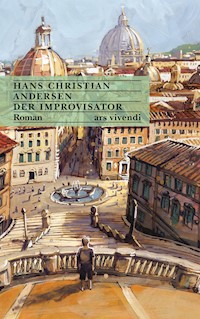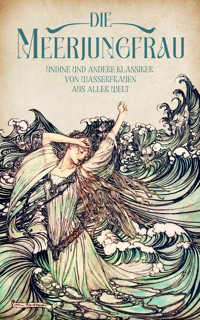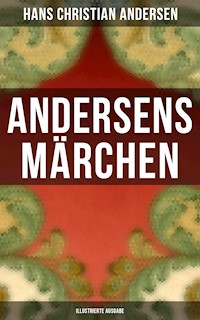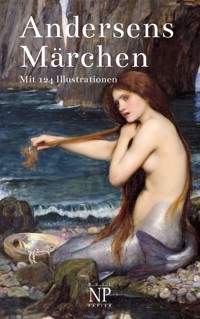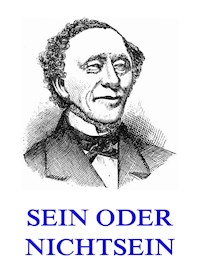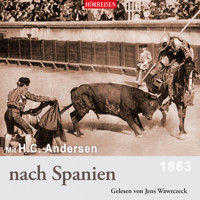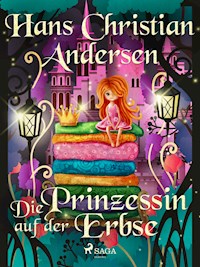O Tannenbaum. Der Adventskalender. 24 Weihnachtserzählungen rund um das Fest der Liebe E-Book
Hans Christian Andersen
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es muss ja nicht immer Schokolade im Adventskalender sein: Dieser hier verwöhnt Sie statt mit Süßem jeden Tag mit einem poetischen Leckerbissen. Gönnen Sie sich kleine Auszeiten von der vorweihnachtlichen Hektik und lassen Sie sich entführen in die zauberhafte Welt klassischer Märchen und Weihnachtserzählungen. Mit mal besinnlichen, mal lustigen Texten und Geschichten von berühmten Autoren wie u. a. Charles Dickens, Joachim Ringelnatz und Selma Lagerlöf wächst mit jedem Adventstag nicht nur die Freude auf das Weihnachtfest, sondern auch die Lust auf ganz große Literatur.
- Herzerwärmende Geschichten statt Süßkram
- Einstimmen aufs Fest: 24 Geschichten von Dickens bis Lagerlöf begleiten Tag für Tag durch die Adventszeit
- Literatur in kleinen Dosen für eine gemütliche vorweihnachtliche Lektüre
- Für wertvolle Momente des Innehaltens in der stressigsten Zeit des Jahres: Entschleunigung mit Klassikern
- Nachhaltige Alternative zum Schokoladenkalender: Ein immerwährendes Geschenk, das zum Verweilen und Vorlesen einlädt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
O TannenbaumDer Adventskalender
24
Weihnachtserzählungen rund um das Fest der Liebe
Ausgewählt von Michael Büsgen
Anaconda
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
© 2025 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR.)
Umschlaggestaltung: Katja Holst, Frankfurt am Main
Umschlagmotive: Shutterstock, © Mascha Taste (Banner und Schnee), Adobe Stock, © a7880ss (Weihnachtsmotive klein), Adobe Stock, © yayasya (Weihnachtsmotive groß)
Illustrationen Innenteil: Designed by Freepik
Satz, Layout und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-33471-0V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
1. Dezember
Ein WeihnachtsengelWalter Benjamin
2. Dezember
Der standhafte ZinnsoldatHans Christian Andersen
3. Dezember
Vom SchneemannPaula Dehmel
4. Dezember
Die Geschichte des armen VerwandtenCharles Dickens
5. Dezember
Die Heiligen Drei Könige. LegendeRainer Maria Rilke
6. Dezember
Die Geschichte des blauen Karfunkels
Arthur Conan Doyle
7. Dezember
Der TraumpfannenkuchenSelma Lagerlöf
8. Dezember
Großstadt-WeihnachtenKurt Tucholsky
9. Dezember
BergkristallAdalbert Stifter
10. Dezember
Der Christabend. Eine Familiengeschichte
Ludwig Thoma
11. Dezember
Der TraumAugust Heinrich Hoffmann von Fallersleben
12. Dezember
WeihnachtsmärchenFranz von Pocci
13. Dezember
Aus der WeihnachtszeitIsabella Braun
14. Dezember
In der ChristnachtPeter Rosegger
15. Dezember
Einsiedlers Heiliger AbendJoachim Ringelnatz
16. Dezember
Das Weihnachtsmahl der ZwergeAus Norwegen
17. Dezember
Der Christbaum der armen KinderFjodor Dostojewski
18. Dezember
Hänsel und GretelJacob und Wilhelm Grimm
19. Dezember
Die verwandelte MausLudwig Bechstein
20. Dezember
Am Weihnachtsmorgen 1772
Johann Wolfgang von Goethe
21. Dezember
Der kleine Schmied VerholenAus Flandern
22. Dezember
WeihnachtKlabund
23. Dezember
Eine WeihnachtsgeschichteHeinrich Seidel
24. Dezember
Zum 24. Dezember 1890Theodor Fontane
Quellenverzeichnis
Verse zum Advent
Noch ist Herbst nicht ganz entflohn,
Aber als Knecht Ruprecht schon
Kommt der Winter hergeschritten,
Und alsbald aus Schnees Mitten
Klingt des Schlittenglöckleins Ton.
Und was jüngst noch, fern und nah,
Bunt auf uns herniedersah,
Weiß sind Türme, Dächer, Zweige,
Und das Jahr geht auf die Neige,
Und das schönste Fest ist da.
Tag du der Geburt des Herrn,
Heute bist du uns noch fern,
Aber Tannen, Engel, Fahnen
Lassen uns den Tag schon ahnen,
Und wir sehen schon den Stern.
Theodor Fontane
1.
Dezember
Ein Weihnachtsengel
Walter Benjamin
Mit den Tannenbäumen begann es. Eines Morgens, als wir zur Schule gingen, hafteten an den Straßenecken die grünen Siegel, die die Stadt wie ein großes Weihnachtspaket an hundert Ecken und Kanten zu sichern schienen. Dann barst sie eines schönen Tages dennoch, und Spielzeug, Nüsse, Stroh und Baumschmuck quollen aus ihrem Innern: der Weihnachtsmarkt. Mit ihnen aber quoll noch etwas anderes hervor: die Armut. Wie nämlich Äpfel und Nüsse mit ein wenig Schaumgold neben dem Marzipan sich auf dem Weihnachtsteller zeigen durften, so auch die armen Leute mit Lametta und bunten Kerzen in den besseren Vierteln. Die Reichen aber schickten ihre Kinder vor, um denen der Armen wollene Schäfchen abzukaufen oder Almosen auszuteilen, die sie selbst vor Scham nicht über ihre Hände brachten. Inzwischen stand bereits auf der Veranda der Baum, den meine Mutter insgeheim gekauft und über die Hintertreppe in die Wohnung hatte bringen lassen. Und wunderbarer als alles, was das Kerzenlicht ihm gab, war, wie das nahe Fest in seine Zweige mit jedem Tage dichter sich verspann. In den Höfen begannen die Leierkasten die letzte Frist mit Chorälen zu dehnen. Endlich war sie dennoch verstrichen und einer jener Tage wieder da, an deren frühesten ich mich hier erinnere.
In meinem Zimmer wartete ich, bis es sechs werden wollte. Kein Fest des späteren Lebens kennt diese Stunde, die wie ein Pfeil im Herzen des Tages zittert. Es war schon dunkel; trotzdem entzündete ich nicht die Lampe, um den Blick nicht von den Fenstern überm Hof zu wenden, hinter denen nun die ersten Kerzen zu sehen waren. Es war von allen Augenblicken, die das Dasein des Weihnachtsbaumes hat, der bänglichste, in dem er Nadeln und Geäst dem Dunkel opfert, um nichts zu sein als nur ein unnahbares und doch nahes Sternbild im trüben Fenster einer Hinterwohnung. Doch wie ein solches Sternbild hin und wieder eins der verlassenen Fenster begnadete, indessen viele weiter dunkel blieben und andere noch trauriger im Gaslicht der früheren Abende verkümmerten, schien mir, dass diese weihnachtlichen Fenster die Einsamkeit, das Alter und das Darben – all das, wovon die armen Leute schwiegen – in sich fassten.
Dann fiel mir wieder die Bescherung ein, die meine Eltern eben rüsteten. Kaum aber hatte ich so schweren Herzens, wie nur die Nähe eines sichern Glücks es macht, mich von dem Fenster abgewandt, so spürte ich eine fremde Gegenwart im Raum. Es war nichts als ein Wind, sodass die Worte, die sich auf meinen Lippen bildeten, wie Falten waren, die ein träges Segel plötzlich vor einer frischen Brise wirft: »Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind« – mit diesen Worten hatte sich der Engel, der in ihnen begonnen hatte, sich zu bilden, auch verflüchtigt. Doch nicht mehr lange blieb ich im leeren Zimmer. Man rief mich in das gegenüberliegende, in dem der Baum nun in die Glorie eingegangen war, welche ihn mir entfremdete, bis er, des Untersatzes beraubt, im Schnee verschüttet oder im Regen glänzend, das Fest da endete, wo es ein Leierkasten begonnen hatte.
2.
Dezember
Der standhafte Zinnsoldat
Hans Christian Andersen
Es waren einmal fünfundzwanzig Zinnsoldaten, die waren alle Brüder, denn sie waren aus einem alten zinnernen Löffel gemacht worden. Das Gewehr hielten sie im Arm und das Gesicht geradeaus; rot und blau, überaus herrlich war die Uniform; das Allererste, was sie in dieser Welt hörten, als der Deckel von der Schachtel genommen wurde, in der sie lagen, war das Wort »Zinnsoldaten!«. Das rief ein kleiner Knabe und klatschte in die Hände; er hatte sie erhalten, denn es war sein Geburtstag, und er stellte sie nun auf dem Tische auf. Der eine Soldat glich dem andern leibhaft, nur ein einziger war etwas verschieden; er hatte nur ein Bein, denn er war zuletzt gegossen worden, und da war nicht mehr Zinn genug da: Doch stand er eben so fest auf seinem einen Bein als die andern auf ihren zweien, und gerade er ist es, der sich bemerkbar machte.
Auf dem Tisch, auf welchem sie aufgestellt wurden, stand vieles andere Spielzeug, aber das, was am meisten in die Augen fiel, war ein niedliches Schloss von Papier. Durch die kleinen Fenster konnte man gerade in die Säle hineinsehen. Draußen vor demselben standen kleine Bäume rings um einen kleinen Spiegel, der wie ein kleiner See aussehen sollte. Schwäne von Wachs schwammen darauf und spiegelten sich. Das war alles niedlich, aber das Niedlichste war doch ein kleines Mädchen, das mitten in der offenen Schlosstür stand; sie war auch aus Papier ausgeschnitten, aber sie hatte ein schönes Kleid und ein kleines, schmales, blaues Band über den Schultern, gerade wie eine Schärpe; mitten in dieser saß ein glänzender Stern, gerade so groß wie ihr ganzes Gesicht. Das kleine Mädchen streckte ihre beiden Arme aus, denn sie war eine Tänzerin, und dann hob sie das eine Bein so hoch empor, dass der Zinnsoldat es durchaus nicht finden konnte und glaubte, dass sie gerade wie er nur ein Bein habe.
»Das wäre eine Frau für mich,« dachte er; »aber sie ist etwas vornehm, sie wohnt in einem Schlosse, ich habe nur eine Schachtel und da sind wir fünfundzwanzig darin, das ist kein Ort für sie; doch ich muss suchen, Bekanntschaft mit ihr anzuknüpfen!« Und dann legte er sich, so lang er war, hinter eine Schnupftabaksdose, welche auf dem Tische stand; da konnte er recht die kleine, feine Dame betrachten, die fortfuhr auf einem Bein zu stehen, ohne umzufallen.
Als es Abend wurde, kamen alle die andern Zinnsoldaten in ihre Schachtel und die Leute im Hause gingen zu Bette. Nun fing das Spielzeug an zu spielen, sowohl »Es kommen Fremde!« als auch »Krieg führen« und »Ball geben«; die Zinnsoldaten rasselten in der Schachtel, denn sie wollten mit dabei sein, aber sie konnten den Deckel nicht aufheben. Der Nussknacker schoss Purzelbäume, und der Griffel belustigte sich auf der Tafel; es war ein Lärm, dass der Kanarienvogel davon erwachte und anfing mitzusprechen, und zwar in Versen. Die beiden einzigen, die sich nicht von der Stelle bewegten, waren der Zinnsoldat und die Tänzerin; sie hielt sich gerade auf der Zehenspitze und beide Arme ausgestreckt; er war ebenso standhaft auf seinem einen Beine; seine Augen wandte er keinen Augenblick von ihr weg.
Nun schlug die Uhr zwölf, und klatsch! Da sprang der Deckel von der Schnupftabaksdose, aber da war kein Tabak darin, nein, sondern ein kleiner schwarzer Kobold. Das war ein Kunststück.
»Zinnsoldat,« sagte der Kobold, »halte Deine Augen im Zaum!«
Aber der Zinnsoldat tat, als ob er es nicht hörte.
»Ja, warte nur bis morgen!« sagte der Kobold.
Als es nun Morgen wurde und die Kinder aufstanden, wurde der Zinnsoldat in das Fenster gestellt, und war es nun der Kobold oder der Zugwind, auf einmal flog das Fenster zu und der Soldat stürzte drei Stockwerke tief hinunter. Das war eine erschreckliche Fahrt. Er streckte das Bein gerade in die Höhe und blieb auf der Helmspitze mit dem Bajonett abwärts zwischen den Pflastersteinen stecken.
Das Dienstmädchen und der kleine Knabe kamen sogleich hinunter, um zu suchen; aber, obgleich sie nahe daran waren, auf ihn zu treten, so konnten sie ihn doch nicht erblicken. Hätte der Zinnsoldat gerufen: »Hier bin ich!«, so hätten sie ihn wohl gefunden, aber er fand es nicht passend, laut zu schreien, weil er in Uniform war.
Nun fing es an zu regnen; die Tropfen fielen immer dichter, es ward ein ordentlicher Platzregen; als derselbe zu Ende war, kamen zwei Straßenjungen vorbei.
»Sieh Du!«, sagte der eine, »da liegt ein Zinnsoldat! Der soll hinaus und segeln!«
Sie machten ein Boot von einer Zeitung, setzten den Soldaten mitten in dasselbe, und nun segelte er den Rinnstein hinunter; beide Knaben liefen nebenher und klatschten in die Hände. Was schlugen da für Wellen in dem Rinnstein und welcher Strom war da! Ja, der Regen hatte aber auch geströmt. Das Papierboot schaukelte auf und nieder, mitunter drehte es sich so geschwind, dass der Zinnsoldat bebte; aber er blieb standhaft, verzog keine Miene, sah geradeaus und hielt das Gewehr im Arm.
Mit einem Male trieb das Boot unter eine lange Rinnsteinbrücke; da wurde es gerade so dunkel, als wäre er in seiner Schachtel.
»Wohin mag ich nun kommen?«, dachte er. »Ja, ja, das ist des Kobolds Schuld! Ach säße doch das kleine Mädchen hier im Boote, da möchte es meinetwegen noch einmal so dunkel sein!«
Da kam plötzlich eine große Wasserratte, welche unter der Rinnsteinbrücke wohnte.
»Hast Du einen Pass?«, fragte die Ratte. »Her mit dem Passe!«
Aber der Zinnsoldat schwieg still und hielt das Gewehr noch fester.
Das Boot fuhr davon und die Ratte hinterher. Hu! Wie fletschte sie die Zähne und rief den Holzspänen und dem Stroh zu:
»Halt auf! Halt auf! Er hat keinen Zoll bezahlt; er hat den Pass nicht gezeigt!«
Aber die Strömung wurde stärker und stärker! Der Zinnsoldat konnte schon da, wo das Brett aufhörte, den hellen Tag erblicken, aber er hörte auch einen brausenden Ton, der wohl einen tapfern Mann erschrecken konnte; denkt nur, der Rinnstein stürzte, wo die Brücke endete, gerade hinaus in einen großen Kanal; das würde für ihn ebenso gefährlich gewesen sein, als für uns, einen großen Wasserfall hinunterzufahren.
Nun war er schon so nahe dabei, dass er nicht mehr anhalten konnte. Das Boot fuhr hinaus, der arme Zinnsoldat hielt sich so steif er konnte, niemand sollte ihm nachsagen, dass er mit den Augen blinke. Das Boot schnurrte drei-, viermal herum und war bis zum Rande mit Wasser gefüllt, es musste sinken. Der Zinnsoldat stand bis zum Halse im Wasser, und tiefer und tiefer sank das Boot, mehr und mehr löste das Papier sich auf; nun ging das Wasser über des Soldaten Kopf. Da dachte er an die kleine, niedliche Tänzerin, die er nie mehr zu Gesicht bekommen sollte, und es klang vor des Zinnsoldaten Ohren:
»Fahre, fahre Kriegsmann!
Den Tod musst Du erleiden!«
Nun ging das Papier entzwei und der Zinnsoldat stürzte hindurch, wurde aber augenblicklich von einem großen Fisch verschlungen.
Wie war es dunkel da drinnen! Da war es noch schlimmer als unter der Rinnsteinbrücke, und dann war es so sehr eng; aber der Zinnsoldat war standhaft und lag solang er war, mit dem Gewehre im Arm.
Der Fisch fuhr umher, er machte die allerschrecklichsten Bewegungen; endlich wurde er ganz still, es fuhr wie ein Blitzstrahl durch ihn hin. Das Licht schien ganz klar und jemand rief laut: »Der Zinnsoldat!« Der Fisch war gefangen worden, auf den Markt gebracht, verkauft und war in die Küche hinaufgekommen, wo die Köchin ihn mit einem großen Messer aufschnitt. Sie nahm mit zwei Fingern den Soldaten mitten um den Leib und trug ihn in die Stube hinein, wo alle den merkwürdigen Mann sehen wollten, der im Magen eines Fisches herumgereist war; aber der Zinnsoldat war gar nicht stolz. Sie stellten ihn auf den Tisch und da – wie sonderbar kann es doch in der Welt zugehen! Der Zinnsoldat war in derselben Stube, in der er früher gewesen war, er sah dieselben Kinder und dasselbe Spielzeug stand auf dem Tische, das herrliche Schloss mit der niedlichen, kleinen Tänzerin; sie hielt sich noch auf dem einen Bein und hatte das andere hoch in der Luft, sie war auch standhaft; das rührte den Zinnsoldaten, er war nahe daran, Zinn zu weinen, aber es schickte sich nicht. Er sah sie an, aber sie sagten gar nichts.
Da nahm der eine der kleinen Knaben den Soldaten und warf ihn gerade in den Ofen, obwohl er gar keinen Grund dafür hatte; es war sicher der Kobold in der Dose, der schuld daran war.
Der Zinnsoldat stand ganz beleuchtet da und fühlte eine Hitze, die erschrecklich war; aber ob sie von dem wirklichen Feuer oder von der Liebe herrührte, das wusste er nicht. Die Farben waren ganz von ihm abgegangen; ob das auf der Reisegeschehen oder ob der Kummer daran schuld war, konnte niemand sagen. Er sah das kleine Mädchen an, sie blickte ihn an, und er fühlte, dass er schmelze, aber noch stand er standhaft mit dem Gewehre im Arm. Da ging eine Tür auf, der Wind ergriff die Tänzerin und sie flog, einer Sylphide gleich, gerade in den Ofen zum Zinnsoldaten, loderte in Flammen auf und war verschwunden, da schmolz der Zinnsoldat zu einem Klumpen, und als das Mädchen am folgenden Tage die Asche herausnahm, fand sie ihn als ein kleines Zinnherz; von der Tänzerin hingegen war nur der Stern noch da, und der war kohlschwarz gebrannt.
3.
Dezember
Vom Schneemann
Paula Dehmel
Am zweiten Weihnachtsfeiertag waren Erich und Marie wieder da. Wir aßen Nüsse und Pfefferkuchen und spielten mit meinem neuen Lebensrad. Wenn man das dreht, werden die Bilder drin lebendig. Ein Clown schlägt Purzelbäume, ein Pudel springt durch den Reifen, ein Junge klettert auf einen Berg und wieder runter, und noch viel andres ist drin zu sehen; es ist ein lustiges Spielzeug.
Nachher haben wir einen Schneemann gemacht. Erst ein paar dicke Beine und einen Bauch, dann Hals und Arme und zuletzt den Kopf. Vater schenkte uns einen alten Kragen und einen Schlips; damit putzten wir unsern Schneemann fein aus. Der alte Steffens holte uns noch einen schwarzen Hut und eine Tabakspfeife, das konnten wir gut gebrauchen. Die Augen machten wir aus Kohle, und Mund und Nase aus Mohrrüben. Der Kerl sah ganz famos aus; wir nannten ihn den weißen Peter und tanzten um ihn herum. Zuletzt machte Erich ihm noch eine lange Perücke und einen Bart aus schwarzem Papier, da sah er wirklich beinah aus wie ein Mensch.
Bald nach dem Kaffee ließ Vater den Schlitten anspannen, und wir brachten Fröhlichs nach Hause. Hei, das ging schnell, viel schneller als im Wagen. Und der weiße Wald glitzerte, und die Abendsonne stand wie eine rote Kugel am Himmel. Wir waren eine Weile ganz still vor Freude; man hörte bloß die Schlittenglöckchen bimmeln. Als wir nach Hause kamen, war es schon dunkel; ich aß schnell mein Butterbrot und ging zu Bett.
Kaum war ich eingeschlafen, hörte ich unten was pfeifen.
Nanu, dachte ich, was ist denn los? und sprang aus dem Bette. Draußen schien der Mond, und ich sah ganz deutlich, wie der weiße Peter unten im Hof auf und ab ging. Ich machte das Fenster auf: Willst du wohl still stehn, alter Junge! Schneemänner gehn doch nicht spazieren!
Ach, sagte der, ich kann mir doch auch mal die Füße vertreten, sie sind mir eklig kalt geworden; übrigens könnte man auch mal Schlitten fahren, das habe ich lange nicht mehr getan. Und da zog er auch schon den Schlitten aus dem Schuppen. Willst du mit? rief er heraus.
Natürlich wollte ich. Ich zog mir Vaterns großen Pelz an und ging hinunter. Richtig, da saß unser Schneemann auf dem Bock; vier große weiße Pudel waren vor den Schlitten gespannt. Eingestiegen und los! Hei, wie wir flogen! Ich konnte kaum um mich sehen, so schnell gings.
Wo fahren wir denn hin, Peter? fragte ich. In den weißen Garten, sagte der Schneemann; und schon waren wir da.
Mitten im Walde blühten Hunderte von weißen Blumen, große und kleine. Ihre Blätter waren weiß, und das Gras war weiß, und alle Käferchen und Schmetterlinge waren weiß; sogar der Mond, der hoch oben stand, sah ganz weiß aus. Es war eigentlich ein bisschen gruselig, als wir ausstiegen und in dem weißen Garten umhergingen.
Peter, sagte ich, wir wollen wieder nach Hause; hier ist es mir zu weiß und zu still, und mich friert.
Aber die weißen Pudel waren mit dem Schlitten weggefahren, und der Schneemann nahm mich auf den Arm. Da wurde er immer größer und höher; wie ein Berg wurde er, und ich wuchs mit, beinah bis in den Himmel.
Und da kam auch schon das Luftschiff angefahren; rasch hinein in die Gondel, und nun wie der Wind nach Hause. Heidi, das ging ja noch schneller als wie im Schlitten! Aber der weiße Peter machte sich so furchtbar dick im Luftschiff; ich hatte auf einmal gar keinen Platz mehr, und plötzlich fiel ich – fiel ich – und bums! lag ich in meinem weichen Bett und wachte auf.
Verwundert guckte ich mich um. Es war Mondschein. Hatte ich denn das alles bloß wieder geträumt?
4.
Dezember
Die Geschichte des armen Verwandten
Charles Dickens
Es war ihm sehr peinlich, dass er vor so vielen geachteten Familienmitgliedern den Vorrang haben und als Erster mit den Geschichten beginnen sollte, die sie, in fröhlichem Kreis um den weihnachtlichen Kamin versammelt, sich erzählen wollten. Er wandte bescheiden ein, dass es richtiger wäre, wenn »John, unser verehrter Gastgeber« (auf dessen Gesundheit er sich zu trinken gestatte), freundlicherweise den Anfang machen würde. Denn was ihn selbst beträfe, meinte er, wäre er so wenig daran gewöhnt, der Erste zu sein, dass wirklich … Aber da hier alle riefen, dass er beginnen müsse, und alle einstimmig dafür waren, dass er beginnen könne, dürfe und solle, hörte er schließlich auf, sich die Hände zu reiben, zog seine Beine unter dem Lehnsessel hervor und begann.
Ich hege keinen Zweifel (sagte der arme Verwandte), dass ich die versammelten Mitglieder unserer Familie durch das Geständnis, das ich abzulegen im Begriff bin, überraschen werde; besonders aber John, unseren verehrten Gastgeber, dem wir für die freigebige Bewirtung des heutigen Tages so viel Dank schuldig sind. Falls ihr mir aber nun die Ehre erweist, von etwas überrascht zu sein, was eine Person von so geringer Bedeutung in der Familie wie ich vorbringt, so will ich nur feststellen, dass ich bei allem, was ich berichte, mit der größten Gewissenhaftigkeit verfahren werde.
Ich bin nicht der, wofür ich gehalten werde. Ich bin ein ganz anderer. Vielleicht wäre es gut, bevor ich fortfahre, einen Blick auf das zu werfen, wofür ich gehalten werde.
Man ist der Ansicht, dass ich niemandes Feind bin als mein eigener. Sollte ich mich darin täuschen, was sehr wahrscheinlich ist, so werden mich die versammelten Mitglieder unserer Familie zurechtweisen. (Hier sah sich der arme Verwandte mit mildem Blick im Kreis um, ob ihm jemand widerspräche.) Man glaubt, dass ich niemals bei irgendetwas besonderen Erfolg hatte. Dass ich im Geschäftlichen versagte, weil ich unkaufmännisch und leichtgläubig war – weil ich den selbstsüchtigen Schlichen meines Partners nicht gewachsen war. Dass ich in der Liebe Unglück hatte, weil ich lächerlich vertrauensselig war – weil ich es für unmöglich hielt, dass Christiana mich hintergehen könnte. Dass ich in meinen Erwartungen von meinem Onkel Chill enttäuscht wurde, weil ich in weltlichen Angelegenheiten nicht so scharf war, wie er es gewünscht hätte. Dass ich das ganze Leben hindurch überhaupt stets betrogen und enttäuscht worden bin. Dass ich jetzt ein Junggeselle zwischen neunundfünfzig und sechzig bin, der ein beschränktes Einkommen in Form einer vierteljährlichen Rente besitzt, über die, wie ich bemerke, John, unser verehrter Gastgeber, keine weitere Anspielung von mir hören möchte.
Das Leben, das ich jetzt führe, stellt sich nach der allgemeinen Annahme etwa folgendermaßen dar:
Ich bewohne in der Clapham Road ein sehr reinliches Hinterzimmer in einem sehr anständigen Haus. Man erwartet von mir, dass ich am Tag nicht zu Hause bin, ausgenommen in Krankheitsfällen, und ich gehe gewöhnlich um neun Uhr morgens fort, unter dem Vorwand, mich ins Geschäft zu begeben. Ich frühstücke – eine Buttersemmel und eine halbe Pinte Kaffee – in dem alten Kaffeehaus in der Nähe der Westminster Bridge, und dann gehe ich, ohne recht zu wissen, wozu, in die City und sitze in Garraways Kaffeehaus und auf der Börse und gehe umher und spreche in ein paar Kontoren vor, wo einige meiner Verwandten oder Bekannten so freundlich sind, mich zu dulden, und wo ich am Kamin stehe, wenn das Wetter gerade kalt ist. In dieser Weise bringe ich den Tag hinter mich, bis es fünf Uhr ist, und dann diniere ich: im Durchschnitt etwa für einen Schilling und drei Pence. Da ich noch ein wenig Geld für meine Abendunterhaltung übrighabe, gucke ich auf dem Heimweg in das alte Kaffeehaus hinein und nehme meine Tasse Tee und vielleicht meine Röstschnitte. So gehe ich denn, so regelmäßig, wie der große Uhrzeiger seinen Weg nach der Morgenstunde zurücklegt, wieder nach der Clapham Road zurück und lege mich, zu Hause angekommen, sofort zu Bett. Denn Heizen ist kostspielig, und die Familie, bei der ich wohne, will wegen der Mühe und des Schmutzes, die damit verbunden sind, nichts davon wissen.
Manchmal ist einer meiner Verwandten oder Bekannten so liebenswürdig, mich zum Dinner einzuladen. Das sind Feiertage für mich, und ich pflege in der Regel anschließend einen Spaziergang im Park zu unternehmen. Ich bin ein einsamer Mensch und gehe selten in jemands Gesellschaft. Nicht etwa, dass man mich meidet, weil ich schäbig aussehe; denn ich sehe gar nicht schäbig aus, da ich immer einen sehr guten schwarzen Anzug anhabe. Aber ich habe die Gewohnheit angenommen, leise zu sprechen und mich ziemlich schweigsam zu verhalten; meine Laune ist nicht rosig, und so verstehe ich vollkommen, dass ich keinem ein sehr wünschenswerter Gesellschafter bin.
Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist das Kind meines Vetters, der kleine Frank. Ich habe eine besondere Zuneigung zu diesem Knaben, und er hängt sehr an mir. Er ist von Natur ein misstrauischer Junge, und in einer Menschenmenge ist er bald überrannt, wie ich mich ausdrücken darf, und vergessen. Doch vertragen wir beide uns ganz vorzüglich, und es kommt mir so vor, als ob der arme Junge eines Tages meine besondere Stellung in der Familie erben würde. Wir sprechen nur wenig miteinander, und doch verstehen wir uns. Wir gehen Hand in Hand spazieren, und ohne dass wir viel sprechen, weiß er, was ich meine, und weiß ich, was er meint. Als er noch ganz klein war, pflegte ich ihn an die Schaufenster der Spielzeugläden zu führen und ihm die ausgestellten Spielsachen zu zeigen. Dabei fand er überraschend schnell heraus, dass ich ihm eine Menge Geschenke gemacht hätte, wenn ich dazu in der Lage gewesen wäre.
Der kleine Frank und ich gehen zum Monument zum Andenken an die große Londoner Feuersbrunst von 1666 spazieren und sehen es uns von außen an – er liebt das Monument sehr –, und wir gehen zu den Brücken und zu allen Sehenswürdigkeiten, die keinen Eintritt kosten. Zweimal haben wir an meinem Geburtstag gespickten Rinderbraten diniert und sind dann zum halben Preis ins Theater gegangen, wo wir mit tiefstem Interesse zugehört haben. Einst ging ich mit ihm in der Lombard Street, die wir oft aufsuchen, weil ihm meine Erzählung, dass es dort große Reichtümer gibt, diese Straße sehr lieb gemacht hat, als ein Gentleman im Vorübergehen zu mir sagte: »Sir, Ihr kleiner Sohn hat seinen Handschuh fallen lassen.« Ich versichere euch, wenn ihr mein Verweilen bei einem so trivialen Umstand entschuldigen wollt, dass diese zufällige Erwähnung, dieses Kind sei mein eigenes, an mein Herz griff und mir närrische Tränen in die Augen trieb.
Wenn der kleine Frank aufs Land in die Schule geschickt wird, werde ich in großer Verlegenheit sein, was ich mit mir anfangen soll. Aber ich habe die Absicht, einmal im Monat zu Fuß dorthin zu gehen und ihn an einem freien Nachmittag zu besuchen. Man sagt mir, er wird dann auf der Heide beim Spiel sein; und wenn meine Besuche unwillkommen sein sollten, weil sie den Knaben aufregen, so kann ich ihn aus der Ferne sehen, ohne dass er mich sieht, und dann wieder zurückwandern. Seine Mutter stammt aus einer hochvornehmen Familie, und ich weiß wohl, dass es ihr nicht besonders angenehm ist, wenn wir zu viel zusammen sind. Freilich bin ich wenig dazu geeignet, auf seinen schüchternen Charakter günstig einzuwirken; aber ich glaube, er würde mich über den Augenblick hinaus vermissen, wenn wir gänzlich getrennt würden.
Wenn ich in der Clapham Road sterbe, werde ich nicht viel mehr auf dieser Welt hinterlassen, als ich aus ihr hinwegnehmen werde. Aber ich besitze das Miniaturbild eines Knaben mit fröhlichem Gesicht und lockigem Haar, der am Hals einen offenen Hemdkragen trägt. Meine Mutter hat es für mich anfertigen lassen, aber ich kann nicht glauben, dass es jemals ähnlich war. Dieses wird beim Verkauf nichts einbringen, und ich werde darum bitten, dass es Frank gegeben wird. Ich habe meinem lieben Jungen einen kleinen Brief dazu geschrieben und ihm darin gesagt, dass es mir sehr leidtäte, von ihm zu scheiden; aber andererseits wüsste ich auch keinen rechten Grund, warum ich hierbleiben sollte. Ich habe ihm in kurzen Worten den Rat gegeben – den besten, den ich ihm geben konnte –, sich ein warnendes Beispiel daran zu nehmen, welche Folgen es hätte, wenn man niemandes Feind wäre als sein eigener. Ich habe mich auch bemüht, ihn zu trösten wegen dessen, was er, wie ich fürchte, als einen Verlust ansehen wird. Ich habe ihm vorgehalten, dass ich für jeden außer ihm nur ein überflüssiger Mensch war; dass es mir irgendwie misslungen sei, einen Platz in dieser großen Gesellschaft zu finden, und dass es deshalb besser sei, wenn ich sie verließe.
Dies (sagte der arme Verwandte, indem er sich räusperte und die Stimme ein wenig erhob) ist die allgemeine Ansicht über mich. Nun ist es aber ein bemerkenswerter Umstand – und das ist Zweck und Ziel meiner Geschichte –, dass das alles verkehrt ist. Das ist nicht mein Leben und das sind nicht meine Gewohnheiten. Ich wohne nicht einmal in der Clapham Road. Ich bin verhältnismäßig sehr selten dort. Ich wohne meistens in einem – ich schäme mich fast, das Wort auszusprechen, es klingt so anspruchsvoll – in einem Schloss. Ich will damit nicht sagen, dass es ein alter freiherrlicher Wohnsitz ist, aber es ist doch ein Gebäude, das jedem stets unter der Bezeichnung Schloss geläufig ist. Darin bewahre ich die Einzelheiten meiner Geschichte auf. Sie verhalten sich folgendermaßen:
Es war zu der Zeit, als ich noch im Haus meines Onkels Chill wohnte, von dem ich ein beträchtliches Erbe zu erwarten hatte. Ich war ein junger Mensch von nicht mehr als fünfundzwanzig Jahren und hatte gerade John Spatter, der mein Angestellter gewesen war, als Partner aufgenommen. Damals wagte ich es, mich Christiana zu erklären. Ich liebte Christiana, die von ungewöhnlicher Schönheit und in jeder Hinsicht reizend war, seit Langem. Zwar misstraute ich ihrer verwitweten Mutter, da ich fürchtete, dass sie hinterlistig und geldgierig wäre. Jedoch suchte ich um Christianas willen so gut wie möglich von ihr zu denken. Ich hatte niemals jemand anders als Christiana geliebt, und sie war von unserer Kindheit an die ganze Welt, ja viel mehr als die ganze Welt für mich gewesen!
Christiana nahm mit Zustimmung ihrer Mutter meine Bewerbung an, und ich war der glücklichste Mensch auf Erden. Ich führte im Haus meines Onkels Chill ein dürftiges, langweiliges Leben, und meine Dachkammer war so öde und kahl und kalt wie ein oberes Gefängnisgelass in einer finsteren Festung im Norden. Aber im Besitz von Christianas Liebe brauchte ich nichts weiter auf Erden. Ich würde mit keinem Menschen getauscht haben.
Zum Unglück war mein Onkel Chill ganz und gar von dem Laster der Habsucht beherrscht. Obwohl reich, war er gierig nach jedem Gewinn, knauserte und sparte und führte ein elendes Dasein. Da Christiana ohne Vermögen war, scheute ich mich eine Zeit lang ein wenig, ihm von unserer Verlobung Mitteilung zu machen. Schließlich aber schrieb ich ihm einen Brief und gestand ihm alles wahrheitsgemäß. Diesen legte ich eines Abends vor dem Zubettgehen in seine Hand.
Als ich am nächsten Morgen herunterkam, war mir das Herz schwer. Ich schauerte in der kalten Dezemberluft, die in dem ungeheizten Hause meines Onkels kälter war als auf der Straße. Denn dort schien doch bisweilen die Wintersonne und auf jeden Fall wurde sie von den fröhlichen Gesichtern und Stimmen der Vorübergehenden belebt. So schritt ich auf das lange, niedrige Frühstückszimmer zu, in dem mein Onkel saß. Es war ein großes Zimmer mit einem kleinen Feuer, und auf dem breiten Erkerfenster hatte der nächtliche Regen seine Spuren hinterlassen, als wären es die Tränen obdachloser Menschen. Es ging auf einen wüsten Hof mit einem rissigen Steinpflaster und einem verrosteten Eisengeländer, das zur Hälfte aus dem Boden herausgerissen war. Ein hässlicher Schuppen stand darauf, der einst in den Zeiten des großen Arztes, der das Haus an meinen Onkel verpfändet hatte, als Seziersaal gedient hatte.
Wir standen stets so früh auf, dass wir zu dieser Jahreszeit bei Kerzenlicht frühstückten. Als ich ins Zimmer trat, hatte sich mein Onkel infolge der Kälte so in seinem Lehnstuhl hinter der einen, trübe brennenden Kerze zusammengekauert, dass ich ihn erst gewahr wurde, als ich dicht am Tisch stand.
Als ich ihm die Hand entgegenstreckte, ergriff er seinen Stock (infolge von Gebrechlichkeit ging er stets mit einem Stock im Haus umher), schlug nach mir und sagte:
»Du Narr!«
»Onkel«, erwiderte ich, »ich hätte nicht erwartet, dass Sie so böse sein würden.«
Ich hatte es auch wirklich nicht erwartet, obwohl er ein harter und zorniger alter Mann war.
»Du hast es nicht erwartet?«, sagte er. »Wann hast du jemals etwas erwartet? Wann hast du je gerechnet oder an die Zukunft gedacht, du niedriger Hund?«
»Das sind harte Worte, Onkel!«
»Harte Worte? Das sind bloße Federn, wenn man einen Idioten wie dich damit schlagen will«, erwiderte er. »Hier! Betsy Snap! Seht ihn an!«
Betsy Snap, ein hässliches, welkes, gelbgesichtiges altes Weib, war unser einziger Dienstbote. Zu dieser Morgenstunde war sie stets damit beschäftigt, meinem Onkel die Beine zu reiben. Als mein Onkel sie aufforderte, mich anzusehen, legte er seine magere Klaue auf den Scheitel der neben ihm Knienden und wandte ihr Gesicht mir zu. In meiner Angst schoss mir plötzlich der Gedanke durch den Sinn, dass sie beide ein Bild aus dem Seziersaal boten, wie er zur Zeit des Arztes ausgesehen haben musste.