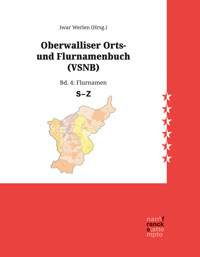
Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Besondere an den Oberwalliser Orts- und Flurnamen ist ihr relativ spätes Auftreten. Während die deutsche Schweiz im Wesentlichen seit dem 5. Jahrhundert langsam alemannisiert wurde, war das Oberwallis noch eine gallo-romanische Sprachlandschaft, in der es kaum Spuren des Alemannischen gab. Die früheste alemannische Besiedlung scheint im 9. Jahrhundert geschehen zu sein. Das "Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch" erschließt den Bestand der alemannischen Oberwalliser Namen sprachhistorisch und sprachgeographisch. Es schließt somit eine Lücke zwischen dem schon vollendeten "Urner Namenbuch" und dem im Erscheinen begriffenen "Berner Namenbuch", die das Oberwallis zwar berührten, aber seinen Namenschatz weitgehend ungedeutet ließen. Die verzeichneten Orts- und Flurnamen wurden in den Siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts erhoben. Sie stammen aus dem agrarischen, alpinistischen und touristischen Bereich, seltener handelt es sich auch um Namen von Straßen und Plätzen. Die Hauptlemmata der Orts- und Flurnamen werde in den Bänden ausführlich dargestellt, etymologisch kommentiert und geografisch verortet. Sie führen als Grundwörter, Bestimmungswörter, in ihrer flektierten und unflektierten Form und begleitet von Adjektiven zur Deutung der Orts- und Flurnamen. Ergänzt wird die Darstellung der Hauptlemmata durch eine Datenbank, die umfangreiche Informationen zu den Lemmata bietet (Belege, geographische Angaben, Kartenangaben etc.). Es entsteht auf diese Art und Weise ein umfassendes Bild der Orts- und Flurnamen des Oberwallis.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1210
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
[3]Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuch (VSNB)
Band 4:Flurnamen S–Z
Herausgegeben von Iwar Werlen
unter Mitarbeit vonAnne-Lore Bregy, René Pfammater und Gabriele Schmid
und Valentin Abgottspon, Claude Beauge, Werner Bellwald, Milda Christen, Martin Clausen, Gabriela Fuchs, Dominique Knuchel, Gisèle Pannatier und Stefan Würth
sowie mit zwei Beiträgen von Philipp Kalbermatter
Umschlagabbildung: Bearbeitete Version der Abbildung „Gemeinden des Kantons Wallis“ von Tschubby (https://de.wikipedia.org/wiki/Kanton_Wallis#/media/Datei:Karte_Gemeinden_des_Kantons_Wallis_farbig_2021.png), CC BY-SA 4.0
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
Das Gesamtprojekt des Oberwalliser Orts- und Flurnamenbuchs wurde gefördert durch die Walliser Delegation der Loterie Romande, im Kanton Wallis durch das Erziehungsdepartement und die Dienststellen für Kultur und Hochschulwesen, die Stadtgemeinde Brig sowie anonyme Spender.
Prof. em. Dr. Iwar WerlenWangenhubelstrasse 53173 Oberwangen bei BernSCHWEIZ
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381116324
© 2024 · Iwar Werlen
Das Werk ist eine Open Access-Publikation. Es wird unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen | CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, solange Sie die/den ursprünglichen Autor/innen und die Quelle ordentlich nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz anfügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der am Material vermerkten Legende nichts anderes ergibt. In diesen Fällen ist für die oben genannten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 · D-72070 TübingenInternet: www.narr.deeMail: [email protected]
Satz: typoscript GmbH, WalddorfhäslachDruck: Elanders Waiblingen GmbHISBN 978-3-381-11631-7 (Print)ISBN 978-3-381-11632-4 (ePDF)ISBN 978-3-381-11633-1 (ePub)Bestellbar im Bundle mit den Bänden 1 bis 4 unter ISBN 978-3-381-10831-2
Inhalt
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Verbunden mit dieser Publikation ist eine Datenbank der einzelnen Orts- und Flurnamen. Zusätzlich sind darin die folgenden Informationen hinterlegt: Gemeinde, Kennzahl, Umschrift des jeweiligen Namens, Kartenangaben, geographische Höhe und geographische Länge und Breite, Hauptlemma und Lemma, zusätzliche Angaben; dazu kommen geographische Lage und Höhe, Beschreibung, lebende Belege und historische Angaben mit der Jahreszahl und einem Zitat mit den historischen Belegen der Namen. Das alles ist natürlich nur vorhanden, wenn die Namen lebend sind; wenn nur historische Belege vorhanden sind, werden nur sie dargestellt. Die Installations- und Systemdateien für die Datenbank können Sie unter diesem Link herunterladen: https://files.narr.digital/9783381108312/Datenbank.zip.
S
Saaga
Saaga f. ‘Sägerei’ ist zu schwdt. Sagen, Sägen; Sagi, Sägi, wdt. Saaga, Saagä (Goms), Saagu f. ‘Säge’ (Id. 7, 423 ff.; Grichting 1998, 166) zu stellen. In den Flurnamen ist meist eine mit Wasser betriebene Sägerei gemeint, nicht primär das Werkzeug. Das HL kommt insgesamt in rund 80 Namen vor.
Am häufigsten ist ein Simplex im Singular mit der Präposition zer ‘zur, bei der’ oder einer andern Präposition wie bi ‘bei’, üf ‘auf’ und den Kombinationen unner der ‘unter der’, hinner der ‘hinter der’. Die Formen sind t Saaga (Ernen, Mund, St. Niklaus), t Saage (Blitzingen, Ergisch (1853), Münster, Oberwald, Reckingen), t Saagu (Albinen (auch Mathieu 2006, 13), Gampel, Leuk, Saas-Balen, Saas-Grund, Staldenried, Varen, Visperterminen), zer Saagun (Blatten, Kippel), Saga (FLNK, Unterbäch), Sage (Obergesteln, bÿ / vnder der Sagen (1620 u. später, Selkingen), bei der Sagen (1683, Biel), hinder der Saagen (1603, Obergesteln), vnder der Saagen (1604, Münster), unter der Sagen (1786, Obergesteln; 1778, Raron), zer Saagen (1794, Salgesch), zer Sagen (1565 u. später, Baltschieder), zer Sagn (1412 Brig), zer Sagun (1390, Glis), zúr Saagen (1709 u. später, Leuk) iuxta der Sagn (1580, Visp), bei der Säge (1803 u. später, Raron). Diminutiv im Singular sind selten: im Saagerli ‘im Gebiet der kleinen Sägerei’ (1761, Naters) und ts Saagi ‘die kleine Sägerei’ (Zwischbergen).
Attributive Adjektive finden sich zum HL primär in der Konstruktion t Alti Saagu und Varianten (Binn, Oberems, Randa, Salgesch, Ulrichen). Eine erweiterte Form ist der Alt Saaguwald ‘der Wald bei der alten Sägerei’ (Oberems).
Ein vorangestellter Genitiv ist in ts Pfammatisch Saagu ‘die Sägerei der Familie Pfammatter’ (Oberems) bezeugt; die Form entspricht der üblichen Verkürzung des FaN zu Pfammatti mit der Endung des Genitiv Singular.
Als Bestimmungswort ist das HL in zweigliedrigen Komposita mit den Grundwörtern Acher, Bach, Bodu, Cheer, Gufer, Hüs, Kapälla, Matta, Sand, Schiir, Schleif, Straas, Tole, Wäg, Wald, Wier und Wuer verbunden. Komplexer ist Ober Sagematte (Saas-Fee).
Unklar sind zwei Belege mit Sägu: Säguacher (FLNK, Albinen) und t Sägutola (Naters). Das HL Saaga erscheint im Wallis sonst nie mit Umlaut und kurzem Vokal; es stellt sich hier die Frage, ob ein sonst nicht belegtes Sägu ‘Segen’ (Id. 7, 444; Grichting 1998, 166, mit Varianten) anzusetzen ist; die beiden Belege könnten z.B. bei einer Segens-Prozession eine Rolle gespielt haben.
Eine Ableitung auf -era ist in Ober und Unner Saagera (Grächen) belegt; es handelt sich um eine Ableitung von Verben (Sonderegger 1958, 551) als Stellenbezeichnungen, hier als ‘wo gesägt wurde’.
Säältina
Der heute Säältina genannte Bach zwischen Brig und Glis heisst erst nach dem Zusammenfluss von Ganterbach, Taferna und Nesselbach so. Die ältesten Belege sind: 1279 Saltenna (Glis), 1331 Saltena (Glis, Brig), 1335 de Saltenon (Glis), 1336 de Saltennon (Glis), 1349 Saltana (Glis), 1383 super Saltanam (Glis).
Es gibt Saltana auch in Steg, aber nur historisch belegt, 1299 als apud Saltanon, 1303 apud Saltanum, 1306 apud Saltana, 1310 Saltanmatta … apud Saltanun.
Jaccard (1906, 413) führt den Bachnamen in Brig-Glis auf lat. saltare ‘springen’ zurück und lehnt eine Ableitung von salice(m) ‘Weide’ (nach Studer 1896) ab. Die ältesten Belege zeigen ein Suffix vom Typ -en(n)a, in Steg -ana. Letzteres scheint eine latinisierte Ableitung zu sein; die Weiterentwicklung zu Säältina in Brig-Glis (mit Umlaut und gehobenem /i/) lässt vermuten, dass die Form Saltena als Ausgangspunkt für den Bachnamen diente und nicht direkt die Form Saltana. In Steg ist anzunehmen, dass kein Bachname vorliegt, sondern das Gut eines Weibels (frz. sautier > lat. saltuarius ‘Waldhüter’ zu lat. saltus ‘Wald’, FEW 11, 122 f.) gemeint ist; dafür hat Id. (7, 871 s. v. Saltner/Salter ‘Alpvogt’) noch Belege aus dem Oberwallis. Dieses Salt- liegt wohl auch vor im historischen Beleg von 1454 (Raron) Feudum Salten ‘das Lehen des Salten (Weibel)’ und in der Salten ‘(wohl) in der (Siedlung des) Salten (Weibels)’ (1890, Täsch) – dies ist jedoch unsicher. Ein Beleg von 1300 apud Saltanum (Lalden) meint wohl den gleichen Namen wie Saltana in Steg.
Alle übrigen Belege beziehen sich auf den Bach zwischen Brig und Glis und seine Umgebung. Das Simplex t Säältina (Brig), t Sältina (Glis) – die Länge des Vokals hängt von der Gliederung nach vermuteter Morphemgrenze Säält#ina vs. Silbengrenze Säl%tina ab – ist historisch als Saltanam (1674), resp. Saltine (1842) für Ried-Brig belegt. In den andern Belegen ist Säältina ein Bestimmungwort oder ein Genitiv, wie in uf der Säältinubrigga ‘auf der Brücke über die Saltina’ (Brig), das historisch als vltra pontem Salthane (1580), resp. trans pontem Seltina‘ (1680) für Glis belegt ist. Ebenfalls in Glis sind 1714 supra Barreriam Saltana’ ‘oberhalb der Saltina-Wehr’, 1844 in dem Saltinen Kinn ‘in der Schlucht der Saltina’ und 1792 antiquum alveum Saltanae ‘das alte Bett der Saltina’ belegt. t Sältinuschlüocht ‘die Geländeeinbuchtung der Saltina’ (Glis) ist im südlichen Teil eine tiefe Schlucht, im nördlichen läuft sie in ein etwas breiteres Tal aus.
In einigen Belegen ist das Lemma zu Salten oder Salti gekürzt, so in Saltenwasserleita (1388, Ried-Brig) und Salti-Sand ‘das Sandgebiet der Saltina’ (1795 (ca.), Brig). Das schon zitierte Feudum Salten ‘Salten-Lehen’ (1454, Raron) weist zwar die gleiche Form auf, ist aber wohl, wie ausgeführt, auf Salt- ‘Weibel’ zurückzuführen.
Saarbu
Saarbu ist nur belegt in t Saarbuachra ‘die Äcker mit den Pappeln’ (Eggerberg, EK Sarbucachra). Saarbu ist wohl eine Kurzform zu Sar-baum ‘Pappel’ (Id. 4, 1245); der Baum heisst sonst im Oberwallis Sarbach (cf. HL Sar). Welche Pappelart genau gemeint ist (Lauber / Wagner / Gygax 5 2014, 426 ff.), ist unklar: die Höhe über Meer spricht für eine Zitterpappel (Populus tremula).
Saas
Saas ist zunächst der Name des Saastales; die vier Gemeinden Almagell, Balen, Fee und Grund erhalten das Präfix erst nach der Trennung der Grossgemeinde Saas 1392. Die Namen im ältesten erhaltenen Dokument, einem Friedensschluss von 1291 (bei Gremaud 2, Nr. 1021, ist ein Vidimus von 1311 abgedruckt), sind – der Reihe nach – de valle Solxa, vallis Solxe [Genitiv], vallis Salxe [Genitiv], vallis Salxe [Genitiv], de valle Solxa, de valle Solxa, vallis Solxe [Genitiv], de val de Soxa, de val Seyxa, de valle Solxa. (Bei Gremaud sind nicht alle Teile abgedruckt). Der Notar Virgilius von Domo(dossola) stammte aus der Diözese Novara, der Notar des Vidimus Johannod d’Auboreynges aus Vevey (nach Gremaud 2, 420). Ph. Kalbermatter (p.c.) hat anhand eines Faksimiles der Dokumente in Zanzi / Rizzi (1999) die Lesungen überprüft und kommt zu den oben erwähnten Belegen. Saorh in Kristol et al. (2005, 776) ist eine falsche Schreibung. Die Belege von 1291, die M. Seeberger notiert hat, sind nicht vollständig. Der Notar aus Domodossola notiert den Namen latinisiert (das zeigen Formen des Genitivs wie Solxe), schreibt meistens das vokalisierte /l/ als {l}, schreibt den Diphthong /au/ meist als {o}. Zweimal ersetzt er {o} durch {a} und einmal erscheint die seltsame Form Seyxa statt Solxa; wieweit hier der Notar des Vidimus eingegriffen hat, ist unklar. Da die sonst belegte Hauptform Sausa ist, dürften die frühesten Belege Umdeutungen des Notars von Domodossola darstellen.
Die ältesten Belege sind oben erwähnt; in historischen Dokumenten aus dem Wallis ist die vorherrschende Form Sausa. Die heutige Form Saas kommt 1569 als Sass vor, ebenso 1570, 1626 als Saass, 1631 als Sas. Das zugrunde liegende romanische Wort enthält sicher ein /l/, das vokalisiert wurde; die Schreibweise Solxa (1291) enthält wie erwähnt noch Reflexe des vokalisierten /l/ und eine Wiedergabe eines romanischen /al/ -> /ol/, das später als /au/ erscheint. Als frühesten Zeitpunkt für eine solche l-Vokalisierung gibt Rheinfelder (41968, 235) das 7. Jahrhundert an. Auch wenn im Wallis diese Entwicklung später stattgefunden hat, ist doch im Saastal ein Ausgangspunkt /salsa/ -> /sausa/ -> /sosa/ anzunehmen, wobei hier /s/ unsicher ist, wie die Belege um 1300 zeigen; vermutlich lag eine Art Affrikate vor.
Jaccard (1906, 401) führt Saas auf ein spätlat. *sauica (zu lat. saliceta ‘Weidengebüsch’, aus lat. salix, salicem ‘Weide’) zurück; allerdings kann sich laut Kristol et al. (2005, 776) spätlat. *salicēta (frz. saussaie) unmöglich zu einer Form wie *saucia entwickeln.
Guex (1938, 363), Rübel (1950, 133) und Zinsli (1965, 338) stellen den Namen direkt zu lat. salicem ‘Weide’. Auch diese Herleitung ist laut Kristol et al. (2005, 776) nicht überzeugend: Zum Zeitpunkt der Germanisierung des Saasertals müsse für die Entwicklung des lat. -c- vor -e- sehr wahrscheinlich eine affrizierte Lautung [dz] angenommen werden. Jedenfalls seien die mit -s- geschriebenen Formen aus dem 13. Jh. auf dieser Grundlage nicht zu erklären. Zudem können die gut belegten Formen vom Typ Solxa, Sausa (mit Schluss-a) nicht auf salicem zurückgehen.
Kristol et al. (2005, 776) erwägen, den Namen zu lat. salsus, salsa ‘salzhaltig, gesalzen’ zu stellen. Die fem. Form von Salsa (‘saures oder salziges Wasser’) wäre in diesem Fall der ursprüngliche Name der Saaser Vispa, der auf das Tal und später die Gemeinden übertragen worden wäre.
Die dt. Form Saas muss in jedem Fall nach einer Vokalisierung von /l/, aber vor einer Entwicklung von /au/ zu /o:/ gebildet worden sein. Das /s/ am Schluss der dt. Form deutet auf ein altes /s/ hin; die Hypothese von Kristol et al. (2005, 776) ist deswegen vorzuziehen.
Von den schon genannten vier Gemeinden ist Saas-Balen nur als Balu erfasst, auch wenn auf LT Saas-Balen steht. Saas Almagell Dörfli ‘das kleine Dorf von Saas Almagell’ (LT, Saas-Almagell) ist eine Kombination von Dörfli und Saas-Almagell, die so nicht auf der Karte steht; es handelt sich um einen Dorfteil von Saas-Almagell. Das it. Cresta di Saas ‘die Cresta di Saas’ (FLNK u. LT, Saas-Almagell) benennt einen Felszug auf italienischer Seite, der aus italienischer Sicht einen Felsrücken zum Saastal meint. Saastal (LT, u.a. in Saas-Almagell) bezieht sich auf das Tal der Saaser Vispe von Saas-Almagell bis Stalden.
Das Adjektiv Saaser, auch ein alter Genitiv ‘der Leute von Saas’ (Sonderegger 1958, 526 ff.), ist belegt in Saaserberg (1787, Saas-Grund), Saaser Vischpa ‘die Saaser Vispe (Fluss durch das Saastal)’ (FLNK, Eisten; FLNK u. LT, Stalden, SK Saaservisp; FLNK, Staldenried). Unklar ist in Sasers Boden ‘im Boden des Saaser’ (1554, Törbel), in Saasers Boden ‘im Boden des Saaser’ (1751, Bürchen), wo wohl ein Einwohner von Saas oder jemand mit dem FaN Saaser gemeint ist (cf. HL Saaser (FaN)). Komposita mit Saaser sind: Saaservispa (LT, Saas-Almagell; FLNK Saaser Vischpa, SK Saaser Visp), Saaser Vispa (LT, Saas Grund; FNLK Saaser Vischpu), únter dem Saaserweg ‘unter dem Weg der Leute von Saas’ (1803, Eisten; früherer Beleg von 1584 als stratam (tendentem) in vallem Sausa’ ‘der Weg, der ins Saasertal führt’ u. später), Saaserwäg ‘der Weg entlang der Saaser Vispe’ (FLNK, Stalden). Das komplexere der Alt Saaserwäg ‘der alte Weg ins Saastal’ (Stalden) benennt heute die Überreste eines alten Fussweges in das Saasertal (auf SK als Weg noch deutlich erkennbar).
Anders zu verstehen sind offenbar t Saasermüüra ‘die Saaser Mauer (laut Gwp. von Maurern aus dem Saastal erstellte Wehrmauer gegen den Rotten)’ (Naters), t Saasimüüra ‘die (gesetzte?) Mauer’ (Baltschieder; EK Saasi Müra, FLNK Saasimüra). In beiden Fällen ist die Deutung von Saaser / Saasi als ‘Maurer aus dem Saastal’ unsicher; es wird wiedergegeben, was in den Daten steht. Vermutlich ist in beiden Fällen eine gesetzte Mauer gemeint.
Saaser (FaN)
Saaser (FaN) kommt nur 1743 in Eggerberg als in Saasero Achren ‘die Äcker der Familie Saaser’ vor. Saasero ist ein Genitiv Plural, der entweder Einwohner des Saastales oder den FaN Saaser meinen kann. In der Datenbank des VSNB ist 1751 in Bürchen Saasers Boden belegt; es dürfte sich um den gleichen Fall handeln. Das Familiennamenbuch der Schweiz (3) kennt keine FaN Saaser. Das Register zu den HRBS führt aber den FaN Saaser mehrfach auf. Gemeint sein kann aber auch eine Herkunftsform (‘aus dem Saastal’).
Saass
Saass f. ist zu schwdt. Sāss, Sāsse(n) f. ‘Einschnitt in den Erdboden, den man beim Bauen eines Hauses macht, um festen Grund für die Mauern zu haben (WLö)’, mhd. sāsse f. ‘Sitz, Wohnsitz, Versteck, Lauer’ (Id. 7, 1371) zu stellen. URNB (3, 13) zitiert zwar diese Stelle, nimmt aber als Bedeutung ‘Alp(sitz)’, ‘Mulde’ an. In Blatten kommt der Typ Sässen m. vor, meistens im Plural. Das maskuline Genus findet sich sonst nur in Sāss ‘Bewohner’ (Id. 7, 1345), was hier nicht gemeint sein kann. Es kann sich um eine Rekonstruktion aus dem Plural Sässen ‘Alpsitze’ handeln.
Die Bedeutung ‘Alpsitz, Alpstufe’ findet sich auch in schwdt. Vor-Sāss, Sāsse(n) f. ‘die unterste der zwei oder drei Alpstufen’ (Id. 7, 1371) und schwdt. Sëss n. ‘Hauptsitz in den Alpen, d.h. dort wo das Obdach für Menschen und Vieh ist’, ‘verhältnismässig ebener, plateau- oder kesselartiger Teil einer Alpweide (im Ggs. zu den steilen Planggen), Alpstufe, -station (die Alp ist häufig in zwei oder mehrere Stationen eingeteilt, die abwechselnd benutzt werden); gedüngter Grasplatz um die Alphütte’, amhd. sëss n.m. (Id. 7, 1381).
Die geografische Verteilung der Namen ist ziemlich klar: der Typ Saass ‘Alpgebiet’ findet sich fast nur im Goms und zwar in Oberwald, Reckingen und Ulrichen. Da der Typ laut URNB (3, 13) auch im angrenzenden Kanton Uri vorkommt, liegt ein regionaler Zusammenhang um den Gotthard herum vor (Lötscher 1983, 169 f.). In Simplon kommt in drei Namen t Hosaas ‘die hohe Alpe’ vor; der gleiche Typ ist jünger auch in Saas-Grund belegt. Der Typ Vorsass / Vorsess ‘Voralpe’ wird bei Rübel (1950, 81) nur für das Lötschental erwähnt; in unseren Daten kommt es historisch auch in Goppisberg, Mühlebach, Münster und Turtmann, lebend in Blatten, Ergisch und Oberems vor.
Nur in Randa finden sich ts Chlei und ts Gross Saas vor. Das Neutrum ist sonst nicht belegt; die Motivation der Namen ist sehr unsicher, da die beiden Namen im Bergsturzgebiet lokalisiert sind. Die SK zeigt an der Stelle steile Felsen; Näheres lässt sich nicht erkennen. Es gibt aber in der gleichen Gemeinde t Saasse mit der Beschreibung ‘Grasterrassen, Steine, zwischen Felsen’. Das in Täsch erwähnte t Saasjini wird von Gwp. als ‘stufenförmige Böden’ genannt und gehört wohl zum gleichen Typ wie der Name in Randa; es ist als Diminutiv zum HL Saass zu stellen und hat nichts mit dem Talnamen Saas zu tun.
Mehrfach findet sich das Kompositum der Sasstei (Reckingen), Sasstein (1659, Betten), vff die Alten Sassteina (1666, Ried-Mörel), auff die Saas Steina (1691, Ried-Mörel) vnder den Sasssteinen (1560, Täsch) vor. Es muss sich um grössere Felsblöcke oder Steine auf einer Saass – einer Alpe – handeln.
Ganz unsicher ist ein historischer Beleg Zen Zassen (1424, Baltschieder, Eggerberg), der in Baltschieder 1437 Zem Zassen genannt wird. Das Genus spricht für einen Zusammenhang mit Sässen (Blatten), wobei das anlautende /z/ wohl ursprünglich aus dem assimilierten Artikel des Plurals stammt.
Neben den Simplizia, resp. den Komposita Vorsass und Hosaas kommt Saass als Grundwort vor in Gletschersaas ‘die Alpe beim Gletscher’ (Oberwald), di Tschafilvorsass ‘die Voralpe beim Tschafil’ (Ergisch) und di Boortervorsaas ‘die Voralpe der Familie Borter’ (Oberems). Neben dem Simplex Sässen sind belegt die Komposita t Seesässen ‘die Alpe beim See’ (Blatten), t Oigschtchummusässen ‘die Alpe bei der Augstkumme (Mulde, die erst im August bestossen wird)’ (Blatten).
Eine Ableitung auf -erri hat Hosaasserrÿ ‘die Wasserleite zur Hosaas’ (Simplon).
Attributive Adjektive weisen auf t Ober Saas und t Unner Saas (beide Oberwald), ts Chlei Saas und ts Gross Saas (beide Randa), t Indru und t Uistru Sässen (Blatten), sowie dr Ober und dr Under Sässen (Blatten). Zu den Seesässen gibt es ebenfalls dr Ober und dr Under Seesässen (Blatten).
Bildungen mit Saass und seinen Varianten als Bestimmungswort sind folgende Namen: t Forsaasfärricha ‘die Pferche auf der Voralpe’ (Blatten), t Forsassuän ‘die Wasserleite zur Voralpe’ (Blatten), der Hosaasstutz ‘der Anstieg zum Hosaas’ (Simplon) und – komplexer – ts Vorsastagfäld ‘das Tagfeld der Alpe’ (Oberems, es handelt sich um eine Alpe auf ca. 2300 m). Zu Saass selbst gibt es Bach, Egga, Gletscher, Grabe, Hore, Lamma, Licka, Pass, Stafel, Tal, Stei und Wang.
Eine seltsame Bildung eines Adjektivs Saasig kommt nur in St. Niklaus vor als ts Saasig Brunnji ‘die kleine, saasige Quelle’, der Saasig Tossu ‘der saasige Fels’, Saasigstei ‘der saasige Stein’ (FLNK). Die drei Fluren befinden sich an drei verschiedenen Orten und können nicht zum Talnamen Saas gestellt werden; St. Niklaus befindet sich im Tal der Matter Vispe und ist durch hohe Berge von der Saaser Vispe getrennt. Das Adjektiv ist sonst nicht belegt; wir geben es daher als ‘saasig’ wieder.
Nicht hieher gehören die Namen der Gemeinden Saas Almagell, Saas Balen, Saas Fee und Saas Grund, des Saastals und der Saaser Vispe (cf. HL Saas).
Sabbione
Sabbione kommt als Plural Sabbioni nur in Passo dei Sabbioni (LT, Oberwald; FLNK Passo del Sabbioni) vor. Gemeint ist hier das im Kanton Tessin liegende Geröllgebiet. Vgl. Petrini (1993, 119 s. v. sabbione ‘ghiaia (Kies, Geröll)’) und Devoto / Oli (2020, 1925 s. v. sabbia ‘Kies, Geröll’). Der Singular erscheint als Punta del Sabbione ‘Geröllspitze’ (dt. Hohsandhorn) in Binn.
Sabonet
Sabonet ist in Albinen (FLNK) belegt; Mathieu (2006, 13) kennt es als Zabonet, das auch für Inden (cf. HL Tschabonet) belegt ist. Die beiden Fluren sind nicht identisch.
Die historischen Belege in Albinen sind sehr unterschiedlich; vermutlich gehören sie nicht alle zu diesem HL. Der älteste Beleg von 1363 hat ou saruaio. 1648 ist ‘E sauana’ belegt, 1650 Eÿ Sawane, 1691 in die Sauanirÿ, 1708 Ey Sawonete, 1783 in Savonete. Es handelt sich um ein Diminutiv auf lat. -itta, entweder zum lat. sabucus ‘Holunder’ (FEW 11, 6; Meyer 1914, 105), also etwa ‘das kleine Gebiet mit Holunder’, oder zu lat. (juniperus) sabina ‘der Sefistrauch’ (FEW 11, 5), also etwa ‘das kleine Gebiet mit Sefisträuchern’ zu stellen. Die belegte Form mit /o/ deutet eher auf die erste Möglichkeit, die historische mit /a/ auf die zweite. In den historischen Belegen nach 1600 ist /n/ gut belegt, was besser zur zweiten Möglichkeit passt, die insgesamt wohl wahrscheinlicher ist. Die Entsprechung von /w/ durch /b/ (z.B. Nib statt Niw ‘neu’) ist in Albinen gut belegt.
Sack
Sack m., Pl. Seck ist zu schwdt. Sack m., Pl. Seck und wdt. Sakk, Sekk, Säkk wie nhd. ‘Sack’, ahd. sach, mhd. secchi (Id. 7, 604 ff., bes. 617 f.; Grichting 1998, 167) zu stellen. In FlN ‘sackförmige Geländevertiefung; Geländeerhebung’ (TGNB 2, 2, 477 f.; URNB 3, 1 ff.). Die rund 30 Namen kommen im ganzen Oberwallis vor.
Als Simplizia im Singular sind belegt der Sack (Reckingen und fünf weitere Gemeinden), im Sack (FLNK, Bratsch (hier Dorfteil); Bellwald; Hohtenn), Sack (FLNK, Gluringen), am Sack (1532, Fieschertal), im Sack (1693 u. später, Törbel; 1304 jn dien Sekken; 1307 jn dem Sekke) und der Sagg (Blatten, Mund; ev. Transkriptionsfehler). Simplizia im Plural sind t Seck (Münster, Naters, Ried-Brig, Saas-Almagell), Seck (FLNK u. LT, Termen).
Vermutlich das Präfix Fir-/Vor- ist in Z’Versack ‘im vorderen Teil des Sack (sackförmige Geländevertiefung)’ (1691, Fieschertal) vorhanden.
Attributive Adjektive in zweigliedrigen Konstruktionen sind: t Foodru Seck ‘die vorderen Säcke’ (Gampel), der Hinner Sack ‘der hintere Sack’ (Bellwald, Randa), t Indru Seck ‘die inneren Säcke’ (Gampel), der Voder Sack ‘der vordere Sack’ (Bellwald), der Vooder Sack ‘der vordere Sack’ (Randa). Die Bemerkung ‘sackförmige Geländevertiefung’ wurde hier weggelassen; manchmal handelt es sich um Grasbänder in den Felsen.
Das Grundwort ist nur in der Miltsack (Oberwald) vertreten; dazu kommt der Miltsackgrabe ‘der Graben beim Miltsack’. Zu vermuten ist, dass hier nicht das Adjektiv mild belegt ist, sondern entrundetes Mühl- mit eingeschobenem t, also ‘Mühlsack’, dem die Flur gleicht.
Als Bestimmungswort kommt das HL in zweigliedrigen Komposita mit folgenden Grundwörtern vor: Acher, Blatta, Egg(a), Grabu, Hooru und Rufina. Gemeint sind dabei meist naheliegende Fluren mit dem HL Sack.
Saflisch
Saflisch ist der Name eines Passes, der vom Rosswald (Ried-Brig, Termen) nach Heiligkreuz (Binntal) führt und ein Namennest bildet, das die Gemeinden Binn, Ernen, Grengiols, Ried-Mörel (wohl allgemein für Östlich-Raron) und Termen betrifft. Die ältesten Belege sind Safenes (1297, Ried-Mörel), Safnes (1390, Binn), Safness (1293, Grengiols), Saffnesch (1531, Ernen). Die Formen vom Typ Saflisch sind klar jünger. Auszugehen ist vom Typ Safenes, wobei das auslautende /s/ wohl romanisch ist. Das Wort ist zu lat. (juniperus) sabina, wdt. Sefina ‘Sade-, Sevebaum’ (Id. 7, 341) zu stellen, vgl. auch Bridel (1866, 346 s. v. savena), FEW (11, 5 s. v. sabīna ‘Sadebaum’) und die Deutung von Safnern bei Kristol et al. (2005, 797). Die Lautform erklärt sich aus der germanischen Erstbetonung und der Übernahme mit aus dem Romanischen mit erhaltenem /a/, während der Pflanzenname Sefina jünger ist. Der Strauch ist laut Lauber / Wagner / Gygax (2014, 92) im Oberwallis kollin-subalpin bis alpin belegt. Vermutlich liegt der Ursprung des Namens auf der Alpe Safnes in Grengiols / Binntal.
Neben den historischen Belegen ist Saflisch als Simplex nicht erwähnt. Ältere Formen sind: ab der Saffneschmatten (1531, Ernen) im Saffnetschgarten (1771, Binn), der lebendig als Saflischgaarte belegt ist, und die wohl verschriebene Safrischmatta (1817, Binn), die neu als Saflischmatta (Grengiols, Termen) erscheint. Die übrigen Belege weisen Saflisch als Erstglied auf: Saflischbach (Grengiols), Saflischhitta (Termen), Saflischpass (Grengiols, Termen), Saflischtal (Grengiols), Saflischwäg (Termen), Saflischwalgi ‘der kleine Wald bei der Saflischmatta’ (Termen). Komplexer ist bim Saflischmatterchriz ‘beim Kreuz die der Saflischmatte’ (Grengiols), sowie der Ober Saflischgaarte ‘der obere Saflischgarten’ (Grengiols). Wenn unsere Annahme stimmt, geht die Benennung von einer Alpe im Binntal aus; die Benennung im Raum Termen ist davon abgeleitet. Die Ersetzung von /n/ durch /l/ ist nicht dokumentiert.
Safran
Safran ‘Safran’ ist zu schwdt. Sáffran, Saffere(n), Saffre(n), Saffer, Saff(e)ret, m. ‘offizineller Safran, Crocus sat., Herbst-Safran’ (Id. 7, 333 ff.) zu stellen. In einigen Texten wird lat. crocus explizit für Safran verwendet, z.B. 1610 hortum crocinum ut vocant Saffrantgarten (Leuk). Der Pflanzenname ist bei Wagner / Lauber / Gygax (52014, 1298) als Crocus sativus belegt.
Der Name ist nur historisch belegt. Als Simplex kommt beÿm Saffrand (1766 u. später, Leuk) vor. Sonst ist Safran Bestimmungswort in Safran Acher (1862, Naters), Saffergarten (1679, Birgisch), Saffrantgarten (1610, Leuk), Saffrantgärten (1660 u. später, Naters), der Safrandtgarten (1716, Visp). Safran wird heute noch in Mund angebaut, doch sind in unseren Daten (VSNB) keine Flurnamen dazu überliefert.
Sägesu
Sägesu f. ist in der Sägesuacher ‘der Sensen-Acker (Acker in Sensenform)’ (Visperterminen) belegt. Zu stellen ist das HL zu schwdt. Sëgens ‘Sense’ und wdt. Sägessa, Seissä (Goms), Sägusa (Zermatt), Sägesu (Saastal), Sägässa (Lötschtal), Sägässu ‘Sense’ (Id. 7, 472 ff.; Grichting 1998, 166), hier aufgrund der Form des Ackers einer Sense.
Sagget
Sagget ist 1774 in Salgesch als in pra Sagget belegt. Ein lebendes Prissaagget (Salgesch) kommt dazu. Mathier (2015, 62) hat Prisaget und stellt es zu lat. pratellum (ergäbe nach Tagmann 1946, 37 Prilet) und einer idg. Wurzel *sapp- ‘Tanne’ mit einem -etu-Suffix, wobei -pp- zu -gg- verändert wurde. Bedeutung wäre danach ‘Wiesenplatz mit Tannen und Fichten’. Diese Herleitung kann die aktuellen Formen nicht erklären. Während die historisch belegte Form ein klares Pra ‘Wiese’ (< lat. pratum) enthält, bleibt Sagget unklar. Im Fall von Prisssaagget wäre eher an Prigea ‘eingezäuntes Stück Land’ zu denken (Tagmann 1946, 76), auch dann bleibt sagget (ev. auch agget) unklar; angenommen wird deswegen ein PN Sagget, das aber so nicht belegt ist.
Sägsch
Sägsch ‘sechs’ ist nur als adjektivisches Numerale belegt in Sägschfischi ‘das Gebiet, das sechs Fischi (Korn) ergab / das Äcker für sechs Fischi enthält’ (FLNK, Goppisberg), t Säggsch Chännja ‘die sechs Kännel’ (Bitsch), Sägschudriisger Militeerwäg ‘der Weg, der im 2. Weltkrieg vom Gebirgsbatallion 36 gebaut wurde’ (Termen; FLNK 36er Militeerwäg), ts Säggschhiischere ‘bei den sechs Häusern’ (Selkingen, FLNK Säggschhiischere, LT Sächshischere) und t Säggschhiischereschlüecht ‘die Geländeeinbuchtung bei den sechs Häusern’ (Biel). Das HL ist zu schwdt. sëchs bzw. sëx und wdt. säggsch, säggschi Zahlwort ‘sechs’ (Id. 7, 239 f.; Grichting 1998, 167) zu stellen.
Saifti
Saifti ist nur belegt als Saiftibode ‘der leicht gesenkte Boden’ (FLNK, Oberwald). Saifti ist ein Nomen, das zum Adjektiv sanft gebildet wurde (Id. 7, 1168); zu stellen ist es wohl zu Sänfti (Id. 7, 1174), allerdings mit Staubschem Gesetz (n-Dehnung vor Spirans), wobei hier der Typ saift ‘sanft’ mit einer i-Abstraktbildung ‘die Sanftheit’ vorliegt, die so in Id. nicht behandelt ist. Grichting (1998) kennt das HL nicht. Wörtlich ist zu deuten ‘der Boden mit Sanftheit’, warscheinlich ist der Boden, der nur wenig geneigt ist, gemeint.
Saits
Saits ist nur belegt in pratum de saits (1328, Inden). Die Lesung ist unsicher. Meyer (1914, 118 u. 171) nennt eine Form seytiz, die er auf lat. sectiles (wohl: ‘Schnitte’?) zurückführt. Mangels Kontext kann keine gesicherte Deutung gegeben werden.
Salche
Salche ist nur in an der Salchon Matten (1392, Goppisberg; 1469 Selchenmatta) belegt. Laut Id. (7, 844 f.) bezeichnen Alchen f. und Salchen f. eine ‘sumpfige, aus Ton bestehende Wiese’ bzw. ‘Futter, das auf diesem Boden wächst’ (Id. 7, 844 f.). Im Beleg ist wohl eine Wiese mit solchen Pflanzen gemeint. Lauber / Wagner / Gygax (52014, 1432) nennen dafür Bromus erectus ‘Aufrechte Trespe’ und andere Bromus Arten. Marzell (1, 676) kennt Bromus erectus dialektal für das WS nur als Alchen.
Salé
Salé, mit Endbetonung, ist in Zwischbergen belegt. Jordan (2006, 301) kennt es und vermutet eine ital. Form zu sala ‘Saal’ oder sale ‘Salz’. Wenn die Endbetonung stimmt, müsste eine Weiterbildung, wohl zu sale ‘Salz’, angenommen werden. In LSI (4, 499) ist salée als saliera ‘Salzbehälter’ aufgeführt. Hierzu könnte das HL gehören, obwohl die Form nicht ganz entsprechend ist. Ob Salé zum HL Sall ‘Gebäude’ gehört, ist unklar; da sich dort ein zerfallenes Gebäude befindet (laut Beschreibung), könnte das HL auch hieher gestellt werden. Das HL wird auch unter dem HL Sali aufgeführt, gehört aber ziemlich sicher nicht dazu.
Saleydo
Saleydo ist nur historisch belegt 1353 in Ergisch ou saleydo. Es handelt sich um eine Ableitung von lat. sal ‘Salz’; vergleichbare Formen ist šalędo (Lens, FEW 11, 78) ‘Salzgabe für das Vieh’, wohl etwa dt. Gläck, also etwa ‘Ort, wo man dem Vieh Salz gegeben hat’. Wohl identisch mit Schalido (cf. HL Schalido).
Saleyr
Saleyr ist nur historisch belegt 1351 in Salgesch sub closo dou saleyr. Laut Bossard/Chavan (2006, 219) ist Saleire zu einer Wurzel *sal ‘cours d’eau (Flusslauf, Bach)’ zu stellen. Das Ableitungssuffix dürfte -ariu(m) als Kollektiv sein (Bossard/Chavan 2006, 288). Die Deutung wäre dann ‘unter dem eingefriedeten Gut beim Bach’.
Sälf
Sälf kommt nur einmal als Bestimmungswort in der Sälfgalu (St. Niklaus) vor. Auf LT heisst er Säldgalen; FLNK hat Sälfgalu.
Lautlich würde Sälf zu schwdt. Salbei (Id. 7, 816) passen; vergleichbare Formen wie Salfi, Selfi sind aber primär im Kanton Graubünden belegt (RN 2, 478; jedoch auch Hinweis auf silva ‘Wald’). Laut Lauber / Wagner / Gygax (52014, 858) ist am ehesten Salvia pratensis (Wiesensalbei) möglich; die Pflanze müsste aber wohl tiefer vorkommen. Das alternative Säld würde als Flurname zu Seld ‘Haus, Herberge’ (Id. 7, 848) zwar in Frage kommen; im betreffenden Gebiet ist aber kein Gebäude zu erkennen. Insgesamt ist ein Zusammenhang mit dem Pflanzennamen wahrscheinlicher.
Salgesch
Salgesch, dial. Salggesch (mit Erstbetonung), frz. Salquenen, patois Sarqueno, ist der Name der westlichsten Gemeinde des Oberwallis an der Sprachgrenze zum Mittelwallis. Die ältesten Belege sind 1075–1125: in Salconio, 1225 (ca.):(A)pud Salquenun, 1225 (ca.), 1238 ff.: de Salqueno, 1287: de Sarqueno, 12??: de Saquenu, 1309: de Salqueno, 1333: de Sarqueno usw., 1423: apud Sarquinum, de Sarquino, 1428: apud Sarquenoz; 1483 Salquini (lat. Genitiv konstruktionsbedingt). 1590 erscheint erstmals die heutige dt. Form Salgesch. Der frühe Wechsel von /l/ und /r/ findet sich auch sonst (cf. HL Albinen und balma vs. barma). Der Wechsel von /c/ und /qu/ ist primär grafisch, wird aber von Kristol et al. (2005, 787) als Zeichen eines ursprünglichen Kompositums gedeutet. Die Gemeinde ist zunächst romanisch und wird erst im 16. und 17. Jahrhundert zweisprachig, danach primär deutsch.
Bisherige Deutungen führen den Namen auf lat. salicetum ‘Weidengehölz’ (Gatschet 1867, 80; Guex 1938, 363) bzw. die romanischen Namenformen vom Typ Salquenen (und den Erstbeleg Salconio) auf eine deutsche Form Salchen ebenfalls mit der Bed. ‘Weidengehölz’, zu ahd. salaha ‘Salweide’ (Jaccard 1906, 413) oder lat. saliconem ‘kleine Weide’ (Guex 1938, 363) zurück. Rübel (1950, 132) deutet den Namen aufgrund eines Hinweises von Hubschmied als kelt. *salikonios ‘die Leute beim Weidengebüsch’. In der bisherigen Forschung werden diese Deutungsansätze regelmässig zitiert (Oettli 1945, 72; Werlen 1991, 251; Mathier 1996, 28 f.u. 2015, 20 ff.; Besse 1997, 252). Muret (1907, 152) und Kristol et al. (2005, 787) weisen sie aber wie folgt zurück; eine deutschsprachige Deutung sei äusserst ungewöhnlich und sprachlich nicht plausibel. Kristol et al. (2005, 787) führen weiter aus, Salgesch/Salquenen sei erst im 16. Jh. germanisiert worden (Zimmerli 3, 57; Werlen 1991, 251), daher sei für die Deutung des Namens sicher von einer lat./rom. Grundlage auszugehen, doch finden die Autoren keine sichere Grundlage. Kristol et al. (2005, 787) denken darum an eine Bildung aus kelt. salico ‘Weide’ (urverwandt mit lat. salix, cf. Delamarre 2001, 225) und dem vermutlich kelt. Stamm venn- (spätlat. venna ‘Fischreuse, Weidegeflecht’, cf. Tavannes BE). In der modernfrz. Form Salquenen beruhe das -l- auf einer Beeinflussung durch die deutsche Form Salgesch. Weiter wird erklärt, die Entwicklung von Salquénno zu Sálgesch sei weitgehend regelmässig und weise auf eine frühe Entlehnung der romanischen Form ins Deutsche hin (seit dem 9. Jh.): (1) Verlegung des Haupttons auf die erste Silbe; Schwund des Auslautvokals. (2) Entlehnung des romanischen k als g (cf. Gampel). (3) Analogische Anfügung eines -s als Endkonsonant (Schmid 1952, 21 f., cf. Klosters GR; Coters GR) und Wandel des auslautenden -s zu -sch (Kristol et al. 2005, 787).
Neben dem Gemeindenamen ist 1822 die Monta Sarqueni ‘der Stutz (Abhang) von Salgesch’ (mit lateinischem Genitiv des Ortsnamens), den Mathier (2015, 69 ff.) als Munta kennt (cf. HL Munta), belegt. Nur Latein hat 1490 jpsarum alpium de Sarqueno ‘der Alpen von Salgesch (Genitiv Plural in alpium bedingt durch Konstruktion)’. 1602 ist ‘Chapella’ Sarqueni ‘die Kapelle von Salgesch’ (mit lat. Genitiv des Ortsnamens) bezeugt.
Zwei Belege beziehen sich auf die Leute von Salgesch: 1640 ad insulam Sarquenensium ‘bei der Aue der Leute von Salgesch’ und 1721 a Sarquenensium Torente ‘vom Salgesch-Bach’.
Zwei weitere Belege enthalten das HL als Bestimmungswort: beÿm Salgesch Stútz ‘beim steilen Weg in / nach Salgesch’ (1783) und Salgescher Wasserfuhr ‘die Wasserleitung von Salgesch’ (1927), wobei hier die Gemeinde, wie ihre Bewohner gemeint sein können (Sonderegger 1958, 526 ff., ursprünglicher Genitiv Plural auf -er als indeklinables attributives Adjektiv).
Alle aufgeführten Belege beziehen sich auf Salgesch. Eine genaue Deutung ist nicht möglich.
Sali (PN)
Sali (PN) ist vermutlich ein Kurzname im Beleg Salis Brÿggelti ‘die kleine Brücke des Sali’ (1712, Münster; 1712 Oberwald). Id. (7, 693) stellt den Kurznamen zu Salomon. Nicht ganz auszuschliessen ist, dass ein Flurname Sali (cf. HL Sali) vorliegt, doch ist das eher unwahrscheinlich. Die beiden historischen Belege befinden sich an zwei verschiedenen Orten, beziehen sich aber wohl auf das gleiche Brücklein. Denn im gleichen Pergament von 1712 ist Salis Brigeltÿ (Obergesteln, Oberwald) ein zweites Mal belegt, hier dem Flurnamen Züreten Studen zugeordnet. In Münster findet sich zum Graúwen Stein ‘zum grauen Stein’ nicht, das im gleichen Text erwähnt wird, während Oberwald Graustei (FLNK) aufweist. Zu vermuten ist daher, dass der Beleg Oberwald betrifft, während Münster nur als Hauptort des Obergoms involviert ist.
Sali
Sali n., auch Saala f. gehört zu schwdt. Salen I, Săla f., Pl. unverändert, Dim. (o. Dim-Bed.) Sāli n. ‘Salweide, Salix caprea’, ahd. salaha, mhd. salhe (Id. 7, 692; Marzell 4, 20 ff.; Lauber / Wagner / Gygax52014, 418 s. v. Salix caprea) oder eine andere Weide-Art. Der Stammvokal ist im Allgemeinen lang, im Unterschied zum HL Sall. In einigen Fällen ist jedoch nicht zu entscheiden, welches HL vorliegt.
Die Simplex-Form im Singular Sali ist als ts Sali (Grengiols, Oberwald), historisch als das Sali (1677, Ried-Mörel) und – unsicher – zum Sali (1707, Saas-Grund) belegt. Historisches beÿm Salin ‘beim Gebiet mit Salweiden’ (1766, Ulrichen) ist ein hyperkorrekt verhochdeutschter Beleg. Die Form Sale erscheint als im Sale (1388, Täsch), jn dem Sale (1305, St. Niklaus), zem Sale (1303 u. später, Stalden) – in allen Fällen ist unklar, ob das HL Sali oder Sall ist. Feminines t Saala (Greich) und t Sala (Ernen) meint wohl ein Gebiet mit Salweiden. Saal (FLNK, Törbel) gehört wohl zum HL Sall – es handelt sich um ein kleines Gebiet mit einem Gebäude. Hierzu ist wohl auch ts Säli (Törbel) zu stellen (cf. HL Sall). Vermutlich zu einem rom. Etymon zu stellen ist Salé (Zwischbergen, mit Zweitbetonung) auf ca. 2050 m nahe der Grenze zu Italien; bisher gibt es dafür jedoch keine Deutung. Historisches jn der Salen ‘bei der Salweide’ (1704 u. später, Guttet) gehört wohl hieher; unklar bleibt den Salens (1650, Visperterminen), wo von einer Wasserleitung die Rede ist.
Attributive Adjektive zum HL sind: ts Ober und ts Under Salä ‘der obere und der untere Teil von Salä (Gebiet mit Salweiden)’ (beide Ferden) und am Vssern Sale ‘am äusseren Gebiet mit Salweiden’ (1309, Saas-Balen). Komplexer ist der Ober Saliwald ‘der obere Teil des Waldes oberhalb des Sali (Gebiet mit Salweiden)’ (Grengiols).
Als Bestimmungswort tritt das HL in zweigliedrigen Komposita mit folgenden Grundwörtern auf: Bodu, Blatta, Brunnu, Grabu, Höu, Stei, Trog, Twära, Wald, Wang, Wasser und Weid. Letzteres kommt vor als Salweide (LT, Oberems; SK, Salweid), in den Saalweiden (1869, Turtmann) und t Obru und Undru Salweide (beide Oberems). Es handelt sich um den gleichen Ort, der sich im Turtmanntal befindet. Dialektal meint Weid ‘die Weide für das Vieh’, während die Pflanze Wiida oder Wiidu ‘Weide (Baum)’ heisst. Salweide wären dann die Weiden (für das Vieh), auf denen Salweiden (hier wohl: Sträucher) wachsen.
Komplexere Belege sind: der Salabodegrabo ‘der Graben beim Salaboden (Boden mit Salweiden)’ (Visperterminen) und der Salabodenzan ‘der Zaun beim Salaboden (Boden mit Salweiden)’ (1881, Visperterminen).
Sälig
Sälig, bzw. Selig ‘selig’ ist nur zweimal belegt als t Säligematte ‘die Wiese des Selig (PN)’ und t Seliggkeite ‘die Seligkeiten’ (Saas-Almagell). Im ersten Beleg liegt zunächst ein Adjektiv vor, das zu schwdt. sälig ‘vom Glück begünstigt, gesegnet, glücklich (und weitere Bedeutungen)’ und wdt. sälig, seelig ‘selig, glücklich, verstorben’ (Id. 7, 695 ff.) und der Ableitung auf -heit, -keit zu schwdt. Säligkeit ‘Herzensgüte und weitere Bedeutungen’, wdt. Säligkeit, Seeligkeit ‘Seligkeit’ (Id. 7, 698 f.; Grichting 1998, 167) zu stellen.
Bei näherem Zusehen kann aber die Zuordnung nicht stimmen. Der Beleg aus Betten ist 1662 als jn der Säligen Matten, 1725 in der Seligú Matten, 1769 in der Seeligi Matten, 1835 im Ort Senligen Matten, 1849 in der Seeligen Matten belegt. Statt des Adjektivs ist hier wohl ein PN oder FaN vorhanden: ‘die Wiese des Selig (PN)’ (Förstemann 1, 1290 zu Salga, das er zu salig beatus stellt) (cf. hierzu auch TGNB 2, 2, 541 s. v. Selig, das sich auf den Besitzer eines Grundstücks beziehe; cf. HL Selig (FaN)).
Der Beleg aus Saas-Almagell ist eine der seltenen Ableitungen auf -heit / -keit, die sonst meist Abstrakta darstellen (Fleischer / Barz 2012, 209 ff.). Gwp. meint, der Name beziehe sich darauf, dass selig (= tot) sei, wer in diese steilen Felsen hineingehe; t Seliggkeite wären dann Orte. wo jemand zu Tode kommen könne. Diese Deutung ist sonst unbekannt.
Sall
Sall m. ‘Saal’ ist zu schwdt. Sal ‘Saal’, Wallis auch Sall ‘Saal’, ‘Vorratsraum’ und wdt. Sall, Saal (Lötschental) ‘Saal, Vorratskammer’ (Id. 7, 687 ff.; Grichting 1998, 167) zu stellen. V. Schmid (2003, 165) legt die gleichen Deutungen nahe. In den Flurnamen kommt neben dem maskulinen Genus der Sall (Simplon) auch das Neutrum ts Sall (Ried-Mörel) und das Femininum t Sal (Reckingen) vor. Wo keine Gebäude vorhanden sind, ist an ein saalartiges Gelände (entweder relativ eben oder dann höher gelegen, wie eine Vorratskammer) zu denken.
Wie TGNB (2, 2, 477 s. v. Saal) ausführt, sind auch schwzdt. Sale ‘Salweide’ und Sali ‘PN, Kurzform zu Samuel’, aber auch ‘Weidengehölz’ möglich. Im Oberwallis hat jedoch Sall kurzen Hauptvokal, Sal(weide) dagegen langen; bei Schreibformen lässt sich das aber nicht immer entscheiden.
Das Simplex im Singular erscheint meist als der Sall (Eisten, Simplon, Unterbäch), t Sall (Mund, Reckingen (FLNK Sal)), ts Sall (Ried-Mörel), im Sall (Bürchen), historisch im Saall (1655, Turtmann, 1706 im Saal; 1727 im Sall), Sal (1779, Naters), zem Sale (1303, Zeneggen; 1677 jm Saall). Ein Beleg von 1650 für Naters hat jm Tsall, wo der Artikel agglutiniert ist. Unsicher ist Saal ‘der Saal’ (FLNK, Törbel) mit einem Gebäude; Salweiden sind wohl nicht gemeint; das Gleiche gilt für ts Säli ‘das kleine, saalartige Gelände’ (Törbel). Simplizia im Plural fehlen.
Das Diminutiv ist ebenfalls nur im Singular belegt: ts Säli ‘der kleine Saal’ (Törbel), ts Sälli ‘der kleine Saal’ (St. Niklaus, doppelt), ts Sälti ‘der kleine Saal’ (Ried-Brig), beim Sälty ‘beim kleinen Saal’ (1731, Visperterminen), zum Selti ‘beim kleinen Sall’ (Visperterminen).
Mit attributiven Adjektiven erscheint das HL in zweigliedrigen Konstruktionen wie folgt: ts Hinner Sall ‘der hintere Teil des Sall’ (Ried-Mörel, FLNK Hinnersal), im Indren Saall ‘im inneren Sall (saalartiges Gelände?)’ (1720, Greich), jn dem Nidern Sale ‘im niederen (unteren) Teil des Saal (saalartiges Gelände)’ (1304, Zeneggen), ts Ober Sall ‘der obere Teil des Sall (saalartiges Gelände)’ (Zeneggen), der Ober Sall ‘der obere Teil des Saal (saalartiges Gelände)’ (Unterbäch), ts Teiff Sal ‘der tiefe Saal’ (Ergisch), ts Teiff Sall ‘der tiefe Saal (saalartiges Gelände)’ (Eischoll), ts Teif Sal ‘der tiefe Saal (saalartiges Gelände’ (Turtmann), t Unner Sal ‘der untere Teil des Saal (saalartiges Gelände)’ (Zeneggen), der Unner Sal ‘der untere Teil des Saals (saalartiges Gelände)’ (Unterbäch), im Aússren Sall im äusseren Teil des Saal (saalartiges Gelände)’ (1753, Ried-Mörel), jm Vsren Saall ‘im äusseren (talauswärts liegenden) Teil des Saal (saalartiges Gelände)’ (1619 u. später, St. Niklaus).
Nur ein Beleg enthält wohl einen vorangestellten Genitiv Plural: jn Steineren Sall ‘im Saal (saalartiges Gelände) der Familie Steiner’ (Ried-Mörel).
Als Grundwort kommt das HL nur einmal in einem zweigliedrigen Kompositum vor: Hosal ‘das hohe Sall (saalartiges Gelände)’ (FLNK, Stalden). Die übrigen Belege sind komplexer: der Chlei und der Gross Salltschuggo ‘der kleine und der grosse Fels beim Saal (Fels beim saalartigen Gelände)’ (Eisten).
Das HL Sall erscheint als Bestimmungswort in zweigliedrigen Komposita mit folgenden Grundwörtern: Acher, Bodu, Brigga, Chnubel, Egg(a), Flüö, Grabu, Höu, Kapälla, Matta, Stapfa, Wäg, Wald und Wase. Unsicher ist das historisch 1628 in Ausserberg belegte zum Salmunter.
Komplexer sind an den Gemeinen Salwald ‘der Wald beim Saal (saalartiges Gelände), der der Gemeinde gehört’ (1850, Mund; der Beleg könnte auch zu Sal(weide) gestellt werden, doch bilden Weiden kaum Wälder), t Sallbachtola ‘die Wasserrinne im Gebiet Sall’ (Eisten), t Sallflüotschugge ‘die Felsen bei der Sallflüe (Fluh beim saalartigen Gelände)’ (Eisten), ts Teifsalbord ‘das Bord (Abhang, Böschung) unterhalb des tiefen Sall’ (Turtmann), Teiffsaalbort ‘das Bord (Abhang, Böschung) beim tiefen Sall’ (1881, Eischoll).
Sallient
Sallient ist in Agarn 1312 als doul sallient, 1338 lo sallent, 1345 ol sallent, 1367 dou sallyent usw. belegt. In Leuk ist 1453 via dov Sallient belegt; es handelt sich um den auch in Agarn erwähnten Weg nach Sallient. In Ergisch ist 1328 lo chablo dol sallent erwähnt.
G. Pannatier (p.c.) führt die Form auf afr. saillant zu lat. salire ‘springen’ (FEW 9, 95) zurück. Es handelt sich um ein Nomen, wohl mit der Bedeutung ‘Höhenlage’. Das Nomen ist auf der linken (Ergisch), wie der rechten Talseite (Agarn, Leuk) zu finden.
Salmina
Salmina ‘Salbei’ ist als Simplex in Ried-Brig belegt, dort auch das Kompositum Salminuchnubel ‘der Hügel bei der Salmina’. Daneben kommt es vor als die Sallminen Eggen ‘die Ecke mit Salbei’ (1708, Mörel). Es ist zu Salbei (Id. 7, 818; Wagner / Lauber / Gygax52014, 856 ff. s. v. Salvia mit mehreren Unterarten) zu stellen; es enthält ein nasaliertes /m/ an Stelle des /b/ im dort auch für das Oberwallis belegten Salbina.
Salmins (PN)
Salmins (PN) ist der Genitiv von Salmin im Beleg Salmýns Gaden ‘der Gaden des Salmin’ (1388, Täsch). Es handelt sich um einen PN, vermutlich zu Salome oder Salomon (beide Id. 7, 693). In den historischen Belegen kommt nur der weibliche Name Salomea (z.B. 1304, Zwischbergen) vor.
Salmu
Salmu ist nur in ts Salmufee ‘das / zum Salmenfee’ (Ausserberg) belegt. 1645 erscheint die Flur als zum Salmenfhee. Die Hauptbetonung liegt auf der ersten Silbe, die dritte Silbe ist nebenbetont. Laut Beschreibung handelt es sich um Scheunen, Äcker, Wiesen und Weiden auf 1197 m. Es ist unklar, ob ein Kompositum mit dem Grundwort Fee (Vieh) vorliegt, das sonst in Flurnamen nicht erscheint, oder ob der Name anders zu deuten ist. Der Fischname Salm ‘Lachs’ (Id. 7, 866) kommt nicht in Frage, da es den Fisch im Oberwallis nicht gab. Eine Deutung ist deswegen nicht möglich.
Salt-
Salt- ‘Weibel’ ist wohl in Belegen aus Steg, Lalden, Steg und Täsch enthalten, cf. HL Säältina.
Saluayos
Saluayos ist nur 1328 in Ergisch als in pratis saluayos ‘in den Saluayos-Wiesen’ belegt. Das HL scheint am ehesten eine Adjektivbildung zu sein. Zu einem Adjektiv saluayo oder ähnlich ist jedoch kein Beleg zu finden. Eine Deutung ist deswegen nicht möglich.
Salyr
Salyr ist nur 1602 in Albinen als ou bou du Salyr ‘beim Stall von Salyr’ belegt. Laut Bossard/Chavan (2006, 219) handelt es sich beim sehr ähnlichen Saleire um einen Bachnamen, der sich auf *sal ‘Wasserlauf’ (mit ligurischer Herkunft?) zurückführen lasse. Die Etymologie ist im Buch nicht näher spezifiziert. Jaccard (1906, 411) kennt Salaire, Sallaire und weitere, die er als Gipfel und Mulde in Étivaz und Mulde in Champéry beschreibt. Er führt sie auf lat. solarium zurück, das bei FEW (12, 36 ff.) als terrasse, altan übersetzt wird, das aber nirgends mit /a/ wie in Salyr wiedergegeben wird. Die Deutungen wie fénil ‘Heuboden’ wären zwar nahe zu bou ‘Stall’, können aber wegen des Vokalismus nicht beigezogen werden. Letztlich bleibt Salyr deswegen ungedeutet.
Salz
Salz n. ist zu schwdt. Salz n. wie nhd. ‘Salz’, amhd. salz (Id. 7, 879 ff.) und wdt. Saalz (Grichting 1998, 166) zu stellen. Salz kommt nur als Bestimmungswort in meist zweigliedrigen Komposita vor. Salz wird dem Vieh als Teil der Fütterung verabreicht. Die Orte, wo das geschieht, heissen meist wdt. Salzgäbi f. ‘Stelle, wo man dem weidenden Vieh Salz zu lecken gibt’ (Id. 7, 889; RN 2, 478), auch Salzgäb n. und Salzgäba f. (cf. HL Gäb). Es gibt aber auch salzige Stellen, an denen das Vieh Salz schlecken kann, vermutlich der Säälzibodo ‘der salzige Boden’ (Zeneggen), mit einem umgelauteten Adjektiv auf -ig: säälzig ‘salzhaltig’. Daneben finden sich Komposita wie t Salzreschti ‘der Rastplatz mit Salz (wohl ein Platz, wo man dem Vieh Salz zu lecken gab)’ (Ried-Mörel), der Salzbiel ‘der Hügel mit Salz’ (1772, Fieschertal), t Salzgräbe ‘die Gräben mit Salz’ (Grächen, St. Niklaus), t Salztole ‘die Mulden mit Salz’ (Visperterminen), Saltzlütten ‘das sandige Gebiet (Litta) mit Salz’ (1510, Visperterminen), t Salzbedu ‘die Böden mit Salz’ (Agarn, Oberems), der Salzbodu ‘der Boden mit Salz’ (Bratsch), t Salzbädu ‘die Böden mit Salz’ (Leuk), der Salzacher (auch: Sulzacher) ‘der Acker mit Salz’ (Eggerberg). im Salzhof ‘im Hof, wo das Salz gelagert wurde’ (Brig) bezeichnete früher ein Gebäude, das zeitweise als Salzlager diente. Heute ist das Gebäude zerstört; dort befindet sich jetzt der Vorplatz der Pfarrkirche von Brig.
Komplexere Konstruktionen mit Salzgäbi und Varianten sind unter dem HL Gäb erwähnt; dort findet sich auch Sauzgäbu ‘Salzgäbel’ (Blitzingen) gedeutet. der Saalzibielbrunno ‘die Quelle / der Brunnen beim salzigen Hügel’ (Birgisch) enthält ein unumgelautetes Adjektiv saalzig ‘salzig’. Salzgäberwald ‘der Wald bei der Salzgäba’ (Eggerberg) könnte auch den FaN Salzgeber (AWWB 221) enthalten.
Samet
Samet ist nur in jm Sametacker ‘(unklar) der Samt-Acker’ (1652, Ried-Brig) belegt. Id. (7, 940) s. v. Samet ‘Samt’ und wdt. Sammatt, Sammätt (Goms), Samad (Vispertal) ‘Samt’ (Grichting 1998, 167) weisen beide auf Samt hin; in der Anmerkung des Id. (7, 941) werden mehrere Pflanzennamen mit Samt erwähnt, allerdings ohne Details. Es muss sich um eine Ackerpflanze oder -blume handeln, die hier wächst. Am nächsten ist das Sammetblüemli ‘Samtblümchen’ (Viola tricolor; Marzell 4, 1197 f.; Id. 5, 87; Lauber / Wagner / Gygax52014, 408), doch ist diese Zuordnung nicht sicher.
Samp
Samp kommt nur im Beleg terram que vocatur Samptag (1398, Glis) vor. Samstag gilt als naheliegende Ergänzung. TGNB (2, 2, 481) kennt einen Flurnamen Langsamstig, weiss ihn aber nicht sicher zu deuten. Uns scheint eine Deutung ausgehend von Sand mit Assimilation an das Grundwort Tag sinnvoll zu sein (cf. HL Tag). Gemeint wäre dann ein Grundstück im Gebiet Sand, der in einem Tag bearbeitet werden kann. Das HL Sand kommt in Glis mehrfach vor (cf. HL Sand).
Sämsu
Sämsu f. ist als Simplex belegt in t Sämsu (Guttet) und historisch als Semsen (1810, Feschel). In Guttet sind weiter bezeugt: Semsentrogli (1713), Semswald (1670), t Sämsuweid ‘die Weide oberhalb Sämsu’. Der älteste Beleg von 1428 hat für Guttet sensen, spätere haben semsun und semsen. SK notiert Gemsen, während LT und FLNK Sämsu haben. Vermutlich liegt eine romanische Form vor. FEW (22, 1, 246) erwähnt ein hochsavoyisches sensa ‘Scheide der Kuh’, das allerdings nicht erklärt werden kann. Die Sämsu (Guttet) ist ein langgezogenes, ansteigendes und gerodetes Stück Land, das in seiner Form an eine Kuh-Scheide denken lässt. Ob diese Deutung stimmt, bleibt mangels weiterer Quellen unklar.
Sand
Sand n. ‘das Sandgebiet’ ist zu schwdt. Sand n., auch m., Pl. Sänder, Sender wie nhd. ‘Sand’, ‘Stück sandigen Erdbodens, Sandbank’, amhd. sant m. (mhd. auch n.) (Id. 7, 1110 ff.) zu stellen. Grichting (1998, 167) kennt nur das maskuline Sand ‘Sand’. Neutrales Sand betrifft entweder sandige Ablagerungen von Flüssen und Bächen oder Moränen. Seltener sind Orte gemeint, wo Sand abgebaut wurde (z.B. für den Häuserbau) oder generell sandige Böden. Ganz selten sind Pflanzennamen für den Huflattich (Tussilago farfara; Sandbletter, Sandblacke; vgl. Lauber / Wagner / Gygax52014, 1114) oder für das Weisslaub (Salix helvetica; vgl. Lauber / Wagner / Gygax52014, 422).
Von den rund 270 Flurnamen mit diesem HL betreffen rund 50 das Simplex im Singular ts Sand ‘das Sandgebiet an der Vispe’ (St. Niklaus) und ähnlich; häufig sind Präpositionen wie im Sand ‘im Sandgebiet der Gamsa (Bach im Nanztal)’ (Visperterminen), ufum Sand ‘auf dem Sandgebiet (Schwemmgebiet des Walibaches’ (Simplon) oder zum Sand ‘beim Sandgebiet’ (Unterems) belegt. Einige dieser Namen sind nur historisch bezeugt oder das Gebiet ist inzwischen überbaut worden, etwa in Visp Sand ‘das Sandgebiet (der Vispe)’ (FLNK, Visp).
Das Simplex des Plurals ist viel seltener, meist mit Umlaut, als t Sändär ‘die Sandgebiete der Lonza (Talbach aus dem Lötschental)’ (Steg), t Senner ‘die Sandgebiete (der Saaser Vispe)’ (Saas-Almagell, mit dem Prozess inlautend nd > nn), ufe Sendru ‘auf den Sandgebieten’ (Saas-Grund; SK Sänder, FLNK Sendru), jn dien Sendern ‘in den Sandgebieten’ (1303 u. später, Visp).
Der Diminutiv des Simplex erscheint im Singular als im Sandji ‘im kleinen Sandgebiet (der Gamsa, Bach im Nanztal)’ (Visperterminen), ts Sangi ‘das kleine Sandgebiet’ (Lax; FLNK Sangji; ähnlich Mühlebach) und ts Sendji ‘das kleine Sandgebiet (des Hofergraben)’ (Stalden, heute Sportplatz); im Plural als t Senn(d)jini ‘die kleinen Sandgebiete’ (Randa) und t Sennjini ‘die kleinen Sandgebiete’ (Saas-Almagell; 1832 als Sändgÿ; ähnlich Randa).
Mit attributiven Adjektiven verbunden ist das HL vor allem im Typ Heesand ‘das hohe Sandgebiet’ (FLNK, Täsch), ts Hesand ‘das hohe Sandgebiet’ (Zermatt), der Hosand ‘der hohe Sand’ (Binn; Genus maskulin ist ungewöhnlich), ts Hosand ‘das hohe Sandgebiet’ (Niedergesteln), Hosand ‘das hohe Sandgebiet (Alpe)’ (LT, FLNK Ulrichen), wozu sich etwa in Binn eine ganze Reihe von Gipfel- und Jochnamen gesellen wie Hohsandhore, Hohsandgletscher, Hohsandjoch und Ober Hohsandjoch, in Ulrichen ein ganzes Namennest mit Hosandbärge (FLNK), t Hosandstüde ‘die Stauden im hohen Sandgebiet’, ts Minschtiger Hosand ‘der zu Münster gehörende Teil der Alpe hohes Sandgebiet’, Reckiger Hohsand ‘der zu Reckingen gehörende Teil der Alpe hohes Sandgebiet’ (FLNK), der Minschtiger Hosandstafel ‘der Stafel der Leute von Münster auf der Alpe Hosand (hohes Sandgebiet), der Reckiger Hosandstafel ‘der Stafel der Leute von Reckingen auf der Alpe Hosand (hohes Sandgebiet)’, t Reckiger Hosandbärge ‘die zu Reckingen gehörenden Berge bei der Alpe Hosand’, t Fodre Hosandwäng ‘der vordere Teil der Grasabhänge beim Hosand (hohes Sandgebiet)’, der Foder Hosandbärg ‘der vordere Teil des Berdes beim Hosand (hohes Sandgebiet)’, Vorder Hosandlöuwi ‘das vordere Rutschgebiet oberhalb des Hosand (hohes Sandgebiet)’ (FLNK), t Hinnre Hosandweng ‘der hintere Teil der Grasabhänge beim Hosand (hohes Sandgebiet)’, der Hinner Hosandbärg ‘der hintere Teil des Berges beim Hosand (hohes Sandgebiet)’, Hinner Hosandlöuwi ‘das hintere Rutschgebiet oberhalb des Hosand (hohes Sandgebiet)’. Das Namennest in Ulrichen zeigt sehr schön, wie – ausgehend vom Namen einer Alpe – die ganze Umgebung benannt wird.
Die übrigen attributiven Adjektive sind seltener: ts Inner und ts Üsser Sand ‘das innere (taleinwärts liegende) und das äussere (talauswärts liegende) Sandgebiet’ (Täsch), aúff dem Langen Sandt ‘auf dem langen Sandgebiet’ (1708, Brigerbad), ts Mittelsand ‘das mitten (im Rotten) gelegene Sandgebiet’ (Mörel und drei weitere), aúf dem Neúen Sant ‘auf dem neuen Sandgebiet’ (1836, Saas-Grund), ts Ober und ts Unner Sand ‘das obere und das untere Sandgebiet (der Vispe)’ (Visp), ts Pmei Sand ‘das Sandgebiet, das der Gemeinde gehört’ (Stalden; FLNK Gmeisand), ts Wiiss Sand ‘das weisse Sandgebiet’ (Naters; Oberems (hier mit Hinweis auf Weisslaub (Salix helvetica)) und ts Wiit Sand ‘das weite Sandgebiet’ (Glis, Saas-Almagell).
Vorangestellte Genitive zum HL sind: ts Bifigersch Sand ‘das Sandgebiet, das der Familie Bifiger gehört’ (Baltschieder), ts Chempfusand ‘das Sandgebiet der Familie Kämpfen’ (Glis), ts Griinisch Sand ‘das Sandgebiet mit kaltem Wind (unklar)’ (Saas-Balen), ts Hälisch Sand ‘das Sandgebiet des Häli (hier wohl zu Wilhelm)’ (St. Niklaus), uf ts Heeresand ‘auf dem Sandgebiet des (Pfarr-)Herrn’ (Niederwald), ts Irmänzusand ‘das Sandgebiet bei Irmänze (wohl PN)’ (St. Niklaus), Kammers Sand ‘das Sandgebiet der Familie Kammer’ (1860, Eyholz), ts Mattjusch Sand ‘das Sandgebiet des Matthäus / Matthias’ (Baltschieder), ts Steinersand ‘das Sandgebiet der Leute von Gstei (Gestein)’ (Zwischbergen), Triegerro Sand ‘das Sandgebiet der Familie Zen Triegen’ (1692, Niedergesteln), vff Wÿestinerro Sandt ‘auf dem Sandgebiet der Familie Wiestiner’ (1597, Visp). Unsicher ist ts Seilersand ‘das Sandgebiet der Familie Seiler’, wo der FaN Seiler ist und ein formaler Genitiv Seilersch lauten müsste, und der Beleg aúf Belzers Glareto seu Sand (1751, Raron), wo unklar ist, ob Sand einfach die Übersetzung des latinisierten Glaretum ‘Kiessand’ ist, oder ob es Belzers Sand ‘das Sandgebiet der Familie Belzer’ als Flurname gab.
Als Grundwort kommt das HL in zweigliedrigen Komposita vor. Häufig sind dabei Fluss- und Bachnamen als Bestimmungswörter: ts Bietschisand ‘das Sandgebiet beim Bietschbach’ (Raron), Bietschisänder ‘die Sandgebiet beim Bietschbach’ (Niedergesteln), Blinnesand ‘das Sandgebiet bei der Einmündung der Blinne in den Rotten’ (FLNK, Reckingen), Gambsensandt ‘das Sandgebiet der Gamsa’ (1673, Brigerbad), ts Gamsusand ‘das Sandgebiet der Gamsa’ (Glis, mehrfach), ts Giessersand ‘das Sandgebiet beim Weiler Giesse’ (Binn; Giesse ist Wassername), ts Ielisand ‘das Sandgebiet beim Jolibach’ (Niedergesteln, FLNK Jolisand), das Lodentzen Sand ‘das Sandgebiet bei der Lonza (Talbach aus dem Lötschental)’ (1522, Steg), ts Melisand ‘das Sandgebiet beim Mellichbach’ (Täsch), ts Rhonesand ‘das Sandgebiet des Rotten (früherer Verlauf des Rottens links vom heutigen Bahnhofsgelände)’ (Brig; ältere Leute sagen Rottesand), ts (e)Rottusand ‘das Sandgebiet beim Rotten’ (Naters), ts Rottusand ‘das Sandgebiet beim Rotten’ (Mörel, Leuk) und aúf dem Salti Sand ‘auf dem Sandgebiet der Saltina’ (1795 (ca.), Brig). Nahegelegene Flurnamen sind ebenfalls vertreten: ts Bildernusand ‘das Sandgebiet gegenüber dem Bereich Bilderne (Zahnfleisch)’ (Mörel), ts Blattusand ‘das Sandgebiet beim Gebiet Blatten (Felsplatten)’ (Saas-Almagell), ts Bordsand ‘das Sandgebiet beim Bord (Abhang, Böschung)’ (Saas-Almagell), ts Chummusand ‘das Sandgebiet bei Ze Chummu (bei der Mulde)’ (Raron), under dem Driest Sand ‘unter dem Sandgebiet beim Driest (unfruchtbares Gebiet)’ (1676, Zeneggen) und viele weitere. Besitzer- oder Nutzernamen sind selten, am ehesten mit vorangestellten Genitiven. Am klarsten ist ts Hügsand ‘das Sandgebiet der Familie Hug’ (Glis), unsicher dagegen auff dem Bernersandt ‘das Sandgebiet des Bernhard (kaum FaN Berner)’ (1716, Visp), wo unklar bleibt, welche Motivation Berner hat. ts Guldersand ‘das Sandgebiet des Rottens bei der Guldernä’ (Grengiols) bezieht sich wohl auf den Flurnamen Guldernä ‘der Ort mit Türkenbund (Lilium martagon, vgl. Wagner / Lauber / Gygax52014, 1260)’ und nicht auf einen Besitzer oder Nutzer. Einen Problemfall stell ts Risand (Termen) dar; es ist vermutlich zum Verb rîsen ‘fallen’ (Id. 4, 1335 ff.) zu stellen und ist entweder das Partizip ‘das Fallende’ oder – mit Sand verbunden – ‘das gefallene Sandgebiet’ (cf. HL Ri). Vermutlich auf die Farbe bezieht sich Silbersand ‘das silberne Sandgebiet’ (Ried-Mörel), laut Beschreibung eine Moräne mit feinem, hellem Sand.
Komplexere Konstruktionen sind etwa ts Ober und ts Unner Bietschisand ‘das obere und das untere Sandgebiet beim Bietschbach’ (Raron), das historische bim Kräytz vffum Sandt ‘beim Kreuz auf dem Sandgebiet’ (1655, Niedergesteln), Hinner und Vor dum Sandbank (FLNK) ‘das Gebiet hinter und vor der Bank aus (Fluss-)Sand’ (Täsch) und andere mehr.
Als Bestimmungswort in zweigliedrigen Komposita ist das HL mit folgenden Grundwörtern belegt: Acher, Bank, Bodu, Egg(a), Eie, Gassa, Gilla, Grabu, Grüeba, Höupt, Hubel, Leeschi, Matta, Pletscha, Räb-, Riife, Stuba, Tola und Wasser.
Komplexer sind t Undru Sandmatte ‘die unteren Wiesen im Sandgebiet’ (Glis), der Sandblackuschleif ‘der (Holz-)Schleif, wo Sandblacken (Huflattich, Tussilago farfara) wachsen’ (Gampel), t Sandbletterlamme ‘der Graben mit / bei den Sandblättern (laut Gwp. Sandblachte (Huflattich; Tussilago farfara)’ (Münster), im Sandgillibiel ‘der Hügel im Bereich des Tümpels im Gebiet Sand’ (1743, Raron) und andere mehr.
Das Adjektiv sandig erscheint in der Sandig Bodu ‘der sandige Boden’ (Zermatt), Sandigbodu ‘der sandige Boden’ (FLNK, Saas-Grund), t Sandigen Grappä ‘die sandigen Murmeltiergrabstellen’ (Blatten), t Sandigu Tole ‘die Mulden mit Sand’ (Glis). Ebenfalls hieher zu stellen ist ts Santigufer ‘das sandige Steingeröll’ (Eyholz; FLNK Visp), das wohl in Anlehnung an Sant ‘Heilig’ ein /t/ erhalten hat.
Die Ableitung der Sander kann eine Stellenbezeichnung auf -er (Sonderegger 1958, 541 ff.) zum HL Sand sein, also ‘das Sandgebiet, das Gebiet mit Sand’, aber auch einen PN Sander (cf. HL Sander (PN)) vertreten; die Belege sind dort aufgeführt. Diminutive dazu sind: auffm Sanderli ‘auf dem kleinen Gebiet mit Sand’ (1651 u. später, Ried-Brig), im Sanderli ‘im Gebiet mit Sand’ (1809, Eischoll).
Die Ableitungen Sanderna und Sanderra weisen jeweils eine Kollektivableitung auf und meinen ein Gebiet mit Sand. Belegt sind: t Sanderna ‘das Gebiet mit Sand’ (Staldenried), Sandernen ‘das Gebiet mit Sand’ (1869, Stalden; Dativ ist konstruktionsbedingt), zer Sandernu ‘beim Gebiet mit Sand’ (Salgesch), z Sandernu ‘beim Gebiet mit Sand’ (Bratsch), zer Sanderrun ‘beim Gebiet mit Sand’ (Ergisch; FLNK Sanderu) und Ze Sanderu ‘beim Gebiet mit Sand’ (Visperterminen). Eine Ausnahme ist Ze Sandru ‘bei den Sandern (Sandfänge der Wasserleitung)’ (Saas-Fee), das sich zum Verb sanndre ‘Sand fangen’ stellen lässt; das Verb ist in Id. und Grichting (1998) so nicht belegt.
Sander (PN)
Sander (PN) ist ein unsicherer Personenname, der am klarsten im Genitiv Singular des Beleges an Sand ers Bl ‘am Hügel des Sander (PN)’ (1472, Ried-Brig) vertreten ist; aber auch hier kann Sander eine Stellenbezeichnung auf -er (Sonderegger 1958, 541 ff.) zum HL Sand sein, also ‘das Sandgebiet, das Gebiet mit Sand’.
Weitere Belege sind: der Sander ‘das Sandgebiet / das Stück Land des Sander (PN)’ (Ried-Brig), vffem Sander ‘auf dem Sandgebiet / auf dem Stück Land des Sander (PN)’ (1669, Visperterminen), auffm Sanderli ‘auf dem kleinen Sandgebiet / auf dem kleinen Stück Land des Sander (PN)’ (1651 u. später, Ried-Brig), im Sanderli ‘im kleinen Sandgebiet / im kleinen Stück Land des Sander (PN)’ (1809, Eischoll), der undere Sander ‘das untere Sandgebiet / das untere Stück Land des Sander (PN)’ (1795, Glis), der Sanderacker ‘der Acker in sandigem Gebiet / der Acker des Sander (PN)’ (1796, Ried-Brig), ts Sandereg ‘die Ecke des Sander (PN)’ (Reckingen), (wozu Gwp anmerkt, es sei dort kein sandiger Boden, eher komme ein FaN in Frage, doch könne es auch ts Ander Eg heissen), im Sandergarten ‘im Garten im Sand / des Sander (PN)’ (1752 u. später, Oberwald), der Sander Stück ‘das abgeteilte Stück Land im Sandgebiet / des Sander (PN)’ (1832, Geschinen).
Id. (7, 1115) kennt das Wort für einen Arbeiter, der im Winter mit dem ‘Sanden’ der Strassen beauftragt ist (regional allerdings vor allem Ostschweiz), Grichting (1998) kennt es jedoch nicht. C. Bürcher-Cathrein (1927) verwendet Sander jedoch für jemand, der die Wasserleitungen vom Sand reinigen muss. Als PN kann Sander eine Kurzform zu Alexander, resp. Xander sein (Id. 1, 173; 16, 2395 f.).
Sang
Sang ist das gemeinsame Hauptlemma für die HLL Gsang und Sang. Belegt ist mit einer Ausnahme das Kompositum Vogel(g)sang (mit und ohne g-Präfix) zu schwdt. Sang, G(e)sang n., m. ‘das Singen, Gesang’, Vogel(ge)sang ‘Vogelgesang’, mhd. vogel(ge)sanc ‘häufiger FlN für waldige, wasserreiche Orte, wo die Vögel sich gerne aufhalten’ (Id. 7, 1175; Id. 7, 1178f). Der isolierte Beleg ts Gsang (Binn) ist ein kollektiver (Brand-)Rodungsname zum schwdt. Sang ‘Sengen’ (Id. 7, 1187) (cf. HL Seng).
Sannu
Sannu ‘sammeln’ ist einmal belegt in Sannustadil ‘der Stadel, in dem der Zehnten gesammelt wurde’ (Eischoll). Der Beleg ze Sanndru ‘bei den Sandern’ ist wohl nicht zum gleichen HL zu stellen (siehe unten). Vermutlich ist sannu ‘sammeln’ zu schwdt. sam(e)nen, sampnen, sammnen, sannen, sanden, sandu, sannu (WLö) ‘sammeln’ zu stellen (Id. 7, 912 ff.; Rübel 1950, 110 kennt es für das Einsammeln des Viehs; ebenso Grichting 1998, 167 ‘Vieh zum Stall holen’). Ze Sanndru hingegen ist eher zu Sanderna ‘Sandfang’ zu stellen (Bellwald/Würth (2006) zitieren das Wort nach Eichenberger 1940, 79): an dieser Stelle wurden die Wasserleitungen mit Sand verstopft und mussten gereinigt werden (V. Schmid 2003, 166). Gwp. selbst spricht jedoch generell von der Fassung der Wasserleitung mit einem Holzbrett.
Sant
Sant ist als Sankt, Sant wie nhd. vor Heiligennamen, it. als San, zu lat. sanctus ‘heilig’ (Id. 7, 1215 f.) zu stellen. In Orts- und Flurnamen ist oft ein Patrozinium einer Kirche oder Kapelle gemeint, manchmal auch ein Bildstock oder ein Heiligenbild (für den Bezirk Goms dienen die drei Bände von W. Ruppen (1976; 1979; 1991) als Nachweis, sofern möglich. An anderen Orten bedeutet das HL ein Stück Land, dessen Ertrag für eine Kirche oder Kapelle bestimmt war. Gelegentlich stellt fromme Umdeutung einen Heiligennamen her, wo nur ein Vorname gemeint war.
Das Adjektiv erscheint zunächst als Attribut in der lateinischen Form Sanctus oder der deutschen Form Sant, so etwa als Abkürzung in cappella ‘S.S. Anna’ et Jacobj ‘die Kapelle der Heiligen Anna und Jakobus’ (1672, Zwischbergen), (lat. prata sancti Theoduli) ‘die Wiese des Heiligen Theodul (Landespatron)’ (1531, Münster), St. Anna ‘das Gebiet der heiligen Anna (heute Bildstock, früher Kapelle, vgl. W. Ruppen 1979, 146)’ (SK, Ausserbinn), St. Anna ‘die Kapelle der heiligen Anna; W. Ruppen 1979, 337 ff.)’ (Bellwald), St. Annakapälla ‘die Kapelle der heiligen Anna’ (FLNK, Raron; LT St. Anna), St. Anton ‘Sankt Anton (die dort bestehende Antonius-Kapelle wurde am 24. 2. 1970 durch eine Lawine zerstört; heute erinnert ein Bildstock daran; W. Ruppen 1976, 324 ff.)’ (SK, Reckingen), St. Barbara Felsen ‘der Felsen bei St. Barbara (Kapelle auf dem Weg nach Leukerbad und Weiler von Leuk)’ (1794, Leuk), St. Barbarae Strasse ‘die Strasse nach St. Barbara (Kapelle auf dem Weg nach Leukerbad und Weiler von Leuk)’ (1794, Leuk), Sankt German ‘Sankt German (Weiler von Raron)’ (SK, LT und FLNK, Raron), St. Georgy ‘(die Kapelle) des Heiligen Georg’ (1698, Zermatt), Sankt Jakob ‘Sankt Jakob (früher stand hier eine Kapelle, vgl. W. Ruppen 1979, 236)’ (FLNK, Blitzingen), St. Johanneslitzi ‘der Schattenhang des Heiligen Johannes’ (LT, Zermatt), St. Josefsheim ‘das St. Josefheim (heute Oberwalliser Alters-, Pflege- und Behindertenheim)’ (FLNK u. LT, Leuk), Sankt Martiniplatz ‘der Platz vor der Kirche St. Martin’ (FLNK, Visp). Die Kurzform Sant erscheint als Sannt Jodren Lüschenn ‘der sumpfige Boden mit Riedgras des Heiligen Joder (um 1446 ist eine Kapelle des Hl. Theodul erwähnt, laut Ph. Kalbermatter)’ (Geschinen), die Kapellen Sant Jodren ‘die Kapelle des Hl. Theodul (Landespatron)’ (1542, Törbel),





























