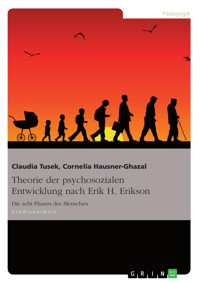Offenes Lernen - Innovationsstrategien zur Förderung selbständigen Lernens an Handelsakademien E-Book
Claudia Tusek
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Pädagogik - Sonstiges, Note: Sehr gut, Wirtschaftsuniversität Wien (Institut für Wirtschaftspädagogik), Veranstaltung: Vertiefungsgebiet der Wirtschaftspädagogik I, Sprache: Deutsch, Abstract: Wie viel „neuen“ Unterricht braucht unsere Schule? Im ersten Teil werden die historischen Wurzeln und die Formen von offenem Unterricht skizziert. Im zweiten Teil wird ein derzeit (Stand: 2009) aktuelles Modell, "COOL" näher beleuchtet. In Österreich gibt es derzeit 33 BHS und weitere 50 AHS und Hauptschulen, die COOL als Unterrichtsmethode praktizieren. Es sind ca. 1.000 Lehrkräfte und 20.000 SchülerInnen in die COOL-Praxis involviert. [Zahlen: DIE PRESSE, 27. Oktober 2008, S 8] Als LehrerIn hat man u. a. die Aufgabe gewählt, neuen Lehrstoff an die SchülerInnen verständlich zu vermitteln und den Unterricht interessant zu gestalten. Unterricht soll sowohl den Lernenden als auch den Lehrenden Freude und Spaß bereiten. Es gibt die Möglichkeit einen guten handlungsorientierten Unterricht in der Klasse auszuüben - ohne das Steuer aus der Hand zu geben und als pädagogisch ausgebildete Lehrkraft seine Ressourcen zu verschleudern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Page 1
Page 3
Vertiefungsgebiete der Wirtschaftspädagogik II WS 2008/09 Prof. Josef AFF LV 1983
*UXQG]JHGHV&RRSHUDWLYHQ2IIHQHQ/HUQHQV
$UEHLWVYHUWUDJ$VVLJQPHQW
'HU.ODVVHQUDW
)D]LW
*UDSKLNYHU]HLFKQLV
$UWLNHOÄ5RWHV/LFKWIU5DGDX9HUXUVDFKHU³
Cornelia HAUSNER-GHAZAL, Claudia TUSEK Seite 3 von 30
Page 4
Vertiefungsgebiete der Wirtschaftspädagogik II WS 2008/09 Prof. Josef AFF LV 1983
1. Die Begriffe „Kooperatives Lernen“ und „Offenes Lernen“
1.1. Die Merkmale des „Kooperatives Lernens“
8QWHU Ä.RRSHUDWLYHV /HUQHQ³ ZHUGHQ /HUQIRUPHQ YHUVWDQGHQ Äindenen in Gruppen unterschiedlicher Größe gelernt und an Aufgaben gearbeitet wird³>*5(,0(/)8+50$116HLWH ,@ 'DV NDQQ VRZRKO LQ =ZHLHUWHDPV DXFK 7DQGHP RGHU 3DUWQHUDUEHLW JHQDQQW DOV DXFK LQ JU|HUHQ *UXSSHQ HUIROJHQ 'DEHL VWHKW QLFKW QXU GLH )DFK :LVVHQVYHUPLWWOXQJ VRQGHUQ DXFK GHU (UZHUE YRQ NRPPXQLNDWLYHQ XQG VR]LDOHQ .RPSHWHQ]HQ LP 9RUGHUJUXQG 'LH *UXSSHQPLWJOLHGHU VLQG QLFKW QXU IU GHQ HLJHQHQ /HUQHUIROJ VRQGHUQ IU GHQ GHU JHVDPWHQ *UXSSH YHUDQWZRUWOLFK >YJO *5(,0(/ )8+50$11@'LH/HKUSHUVRQ]LHKWVLFKDOV%HREDFKWHU,QXQG%HUDWHU,Q]XUFNXQG JUHLIWQXUÄUHVSRQVLY³GKYRQGHU*UXSSHVHOEVWJHIRUGHUWHLQ>YJO*8'-216E]Z '8%6 @ .RRSHUDWLYHV /HUQHQ VHW]W HLQH DQJHQHKPH XQG DQJVWIUHLH /HUQDWPRVSKlUH YRUDXV ZHLWHUV JUXSSHQVWlUNHQGH 0DQDKPHQ XQG JHHLJQHWH VWUXNWXUHOOH%HGLQJXQJHQ]%5DXPYHUKlOWQLVVH>YJO:(,'1(5'8%6@
1.2. Die Merkmale des „Offenes Lernens“