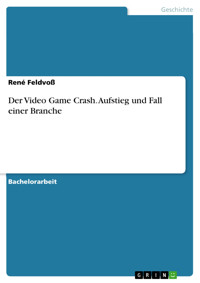Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Selbstverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Robert Lenz ist 24 Jahre alt und arbeitet als Angestellter in einem Großhandelsunternehmen für Motorenersatzteile mit angeschlossener Servicewerkstatt. Er hasst seinen Job, seine Kollegen und seine eigene Abhängigkeit hiervon so sehr, dass er sich in eine Fantasieidentität flüchtet. Office Boy, wie er sein Gedankenkonstrukt nennt, ist nicht nur der kompetenteste Drehstuhlakrobat, den eine Schreibstube je gesehen hat, sondern obendrein auch noch der Inbegriff all dessen was Robert selbst nicht ist. Er kämpft gegen alltägliche Ungerechtigkeiten und gegen das Fehlverhalten seiner Mitmenschen, um eine Welt zu schaffen, die vor allem von Eigenverantwortlichkeit geprägt ist. Eine Welt, in der Robert nur allzu gerne leben würde. Allerdings weiß Robert im Gegensatz zu seinem Alter Ego nicht, wie er sich eine solche Welt schaffen soll. Er irrt durch sein Leben und hat außer abstrusen Rockstarphantasien keinerlei Ziele. Robert leidet dermaßen unter seiner Arbeit in der Seelenmühle, dass er einen festen Termin im Therapiekalender von Frau Doktor Sperber-Nagel hat. Während es den meisten Männern in seinem Alter bereits nach wenigen Monaten gelingt sich von ihren Ex-Freundinnen zu lösen, dreht sich Roberts Gefühlswelt jedoch auch Jahre nach der Trennung noch um seine ehemaligen Geliebten. Aus diesem Grund fällt es ihm auch einigermaßen schwer eine Beziehung mit Eva einzugehen, obwohl sich die zwei ihrer Gefühle füreinander äußerst sicher sind.Office Boy beschreibt das Arbeits- und Privatleben des Protagonisten Robert Lenz auf tragisch-komische Weise. Handlungsorte sind neben der eigenen Wohnung und der Psychotherapiepraxis seiner Therapeutin vor allem dessen Arbeitsstelle. Zentrales Thema der Handlung ist das Spannungsfeld zwischen Realität und imaginierter Scheinwelt, in dem sich die Hauptfigur bewegt. Nach zahlreichen Irrungen und Wirrungen zwischen verzweifeltem Kopfschütteln und herzhaftem Lachen kann Robert sich am Ende nicht nur endlich wieder über leidenschaftliche Begegnungen außerhalb seiner Fantasie freuen, sondern auch darüber einen Entschluss gefasst zu haben, der seine Lebensziele ein wenig realistischer gestalten wird und ihn endlich aus seinem verhassten Job befreit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René Feldvoß
Office Boy
I M P R E S S U MOffice BoyRené Feldvoß© 2021 René Feldvoß.Alle Rechte vorbehalten.Autor: René FeldvoßHorner Landstr. 126, 22111 Hamburg
[email protected]: 978-3-98551-068-9
Take This Job AndShoveIt
Es begann wie an jedem verdammten Morgen in den letzten zweieinhalb Jahren.
„Morgen.“
„Morgen.“
„Morgen.“
„Guten Morgen.“
Robert hasste es. Nicht nur, weil es ihn wurmte tagtäglich einer Tätigkeit nachzugehen, die er verabscheute, sondern auch, weil er sich an diesem Ort so fehlbesetzt fühlte wie der Papst auf dem Christopher Street Day.
Er war 24 Jahre alt, knapp 1,80 groß und hielt sich selbst für überdurchschnittlich intelligent. Schließlich wird man nicht ohne Grund schon mit fünf Jahren eingeschult. Lesen und schreiben konnte er bereits vor seiner Schullaufbahn, worauf er sich einiges einbildete.
Eine dünne Drahtgestellbrille, die ihm ständig von der Nase rutschte, zierte das kantige Gesicht. Sein Haar war von einem recht dunklen braun, das manch Unwissender fälschlicherweise für schwarz hielt und stets akkurat nach rechts gescheitelt.
An guten Tagen, die äußerst spärlich gesät waren, hatte er einen naiv-hoffnungsvollen Gesichtsausdruck, ansonsten wirkte selbst der Versuch eines Lächelns wie die Musterstudie einer miesepetrigen Leidensfratze.
Leider hatte Robert schon seit einiger Zeit mit einem eklatanten Schuppenproblem zu kämpfen, was sich auch sehr deutlich auf seinem Hemd abzeichnete, das vorzugsweise hellblau oder, wie an diesem Montagmorgen, senfgelb war. Diese von Geschmack zeugende Oberbekleidung rundete er, modisch selbstbewusst, mit blauen Jeans und strahlend weißen Turnschuhen ab.
Normalerweise hätte man einen adretten jungen Mann wie ihn in den Großraumbüros einer renommierten Versicherungsfirma erwartet. Doch stattdessen fristete er sein Dasein in dieser schäbigen Treckerinstandsetzungsklitsche.
Und dann diese verfluchte aufgesetzte Freundlichkeit H.s! Musste er auch noch „guten“ Morgen sagen? Und dabei war es gerade einmal 7:04 Uhr. Viel zu früh, um überhaupt irgendetwas gut finden zu können, erst recht an einem so beschissenen Ort wie diesem und schon gar nicht wenn H. etwas sagte.
Eine durch und durch indiskutable Person dieser H., mit seinem ekelhaften Schnauzbart, diesem Relikt aus längst vergangenen Zeiten, von denen er offenbar keinen Abschied nehmen konnte oder wollte und der aussah wie eine jahrzehntelang abgenutzte Schuhputzbürste.
H., mit seinem verquollenen, fettigen Gesicht und den kleinen Schweinsaugen hinter der deplatziert wirkenden Brille. Dazu diese ewig dreckigen Hände, die andauernd mit irgendwelchen kleinen Wunden übersät waren.
Und dann noch T., den Robert eigentlich noch am ehesten von diesem inkompetenten Haufen mochte. Dennoch machten ihn seine abscheulich schmalen, hervorstehenden Lippen und die immerzu wie irre blinzelnden Glubschaugen zu einem durch und durch unsympathischen Zeitgenossen. Wäre er T. nur zufällig auf der Straße begegnet, während dieser wieder eines seiner Liedchen vor sich hin pfiff und mit einem unpassenden Text versah, käme ihm zu allererst der Gedanke bei T. handele es sich um einen einschlägigvorbestraften Sexualstraftäter. Mit seinem hutzelmännchenartigen Gebaren und der unangenehmen Fistelstimme komplettierte er diesen nicht gerade positiven Eindruck.
Die Blechhütte in der er jeden Tag neun Stunden seiner kostbaren Zeit absaß, war nichts weiter als eine ordinäre Werkstatt mit gerade einmal vier Mitarbeitern. Und eigentlich noch nicht einmal das. Vielmehr war sein Halbtagskerker nichts weiter als die Außenstelle eines regional semierfolgreichen Großhandelsunternehmens für Baumaschinen- und Traktorersatzteile mit angeschlossener Servicewerkstatt.
Doch diese Filiale war lediglich theoretisch eine Handelsniederlassung. In Wirklichkeit tobten sich hier nur die beiden Landmaschinenschlosser H. und T., sowie der nicht wesentlich höher qualifizierte Niederlassungsleiter K., nach Herzenslust in der Baggerhalle aus, während er ein einsames Dasein im so genannten „Büro“ fristete.
Dieses linoleumbeklebte Loch war lediglich durch ein lächerliches Holzgestell mit darin eingesetzten Fensterscheiben vom ständig lärmenden Wirkungsbereich seiner Kollegen abgetrennt. Nicht nur, dass er somit deren ewig monotones Treiben permanent vor Augen hatte, sein Blick wurde auch immer und immer wieder auf ein ganz besonderes Werkzeug gelenkt, das zentriert vor seinem Schreibtisch aufragte.
Vielleicht drei oder vier Meter Luftlinie trennten ihn von dem faszinierenden gelben Gerät, das ihn aber auch gleichzeitig an seine fatale Fehlentscheidung erinnerte, eine Stelle in dieser Seelenmühle angetreten zu haben. Dieser gelbe Kran war oft die einzige Aussicht, die er über Stunden hinweg hatte. Stand ein Bagger oder Radlader in der Halle, versperrte dieser den trostlosen Blick durch das große Rolltor am Ende der Werkstatt, wo Robert die Jahreszeiten an sich vorbeiziehen sah.
Im Laufe der Wochen, Monate und mittlerweile sogar Jahre, hatte Robert dieses ekelhafte Stück Metall genau beobachten können. Es wurde von einem Elektromotor angetrieben, der ein nervtötendes „ÄÄÄÄÄÄÄ“ von sich gab, wenn man den daran hängenden Haken mittels der seitlich am Arm baumelnden Steuereinrichtung auf oder ab bewegte. Um den Schlitten vor oder zurück zu bewegen, musste man ein kratzendes „SCHUUUSCH“ in Kauf nehmen.
Zwei Tonnen konnte das Ding heben, obwohl keiner der Motoren die dort drangehängt wurden jemals mehr als eine Tonne gewogen hätte. Aber die hauseigenen Kretins zweckentfremdeten Roberts speziellen Freund ohnehin fortlaufend. Um sich vor der Herbeischaffung eines Wagenhebers zu drücken, wurde der Kran dazu genötigt die voll bepackten Kundendienstwagen zwecks Reifenwechsel anzuheben. Robert hatte keinen Zweifel daran, dass diese, inklusive des schweren Spezialwerkzeugs und den haufenweise gehorteten Ersatzteilen darin, weitaus mehr als zwei Tonnen wiegen würden.
Des Weiteren konnte sich die Hebemaschine auch noch drehen und zwar um 360 Grad, was Robert immer wieder erstaunte, denn die Abmessungen der Halle waren so knapp berechnet, dass er oft das Gefühl hatte, der schwefelfarbene Arbeitsarm würde geradewegs in eine der Blechwände hinein rasen, wenn man den für die Drehung vorgesehenen Knopf drückte.
Es machte „BRRRRRT“, während die Maschine sich um ihren, fest im Fundament verankerten, Stahlfuß drehte. Ferner klebte eine große TÜV-Plakette an der runden Säule, die dem Kran eine unbedenkliche Nutzung bis zum März 2007 bescheinigte.
Man zählte den elften Monat des Jahres 2006 und Robert fieberte besagtem Datum bereits entgegen, seit er angefangen hatte hier zu arbeiten. Er hatte diesen Termin nach ein paar Wochen der Tristesse schon recht bald zu seinem persönlichen Highlight auserkoren. Es würde fast so werden wie im letzten Jahr, als die Wartungscrew für das Rolltor anrückte und ihn eine ganze Stunde lang damit fesselte, was man so alles an einem popligen Tor inspizieren konnte. Allein das Herbeisehnen dieses erwartungsvollen Moments ließ ihm ein ums andere Mal deutlich werden was für einen bejammernswerten Arbeitsalltag er hatte. Der intellektuelle Anreiz fehlte völlig. Man verrohte und verdummte, stumpfte ab und litt schließlich an Depressionen und psychosomatischen Stresssymptomen, wenn man nicht rechtzeitig den Absprung schaffte.
„Ich war noch nicht hinten.“, riss ihn K.s sonore Stimme aus seiner kurzen Träumerei.
K. war Roberts direkter und einziger Vorgesetzter, obwohl die beiden Schrauber H. und T. sich selbst ebenfalls für höhergestellt hielten. Warum gerade K. und nicht einer der anderen beiden Trottel diesen Posten bekleidete, wollte Robert bis heute nicht so ganz klar werden. K. hatte keinerlei kaufmännische Ausbildung genossen, und war noch nicht einmal Schlossermeister oder etwas Vergleichbares.
Er war sogar der jüngste dieser armseligen Gestalten und demnach auch nicht unbedingt der Erfahrenste der drei. Aber irgendein unwissender Schwachmat aus der Zentrale hatte ihn vor gut zwanzig Jahren hier eingesetzt und diese Entscheidung wurde in den vergangenen zwei Dekaden offenbar auch nie wieder hinterfragt. K.s Gesicht wirkte ständig zerknautscht und seine Art sich zu bewegen hatte etwas hölzernes, so als sei er sich bei jedem Schritt unsicher, was seine beiden Beine eigentlich tun sollten. Überhaupt machte er bei vielen Dingen, die er zum ersten Mal zu bewältigen hatte einen ratlosen Eindruck. So war es auch erst kürzlich bei der Inbetriebnahme des nagelneuen Navigationsgerätes für seinen Dienstwagen gewesen. Zwei Wochen lang führte das vertrackte Ding ihn in die Irre, bis er endlich durchschaut hatte, was die Knöpfe „On“ und „Select“ zu bedeuten hatten. Einfach die Bedienungsanleitung zu studieren war selbstverständlich keine Option gewesen! Der herkömmliche Handwerker wirkte absichtlich desinformiert, um den Eindruck zu erwecken, auch ohne viel nachzudenken ein angenehmes Leben führen zu können.
Nicht so jedoch bei Abläufen die er bereits seit Jahren kannte. Diese hatten sich auf immer und ewig in sein Hirn eingebrannt. Sollte er eines Tages auf dem Sterbebett liegen und jemand würde ihn nach dem Spaltmaß irgendeines Motors fragen, so könnteer diese Information in seinen letzten Atemzügen prompt herunterbeten.
K.s scheinbar motivationslose Aussage war als Aufforderung an Robert zu verstehen, die am Freitag bestellten Ersatzteile aus dem Anlieferungsraum zu holen, wohinein der Nachtkurier stets die Kartons platzierte und in den Robert auch die zum versenden vorgesehenen Pakete immer ablud, bevor er nach Hause fuhr.
Wortlos schnappte er sich den Schlüsselbund mit dem gelben Ring, an dem sich auch der Schlüssel für den Briefkasten befand, den Robert ebenfalls würde leeren müssen. Montags war der Kasten immer randvoll, da der Postbote es freitags meistens nicht mehr schaffte die Briefe rein zu bringen, da bereits um 12:45 Feierabend war und am Samstag erst gar nicht gearbeitet wurde.
Der Weg war jedes Mal der gleiche. Hinter seinem Schreibtisch, der nicht viel mehr war als ein abenteuerlich zusammengezimmertes Provisorium aus Brettern und Metallstangen, ging es am blechernen Aktenschrank vorbei. Dann links zum Büroausgang, durch die Tür und in den Flur mit der großen Übersichtskarte an der Wand, auf der sämtliche regionale Niederlassungen seines Brötchengebers eingezeichnet waren. Von hier aus schließlich nach draußen, dann rechtsherum an der Halle entlang, bis kurz vor den Drahtzaun, der das Gelände vom benachbarten Grundstück einer Gummifabrik trennte. Heute hatte Robert Glück. Die Produktion lief noch nicht auf Hochtouren. An manchen Tagen stank es vor der Tür so sehr nach verbranntem Gummi, dass man sich eine Duftbäumchenmanufaktur auf der anderen Straßenseite herbeisehnte.
Jedenfalls befand sich dort die Tür zum Heizraum, welche schon arg verrostet war und beim öffnen ein beunruhigendes Knarren von sich gab. Robert hatte das Gefühl, sie ging jedes Mal ein klein wenig schwerer auf. Drinnen roch es nach Moder und irgendwelchen nicht näher definierbaren Chemikalien. Auf einem kleinen Rollwagen, der bereits ein infernalisches Geklapper entfachte, wenn er nur leicht bepackt war, lagen die zwei Kartons.
Und wieder war Robert sein wahnwitziges Glück hold, denn einer der Kartons sah ziemlich schwer aus und er erinnerte sich wieder, am Freitag noch vier Sätze Zylinder und Kolben bestellt zu haben, die einiges auf die Waage brachten. Nur schnell raus aus diesem Drecksloch dachte er sich, während der Wagen unrund über den gepflasterten Hinterhof rumpelte, bis zum Eingangsbereich, in dessen Schutz sich der Briefkasten befand.
Irgendwelche Randalemacher hatten die rechte untere Ecke bereits vor Jahren versucht aufzubiegen, was ihnen jedoch misslungen zu sein schien. Vielleicht hatten sie aber auch schon nach kurzer Zeit die Lust daran verloren. Robert fragte sich, warum überhaupt jemand Interesse daran hätte haben sollte. Hier kamen nur belanglose Rechnungen und interne Hauspost aus der Zentrale an. Zwei große Umschläge, vermutlich Rechnungen, und ein kleines Briefchen förderte er schließlich zutage. Der Wagen überwand die Schwelle an der Eingangstür wie gewöhnlich nur durch massive Gewaltintervention.
Der Weg führte wieder zurück ins Büro, vorbei an H., der mittlerweile seinen Kaffee hörbar in sich hinein schlürfte. Seit jeher hockte H. seitlich an Roberts Schreibtischfront, so dass er T. direkt gegenübersaß, welcher in der gleichen Haltung den allmorgendlichen Koffeindrink in sich rein kippte.
K. selbst hockte vor seinem Computer, den er eher rudimentär, wenn überhaupt, beherrschte. Vermutlich checkte er die E-Mails. Er machte dann immer so ein angestrengtes Gesicht, als würde er etwas ungemein Wichtiges tun, das nur er und kein anderer bewältigen konnte. Dabei waren die Mails die ihn erreichten so wichtig wie eine Lieferung Pferdedung in Kambodscha. Dreiviertel davon waren, trotz des neuen hoch gelobten Spamfilters, Müll und der Rest absolut nichtige Mitteilungen des Geschäftsführers, die sich meist damit befassten, wo welcher Lufterfrischer im Großraumbüro der Zentrale aufzustellen sei, oder wer das „Rauchen verboten“ Schild aus der Herrentoilette entwendet hatte.
Eine permanent offenstehende Tür, die Robert tatsächlich noch nie geschlossen vorgefunden hatte, führte ins Lager. Es bestand aus fünf doppelseitigen Regalen, von denen die Hälfte leer stand, oder lediglich den Staub der vergangenen Jahrzehnte verwaltete. Oben an den Enden waren die Regale mit kleinen Pappschildchen von eins bis elf beschriftet. Der Rollwagen wurde immer zwischen den Regalen vier und fünf geparkt. Warum? Das spielte keine Rolle. Robert hatte auch noch nie gewagt danach zu fragen. Generell galt als oberste Regel: „Nicht fragen! Akzeptieren!“
Wenn man das erst einmal begriffen hatte, war es auch nicht mehr weit, bis man sich vollends seinem Schicksal ergeben konnte und den Irrsinn nicht mehr hinterfragte.
Doch bevor er sich daran machte die Kartons mit dem stumpfen Teppichmesser aufzuschlitzen, führte ihn sein Routineweg noch bis jenseits des elften Regals in einen kleinen Abstellraum, in dem Besen und Kehrblech, sowie dreckiger alter Mist, wie z. B. ein verschimmelter Eimer oder spinnennetzbedeckte Getränkekisten lagerten.
An der Wand hinter der schief in den Angeln hängenden Tür war ein massives Holzbrett in die Wand geschraubt worden, das mit vier Nägeln verziert war und als Garderobe fungierte. Die hieran hängenden Hosen und Jacken waren während der gesamten Zeit, die Robert bereits seine Jacke an diesem Brett aufhängte, nicht ein einziges Mal benutzt worden. Warum er gerade diesen Abort als seine persönliche Kleiderkammer benutzte war ihm selbst auch nicht so ganz klar.
K. hatte ihm schon mehrmals nahegelegt, seine Jacke zu denen der anderen in den Aufenthaltsraum, der sich gegenüber dem Büroeingang befand, zu hängen. Aber die Macht der Gewohnheit ließ Robert immer wieder hinter die Regale verschwinden.
Jetzt konnte Robert endlich die Ersatzteile auspacken und darüber staunen, mit was für einer unmotiviert zusammengeschusterten Ansammlung von Metall und Plastik so unverschämt viel Geld zu verdienen war. Mit geübtem Griff entfernte er die stabilisierenden Plastikbänder um die Kartons herum und stieß die Schwingtür zur Werkstatt auf, die ein Geräusch produzierte das sich auf ewig in seinen Gehörgängen festgesetzt hatte.
„KNAA-KLACK“ machte sie, während Robert die Tür mit einer Hand aufhielt und mit der anderen die Mülltonne öffnete, an deren Boden sich der Dreck der letzten Wochen und Monate festgesetzt hatte und trotz der zweiwöchentlichen Leerung auch nicht mehr verschwand. Schnell schmiss er die Plastikbänder hinein und ließ die Tür, „KNAA-KLACK“, wieder hinter sich zu schwingen.
Die heutige Ausbeute umfasste neben den Kolben und Zylindern ein paar Keilriemen, ein Sammelsurium an Dichtringen und zwei Austauscheinspritzdüsen. Robert legte die Ersatzteile auf den Tresen, der nichts weiter war als ein massives Holzbrett auf einem ebenso rustikalen Gestell aus Spannholzplatten. Ursprünglich war die Oberfläche einmal weiß lackiert gewesen, aber der nicht gerade pflegliche Umgang hatte an den meisten Stellen das blanke Holz zutage gefördert. Noch dazu war alles mit altem, verkrustetem Öl zugeschmiert, so dass der Eindruck entstehen musste, die hier gehandelten Waren seien ausschließlich doppelt und dreifach wiederverwerteter Müll.
Vom Gegenteil zeugten die blitzsauberen Lieferscheine, die Robert aus den aufgeklebten Plastiktaschen herauszog, um sich damit auf den Rückweg zu seinem Arbeitsplatz zu machen. Die übrige Unordnung auf der weißen Platte ignorierte er, wohlwissend dass es keinen Sinn hatte eine Ordnung zu schaffen, da die gedankenlosen Mechaniker einfach alles, was sie gerade nicht mehr benötigten, dort drauf warfen, nur um es später dann verzweifelt zu suchen. Im Büro war bereits eine dieser Unterhaltungen im vollen Gange, wegen derer Robert sich am liebsten eine Kugel durch den Kopf gejagt hätte, damit er diesen Stuss nicht mehr ertragen musste.
Für gewöhnlich ging es um das sonntagabendliche reißerische Actiondrama im Privatfernsehen, sowie Anne Will mit ihren unumstößlichen Wahrheiten. Besonders T. hatte an dieser demagogischen Sendung einen Narren gefressen und freute sich den Arsch ab, wenn dieses inhaltslose Politikgeschwafel tags darauf zum Thema Nummer Eins erkoren wurde. Doch an diesem Tag sollte alles noch schlimmer kommen.
„Was ist los mit Hansa Rostock?“, eröffnete T. die Diskussion.
Er hatte sich an H. gewandt, in dem er einen Experten für sämtliche Mannschaften aus den neuen Bundesländern zu erkennen meinte, da sich nicht nur dessen Heimat dort befand, sondern er zudem auch noch sämtliche Stufen der sozialistischen Erziehung in seinen 54 Lebensjahren durchlaufen hatte. Allerdings hatte H. nicht die geringste Ahnung von Fußball und von den Begebenheiten in der 3. Liga schon gar nicht, was ihn aber nicht davon abhielt trotzdem seinen Senf dazuzugeben.
„Och, das passiert halt mal“, druckste er herum.
Aus T.s Äußerung las er vermutlich heraus, dass Hansa Rostock am Wochenende verloren hatte und ging nun auch, wie erwartet, vollends darauf ein.
„Das war jetzt schon das dritte Unentschieden hintereinander, oder nicht?“, brachte T. ihn aus dem Konzept.
Doch seinen entgleisten Gesichtszügen folgten vorerst keine Worte, da K. noch eine viel abenteuerlichere Variante parat hatte.
„Nee, die haben doch letzte Woche in Karlsruhe 4:1 verloren.“
Damit wollte sich T. nicht zufriedengeben.
„Waaas?! Das kann ich ja gar nicht glauben. Ich mein der Reporter hat gesagt, die haben jetzt dreimal Unentschieden gespielt.“
Die Wahrheit war eine gänzlich andere, aber das behielt Robert für sich. Richtig Bescheid wusste keiner von den Dreien. Weder über die aktuellen Ergebnisse oder Tabellenstände, noch über die einfachsten Spielmechanismen dieses Ballsports.
„Jaa? So wird das jedenfalls nichts mit dem Aufstieg.“, dröhnte T. erneut.
„Dann müssen sie eben ein paar neue Spieler kaufen. Was ist mit Frings? Warum holen sie den nicht?“
H. war wirklich ein Laie in Sachen Fußball. Und dennoch war der Glaube an die Richtigkeit seiner Aussagen unerschütterlich.
„Ach Frings“, meinte K., „den sollten die Hamburger schnell wieder verkaufen. Wieso haben die den Toppmöller damals gehen lassen? Das ist doch bescheuert den Trainer zu entlassen mit dem man Meister geworden ist.“
Eine solche Verkennung der Tatsachen grenzte schon an Bildungsanarchie. Die nächsten Minuten blendete Robert größtenteils aus, um sich voll und ganz darauf konzentrieren zu können, seinem Computer beim hochfahren zuzusehen.
Doch schon nach wenigen Minuten schwenkte das Gespräch wieder auf das Thema um, auf das es immer hinauslief. Das erbärmliche Leben dieser Menschen hatte einfach keinen anderen Inhalt. Sie waren nicht glücklich, wenn sie nicht über das sprechen konnten, was ihr ganzes Dasein legitimierte und ihnen den einzigen Sinn auf diesem Planeten gab: Ihre Arbeit.
„Weißt du noch wo wir letztes Jahr bei diesem Radlader in Grabow waren?“, platzte es aus H. heraus, als hätte er es gar nicht abwarten können, endlich wieder über Motoren und Maschinen zu reden.
Überhaupt kam es Robert oft so vor, als wäre all das andere Gequatsche nur so eine Art verbales Vorspiel, bis sie schließlich zum eigentlichen Akt kamen und sich dabei immer weiter, bis zum Höhepunkt hochschaukelten, um dann in weiteren Details zu versinken.
„Wieso, was ist damit?“, fragte K.
„Jaaaa…, der hat mich Gestern Abend angerufen. Der Motor hat keine Leistung.“
„Ha! Wie kann das denn sein?“, schaltete sich nun auch T. ein, „Da haben wir doch alle Pumpen getauscht und das Ventilspiel neu eingestellt.“
Jetzt ging’s erst richtig los. Ab diesem Punkt war jeder hoffnungslos verloren, der nicht mit den technischen Details und den Eigenarten des jeweiligen Kunden vertraut war. Robert hatte von beidem nicht die blasseste Ahnung. Nicht, dass er sich in den letzten Jahren das eine oder andere hätte aneignen können, aber er wollte das alles gar nicht wissen. Drauf geschissen ob Bauer Piepenbrinks bekackter Trecker von neunzehnhundertachtundfuffzich mit oder ohne Glühwendelkerze lief, oder ob Zylinder 3 seit Jahren stark ölt und mal neu abgedichtet werden müsste. Aber die drei Kasper vor und neben ihm hatten solche Angelegenheiten zu ihrer heiligen Mission auserkoren.
„Ja, ich sag’s ja nur.“, entgegnete ihm H. schnippisch.
Das forderte T. natürlich heraus. Er lehnte sich mit skeptischer Miene zurück und spielte mit dem Plastikbecher, aus dem er sich zuvor noch den letzten Rest Kaffee gegönnt hatte, an seiner Lippe herum.
„Na, wenn der da mal nicht am Regler rumgespielt hat. Du kennst doch die Bauern.“
K. zündete sich eine seiner stinkenden Zigaretten an. Er war übrigens der Einzige in dem Laden, der rauchte. Ein Umstand den vor allem Robert zu spüren bekam, da nur er den ganzen Tag in den blauen Dunstwolken hocken musste. Deutlich hörbar atmete K. den Rauch aus, den sich einzuverleiben vermutlich eine der wenigen Freuden in seinem Leben war. Neben der Arbeit natürlich!
„Und nu? Hat er gesagt, dass wir vorbeikommen sollen?“, wollte K. wissen.
„Hat er nicht gesagt. Er war nur gerade beim Ölfilterwechseln, da fiel ihm das ein.“
„Hat er ne Nummer dagelassen?“
„Er sagt die hast du im Computer.“
Die Kunden gingen immer davon aus, dass alles was je mit ihren Geräten passierte „im Computer“ war. Für diese geistig Minderbemittelten waren das hellsehende Wundermaschinen, in die man nur hineinsprechen musste, damit alle ihre Wünsche in Erfüllung gingen. Dass aber stattdessen ein irrsinnig unsinniges Warenwirtschaftssystem aus den frühen 90ern dafür sorgte, dass eben nicht alles, ja nicht einmal die wirklich hilfreichen Daten, nachvollziehbar archiviert wurden, das ahnte keiner von ihnen.
„Irgendwo hab‘ ich die auch“, merkte K. an.
Währenddessen wurde T. unruhig.
„Was ist mit dir los?“, wollte H. wissen, „Musst du wieder was tun?“
„Ich kann mir das nicht erlauben hier nur rum zu sitzen. Wir können ja nicht alle unser Geld so verdienen wie Robert. Ich muss was machen.“
Sekunden später war er bereits in der Werkstatt verschwunden und pfiff vor sich hin.
Wenn man ehrlich war, hatte er durchaus recht; Robert saß praktisch sieben von seinen acht Arbeitsstunden (zuzüglich einer Stunde offizieller Pause) nur herum und las Zeitschriften. Aber dass er damit Geld verdiente war ein Witz. Er bekam sogar weniger als den ohnehin erbärmlichen Tariflohn. Warum, darüber hatte er sich nie allzu viele Gedanken gemacht. Ihm reichte das Geld trotzdem.
Wozu hätte er auch viel Geld gebraucht? Die Hauptsache war, dass er seine Miete zahlen konnte und genug zu essen hatte. Er war ein sehr genügsamer Mensch, fast schon ein Asket, der sich oft einfach nur selber geißelte. Weder T. noch die anderen hätten seiner Meinung nach allerdings Grund gehabt, sich über ihre Bezahlung zu beschweren. Roberts Informationen zufolge verdienten diese unfähigen Dilettanten locker das drei- bis vierfache seines Gehaltes. Netto!
K. vermutlich sogar noch mehr, in seiner Position als Niederlassungsleiter. Genau dieser Umstand war es, der Robert am Gehaltsgefüge so wurmte. Dummheit wurde allem Anschein nach auch noch honoriert. Dabei war H. nicht einmal in der Lage eines der Telefone zu bedienen! Wahrscheinlich waren diese neumodischen Geräte mit Tasten statt Wählscheibe einfach zu kompliziert für sein verkümmertes Handwerkerhirn. Wollte er irgendwo anrufen, bat er generell Robert darum die Zahlen für ihn einzutippen. Er sagte dann: „Robert, mach du das mal, ich weiß nicht wie das geht.“
Er gab es also auch noch zu! Seine ganze Unfähigkeit stellte er zur Schau, ja er zelebrierte sie förmlich. Vor nicht allzu langer Zeit wurde allen Monteuren ein Diensthandy aufgezwungen, damit sie auch unterwegs erreichbar waren. Besonders H. hatte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil er dann ja etwas Neues hätte dazulernen müssen. Undenkbar für ihn! Es war nicht nur das Unvermögen allein, nein, es war vor allem der Unwille, über den Robert sich so aufregte. Es wurde sich einfach geweigert etwas anders zu machen, als auf die Weise, die diese Dummschwätzer seit Anbeginn der Zeit kannten.
Es kam Robert vor, als wollte er ihm jedes Mal aufs Neue zeigen wie er mit der Intelligenz eines Korkenziehers trotzdem über alle anderen triumphierte, die sich jahrelang in der Schule den Arsch aufgerissen hatten. Genau das war in Roberts Augen das Problem der Handwerker, oder besser gesagt, an den Handwerkern. Sie kamen damit durch. Für ihren Unverstand und ihre Inflexibilität wurden sie auch noch belohnt und das bereits seit Jahrzehnten. Sie hatten es nie anders kennen gelernt. Ihre berufliche Laufbahn hatte in einer Zeit begonnen, in der alles bestens lief und Arbeitslosigkeit nur etwas für geistig stark Zurückgebliebene und Vollzeitalkoholiker war.
Die heutige Generation von jungen Menschen zwischen zwanzig und dreißig würde niemals auch nur auf die Idee kommen, sich für immer in ihrem einmal erlernten Beruf einen sicheren Arbeitsplatz zu erhoffen. Das wollen die meisten ja auch von sich aus schon gar nicht. Mittlerweile war die wichtigste Eigenschaft im Berufsleben Flexibilität und nicht mehr Muskelschmalz und Lernresistenz. Doch davon wollten seine drei Handwerkerfreunde nichts wissen.
Überhaupt hielt Robert das Konzept der Lohn- und Gehaltsarbeit für würdelos, unsinnig und unzeitgemäß. Für jemand Anderen oder eine Firma zu arbeiten, die einen dann mit einem lumpigen Gehalt abspeiste, das konnte es doch nicht sein. Jedenfalls nicht für einen vernunftbegabten Menschen mit Selbstachtung und der Fähigkeit für sich selbst zu denken und Entscheidungen zu treffen.
Wie dem auch sei, zuerst musste Robert noch die neuen Waren einbuchen, bevor er sich darüber weitergehende Gedanken machen konnte. Es war das ewig gleiche Spiel. Er tippte „WE“ für Wareneingang in seine ölverkrustete Tastatur, gab die zehnstellige Bestellnummer ein und bestätigte alle Wareneingänge der Bestellung mit der Enter-Taste. Nachdem er dieses Kunststück fertiggebracht hatte, das seiner Meinung nach auch ein dressierter Affe an seiner statt hätte erledigen können, öffnete er das Stempelkissenkästchen, dessen Deckel schon verbeult war, mit einem klirrenden Scheppern und setzte den „Gebucht“-Stempel in dessen Mitte.
Das dreckige Moosgummi saugte sich mit der blauen Farbe voll. Auch wenn Robert es nicht sah, so wusste er doch ganz genau um die Vorgänge, die sich in und um sein Arbeitswerkzeug abspielten. Schließlich waren seine sechs Stempel, von denen er drei regelmäßig, einen kaum und die anderen beiden nie benutzte, die Utensilien, die er neben dem Locher und dem Hefter am meisten gebrauchte. Den eingefärbten Verbund aus Holz und Gummi setzte er mit dem nötigen Druck auf die beiden Lieferscheine und kritzelte darunter sein Kürzel, sowie das aktuelle Datum.
Geräuschvoll glitt der Stempel in seine Halterung zurück, die ihre besten Tage ebenfalls schon lange hinter sich zu haben schien.
„Ich hab‘ heute noch gar nicht gestempelt, Robert.“
H.! Er liebte es mit den Stempeln Schindluder zu treiben. Vermutlich waren diese kleinen Dinger mit den eingeschnitzten Lettern für ihn so eine Art Statussymbol der Büroschaffenden, ein Prädikat der Wichtigkeit. Wer einen Stempel hatte und diesen irgendwo raufknallen konnte, der hatte etwas zu sagen, durfte über andere bestimmen. „Gebucht“, „Betrag dankend erhalten“, oder „Rechnungsprüfung durchgeführt“, das waren H.s Instrumente der Macht, wenn er in seinen Fantasien schwelgte. Oder es war schlicht und einfach der nicht zu unterdrückende Zwang aller Schrauber und sonstiger Analphabeten alles anzufassen und auszuprobieren. So wie der verbotene rote Knopf, den man nicht drücken durfte.
Robert wollte eigentlich seine Standartbemerkung loslassen, die er H. zu hören lassen pflegte, wenn dieser seine scheußlichen Wurstfinger in Richtung des fein säuberlich geordneten Schreibtischinventars ausstreckte. Robert war nämlich pedantisch um eine gewisse Symmetrie an seinem Arbeitsplatz bemüht, um in diesem Hort des Chaos wenigstens einen Fixpunkt des Beständigen zu haben.
Normalerweise hätte er H.s Vorhaben mit einem „Na dann wird’s aber Zeit“ kommentiert, aber diesmal war der verfluchte Kerl schneller. Seine rechte Pranke schnellte schon hervor um Roberts sauberen Schreiblock zu packen und in völlig verwirrender Anordnung die Stempelfarbe darauf zu verteilen.
„Plack“, „Plack“, und noch mal „Plack“ machte es. Auch auf Roberts Schreibtischunterlage, die bereits schmutzig und verschmiert genug war, entlud H. seinen Tatendrang.
„Siehst du Robert. Zack, und schon hab ich mein Geld heute verdient. Ich kann mich einfach immer nicht beherrschen.“
Nicht nur, dass seine Ausdrucksweise eine Beleidigung für jedes denkende Wesen war, während er sprach flogen auch noch diverse Speicheltropfen aus seinem Mund und blieben teilweise in seinem Oberlippenschmuck hängen. Hoffentlich würde der schnauzbärtige Delinquent bald in der Werkstatt, oder noch besser in seinem Wagen, verschwinden, um auf Außenmontage zu fahren. Doch den Gefallen tat er Robert noch nicht. Stattdessen wandte er sich wieder an K.
„Nächsten Montag bräuchte ich noch mal Urlaub, da wollte der Maler bei mir gucken.“
K. war immer noch schwer mit seinen E-Mails beschäftigt, fand aber tatsächlich auch genügend Kapazitäten in seinem degenerierten Hirn um H. zu antworten.
„Schon wieder Urlaub? Ihr habt ja bald mehr frei als dass ihr arbeitet.“
„Jaahaha, wer ist denn andauernd auf Lehrgang oder auf Messen?“
Wie um seine Aussagen zu bekräftigen, kloppte er seine Faust mehrmals gegen die Schreibtischkante.
„RAMM.“
„RAMM.“
Das war eine der Angewohnheiten die Robert am meisten an ihm hasste. Fast damit einher ging H.‘s Angewohnheit, seinen rechten Unterarm regelmäßig auf den Schreibtisch aufzustützen, so dass er damit die darauf liegenden Unterlagen nicht nur durcheinanderbrachte, sondern auch noch zerknickte.
„Das ist alles für die Firma. Ich mach mir da ja keinen faulen Lenz.“, entgegnete K., während er den Kalender unter einem Stapel Notizzettel und unbearbeiteter Post hervorkramte.
K. machte nicht gerne den „Papierkram.“ Seiner Meinung nach war das was für „Tintenpisser.“ Nicht dass Robert sich tatsächlich dadurch beleidigt gefühlt hätte, dafür waren ihm diese Personen einfach zu minderwertig. Dennoch bestätigte diese unüberlegte Ausdrucksweise K.s, und auch der anderen Monteure, dass es mit deren Feingefühl und Anstand nicht weit her war.
H. war endlich im Begriff sich zu erheben, als K. ihn verbal stoppte.
„Dann habt ihr ja beide frei. Dann bin ich ja alleine in der Werkstatt. Das geht nicht!“
„Ja, was soll ich machen? Der Maler kann nur Montag. Ich hab‘ sogar noch zwanzig Überstunden, die muss ich auch noch loswerden.“
Trottel, dachte Robert. Ohne bestimmten Grund. Alleine seine Art zu sprechen und seine Wünsche vorzutragen, reichten ihm schon aus, um einen inneren Ekel vor H. zu empfinden. Gepaart mit dem äußeren Erscheinungsbild, das ihn immer wieder an ein stinkendes Walross mit dumm dreinblickenden Knopfaugen erinnerte, hatte H. bei ihm spätestens seit ihrer ersten Begegnung verloren. Während Robert die anderen Kollegen nicht auch nur annähernd mochte, so hasste er diese Verschwendung menschlichen Zellmaterials regelrecht. Ihm wünschte er tatsächlich die Pest an den Hals, dass er seine Arbeit verlieren würde und ohne sinnstiftende Betätigung jämmerlich eingehen würde, in einer Welt die ihn längst überholt hatte.
K. guckte bereits wieder auf diese abwägende Art. Bestimmt würde er doch noch einen Weg finden H. freizugeben.
„Dann muss Klaasen seinen Schlepper eben herbringen. Oder den Motor ausbauen und herbringen. Und die Wartung bei Sennemann machen wir dann Dienstag oder Mittwoch. Den ruf ich am besten gar nicht an. Wenn wir Glück haben meldet der sich gar nicht.“
Er verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich zurück. Wenn man es nicht besser wusste, hätte man denken können, er ließe sich das Ganze abschließend noch einmal durch den Kopf gehen. Aber Robert wusste es besser.
Seine Pausen waren nur Show. Ein Trick, von dem K. glaubte ihn sich raffinierterweise angeeignet zu haben, weil er es Leuten, die wirklich über das nachdachten was sie gesagt hatten, somit gleichtun würde. In Wirklichkeit machte K. sich nämlich ausschließlich über seine vermeintliche Schläue Gedanken und lachte sich ins Fäustchen ob seiner imaginären geistigen Überlegenheit. Und tatsächlich: K. war den beiden anderen Handwerksgesellen um einiges voraus!
So wusste er immerhin als einziger der Drei den Computer, zumindest in den für ihn relevanten Bereichen, zu bedienen und war mit gewissen Einzelheiten der Ersatzteilbestellung vertraut, die den anderen völlig abgingen.
Faktisch waren nur er und Robert überhaupt dazu in der Lage Ersatzteile zu bestellen. Sollte jemals der Supergau eintreten, und H. und T. wären alleine im Betrieb, was K., aus guten Gründen unter allen Umständen zu vermeiden versuchte, und sie bräuchten zum nächsten Morgen dringendst Ersatzteile für eine Reparatur (denn alle Reparaturen in diesem Laden waren äußerst dringend), würden sie in Panik verfallen und vor lauter Hilflosigkeit auf der Stelle tot umfallen.
Viele Informationen enthielt K. seinen Handlangern aber auch bewusst vor. Die regelmäßig eintreffenden Servicemitteilungen der Zulieferer, welche wichtige Auskünfte für die Kunden, oder aber auch geänderte technische Details beinhalteten, ließ er blitzschnell nach ihrer Ankunft in einem seiner Ordner verschwinden, deren kryptische Beschriftung und Wegheftsystematik nur ihm selbst einleuchtete. Robert vermutete, dass er dadurch versuchte sich praktisch „unentbehrlich“ zu machen.
Die Zentrale hatte die Niederlassung, wegen der verheerenden Verluste die sie seit Jahren einfuhr, seit jeher auf dem Kieker und das Damoklesschwert einer möglichen Kündigung schwebte permanent über den Köpfen derer, für die eine Entlassung eine folgenschwere Katastrophe wäre. Wer würde auch schon einen einfachen Landmaschinenschlosser ohne jegliche Zusatzqualifikation jenseits der Fünfundvierzig einstellen? Jedenfalls war K. aus dem Schneider, denn ohne ihn konnten sie den Laden überhaupt nicht am Laufen halten. Er war Schreibtischtäter und Werkstattleiter in einem. Der Einzige mit den nötigen Informationen um einen Kunden vollends zufrieden stellen zu können. Robert hatte von den technischen Details wenig bis gar keine Ahnung, was aber zum Teil auch daran lag, dass K. ihn seinerzeit eingearbeitet hatte.
„Dann mach das so.“, beendete K. seine Denkpause.
„Gut.“
H. hatte sich zwischenzeitlich von seinem Platz erhoben und schlenderte langsam Richtung Schwingtür.
„Wir brauchen wieder welche von den Glühbirnen für die kleinen Taschenlampen.“, warf er noch schnell in den Raum.
„Schon wieder!?“
K. war sichtlich entsetzt und das zu Recht. Andauernd verschwand irgendwas, oder die Monteure ließen irgendwo ihr Werkzeug liegen. Robert vermutete schon seit längerem, dass H. die ganzen teuren Gerätschaften heimlich an seine Pappenheimer im östlichen Teil Deutschlands verscheuerte. Er war ein neugieriger Banause, der alles immer ganz genau wissen wollte und stets zur Stelle war, wenn neue Werkzeuglieferungen eintrafen, die er mit der Gründlichkeit eines Stasi-Offiziers durchwühlte. Ausschließen konnte man eine Beteiligung dieser menschlichen Katastrophe am damaligen DDR-Überwachungsapparat sowieso nicht. Überhaupt traute er diesem degenerierten Tunichtgut einen hohen Grad an krimineller Energie zu.
„Wo lasst ihr die Dinger immer?“
„Ja…, ist so. Ich brauch noch nen Blanko-Auftrag.“, waren H.s letzte Worte, bevor er, ohne darauf zu warten, dass man ihm das verlangte Papier überreichte, in der Werkstatt verschwand, um mit ungelenken Bewegungen seinen roten Overall überzustreifen.
Jedes Mal machte er das so, er verlangte irgendetwas und verschwand dann einfach. Widerlich! Außerdem ließ er sich die Aufträge stets von K. oder Robert ausfüllen, weshalb die Vermutung nahe lag, er sei zu allem Überfluss auch noch Analphabet.
So eine absurde Person, noch dazu mit solch abscheulichen Manieren, konnte es doch gar nicht geben! Jedenfalls nicht im normalen Berufsleben, innerhalb einer halbwegs zivilisierten Gesellschaft.
Zumindest vor ihm hatte Robert vorerst seine Ruhe. Blieb nur noch K. Die Uhr zeigte 7:45. Gewöhnlich die Zeit, zu der seine Untätigkeit einsetzte. Die Zeit, in der die peinlichen Momente zunahmen, in denen Robert einfach nur dasaß und in die Luft starrte, oder mit dem Kugelschreiber in seiner Hand herumhantierte, während K. vorgab schwer beschäftigt zu sein.
Obwohl es keinen Grund gab, fühlte sich Robert dennoch oft in gewisser Weise „schuldig“, nichts zu tun zu haben.
Es war tatsächlich absolut nichts zu tun, wenn nicht gerade ein Kunde etwas verlangte oder die Post kam. Rechnungen schrieb er einmal in der Woche, wenn K. sein O.K. dazu gab. Ein paar Angebote an die Kunden zu verschicken hatte auch keinen Sinn, da diese nur Ersatzteile kauften, wenn sie auch wirklich welche brauchten. Also blieben pro Tag rund sieben bis acht Stunden, in denen Robert entweder auf den gelben Kran gaffte oder eine Zeitschrift las.
Er wartete förmlich auf den Tag, an dem K. einen Kommentar dazu abgab, wie „Du wirst hier nicht fürs Lesen bezahlt-“ Aber K. wusste wohl ebenso wie Robert, dass der Job hier absolut überflüssig war. Eine Nonsensentscheidung der Zentrale, die mit irgendeiner abstrusen Statistik errechnet hatte, dass eine weitere Person für das Büro notwendig wäre.
Jedenfalls war es ihm unangenehm wie ein Tagedieb einfach nur dazuhocken, während K. seine Arbeit verrichtete. Trotzdem holte er demonstrativ seine Zeitschrift aus dem Rucksack und schlug die erste Seite auf. Ohne die notwendige Ablenkung wäre Robert früher oder später dem Wahnsinn anheimgefallen, oder hätte sich gar am Ende seinen Arbeitskollegen angepasst. Und das war das Letzte auf diesem Planeten, was er wollte!
Es war die neueste Ausgabe einer Gitarrenzeitschrift, dessen Vorwort er gegenwärtig las. Robert war kein außerordentlich guter Gitarrist, aber durch die Lektüre zahlreicher Zeitschriften konnte er immerhin von sich behaupten einiges von den technischen Details zu verstehen die eine Gitarre zum Klingen und Schwingen brachten. Er hatte sein Interesse für Musik viel zu spät entdeckt.
Dazu kam noch, dass er seiner Meinung nach wenig Talent dazu hatte ein Saiteninstrument zu bedienen. Mittlerweile besaß er auch schon eine stattliche Sammlung von drei Gitarren der preislichen Mittelklasse, auf denen er immer dann übte, wenn seine Stimmung dies zuließ. Das war gar nicht so einfach, denn schließlich musste Robert ja auch noch arbeiten und wenn er abends nach Hause kam, fehlten ihm Ruhe und Muße für solcherlei zeitintensive Aktivitäten. Am Wochenende war auch nicht damit zu rechnen, weil ihn schon am Freitagnachmittag die Gewissheit quälte, er würde am Montag wieder zur Arbeit müssen.
Robert hasste seinen Job! Er hasste die Arbeit mit solch einer Inbrunst, wie einst Ahab Moby Dick.
Doch leider liebte er das Geld. Er verdiente zwar, wie gesagt, weniger als den Tariflohn, doch am Ende des Monats mehr als tausend Euro für sich zu haben war für den gelernten Kaufmannsgehilfen schon eine gehörige Portion Luxus. Er rauchte nicht, er trank nicht und nahm auch sonst keine Drogen. Er war ein Purist. Bevor er sich etwas leistete, musste die Gelegenheit schon mehr als günstig sein.
Es war seine Art der Selbstgeißelung, mit der er regelmäßig durch die Stadt ging und sich vor Schaufenstern die Nase plattdrückte, immer mit dem festen Vorsatz ein ausgegucktes Kleinod zu kaufen. Obwohl er sich in 95 % aller Fälle dann doch scheute das Geschäft zu betreten und die Transaktion durchzuführen, pendelte sich sein Kontostand am Monatsende doch immer wieder recht konstant bei Plus-Minus Null ein. Grund dafür waren sein immenser Zeitschriftenkonsum, den er sich gerne vierzig bis fünfzig Euro die Woche kosten ließ, um nicht auf der Arbeit vor Langeweile einzugehen, sowie seine Vorliebe für Nostalgie.
Genau genommen war Robert ein Anachronist. Stets erfüllt von einer Vergangenheitssehnsucht und irgendwo stehen geblieben, zwischen den späten 80ern und frühen 90ern, der Zeit seiner Kindheit und frühen Jugend. Eine Zeit, die er als romantisch verbrämte Hochphase seines noch jungen Lebens empfand. Um sich diesen Erinnerungen hingeben zu können, gab er enorme Summen für Zeitschriften, Musik, Filme, Spiele, Bücher und Spielzeug aus dieser Zeit aus. Die Suche nach den begehrten Sammelobjekten kostete ihn übrigens einen beträchtlichen Teil seiner kostbaren Freizeit, da er diverse Internetauktionshäuser hiernach durchforsten musste.
Robert konnte jedenfalls kein Verständnis für all diejenigen aufbringen, die sich darüber beschwerten, dass es ihnen doch so schlecht ginge und dass es in Deutschland ständig weiter bergab ginge.
Ließe man seinen Blick nur wenige hundert Kilometer über unsere östlichen Grenzen schweifen, konnte man schon sehen, was es hieß, wenn es einem wirklich schlecht ging. In keinem anderen Land der Erde war der Lebensstandard so hoch wie in Deutschland. Hier brauchte niemand auf der Straße zu verhungern, jedermann konnte auf eine umfassende medizinische Versorgung zurückgreifen und selbst wer nicht arbeitete bekam Geld um weiter existieren zu können und das nicht einmal schlecht. Es gab nahezu keinen Haushalt ohne Fernsehen oder Telefon, fließend Wasser und eine funktionierende Kanalisation. Zustände, die für den größten Teil der Weltbevölkerung paradiesisch anmuteten.
Bei zahlreichen Diskussionen, die er schon mit seiner Mutter, anderen Verwandten, Lehrern, Arbeitskollegen und Freunden geführt hatte, stieß diese Argumentation immer wieder auf taube Ohren. Das könne man nicht mit der Situation in Deutschland vergleichen, hieß es da. Warum nicht? Ob in Afrika, Asien oder anderen Teilen der Welt, in der Menschen darbten und von Hunger und Krieg bedroht waren, lebten doch schließlich auch Personen, die das gleiche Recht auf Freiheit und Unversehrtheit von Körper und Seele hatten, wie in diesen Breitengraden. Anscheinend sahen das Roberts Gesprächspartner anders.
Die Leute waren seiner Meinung nach einfach faul geworden. Faul für sich selbst zu sorgen, die Initiative zu ergreifen, einen eigenen Lebensplan zu entwerfen, oder gar für sich selbst zu denken. Es ging einfach zu lange alles gut.
Auch ohne Riester-Rente war Robert schon immer klargewesen, dass dieses System nur dann funktionieren kann, wenn jeder für sich selbst auch was zurücklegte.
Den Status Quo zu akzeptieren und sich dem eigenen Schicksal zu ergeben, konnte nur in Stagnation enden. Eine Stagnation in der die Gesellschaft seit einigen Jahren feststeckte. Außer dem Ausbau des Mobilfunknetzes und des systematischen Kreativitätsabbaus in der Unterhaltungsbranche hatte die Menschheit in den vergangenen zehn Jahren nicht viel zu Stande gebracht.
Die Leute brauchten neue Ideen. Und Robert hatte diese Ideen! Was er leider nicht hatte, war Zeit. Zeit, in der er seine Ideen konkretisieren und in die Tat umsetzten konnte.
„So Robert, ich geh erst mal in die Werkstatt.“, riss ihn K.s beißende Stimme schlagartig aus seinen Überlegungen.
Noch während er sprach hatte er sich eine Zigarette aus der kleinen Plastikschatulle genommen, in der er seine selbst gestopften Glimmstängel aufbewahrte und sie sich in den Mundwinkel gesteckt. Was jetzt folgte war für jeden anderen ein ganz gewöhnlicher, nicht weiter beachtenswerter Vorgang. Für Robert war es jedoch ein weiterer Aspekt, der ihm seine Arbeit unerträglich machte. Es war nicht einmal unbedingt das Rauchen an sich, was er schon als schlimm genug empfand, sondern vielmehr die damit verbundenen Begleitgeräusche waren es, die sein ästhetisches Empfinden störten.
Es fing an mit einem „Klick, klick“ des Feuerzeuges, gefolgt vom geräuschvollen Saugen am Filter des Tabakstäbchens. Es machte „Mmmpp“ während K. den blauen Dunst in seine Lungen sog. Nur Sekundenbruchteile später blies er den Rauch mit einem „Pfuuuh“ in die ohnehin schon mehr als unreine Luft des winzigen Raumes, aus dem er auch sodann entschwand und Robert mit dem herrlichen Qualm alleine ließ.
Wenigstens hatte dieser nun endlich Zeit für seine Zeitschrift. Es war die 10-jährige Jubiläumsausgabe, mit einem großen Preisausschreiben und zwölf Seiten Testberichten. Jene las Robert am liebsten, auch wenn er sich die Instrumente die am besten abschnitten, niemals würde leisten können, wenn er ein Leben lang in dieser Hütte hocken würde.
„Wer arbeitet, hat keine Zeit Geld zu verdienen“, hat mal ein kluger Mann gesagt. War es nicht sogar Rockefeller selbst, dieses Sinnbild des Reichtums? Was Robert alles angestellt hätte, wenn er nur das Geld dazu gehabt hätte…
Vor allem würde er diesen Laden ordentlich aufmischen. Er würde die komplette Firma kaufen, mit allen Niederlassungen und den Angestellten. Und dann würde er sie alle schließen und abreißen lassen. Alle würden ihren Job verlieren: der dämliche H., der „unverzichtbare“ K. und auch T., dem Robert es rein menschlich gesehen eigentlich nicht zumuten wollte. Hätte er ihn woanders kennen gelernt und nicht bei seinem 9-Stunden-Martyrium, wer weiß, wahrscheinlich wären sie gut miteinander ausgekommen.
Aber in dieser antiintellektuellen Hölle war jeder sein Feind. Er musste auf der Hut sein. Hinter jedem Bestellformular das ihm zugespielt wurde, hinter jeder Rechnung die es wegzuheften galt, befand sich eine gemeine Falle K.s, der nur darauf wartete, dass Office Boy, der Streiter für ein sinnvolles und geordnetes Arbeitsleben, das falsche Ersatzteil raussuchte, oder die Rechnung in den Ordner mit den Reparaturaufträgen ablegte.
Seine Handlanger waren ebenfalls darauf aus, den Superhelden mit den Kräften der Vernunft, des Anstandes und der Gabe der Intelligenz, mit ihrem grenzdebilen Kretinismus in den Wahnsinn zu treiben. H. war gerade dabei seine mutierten Schmierfinger einzusetzen um die fein säuberlich aufgestapelte und versandfertige Post über und über mit Öl zu beschmieren, während T. unablässig den Arm des Kaffeespenders bediente.
„Schrhürrrt, Schrhürrrt“, machte das Höllengerät, weil es schon so gut wie leergelutscht war und fast nur noch Luft ansaugen konnte. Fatal, denn T. setzte gleichzeitig dazu an eine seiner gefürchteten, erzdummen Fragen zu stellen. Sein Mund öffnete sich bereits, als Office Boy geistesgegenwärtig seinen Ordnungsstrahler Richtung Schlund abfeuerte, um dem Dämlack das Maul zu stopfen. Eine Körperdrehung später hatte er die Briefe mit seinen blitzsauberen weißen Handschuhen vor den Fängen des öligen Grabsch gerettet und mit einer geschickten Bewegung in der sicheren Schublade des Schreibtisches verstaut, wo sie unbehelligt darauf warten konnten vom Postboten abgeholt zu werden.
Blieb noch das nervenzerfetzende Geräusch der Mehrzweckkaffeekanne, Office Boys Kryptonit! Jetzt war Eile geboten, denn er spürte schon wie er schwächer wurde, wie die