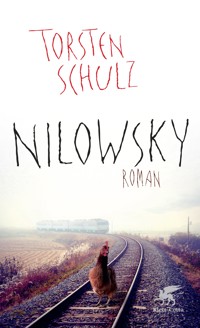17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Zeiten, in denen man in Beutenberge den Siegeszug des Erdöls ersehnte, sind längst vorbei. Stattdessen hoffen Lothar Ihm und seine Freunde höchstens noch auf die nächste geschmuggelte Platte aus dem Westen. Doch dann fällt ein Schwarm heiratswilliger Frauen in das havelländische Provinznest ein, und nichts bleibt mehr, wie es war. Ein herrlich skurriler DDR-Roman über die Beharrlichkeit von alten und neuen Mythen. Den Männern in der Familie Wutzner liegt das Aufspüren von Erdöl in den Genen. Kaum stapfen sie durch die Havelländische Heide, schon scheint unter ihren Füßen der Boden zu vibrieren. Dumm nur, dass das sprudelnde schwarze Gold jedes Mal wieder versiegt, wenn man es aus dem Boden holen will. Als der Staat in den 20er Jahren die Siedlung Beutenberge errichtete, glaubten die Bewohner noch an die verheißungsvollen Erdölquellen. Doch inzwischen ist man in der Realität angekommen, und Lothar Ihm, dem letzten Nachfahren der Wutznerschen Dynastie, bleibt nichts Besseres übrig als mit seinen DDR-Kumpanen Blutblase und Krücke im hauseigenen Garten dem Bier zuzusprechen und zu der aus dem Westen eingeschmuggelten Musik ausdrucksvoll mit dem Kopf zu nicken. Bis dann eines Tages ein Schwarm Frauen anrückt und Schluss ist mit der friedlichen männlichen Existenz zwischen Alkohol und Rockmusik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Torsten Schulz
Öl und Bienen
Roman
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2022 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: ANZINGER UND RASP Kommunikation GmbH, München
unter Verwendung einer Abbildung von © Plainpicture
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-98500-9
E-Book: ISBN 978-3-608-11838-4
Für Angelika undmeine Kinder, Stief- und Schwiegerkinder
Wie Edwin Kronokiewitschky mit seiner Wutzner-Geschichte die Zeche bezahlt und Krücke einen Traum erwähnt
»Ein ganzes Stück hinter Nauen, tief in der Havelländischen Heide, wo es außer Sand und Sträuchern kaum etwas zu sehen gibt, befand sich einst, von 1920 bis später, die Siedlung Beutenberge.«
So sagt es, knapp hundert Jahre nach 1920, der selbsternannte Heimatchronist Edwin Kronokiewitschky. Dann macht er eine Pause, in der sein Redebeginn nachklingen kann. Vor allem aber dient ihm die Pause dafür, einen Schluck Bier zu trinken. Und am Kräuterlikör zu nippen: Wurzelpeter, seine Stammsorte.
Früher, fügt er hinzu und ruckelt in seinem Rollstuhl hin und her, habe er nicht genippt, sondern ein ordentliches Glas in einem Zug geleert und mit Bier kräftig nachgespült. Dabei habe er am Tresen gestanden, hier in Schröders Wirtsstube am Rande von Nauen oder in irgendeiner anderen Kneipe, wie eine Eins habe er gestanden, vom Anfang eines Trinkabends bis zu seinem Ende. Erst seit ein paar Jahren, seit ihm, wie er es ausdrückt, das Blut täglich aufs Neue von den Beinen in den Kopf steigt, kriegt er das nicht mehr hin.
Das mit dem Blut im Kopf kauft ihm jeder ab, der sein dunkelrotes Gesicht sieht. Und da auch die Glatze dunkelrot ist, würde sich vermutlich niemand wundern, wenn der Kopf das viele Blut irgendwann nicht mehr aushalten und platzen würde. Freilich will keiner der Gäste seinen Kopf platzen sehen. Die Vorstellung reicht allemal.
Aus Nauen kommen die Besucher, aus Friesack und Falkensee, aus Wustermark und Schönwalde oder auch von weiter her, manchmal sogar aus Berlin. Fünf bis zehn an einem Sonntagabend, gelegentlich auch ein paar mehr, heute vierzehn. Edwin sieht keinen an, während er redet. Dass sie mit den Kneipenstühlen ein Halbrund um ihn gebildet haben, ist ihm allerdings nicht entgangen.
»Beutenberge«, fährt er fort, wie jemand, der einen großen Gedanken wiederaufnimmt. »Dieser Ort war ein Ort von Bedeutung. Und das lag am Erdöl. Oder am Traum vom Erdöl …«
Alle haben von der Geschichte, die Edwin hier an jedem Sonntagabend erzählt, bereits gehört. Aber da sie die Geschehnisse aus erster Hand dargeboten bekommen wollen, haben sie zum Heimatabend die Wirtsstube aufgesucht. An der Kneipentür mussten drei Euro Eintritt gezahlt werden; außerdem gehen Edwins Getränke auf die Rechnung der Gäste.
»Den Ersten Weltkrieg, das sollten Sie wissen, verlor Deutschland vor allem wegen des Erdöls. Das man für die Herstellung von Benzin brauchte, für Panzer, Lastwagen, Flugzeuge… U-Boote… Ich meine damit nicht, dass Deutschland den Krieg hätte gewinnen sollen. Obwohl es dann den zweiten, 1939, bestimmt nicht gegeben hätte.« Wer möchte das bestreiten, fügt er fast hinzu. Aber das erscheint ihm dann doch zu provokativ.
»Der Sieg der Gegner Deutschlands war ein Sieg des Erdöls, der die Weltgeschichte verändert hat. Logisch, dass die Verlierernation nach dem Ersten Weltkrieg wie verrückt nach diesem Stoff zu suchen begann. Unzählige Männer zogen los. Der eine oder andere kam ins Havelland.«
Edwin atmet tief ein und aus, seine Hände zittern. Er verbirgt sie nicht, im Gegenteil: Mit beiden Händen, so fest wie möglich, nimmt er das Bierglas, umklammert es und trinkt, bis nur noch eine Neige übrig geblieben ist. Nie trinkt Edwin sein Glas leer, immer bleibt eine Neige. Lucy Schröder, die Wirtin, ist schon auf dem Weg, ihm ein neues zu bringen.
»Adalbert Wutzner, so hieß einer der Männer, Mitte dreißig, Hauptfeldwebel a. D.« Eine Spur Wehmut ist in Edwins Stimme. Als spräche er über einen guten Bekannten, den er gern an seiner Seite hätte. »Ein respektabler Mann, dynamisch, kraftvoll. Verwunderlich nur die ausgesprochen dünnen Beine, die Wutzner-Beine, wie er sie selbst nannte. Aber gerade in denen steckte Kraft, das können Sie mir glauben. Außerdem immerfort rote, wässrige Augen, obwohl er, soviel bekannt ist, keinen Alkohol trank und auch sonst nichts nahm, was den Namen Droge verdient hätte. Seine Droge war, so gesehen, das Erdöl. Alles tat er, um es zu erahnen, zu fühlen, zu orten. Er pilgerte von Nauen nach Linumhorst und Kremmen, durchs havelländische Luch bis zum Westhavelland, über Felder, durch Wälder… grub und roch an der Erde, in die Erde hinein. Zwei Meter tiefe Löcher hob er aus, stampfte und hüpfte stundenlang in den Gruben, um durch die Vibration, die das Hüpfen auslöste, eine Gegenvibration des Öls zu erzeugen, die er sofort in den Füßen spüren würde, unverkennbar, wie er behauptete, wenn man ihn fragte oder auch wenn man ihn nicht fragte. Und wer ihm nicht glaubte, bekam es mit seinem harschen Befehlston zu tun. Hauptfeldwebel bleibt eben Hauptfeldwebel, a. D. hin oder her. Ja, Herrschaften, so war das bei ihm …«
Nicht nur dass Edwin, so scharf und laut, wie er ihn sich vorstellt, den Befehlston von Adalbert Wutzner darbietet, er ist sich auch bewusst, dass er das eine oder andere Detail enthüllen muss, um der Geschichte die Glaubwürdigkeit zu verleihen, die sie verdient.
»Adalbert Wutzner …« Die Lust, diesen Namen auszusprechen, ist ihm deutlich anzumerken. »Er suchte und suchte, und obwohl sich kaum jemand traute, ihm das zu sagen, hielten ihn die meisten für nicht ganz richtig im Kopf. Trotzdem hat er Unterkunft in Schuppen und Scheunen bekommen, auch Wasser und Brot, manchmal Wurst oder Speck. Selten von den Bauern, meist von ihren Frauen, die ihn für seine Hingabe bewunderten und denen er dann und wann schöne Augen machte, ohne freilich dass die Bauern davon etwas mitbekamen. Boten ihm die Frauen ein Gläschen Schnaps an, lehnte er ab; ein leidenschaftlich Suchender, der keinen Tropfen Alkohol trinkt – was konnte man sich Schöneres vorstellen? Und eines Tages«, so Edwin weiter, »geschah das, womit niemand, außer ihm selbst natürlich, mehr rechnete… Ein sonniger Frühlingsnachmittag, der schon den Sommer ahnen ließ, und da war es auf einmal: das Vibrieren. Seltsamerweise durch keine Aktivität von ihm ausgelöst. Im Gegenteil: Fast ein wenig achtlos war Adalbert Wutzner an einem Feldrain entlangspaziert, als er unter seinen Füßen plötzlich ein Beben verspürte. Unverzüglich hieb er den Spaten in die Erde und begann zu graben. Zwischenzeitlich hörte es auf, dann war es wieder da, und als er die Tiefe von einem Meter und fünfzig erreicht hatte, taten sich Risse in der Erde unter ihm auf. Er hielt inne, starrte auf die sich immer deutlicher abzeichnende Musterung und sah, wie aus den Rissen Erdöl hervorquoll. Dickflüssige schwarze Soße mit beißendem Schwefelgeruch …«
Edwin hält sich nicht dabei auf, den Gestank näher zu beschreiben oder die Farbe und Konsistenz des Öls. »Adalbert Wutzner«, fährt er fort, »war der Letzte, der im Havelland überhaupt noch suchte, und er war der Erste, der auf Erdöl stieß. Und was er damit auslöste, überstieg sein Vorstellungsvermögen und das der Havellandbewohner erst recht.«
Zunächst, so Edwin, kamen die staatlich geprüften Überprüfer, ihres Zeichens Geologen, Geophysiker und Chemiker, aus Potsdam, aus Brandenburg, schließlich aus Berlin. Sie nahmen Proben des Öls mit, untersuchten es in ihren Laboren, kamen wieder mit Bohrgeräten und Arbeitern und Technikern, die die Geräte bedienten. Adalbert Wutzner suchte beharrlich weiter, stapfte über Felder und Wiesen, und der edle Stoff ließ die Erde unter seinen Füßen nun häufiger vibrieren. Ein Wunder! Der Sommer brach an, die Zeitungen in Deutschland berichteten vom legendären Hauptfeldwebel a. D.; manche Blätter priesen ihn als Gott des schwarzen Goldes oder Zauberer für Deutschland. Adalbert Wutzner alias Wunder-Wutzner wurde mit Spenden aus industriellen Kreisen und von reichen Privatmenschen überschüttet. Friedrich Ebert, erster Reichspräsident der Weimarer Republik, empfing ihn und verlieh den Orden Ehrenzeichen der Republik für Forscher und Erfinder. Ein Finder, sprach der Reichspräsident zum Hauptfeldwebel a. D., sei mehr noch als ein Erfinder, auch wenn das Wort zwei Buchstaben weniger habe als das andere. Ein Finder nämlich sieht, was es alles gibt in Gottes schöner Welt, ein Erfinder fantasiert sich nur etwas zurecht.
Bei Potsdam, nicht weit entfernt vom Griebnitzsee, wurde die Wutzner-Villa gebaut, ein Geschenk des Staates; Adalbert heiratete die wenig bekannte, aber sehr hübsche Schauspielerin Ottilie »Ottchen« Schulze, zog mit ihr in die Villa und schwängerte sie. Und während all dies geschah, gedieh im Havelland der Traum von der Erdölförderung, und in unmittelbarer Nähe der Fundstellen entstand die Siedlung Beutenberge. Alles wäre gut gewesen, ja perfekt, wenn nicht das Öl… ja, man müsse es wohl so nennen… plötzlich abhandengekommen wäre. Auch dies ein Wunder: Bereits wenige Wochen nach dem Beginn der Förderarbeiten war es fort. Man bohrte tiefer, es blieb fort. Man bohrte so tief es möglich war – kein Tropfen. Eine Tücke der Natur? Ein perfider Sabotageakt, wie und von wem? Oder von vornherein Betrug? Wer ist denn eigentlich dieser Adalbert Wutzner, begann man sich nicht nur in Potsdam, sondern auch in Berlin und schließlich überall in der Republik zu fragen. Ein Hauptfeldwebel a. D. – ja schön, aber was hat er denn gelernt? Was ließ ihn denn in irgendeiner Weise mit Erdöl in Verbindung stehen? Nichts. Oder seit wann hätten Bürokaufleute, wie er doch einer war, eine spezielle Beziehung zu diesem Stoff? So sehr sich Adalbert Wutzner auch zu verteidigen suchte, man hielt ihn für einen ausgemachten Hochstapler. Auch sein Argument, dass Fachleute die Erdölvorkommen bestätigt hätten, fruchtete nicht. Sie, die Fachleute, hätten sich blenden lassen von seiner unverschämten Hochstapelei. »Ohne Frage«, so Edwins wohlbedachtes Resümee, »Adalbert Wutzner war der Sündenbock für die unerfüllten Hoffnungen der Menschen… Und sein Fall ein Vorbote jener Irrationalität, die die Welt in späteren Jahren beinahe vollständig in Schutt und Asche legte.«
Wenn schon solch eine Sentenz, dann muss sie auch nachklingen. Das kann sie, während der nächste Wurzelpeter, das nächste Bier serviert werden. Und weiter geht’s: Nach einer Gnadenfrist von einem Monat, in der sich immer noch kein Tröpfchen zeigte, erhielt Adalbert Wutzner eine Anklage wegen Betrugs und wurde zu einer Haftstrafe von sechs Jahren ohne Bewährung verurteilt. Ottilie Wutzner ließ sich scheiden und heiratete bald darauf den halbwegs bekannten Schriftsteller Diethard Simmel, der ihr zu einem Theaterengagement in einer Stadt namens Oberhausen verhalf. Sie gebar einen Sohn, der vom neuen Mann adoptiert wurde. Egon Simmel, so hieß das Kind.
Edwin macht die nächste Schluck-Bier-Pause. Einen Vortrag, weiß er, steigert man am eindrucksvollsten, indem man von der Vergangenheit in die Gegenwart wechselt. Das tut er wie jedes Mal an dieser Stelle:
»Als Egon dreizehn Jahre alt ist, lässt sich seine Mutter abermals scheiden und erzählt dem Jungen, dass sein Vater nicht dieser Simmel sei, sondern ein Mann namens Adalbert Wutzner… ein großer Abenteurer, der fürs Vaterland Erdöl fand, doch dann, weil das Erdöl ausblieb, inhaftiert wurde. Egon fühlt sich von der Mutter verraten… zumal er seinen Adoptivvater sowieso nie mochte. Mit achtzehn verlässt er sie, zieht nach Berlin, wo er als gelernter Fliesenleger eine Arbeit findet. Es ist das Jahr 1938, die Nazis an der Macht. Er versucht, Adalbert Wutzner zu finden. Deshalb fährt er nach Beutenberge. Wo, wenn nicht dort, kann man etwas wissen?«
Mit dem Regionalzug bis Nauen, so Edwin, dann mit einem langsamen Überlandbus, der nach über einer Stunde Halt in Beutenberge macht. Wo sind denn hier die Berge, fragt sich Egon, als er auf dem Hauptweg steht, einem schlichten Betonplattenweg, von dem fünf kleine Schotterstraßen abgehen, die links und rechts von grau verputzten Häuschen mit flachen Satteldächern gesäumt sind. Er geht ins Lebensmittelgeschäft, das sich von den anderen Häuschen nur durch ein Schild mit der Aufschrift Frische Waren unterscheidet. Dort steht eine schlanke Enddreißigerin hinterm Verkaufstisch, Kurzhaarschnitt, hochgeschlossene Bluse, die Inhaberin des Ladens. Ich suche meinen Vater, Adalbert Wutzner, sagt Egon. Hab ihn hier nicht im Sortiment, antwortet Elfriede Schrebnitz. Egon verlässt den Laden, geht durch die Siedlung, und als er im Talweg auf eine kleine, rundliche Frau trifft, die hinterm Gartenzaun ihre Tulpen gießt, versucht er es aufs Neue: Entschuldigen Sie bitte, ich suche meinen Vater, Adalbert Wutzner. Die Frau ist Mitte dreißig, ihr Blick freundlich, mitleidvoll. Ach, dann kommen Sie einfach mal rein.
Edelgard Nickel heiße sie, und natürlich kenne sie den Herrn Wutzner. Ohne ihn wäre sie ja nicht in Beutenberge gelandet. Sechzehn war sie, und ihr Vater sollte das Erdöl aus der Erde holen. Aber da es das nach ein paar Wochen nicht mehr gab, musste er sich in Nauen eine Arbeit im Tiefbau suchen. Und Adalbert Wutzner, fragt Egon vorsichtig. Edelgards Augen füllen sich mit Tränen. Ein schöner Mann, irgendwie so. Sie ähneln ihm sehr. Er ist im Gefängnis gestorben. So haben wir’s gehört. Kurz bevor er rausgekommen wäre, soll’s passiert sein.
Egon ist erschüttert. Er fährt nach Berlin und beantragt die Änderung seines Nachnamens. Zunächst will man seinem Ansinnen nicht folgen, doch als er Adalbert Wutzner, ohne auch nur das Mindeste über dessen politische Haltung zu wissen, als national begeisterten Menschen schildert, als Vorreiter des Nationalsozialismus, bekommt er die Umbenennung genehmigt. Als Egon Wutzner kehrt er zurück nach Beutenberge und bittet Edelgard Nickel um Unterkunft. Sie ist entzückt von dem jungen Mann auf den Spuren des Vaters. Wenn sie nicht sechzehn Jahre älter wäre als er, wer weiß, was sich zwischen ihnen entspinnen könnte. Sie genießt es, den Wutzner-Sohn zu umsorgen, und er genießt es, von ihr umsorgt zu werden; Erotisches kommt ihm nicht in den Sinn. Das ist anders, wenn er das Lebensmittelgeschäft betritt und die mürrische Elfriede Schrebnitz erlebt. Obwohl sie ebenfalls der Rubrik alte Jungfer zugerechnet wird und sogar zwanzig Jahre älter ist als Egon, stellen sich bei ihm bestimmte Fantasien ein, die er nur abstrus und schmutzig finden kann; missen jedoch möchte er sie keinesfalls: Einmal reißt er ihre Bluse auf, und die Knöpfe fliegen im Laden umher. Ein andermal fasst er derart flink unter ihren langen Rock und packt ihre Beine, sodass sie nicht wegrennen kann und sich vor Schreck auch nicht wehrt, stattdessen einen ebenso überraschten wie wonnevollen Seufzer von sich gibt. Niemandem erzählt er etwas von diesen Vorstellungen; wem sollte er auch? Sicherlich werden sie ausbleiben, sobald er das erste Mal Sex gehabt haben wird. Nur wann und mit wem? Egal. Hier jedenfalls nicht. Hier ist er, um die Mission seines Vaters zu erfüllen.
Jeden Morgen läuft er los, Kilometer um Kilometer, über Felder und Wiesen, durch Dörfer und Wälder, Spaten und Spitzhacke hat er dabei und einen Elan, der größer nicht sein könnte. Von den Bauern und Bäuerinnen erfährt er, wie der Vater vorgegangen ist, und tut es ihm nach: Gräbt und riecht an der Erde, in die Erde hinein; zweimetertiefe Löcher hebt er aus, stampft und hüpft stundenlang in den Gruben.
Nicht lange, und Staat und Partei werden auf ihn aufmerksam. Emil Stürtz, Gauleiter des Gaus Kurmark, lässt ihn zu sich beordern, und Egon gelingt es, den Parteifunktionär von der Glaubwürdigkeit seines Unterfangens zu überzeugen. Das ganze Havelland, so sein Traum, soll voller moderner Pferdekopfpumpen sein; wunderschöne Gebilde, eine Augenweide für jeden Freund, angsteinflößend für alle Feinde. Darüber hinaus werde er mit dem Ölfund die Ehre seines Vaters wiederherstellen. Adalbert Wutzner, der durch und durch nationalsozialistisch gedacht und gefühlt habe, würde stolz auf ihn sein, wenn er nicht in der verhassten Weimarer Republik sein Leben hätte lassen müssen. Gauleiter Stürtz ist die nationalsozialistische Gesinnung Adalbert Wutzners unbekannt; aber wenn es denn so sei, soll es ihm und dem Vaterland recht sein.
Egon Wutzner sucht den Sommer über und den Herbst, bis es winterlich kalt wird und Bodenfrost droht. Jede Nacht kehrt er erschöpft, doch mit unvermindertem Glauben ins Häuschen von Edelgard Nickel zurück. Er verzehrt das Abendessen, das für ihn bereitsteht, schläft drei Stunden und zieht aufs Neue los. Die dünnen Wutzner-Beine, vom Vater geerbt, haben bald jeden Zentimeter Erde zwischen Nauen, Oberkrämer, Friesack und Havelsee berührt, aber nicht ein einziges Mal hat es unter ihnen vibriert. Eines Nachts läuft er nicht zurück nach Beutenberge, sondern weiter von Pessin nach Paulinenaue, nach Wiesenau, Fehrbellin, Temnitztal… Er läuft und läuft, Spaten und Spitzhacke im Rucksack. Die Füße schmerzen, der Kopf schmerzt, er muss weiterlaufen, um den Schmerz nicht mehr zu spüren. Einmal schläft er im Gehen ein, stolpert über einen Strauch, stürzt und rappelt sich auf. Weiter, weiter, die Schritte werden kleiner, manchmal torkelt er, schlägt sich mit den flachen Händen ins Gesicht, um wach zu bleiben… Die Morgendämmerung setzt ein, Raureif auf den Wiesen, eine fahle Sonne hinterm Wald, in dem es knackt und knistert. Neben einer riesigen Eiche bleibt er stehen. Kann nicht mehr gehen, legt den Kopf auf die Brust, lässt sich auf die Knie sinken. Nur wenige Sekunden, und er wird vornüberfallen, und die Kälte aus dem Boden wird seinen Körper umklammern. Er wird nicht mehr aufstehen, nie mehr. Der Tod durch Erfrieren ist ein schöner Tod. So hat er es einmal gehört. Wo? Von wem? Egal. Er legt sich bäuchlings auf die Erde, die Augen geschlossen. Schläft er schon, und ist das Vibrieren ein Vibrieren im Traum? Es breitet sich unterm Bauch bis zum Herzen aus, wärmt den Brustkorb, den Hals, den Kopf. Noch im Liegen greift er nach dem Rucksack auf seinem Rücken, holt die Spitzhacke heraus. Springt auf, beginnt zu hacken, dem Vibrieren entgegen, Zentimeter um Zentimeter… Gegen Mittag finden ihn Bauern, hieven den Bewusstlosen aus der metertiefen Grube, schleifen ihn zu ihrem Pferdefuhrwerk, rütteln ihn wach, versorgen ihn mit Wasser und Brot und fahren diesen Menschen, der zusammenhanglos von seinem Vater, vom Vaterland, vom kommenden Krieg und vom Erdöl redet, nach Nauen ins Krankenhaus.
Edwin ist nicht weniger außer Atem, als es Egon Wutzner gewesen sein muss. Ein Schluck Bier hilft, um weiterreden zu können: Egon, kaum wieder bei Kräften, flüchtet aus dem Krankenhaus, Richtung Temnitztal, dorthin, wo Spaten und Spitzhacke noch liegen, sofern sich nicht irgendjemand ihrer bemächtigt hat. Kurz vor Paulinenaue wird er von der Polizei gestellt. Man will ihn in die ärztliche Obhut zurückbringen, aber er widersetzt sich, schlägt auf die Polizisten ein und wird verhaftet. In der Untersuchungshaft verlangt er, den Gauleiter Stürtz zu sprechen, doch der, vom Gericht benachrichtigt, gibt vor, einen Egon Wutzner nicht zu kennen. Im Prozess geht Egon auf die Strafvorwürfe nicht ein, sondern erläutert, dass er nur eines im Sinn gehabt habe: dem Vaterland zu dienen, das große Mengen Erdöl brauche, um einen motorisierten Krieg zu gewinnen.
Am letzten Tag des Prozesses kommt es zur Wiederbegegnung mit drei Frauen aus Beutenberge, die als Zeuginnen geladen sind: Elfriede Schrebnitz, Edelgard Nickel und Lucinde Ihm, die Edelgards Nachbarin ist; Egon kennt sie nur vom Grüßen. Elfriede Schrebnitz kann oder will auch im ehrwürdigen Potsdamer Gerichtssaal nicht auf ihre mürrische Art verzichten: Was sie denn sagen solle. Kenne den Mann ja kaum. War nett und höflich, reicht das? Immerhin, von ihr hat Egon ein schlechteres Zeugnis befürchtet. Edelgard Nickel indes schwärmt unter Tränen, dass sie noch nie einen Menschen erlebt habe, der anständiger gewesen wäre als Egon Wutzner. Sie fällt fast in Ohnmacht bei so viel Lob; Lucinde Ihm muss sie stützen und sagt, dass sie Herrn Wutzner eigentlich nicht kenne, aber das Vaterland müsse dankbar sein für junge Männer, die sich derart aufopfern.
Egon Wutzner wird freigesprochen, Beutenberge allerdings darf er, aus Gründen der Volkssicherheit, nie wieder betreten. Wenige Monate später beginnt der Krieg, und Egon wird eingezogen. Nach Polen muss er, dann weiter nach Russland, wo er von Adolf Hitlers »Weisung Nr. 41« hört: Zunächst soll Stalingrad erobert werden, danach der Kaukasusraum mit seinen Erdölzentren. Welch immense Bedeutung das schwarze Gold für den Führer hat, wird ihm vollends bewusst, als er von dessen Worten auf einer Oberbefehlshaber-Besprechung hört: »Wenn ich das Öl von Maikop und Grosny nicht bekomme, muss ich diesen Krieg liquidieren.«
Egon ist dermaßen begeistert, dass er nicht im Entferntesten ahnt, dass dieses Vorhaben der Anfang vom Ende ist. Drei Monate später wird es in der Schlacht um Stalingrad im Grunde genommen schon besiegelt. Von nun an ist die Wehrmacht auf dem Rückzug, doch Egon glaubt an eine Wende zum Sieg, mit sprudelnden Ölquellen fürs Deutsche Reich. Noch im Jahr 1944, als er seinen ersten Heimaturlaub antritt, glaubt er daran und fährt nach Beutenberge. Die Auflage, den Ort aus Gründen der Volkssicherheit nicht mehr betreten zu dürfen, stammt noch aus der Zeit des Friedens; der Krieg, so entscheidet er für sich, kennt solche Anordnungen nicht.
Von einem Kameraden hat sich Egon ein Motorrad ausgeborgt, eine BMW R75; den Rucksack aus der Erdölsucherzeit mit drei Flaschen Wacholderschnaps gefüllt, hält er am Dorfeingang. Es ist ein warmer Frühherbstabend, er fühlt sich zu Hause, und zugleich ist er aufgeregt wie nie zuvor. Er trinkt einen kräftigen Schluck, und da er trotz vieler Soldatenbesäufnisse nicht viel verträgt, verliert er ein wenig die Kontrolle über seine Wutzner-Beine. Leicht torkelnd geht er auf das Lebensmittelgeschäft zu, in dem Elfriede Schrebnitz Zucker- und Mehltüten in Regale sortiert. Fast erstarrt sie, als er in der Tür steht. Ich denke, Sie sind an der Ostfront. – Jetzt bin ich hier. – Desertiert? Mürrisch hört es sich an, hochmütig. Egon spürt Wut in sich aufsteigen: Was heißt hier desertiert? Sie antwortet nicht. Ihre Bluse ist bis zum Hals zugeknöpft. Egon nimmt den nächsten Schluck, geht auf sie zu, doch bevor er die Bluse aufreißen kann, ist sie ein Stück zurückgewichen. Du dussliger Kerl, verschwinde. – Warum? – Ich mach mir nichts aus dir. – Warum? – Ich mach mir nichts aus Kerlen. Verschwinde. – Hässliche Ziege, stößt Egon hervor, torkelt aus dem Laden, den Hauptweg entlang, den Talweg hinauf. Edelgard Nickel gräbt Tulpenzwiebeln ein, sieht ihn, stößt einen Seufzer aus vor Freude. Bist du gesund, wie geht es dir? Die kleine rundliche Frau fasst seine Hand, zieht ihn in ihr Häuschen. Wie ein Mädchen, denkt Egon. Ein altes Mädchen. Ich koche für dich, ich sorge für dich, ruh dich aus, so lange du willst. – Ich ruh mich aus, wenn ich tot bin. – Tot, mein Lieber, bist du noch lange nicht. – Ja, sagt er, packt ihren Kopf mit beiden Händen und küsst sie. Sie fängt an zu zittern, stößt einen Schrei aus, reißt sich von ihm los. Was ist mit dir? Du bist ja betrunken. Ich dachte, du wärst ein anständiger Mensch… Er winkt nur ab, torkelt hinaus. Sieht Lucinde Ihm in ihrer Haustür stehen. Sie bewegt ihren Kopf zum Zeichen, dass er herüberkommen soll.
Sie ist die jüngste unter den drei Frauen; achtunddreißig Jahre alt, klein und dünn, aber mit einem großen, kräftigen Hintern gesegnet, wie Egon findet. Sie sitzen in ihrer Küche, trinken Wacholderschnaps, und Lucinde erläutert ihm, dass sie in Nauen als Putzkraft in einer Schule arbeite und die Kinder dort so nervtötend finde, dass sie hofft, der Führer werde die Ungeheuer bald für seine großen Kriege benötigen, wo aus ihnen vielleicht doch noch anständige Menschen werden. Anständige Menschen, lallt Egon grinsend vor sich hin, worauf Lucinde ihn unvermittelt fragt, wie man denn eigentlich so bescheuert sein könne, im Havelland nach Erdöl zu suchen. Hätte sie mit ihrer Aussage vor Gericht nicht zu seinem Freispruch beigetragen, würde er jetzt aufstehen und sie an der Gurgel packen, auch wenn der Schnaps seine dünnen Beine schon fast lahmgelegt hat. So aber schnappt er sich Lucindes riesige Segelohren, zieht ihr Gesicht zu sich heran und sagt in feierlichem Ton: Ich mach dir… einen Sohn… fürs Vaterland. Niemand würde bei diesen Worten darauf kommen, dass Egon Wutzner noch nie Sex gehabt hat. Er lässt sich, Lucindes Ohren unverändert fest im Griff, mit ihr auf den Küchenboden sinken, hebt ihren Rock, zieht ihren Schlüpfer herunter …
Wie jedes Mal an dieser Stelle unterbricht Edwin seinen Vortrag, denn was er nun sagen müsste, kann sich jeder selbst denken. Er ist auch kein Meister bestimmter Beschreibungen, also versucht er es besser erst gar nicht. Stattdessen ein Schluck Bier und kräftiges Durchschnaufen. Und weiter geht’s: Egon Wutzner steckt die halbvolle Flasche Wacholderschnaps in seinen Rucksack und fährt mit der BMW R75 los. Der entgeisterten Lucinde, die ihm von der Haustür aus hinterherstarrt, ruft er zu, dass er wiederkomme, sobald der Krieg zu Ende sei, und sein Söhnchen werde den stolzen Namen Wutzner tragen.
Mit Beginn der Dunkelheit hat Egon seine metertiefe Grube erreicht, neben der riesigen Eiche. Wie nach fünf Jahren nicht anders zu erwarten, sind Spitzhacke und Spaten fort. Aber zur Not würde er auch mit bloßen Händen das kräftig gewachsene Gras herausreißen und weitergraben. Er stampft und springt, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, doch der Boden vibriert nicht, nicht ein bisschen. Gut, sagt er sich, dann eben nicht. Die Erdölfrage hat sich nach Russland verlagert; noch kann Russland erobert werden, da gibt es keinen Zweifel, da muss man einfach optimistisch bleiben.
Zurück an der Front, trifft ihn am dritten Tag eine Partisanenkugel ins Herz. Egon Wutzner ist, wie es heißt, auf der Stelle tot. In der Brusttasche seiner Uniform findet sich ein Zettel mit der Notiz, dass im Falle seines Ablebens Frau Lucinde Ihm aus der Siedlung Beutenberge im Havelland zu benachrichtigen sei.
Mit dieser Feststellung könnte der selbsternannte Heimatchronist Edwin Kronokiewitschky seine Erzählung beenden, doch die Pointe, wegen der er überhaupt Abend für Abend berichtet, steht noch aus: Als Lucinde vier Wochen später von Egons Tod erfährt, weiß sie bereits, dass sie von ihm schwanger ist. Sie hat mit einigen Männern geschlafen, von keinem ist sie schwanger geworden. Und nun mit achtunddreißig… dass das überhaupt noch geht in dem Alter… Und dann von einem Mann, den sie im Grunde genommen gar nicht kennt. Von einem Verrückten… Wer weiß, was der an Absonderlichkeiten zu vererben hat. Wäre jedenfalls ein Wunder, wenn das Balg nicht noch nervtötender wäre als alle anderen. Keine Frage, es muss weg. Lucinde klettert auf den Küchentisch, springt auf den Fußboden, drei Mal, sechs Mal, zehn Mal… Nichts passiert, zumindest spürt sie nichts. Das soll so sein, Schicksal… Und überhaupt: Ist es nicht so, dass es Unglück und nichts als Unglück bringt, die von einem Toten stammende Frucht abzutreiben?
Lucinde Ihm lebt ihr Leben weiter, als wäre nichts geschehen: Sie fährt mit dem Überlandbus nach Nauen, um in der Schule Reinigungsarbeiten zu verrichten; nachmittags fährt sie heim, hört Blasmusik im Radio, kocht ihr Essen und pflegt den Garten, und als der Krieg zu Ende geht, ist sie hochschwanger. Zwei Monate später kommt ihr Kind auf die Welt, tatsächlich ein Sohn; Lothar nennt sie ihn. »Mein Freund Lothar Ihm«, betont Edwin. »Der Ihmsche, wie wir ihn nannten, über viele Jahre …«
Damit macht er einen Punkt; es ist der Punkt, den er jedes Mal macht. Würde ihn jemand fragen, wie er sich fühlt, würde er sagen: Wie ein Lappen, der bis zum letzten Tropfen ausgewrungen ist. Ein paar Bier könnten helfen, den Lappen wieder in Schwung zu bringen. Aber wozu? Lothar Ihm, der Ihmsche… auch er ein Finder des schwarzen Goldes. Aber das ist ein anderes Kapitel, zu viel für einen Abend und zu intim für fremde Menschen. Ach Lothar, könntest du doch hier sein. Oder gäbe es wenigstens die Chance, dich wiederzusehen, mit dir zu sprechen, zu trinken.
Lucy Schröder kassiert die Gäste ab; das Trinkgeld, das reichlich gezahlt wird, steckt sie Edwin in die Brusttasche seines Hemds. Obendrein bekommt er eine Flasche Wurzelpeter. Von ihr aus könnte es auch ein anderer Kräuterlikör aus höherer Preisklasse sein, doch Edwin will nur seine Stammsorte. Das sei eben Tradition. Die brauche der Mensch.
Auch wenn sie am Wahrheitsgehalt seiner Erzählung zweifeln, wichtig ist, dass die Leute ihm zuhören, ihn erleben wollen und das, was er erzählt, zumindest Teile davon, für möglich halten. Außerdem: In welcher Kleinstadt, nicht nur in Brandenburg, sondern im ganzen Osten, gibt es denn noch eine Kneipe, in der solch ein Heimatabend stattfindet? Sonntag für Sonntag, wie ein Monolog im Theater. Lucy ist gewissermaßen die Intendantin; darauf ist sie stolz. Wenn das nicht so wäre, hätte sie mit ihren siebzig Jahren die Kneipe längst verkauft.
Edwin Kronokiewitschky winkt den Gästen hinterher, die Schröders Wirtsstube verlassen, ohne ihn mit Fragen oder Bemerkungen belästigt zu haben. Vielleicht gehen sie in eine andere Kneipe, um sich untereinander auszutauschen; hier jedenfalls ist Feierabend.
»Na dann, bis zum nächsten Mal«, verabschiedet sich Edwin von Lucy Schröder, und sie denkt sich wieder einmal, ob er nicht, so klug und fantasievoll wie er reden kann, ein attraktiver Mann wäre, in den man sich unter Umständen sogar verlieben könnte. Aber was heißt hier Umstände? Er ist ein alter Säufer, ein Wrack, dessen Gegenwart einzig und allein darin zu bestehen scheint, dass er einen Heimatchronisten spielt, die Rolle seines Lebens, die sich nur aus Vergangenem speist.
*
Für einen alten Sack gibt es kein gutes Wetter, sagt sich Edwin, als er im Rollstuhl die Karl-Marx-Straße Richtung Güterbahnhof hinunterfährt. Und eine gute Jahreszeit erst recht nicht. Im Sommer schwitzt man jeden Tropfen Alkohol fünffach aus, im Herbst kriecht einem die Dunkelheit ins Gemüt, bis man sich nur noch vor den nächsten Güterzug werfen will, im Winter klappern die morschen Knochen und die Menschen rennen vor einem weg, weil sie denken, der Sensenmann ist gekommen. Und der Frühling? Der Frühling ist die gefährlichste Jahreszeit: Das Herz schlägt höher, das Blut fließt schneller, aber es fließt nicht, wie es fließen soll, immer schön im Kreis herum, es fließt von unten nach oben, und irgendwann, bevor der Sommer beginnt, ist es tatsächlich so weit, dass kein Milligramm Blut mehr in den Beinen ist und der Kopf platzt, weil der rote Saft nicht weiß, wohin.
Die Jalousien an Krückes Fenstern sind wie immer heruntergelassen. Niemand soll ihn sehen. Deshalb geht er auch nicht aus der Wohnung. Wenn er etwas braucht, bringt Edwin es ihm mit: Bier, Schnaps, Brot, Butter, gelegentlich einen Apfel oder eine Möhre. Edwin, den er Blutblase nennt, so wie früher schon; früher, als sie Lothar Ihm den Ihmschen genannt haben. Er selbst, Heiner Schmidtke, heißt seit seiner Beinamputation Krücke, obwohl er nie eine Krücke benutzt hat. Erst vor ein paar Jahren hat er von der Krankenkasse einen Rollstuhl bekommen. Aber da er seine Erdgeschosswohnung nicht verlässt, hat er ihn dem Freund geborgt. Eine Dauerleihgabe, die mit dem Tod enden wird; mal sehen, wessen Tod zuerst kommt.
Edwin klopft an die Jalousie vom Küchenfenster, hinter dem Krücke sitzt. Drei Mal kurz, drei Mal lang, das ist ihr verabredetes Zeichen. Dann rollt er durch den offenstehenden Hauseingang und wird vom Freund in der Wohnungstür erwartet. Sie stoßen die Fäuste aneinander, bevor Edwin über den Flur in die Küche rollt, die Flasche Wurzelpeter unter der Jacke hervorholt und sie auf den Tisch stellt. »Absacker!«, sagt er. Es klingt wie ein Befehl.
Das erste Glas auf ex, das zweite hingegen langsam und schweigend. Beim dritten Glas klopft Krücke sich zwei Mal kurz hintereinander aufs Holzbein und stellt seinen Gedankenstrom auf laut: »… Muss hier nicht raus, höchstens mit den Füßen zuerst, aber das kann gerne noch ’n bisschen hin sein. Hab genug gesehen, reicht für zwei Leben, mindestens… Will ich mir nicht kaputt machen… durch unnütze neue Eindrücke. Außerdem, hab dich ja. Wehe, du kommst nicht mehr …«
Edwin betrachtet den Freund, den er seit der Schulzeit kennt. Mit fünfzehn ließ sich Heiner Schmidtke seinen Vokuhila wachsen, Vorne-kurz-hinten-lang, aber davon ist nichts mehr zu sehen. Ein fusseliger Haarkranz ist übrig geblieben; eine Opa-Frisur, wie sie es früher nannten. Nur die lange Hakennase hat sich nicht verändert; sie ist picklig wie in der Pubertät. Greisen-Pubertät, sagt Krücke dazu, wenn er sich bisweilen einen Pickel ausdrückt.
Edwin muss nicht erklären, dass er so lange kommen wird, wie es ihm möglich ist, und Krücke erwartet diese Zusicherung auch nicht. Im Gegenteil, sie wäre fast eine Beleidigung, denn unter Freunden ist es doch selbstverständlich, dass der eine den anderen besucht, so lange es geht. Und Krücke bei seiner Litanei zuzuhören, ist für Edwin eine Art Ehrensache.