
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Winter 1942: Leningrad ist von Soldaten eingeschlossen, und Oleg muss seiner kranken Mutter Essen besorgen. Winter 1942: Leningrad ist von deutschen Truppen eingeschlossen. Die Bevölkerung der Stadt ist dem Hungertod nahe. Nur mit Mühen kann der 12-jährige Oleg seine kranke Mutter mit etwas Suppe versorgen. Zusammen mit seiner schon zu Tode erschöpften Freundin macht er sich auf den Weg zu einer Kartoffelmiete außerhalb der Stadt. Da sehen sich die Kinder unversehens von deutschen Soldaten umgeben...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jaap ter Haar
Olegoder Die belagerte Stadt
Roman
Aus dem Niederländischen vonJutta und Theodor Knust
Deutscher Taschenbuch Verlag
2010 Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG
© 1997 der deutschsprachigen Ausgabe: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-41946-8 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-07858-0
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website www.dtv.de/ebooks
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
1
Oleg Turjenkow schlief. In der Ferne war das Donnern der deutschen Geschütze zu hören. Sprengbomben, Brandbomben und Granaten fielen auf die sterbende Stadt Leningrad, die nicht bereit war, den Kampf aufzugeben. Es war Dezember 1942.
Oleg Turjenkow schlief und träumte. Es war fast immer derselbe Traum . . .
Dutzende von Lastern bewegten sich, im Zickzack fahrend, über den zugefrorenen Ladogasee. Wie eine weiße Hölle voller Gefahren und Unsicherheiten erstreckte sich vor ihnen die beschneite Eisfläche. Wo lagen die schwachen Stellen? Wo die Waken, die Löcher im Eis? Der Tod fuhr mit. Er hockte auf jedem der Laster, die mit Lebensmitteln auf dem Weg in das belagerte, ausgehungerte Leningrad waren.
Rutschende Räder . . . berstendes Eis . . . aufspritzendes Wasser! Links versank Solymski mit seinem Beifahrer in der Tiefe: Einen Augenblick schwankte der Laster, während das Eis unter den Rädern brach. Dann tauchte die Nase zwischen den Schollen unter. Langsam, quälend langsam verschwand eine kostbare Ladung Lebensmittel im eisigen Wasser. Und Solymski und sein Beifahrer in der kleinen versinkenden Kabine sahen sich untergehen. Ein Wassertier mit scheußlichem Kopf und vorquellenden Augen – so tauchte der Laster noch einmal aus der dunklen Tiefe auf. Mit gewaltigen Flossen zerschlug er das Eis. Die Windschutzscheibe barst . . .
Der Konvoi fuhr weiter. Niemand durfte anhalten, um Hilfe zu leisten. So lautete der Befehl.
Und in der Ferne der Donner der deutschen Geschütze. Aus der dunklen Frostnacht schob sich das erste Morgengrauen am Horizont hoch.
Im Traum saß Oleg neben seinem Vater in der Kabine.
»Nach links!«, murmelte er im Schlaf. »Vater, nach links! Nach links!« Er wollte die Worte hinausschreien, aber seine Kehle war zugeschnürt.
Im Traum sah er das ruhige und vertraute Gesicht seines Vaters wie in einem Film vor sich. Sein Vater schaute durch die zugefrorene Windschutzscheibe auf das Eis, auf die Spuren, die die Wagen vor ihm durch den Schnee zogen. Er drehte das Lenkrad jedoch nicht nach links, sondern nach rechts.
Unter dem Eis schwamm das Wasservieh riesenhaft groß vor dem Lastwagen her. Schnee . . . schwarzes Eis . . . Wasser . . . Dazwischen die Flossen, das große Fischmaul, die vorquellenden Augen . . .
Plötzlich erklang aus einem schwarzen Loch im Himmel schauriges Geheul. Ein einsames Jagdflugzeug stürzte aus den Sternen nach unten. Die Maschinengewehre ratterten. Die Sterne barsten zwischen Eisschollen und aufspritzendem Wasser auseinander, als die ersten Granaten einschlugen. Olegs Vater umklammerte verbissen das Lenkrad und wich abermals nach rechts aus. Schräg hinter ihm kippte Iwanows Wagen um. Das Eis brach . . . Neben ihm fuhr Pawlitschko mit zersplitterter Windschutzscheibe in eine Wake und verschwand mit seinem Beifahrer und allen Lebensmitteln in der Tiefe des Sees.
Der Kopf des Jungen bewegte sich im Schlaf auf dem Kopfkissen hin und her, als ob er zu all diesen Traumbildern Nein sagen wollte. Er murmelte unverständliche Worte und krallte die Hände in die Bettdecke.
Wie wild gewordene Elefanten fuhren die Laster im Zickzack über das Eis, um den Kugeln, Granaten und Waken zu entgehen. Der Tod fuhr mit.
Mit rutschenden Rädern lenkte Olegs Vater seinen Wagen über die weiße Fläche. Sah er den dunklen Fleck nicht, wo der Schnee weg geweht war?
»Nach links, Vater! Nach links!«
Doch wieder wich sein Vater nach rechts aus. Die Entfernung des dunklen Flecks betrug nur noch vierzig Meter . . . noch dreißig . . . noch zwanzig . . .
Dort war die Rille im Eis, wo der Schnee zu einem weißen Rand zusammengeweht war. Noch wenige Meter, dann . . . Das Krachen im Eis übertönte das Rattern des Motors. Das Vorderrad bohrte sich in die Schneeschicht, der Wagen blieb stecken und das Hinterrad brach ein. Dröhnend schlug die Ladefläche voll mit Kisten und Säcken auf das splitternde Eis. Dunkles Wasser färbte den Schnee. Der Motor stotterte . . .
Langsam, quälend langsam sank nun auch der Wagen seines Vaters zwischen den Schollen ins eisige Wasser des Ladogasees. Tiefer, immer tiefer . . .
Das furchtbare Wassertier schwamm riesig groß an den Fenstern der Kabine vorbei, in der, Todesangst in den Augen, sein Vater saß . . .
Schweißnass wurde Oleg wach. Abermals hatte er von dem Konvoi geträumt, bei dem sein Vater umgekommen war. Es dauerte eine Weile, bis er sich allmählich seiner Umgebung bewusst wurde.
Was täglich im belagerten Leningrad geschah, gab Stoff zu tausend Albträumen. Die Deutschen hielten die Stadt eingeschlossen. Durch Aushungern und Bombardieren – täglich fielen im Durchschnitt dreihundert Bomben und Granaten auf die Stadt – hofften sie, die Verteidiger zur Übergabe zu zwingen. Oleg hätte von den Tausenden von Menschen träumen können, die vor Hunger und Erschöpfung auf der Straße starben; von Soldaten, die schwer verwundet aus den Stellungen rund um die Stadt zurückkamen; von Häuserblocks, die brennend zusammenstürzten; von Frauen, die weinend zwischen den Trümmerhaufen nach ihren Kindern suchten.
Leningrad war eine sterbende Stadt. Die Wasserversorgung funktionierte nicht mehr, die Klosetts waren eingefroren. Die Menschen verrichteten ihre Bedürfnisse in der eisigen Kälte auf der Straße. Menschliche Scham war in der Gewalt des Krieges längst verloren gegangen.
Oleg hätte auch von dem alles beherrschenden Hunger träumen können; von Frauen und Kindern, die bei zwanzig Grad Kälte stundenlang Schlange standen, um einen Schlag wässrige Suppe oder ein Stückchen Brot zu erhalten. In Hunderten von Häusern lagen die Sterbenden – und Toten –, noch von niemand entdeckt. All diese grimmigen Zustände gehörten jetzt zur Wirklichkeit des täglichen Lebens. Sie waren zu einem greifbaren Teil des Krieges geworden, an den man sich schließlich gewöhnte, weil man einfach damit leben musste.
Weit stärker als die Wirklichkeit seiner Umgebung hatten die Lebensmitteltransporte Olegs Fantasie beschäftigt – vor allem, weil sein Vater mit diesen Konvois gefahren war. Wenn der ausgedehnte Ladogasee zufror, konnten die Lastwagen mit unentbehrlichen Medikamenten, Lebensmitteln und Munition die deutschen Linien umgehen, um so die unvorstellbare Not in Leningrad wenigstens zu einem Teil zu lindern. In Gedanken hatte Oleg schon Dutzende von Malen seinen Vater begleitet. Wie mochte es den Männern in den Kabinen zumute sein, wenn die schweren Laster im Zickzack über das längst nicht überall sichere Eis dahinkrochen? Ob sie die Angst lähmte? Oder war ihr Mut stärker? Am schlimmsten war es immer zu Beginn des Winters, wenn das Eis noch nicht fest genug war, und im Frühjahr, wenn es zu tauen begann und die Wagen bis über die Räder im Wasser fuhren. Dann war die Spannung wegen Vaters Rückkehr fast unerträglich gewesen. Nach einer dieser Fahrten war nahezu die Hälfte des Konvois nicht zurückgekehrt. Dennoch waren die andern am nächsten Tag aufs Neue gefahren. Jeder Wagen, der das Ziel erreichte, rettete Menschenleben. Jeder Wagen, der bei den grimmigen Todesfahrten im Ladogasee versank, bedeutete den fast sicheren Tod für eine Anzahl von Männern, Frauen und Kindern in der Stadt.
Deshalb träumte Oleg von den Transporten. Dass das Wassertier unter dem Eis schwamm und sein Vater unvermeidlich auf diesen dunklen Fleck zufuhr, machte den Traum zu einem Albtraum. Jedes Mal, wenn der Wagen kippte und quälend langsam in der Tiefe verschwand, wurde Oleg wach: nass vom Angstschweiß und für einen Augenblick völlig verwirrt durch diesen schrecklichen Traum. Das Furchtbarste daran war jedoch, dass sich das alles wirklich so zugetragen hatte.
Das Bett seiner Mutter knarrte.
»Oleg, bist du wach?«
Oleg öffnete die Augen. Im Dämmerlicht sah er die vertraute Umgebung: die Bretter, die sein Vater noch vor die Fenster genagelt hatte, als bei einem Luftangriff alle Scheiben gesprungen waren, den Herd in der Ecke, für den es keine Kohlen gab, das Bett seiner Mutter, die schief hängende Lampe an der gerissenen Decke, den Riss in der Außenwand.
Oleg schlug die Bettdecke zurück. Es war eiskalt im Zimmer. Hastig fuhr er in die Schuhe, zog Jacke und Mantel an. Dann lief er zum Bett seiner Mutter.
»Du musst zur Garküche. Geh lieber frühzeitig!«
Oleg nickte. In der Ferne klang das stetige Dröhnen der Geschütze. Oleg sah seine Mutter an. Er wollte nicht fragen, wie sie sich fühle. Sie würde doch nur antworten, dass es besser gehe und dass sie gut geschlafen habe. Als ob er noch ein Kind wäre, das es nicht besser wusste. In den fiebrigen Augen seiner Mutter las Oleg Sorge und Angst. Doch sie lächelte ihm zu, weil sie sich nichts anmerken lassen wollte. Oleg erwiderte das Lächeln. Er wollte tapfer wirken, weil er sich nicht mehr als Kind fühlte. Wer zwölf Jahre alt war und schon fast zwei Jahre deutsche Belagerung durchgestanden hatte, der war erwachsen!
»Zieh dich warm an!«
Oleg nickte wieder. Er schaute auf das hohle Gesicht seiner Mutter. Kleine Geschwüre von der Unterernährung entstellten ihre Lippen und die rechte Wange. Ob seine Mutter fürchtete, dass sie sterben würde?
»Soll ich nicht zu Dr. Kirow gehen und fragen, ob er kommen kann?« Oleg hatte das schon mehrmals vorgeschlagen, doch seine Mutter schüttelte auch jetzt wieder den Kopf. Der Arzt würde gewiss keine Zeit haben. Er musste sich um die Soldaten kümmern, die verwundet von der Front zurückkamen, und um die Opfer der Luftangriffe. Gegen Hunger und Erschöpfung konnte Dr. Kirow ohnehin nichts ausrichten. Täglich starben Hunderte in der Stadt. Das war ein Teil des Preises, den Leningrad für die Freiheit bezahlte.
»Aber etwas anderes musst du für mich tun«, sagte seine Mutter. Sie streckte die Hand nach ihm aus und zog ihn näher an ihr Bett. »Du musst zu Onkel Wanja gehen. Bitte ihn, er möchte dich auf die Liste für die Evakuierung setzen . . .« In den Augen seiner Mutter sah er plötzlich das Wassertier, dieses ungeheuerliche Ding mit seinen riesigen Flossen.
»Doch, Junge, du musst! Es ist besser, wenn du aus der Stadt wegkommst!«
»Nein!«, rief Oleg. »Niemals!« Er wusste, dass die Lastwagen, die Lebensmittel über den See brachten, auf dem Rückweg Frauen und Kinder mitnahmen. Aber nicht einmal für das beste Essen wollte Oleg mit den Lastern über den See fahren, in dem das Wassertier als Symbol seiner Angst schwamm. Schließlich war da der dunkle Fleck, wo sein Vater ertrunken war. Um nichts auf der Welt würde er über den riesigen Ladogasee fahren. Und außerdem dachte er gar nicht daran, seine Mutter im Stich zu lassen!
»Der Krieg kann noch Jahre dauern«, sagte seine Mutter. Sie setzte sich ein wenig auf und sah Oleg fast flehend an. »Ich will, dass du hier weggehst. Du musst fahren!«
»Und du?«
»Ich komme schon zurecht.«
»Wer soll denn dann Essen und Wasser für dich holen?«
»Bis du abfährst, bin ich wieder gesund.«
Ein Kampf mit Worten, der ganz überflüssig war. Denn was auch geschehen mochte, Oleg würde nicht gehen. Um diesem sinnlosen Gespräch ein Ende zu machen, beugte sich Oleg vor und küsste seine Mutter. Sie sahen sich gegenseitig ernst an, jeder mit den eigenen Gedanken beschäftigt. Oleg dachte: ›Wird sie sterben? Will sie mich hier weghaben, um in Ruhe sterben zu können? Will sie mir den Kummer ihres Sterbens ersparen?‹
Die Mutter dachte: ›Lass ihn gehen! Gott, lass nicht zu, dass er in der Stadt bleibt! Lass ihm das Leben!‹ Oleg war alles, was sie noch besaß. Ihr fehlte die Kraft, für ihn am Leben zu bleiben.
Oleg stand auf. »Ich hole Essen«, sagte er.
»Zieh dich warm an!«, sagte seine Mutter noch einmal. Oleg band den Schal um, setzte die Mütze auf. Er nahm die Taschenlampe mit dem kleinen Dynamo zum Drücken darin vom Tisch und leuchtete in den Küchenschrank, um den Topf im Halbdunkel zu finden.
»Kann ich noch irgendetwas für dich tun?«
Seine Mutter schüttelte den Kopf.
Oleg knöpfte den Mantel bis obenan zu. In der Hoffnung, dass seine Mutter es nicht sah, griff er sich die kleine Dienstpistole seines Vaters und schob sie schnell in die Tasche. Es war gut, die kleine Waffe in der Tasche zu spüren – als ein Stück von früher, etwas von seinem Vater, was ihm ein wenig Festigkeit verlieh.
An der Tür winkte er seiner Mutter, so munter er konnte, noch einmal zu. Sie sollte nicht merken, dass er sich Sorgen machte, sich unsicher und unglücklich fühlte. Den Topf unter dem Arm, lief Oleg die ausgetretene Treppe hinunter.
2
Auf der Straße schlugen ihm die Geräusche der Stadt entgegen, das Hacken der Trümmerräumer, die die festgefrorenen Steine aus dem Schnee schlagen mussten, der Marschtritt einer Kompanie Soldaten. Ein Lautsprecherwagen forderte Freiwillige auf, sich für diese oder jene Arbeit zu melden. In der Ferne heulte eine Sirene. Aber Oleg achtete nicht auf die Geräusche. Er dachte an seine Mutter, die vielleicht sterben musste wie die Mütter von Pjotr, Sergej, Iwan, Wladi und tausend andern Kindern. Er musste Essen beschaffen! Das war das Wichtigste. Oleg hoffte leidenschaftlich, dass man ihm in der Garküche diesmal einen ordentlichen Schlag geben würde. Das vorige Mal war es zu wenig gewesen, aber sein Protest hatte nichts geholfen.
Eisiger Wind blies durch die Straße. Oleg setzte den Topf einen Augenblick ab und zog die Mütze tiefer über die Ohren. Auf der andern Seite zeichneten sich die Ruinen zerbombter Häuser spukhaft vor dem grauen Himmel ab. Oleg warf einen Blick auf den alten Mann, der auf einem Schutthaufen lag. Eine dünne Schneeschicht hatte ihn während der Nacht zugedeckt. Er war tot. Oleg wollte nicht länger hinsehen. Gleich würde der große Wagen durch die Straßen kommen, um den alten Mann und Hunderte von andern Toten zu holen.
Als die Angriffe auf Leningrad begannen und Oleg die ersten Toten auf der Straße liegen sah, hatte er verzweifelt geweint. Damals hatte ihn sein Vater um die Schultern gefasst, ihn ernst angesehen und gesagt: »Wir müssen das durchstehen, Oleg. Alle in Leningrad müssen das durchstehen. Der Mut, den wir zeigen, wird andern Mut geben. Denn nur mit Mut, immer wieder neuem Mut, können wir den Deutschen standhalten.« Dann hatte ihm sein Vater die Tränen abgewischt. Seitdem hatte Oleg nicht mehr geweint. Manchmal hatte er mit Verwirrung und Entsetzen die Gräuel in der Stadt wahrgenommen. Aber er hatte nicht mehr geweint – nicht einmal, als Zaretzki kam und berichtete, dass Olegs Vater als Held für Russland und die Freiheit gefallen sei. Darüber nicht zu weinen war sehr schwer gewesen.
Oleg ging weiter. Er dachte an seine Mutter. Sie musste am Leben bleiben. Was war die Freiheit wert, wenn sie sterben sollte? Er musste versuchen, Essen zu beschaffen. Die wässrige Rübensuppe aus der Garküche genügte nicht – auch nicht, wenn er heimlich einen Teil der eigenen Ration an die Mutter abtrat. Wie oft hatte seine Mutter das nicht schon für ihn getan!
»Oleg, wart mal!«
Oleg drehte sich um. Nadja kam ihm nachgelaufen. Sie trug die Schuhe ihres Bruders, die ihr viel zu groß waren. Ihr Atem lag weiß auf dem Wollschal, den sie bis übers Kinn gezogen hatte.
Oleg war froh, dass sie sich trafen. So brauchte er den weiten Weg zur Garküche nicht allein zu machen. Vielleicht konnte er mit Nadja über seine Mutter sprechen. Nadja war schließlich zwei Jahre älter als er. Oleg wollte sie ein wenig wegen der zu großen Schuhe necken, die wie Kähne an Nadjas dünnen Beinen saßen. Doch als er sie ansah, schluckte er die Worte rasch hinunter. Nadjas Gesicht war totenblass und bedrückt, als ob etwas Schreckliches geschehen wäre. Tränen liefen ihr über die Backen in den Wollschal. Weinte sie? Oder kamen die Tränen von dem schneidenden Wind?
Oleg fragte nichts. Gemeinsam gingen sie über den Pfad zwischen den leicht beschneiten Trümmerhaufen.
»Hoffentlich gibt’s heute was Ordentliches zu essen«, sagte Oleg. Er hatte etwas Freundliches sagen wollen, aber es war ihm nichts anderes eingefallen.
»Es wird wohl wieder Rübensuppe sein«, erwiderte Nadja. »Vielleicht werden wir in ein paar Tagen, wenn der See zugefroren ist und die Laster wieder fahren, besseres Essen bekommen.«
»Ein paar Tage dauern nicht lange.« Oleg blickte verstohlen unter seiner Mütze zu Nadja auf. Ihr Gesicht war noch genauso bedrückt wie zuvor. »Ein paar Tage sind rasch vorbei.«
»Es muss nur dauernd frieren«, entgegnete Nadja. »Wenn es zwischendurch taut, können wir kaum etwas erwarten.«
Sie bogen um die Ecke und liefen über den Platz, auf dem viele Denkmäler durch Haufen von Sandsäcken geschützt worden waren. Dann kamen sie durch eine schmale Straße, in der sämtliche Geschäfte mit Brettern vernagelt waren. Wieder schaute Oleg zu Nadja auf. Er hätte sie so gern mit einem kleinen Spaß aufgeheitert. Doch ihr starres, schmerzverzogenes Gesicht nahm ihm jeden Mut. Er kannte Nadja nicht anders als ausgelassen und fröhlich. Sie konnte sich die verrücktesten Dinge ausdenken und manchmal so übermütig und albern sein, dass sie selbst die größten Sauertöpfe zum Lachen brachte. Es musste also etwas Schlimmes geschehen sein, aber danach konnte er sie jetzt nicht fragen. Er spürte die Pistole in der Manteltasche. Dabei fielen ihm die Worte seines Vaters ein: »Der Mut, den wir zeigen, wird andern Mut geben.« Wie konnte er Nadja Mut machen?
Aus einem Lautsprecher ertönte die Stimme eines Radioansagers, der die letzten Nachrichten von der Front verkündete. Auch in andern Gegenden Russlands wurde gegen die Deutschen gekämpft. Ob die Menschen dort auch nur Rübensuppe zu essen bekamen? Wehmütig dachte Oleg an die guten Dinge, die er früher, vor dem Krieg, hatte stehen lassen. Wenn er die doch jetzt wieder herzaubern könnte! Von solchem Essen würde seine Mutter bestimmt bald wieder gesund. Doch er wollte nicht mehr an Essen denken, dann spürte man den Hunger doppelt. Deshalb sagte er rasch: »Wenn ich erwachsen bin, werde ich Soldat.«
Ein kurzes Lächeln huschte über Nadjas Gesicht. »Wenn du erwachsen bist, ist der Krieg vorbei«, entgegnete sie.
»Hoffentlich nicht!«, murmelte Oleg. Er wollte gegen die Deutschen kämpfen, die seinen Vater umgebracht hatten, gegen die Deutschen, die schuld daran waren, dass in Leningrad Tausende starben, dass schöne Häuser in Schutthaufen verwandelt wurden, dass alle hungern mussten!
»Ich will Ärztin werden«, sagte Nadja.
»Nicht Schauspielerin?« Das hatte sie sonst immer gewollt.
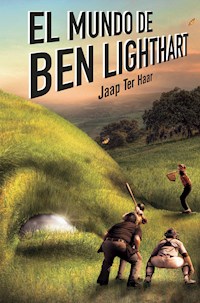












![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















