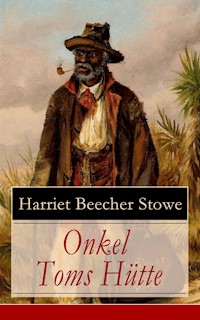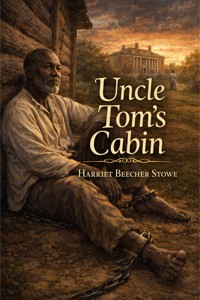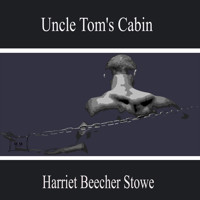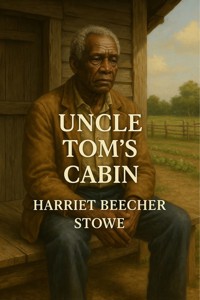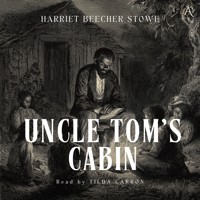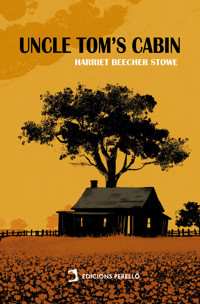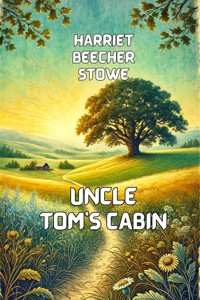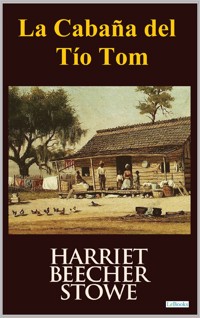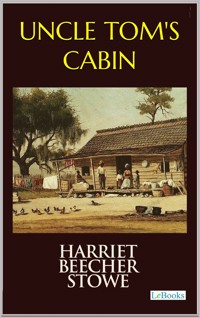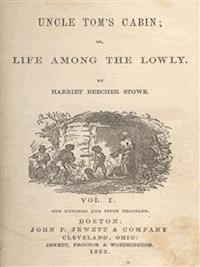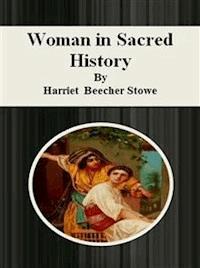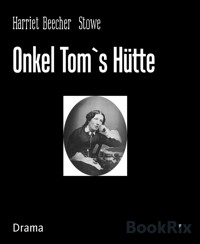
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch ist eine flammende Anklage gegen den Rassismus, wo immer er einem begegnet. Die Autorin schreibt dieses Plädoyer für ein freies Amerika im Jahre 1852. Die Sklaverei ist im Süden der USA integraler Bestandteil des Wirtschaftswesens. Die Schrift war wichtige Unterstützung für die Verfechter einer von Sklaverei befreiten Welt im Sezessionskrieg, der letztendlich zur Abschaffung der Sklaverei führte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Onkel Tom`s Hütte
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenErstes Kapitel, in welchem der Leser die Bekanntschaft eines menschenfreundlichen Mannes macht
An einem kalten Februartage, spät des Nachmittags, saßen zwei Herren in einem schön möblirten Eßzimmer, in der Stadt P– in Kentucky, allein beim Weine. Keine Dienstboten waren gegenwärtig, und die Herren, mit dicht an einander gerückten Stühlen, schienen den Gegenstand ihrer Unterhaltung mit sehr großem Eifer zu besprechen.
Der Bequemlichkeit halber haben wir uns bisher des Ausdrucks: „zwei Herren“ bedient; allein einer derselben würde bei einer genaueren Untersuchung, im strengeren Sinne des Wortes, nicht unter diese Kathegorie zu bringen gewesen sein. Er war ein kurzer, untersetzter Mann, mit groben, gemeinen Zügen, und jenem großthuenden, gemeinen Wesen, welches stets einen Menschen niedrigen Standes verräth, der bemüht ist, sich in höhere Sphären hinauf zu drängen. Seine Kleidung war überladen, und ließ eine bunte Weste von zahllosen Farben mit einer blauen, gelbgefleckten Halsbinde sehen, deren stutzermäßige Schleife mit dem ganzen Wesen des Mannes in genauem Einklange stand. Seine großen, ungeschickten Hände waren reich mit Ringen bedeckt, und an seiner Brust hing eine schwere goldene Uhrkette, mit Petschaften von ungewöhnlicher Größe und sehr verschiedenartigen Farben, welche er im Eifer des Gesprächs, augenscheinlich mit großem Wohlgefallen, durch seine Hände spielen ließ. Seine Unterhaltung verrieth eine freie und dreiste Verachtung jeder grammatischen Regel, und war überdies in passenden Zwischenräumen mit verschiedenen gemeinen Ausdrücken und Wendungen ausgeschmückt, die selbst der Wunsch, in unserer Schilderung getreu zu sein, uns nicht bestimmen kann, hier wiederzugeben.
Sein Gesellschafter, Mr. Shelby, hatte das Aeußere eines Gentleman, und die häuslichen Einrichtungen, so wie das ganze Aeußere des Hauses und Haushaltes ließen auf gute Verhältnisse und sogar auf Reichthum schließen. Wie wir vorher erwähnt haben, befanden sich Beide in sehr angelegentlicher Unterhaltung.
„Dies ist der Weg, den ich vorschlagen würde, um die Sache in Ordnung zu bringen,“ sagte Mr. Shelby.
„Kann auf diese Weise keinen Handel machen, – kann wahrhaftig nicht, Mr. Shelby,“ sagte der Andere, ein Glas Wein zwischen seinem Auge und dem Lichte haltend.
„Ja, aber ich versichere Euch, Haley, der Tom ist ein ganz ungewöhnlicher Kerl; er ist ganz ohne Zweifel die Summe überall werth, – beständig, ehrlich, tüchtig, und verwaltet eine ganze Wirthschaft wie nach der Uhr.“
„Ihr meint, so ehrlich, wie's bei Negern möglich ist,“ sagte Haley, sich selbst ein Glas Brandwein einschenkend.
„Nein, ich meine in vollem Ernste, Tom ist ein guter, stätiger, vernünftiger, frommer Kerl. Er hat seine Religion in einer Brüderversammlung, vor vier Jahren empfangen; und ich glaube, er besitzt wirklich Religion. Ich habe ihm seitdem Alles anvertraut, was ich besitze, – Geld, Haus und Pferde, – habe ihn durch das Land gehen lassen und ihn dennoch stets treu und redlich gefunden.“
„Manche Leute glauben nicht an fromme Neger, Shelby,“ sagte Haley mit einer ungenirten Handbewegung, „aber ich glaube dran. Ich hatte 'mal einen Kerl, – er war mit unter dem letzten Trupp, den ich dieses Jahr nach Orleans brachte, – 's war so gut wie eine Betstunde, wenn man den Kerl beten hörte, und dabei war er ganz sanft und gefügig. Brachte mir auch eine gute Summe ein, denn ich hatte ihn von Einem gekauft, der verkaufen mußte; so gewann ich netto sechs hundert an ihm. Ja, kein Zweifel, Religion ist eine ganz vortreffliche Sache in einem Neger, wenn's ächte Waare ist, kein Zweifel.“
„Nun, bei Tom ist es ächte Waare,“ entgegnete der Andere. „Seht, letzten Herbst ließ ich ihn allein nach Cincinnati gehen, um für mich Geschäfte abzumachen und ungefähr fünfhundert Dollar zu holen. ‚Tom,‘ sagte ich zu ihm, ‚ich vertrau Dir, weil ich weiß, daß Du ein Christ bist, – daß Du nicht betrügen willst.‘ Tom kömmt zurück, pünktlich, ich wußte es wohl. Einige schlechte Kerle sollen zu ihm gesagt haben: ‚Tom, warum nahmst Du nicht den Weg nach Canada?‘ ‚Ah,‘ hat er geantwortet, ‚Master hat mir getraut, und ich konnte nicht.‘ So ist mir erzählt worden. Ich muß sagen, es thut mir leid, mich von ihm zu trennen. Ihr solltet ihn für den ganzen Rest der Schuld annehmen; und Ihr würdet es thun, Haley, wenn Ihr ein Gewissen hättet.“
„Je nun, ich habe gerade so viel Gewissen, wie ein Mann in Geschäften brauchen kann, – grade so etwas, um drauf zu schwören, so zu sagen,“ entgegnete der Händler scherzhaft, „und dann bin ich auch immer gern bereit, guten Freunden gefällig zu sein; aber dieses Jahr, seht, dieses Jahr ist ein wenig zu schwer für einen Mann, – zu schwer.“ Bei diesen Worten seufzte der Händler gedankenvoll und schüttete von Neuem etwas Brandwein hinunter.
„Nun so sagt, Haley, wie soll der Handel werden?“ sagte Mr. Shelby nach einer peinlichen Pause.
„Wohl, ist denn da kein Junge oder Mädchen, das mit Tom in den Handel geworfen werden kann?“
„Hm! – ich wüßte keinen, den ich entbehren könnte, und, um die Wahrheit zu sagen, es ist nur eine bittere Nothwendigkeit, was mich überhaupt dazu bestimmt, zu verkaufen. Ich trenne mich höchst ungern von irgend einem meiner Leute, ganz gewiß.“
Hier öffnete sich die Thür, und ein kleiner Mulattenknabe von vier bis fünf Jahren kam in das Zimmer. Es lag etwas außerordentlich Liebliches und Einnehmendes in seiner Erscheinung. Sein schwarzes, seidenfeines Haar hing in vollen Locken um sein volles Gesicht, während ein Paar großer, dunkler Augen unter schweren, langen Wimpern hervorschauten, als er neugierig in das Zimmer blickte. Ein buntes Röckchen von gelber und scharlachrother Farbe, welches sehr sorgfältig gearbeitet und besonders passend für ihn war, hob seine üppige, dunkle Schönheit noch mehr, und eine gewisse komische Zuversicht mit einer eigenthümlichen Mischung von Schüchternheit in seinem Wesen verrieth, daß er von seinem Herrn nicht unbeachtet und ungehätschelt geblieben war.
„Sieh da, Jim Crow!“ rief Mr. Shelby pfeifend und ihm eine Weintraube zuwerfend, „greif zu!“
Das Kind sprang mit allen Kräften nach der Beute, während sein Herr lachte.
„Komm hierher, Jim Crow,“ sagte Mr. Shelby, und klopfte, als das Kind zu ihm getreten war, freundlich seinen lockigen Kopf und sein Kinn. „Nun, Jim Crow, zeige diesem Herrn, wie Du tanzen und singen kannst.“
Der Knabe begann augenblicklich mit seiner hellen, klaren Stimme einen jener wilden Gesänge, die unter den Negern üblich sind, und begleitete ihn mit mannigfachen Bewegungen seiner Hände, Füße und seines ganzen Körpers, welche in genauem Einklange mit dem Takte der Musik waren.
„Bravo!“ sagte Haley, ihm eine halbe Orange zuwerfend.
„Nun, Jim, laß uns sehen, wie Onkel Cudjoe geht, wenn er die Gicht hat,“ sagte sein Herr.
Sofort nahmen die biegsamen Glieder des Knaben eine mißgestaltete verzerrte Form an, während er, mit hinaufgezogenen Schultern, den Stock seines Herrn in der Hand, durch das Zimmer hinkend, sein kindliches Gesicht in eine schmerzhafte Miene verzog, und, nach rechts und links speiend, die Gewohnheit eines alten Mannes nachäffte.
Beide Anwesende brachen in ein schallendes Gelächter aus.
„Nun, Jim, zeige uns, wie der alte Elder Robins den Psalm singt,“ sagte drauf sein Herr.
Der Knabe verzog sein rothwangiges Gesicht in unglaubliche Länge und begann einen Psalm mit unerschütterlichem Ernste durch die Nase zu singen.
„Hurra, bravo! was für ein Junge ist das!“ rief Haley. „Der Junge ist ein Kapital, auf mein Wort! – Hört,“ sagte er dann plötzlich, seine Hand auf Mr. Shelby's Schulter legend, „werft den Jungen mit in den Handel – und unsre Rechnung soll abgemacht sein. Kommt, seht, das ist der beste Weg!“
In diesem Augenblicke wurde die Thüre langsam geöffnet, und eine junge Mulattin, ungefähr fünfundzwanzig Jahr alt, trat ein. Es bedurfte nur eines Blickes auf sie und das Kind, um sie als die Mutter desselben zu erkennen. Sie hatte dasselbe tiefe, volle und dunkle Auge, mit den langen Wimpern, und dieselben Locken schwarzen seidenen Haares. Das Braun ihrer Haut wich auf den Wangen einem deutlich erkennbaren Anfluge von Röthe, welche sich steigerte, als sie den Blick des fremden Mannes in dreister und unverstellter Bewunderung auf ihre Person geheftet sah. Ihre Kleidung war im höchsten Grade sauber und passend, und ließ ihre schönen Körperformen vortheilhaft hervortreten. Ihre zart geformte Hand und ihr niedlicher Fuß waren Dinge, die dem schnellen Auge des Händlers nicht entgingen, welches daran gewöhnt war, in einem Blicke alle Merkmale eines schönen weiblichen Artikels aufzufassen.
„Nun, Elisa?“ fragte der Herr, als sie zaudernd still stand und ihn anblickte.
„Ich suchte Harry,“ erwiderte sie, während der Knabe in großen Sätzen auf sie zugesprungen kam, ihr seine Beute zeigend, die er im Schooße seines Kleides trug.
„Wohl, so nimm' ihn hinweg,“ sagte Mr. Shelby, worauf sie sich eiligst, den Knaben auf den Arm nehmend, mit ihm entfernte.
„Bei Jupiter!“ rief der Händler, sich voll von Bewunderung zu Mr. Shelby umwendend, „das ist ein Artikel! Ihr könntet Euer Glück mit dem Mädchen allein jeden Augenblick in Orleans machen. Ich habe mehr als tausend für Mädchen bezahlen sehen, die kaum so hübsch waren.“
„Ich will mein Glück mit ihr nicht machen,“ entgegnete Mr. Shelby trocken, und suchte das Gespräch auf einen andern Gegenstand zu lenken, indem er eine neue Flasche öffnete und den Gast um seine Meinung darüber fragte.
„Vortrefflich, – erste Qualität!“ sagte der Händler und fuhr dann fort, sich zu Shelby wendend und ihm vertraulich auf die Schulter schlagend: „Kommt, was wollt Ihr für das Mädchen haben? – was soll ich sagen? – was verlangt Ihr?“ „Mr. Haley, sie soll nicht verkauft werden,“ sagte Shelby, „meine Frau würde sich nicht für eben so viel Gold, als sie wiegt, von ihr trennen.“
„Pah, pah, Weiber reden immer so, weil sie keine Berechnung haben. Zeigt ihnen nur, wie viel Uhren, Federn und andere Sachen für so viel Gold, als ein Mensch wiegt, gekauft werden können, das wird die Sache schon ändern, denke ich.“
„Ich sage Euch, Haley, davon darf keine Rede sein, ich sage nein und ich meine nein,“ sagte Shelby mit Nachdruck.
„Nun, so werdet Ihr mir wenigstens den Jungen lassen,“ sagte der Händler, „Ihr müßt zugestehen, daß ich ein hübsches Gebot für ihn gemacht habe.“
„Wozu in aller Welt braucht Ihr den Jungen?“ sagte Shelby.
„Wozu? seht, ich habe einen Freund, der in diesen Artikeln handelt, – der hübsche Jungen aufkaufen und für den Markt aufziehen will. Sind natürlich Luxusartikel, – werden als Aufwärter und so dergleichen an Reiche verkauft, die dafür bezahlen können. Es macht sich gar nicht übel in solchen großen Häusern, – wenn ein wirklich hübscher Junge die Thür aufmacht, und aufwartet und bedient. Diese Art bringt einen hübschen Preis; und dieser kleine Hallunke ist so ein komisches, musikalisches Exemplar, daß er gerade dazu paßt.“
„Ich möchte ihn doch lieber nicht verkaufen,“ sagte Mr. Shelby nachdenkend; „seht, Herr, ich habe menschliches Gefühl, und kann das Kind nicht von der Mutter reißen.“
„O wahrhaftig? – So etwas von der Art? – ich verstehe, ganz richtig. S'ist manchmal gewaltig fatal, mit Weibern zu thun zu haben. Ich hasse das Geschrei und Geheul. S'ist gewaltig fatal; aber seht, so wie ich das Geschäft einrichte, wird es gewöhnlich vermieden. Warum schickt Ihr nicht das Mädchen für eine Woche, oder ein paar Tage oder so aus dem Wege? – dann macht sich die Sache ganz ruhig ab; – ehe sie zurückkömmt ist Alles vorüber. Eure Frau mag ihr dann ein Paar Ohrringe, oder ein neues Kleid, oder so etwas Aehnliches geben, was Alles wieder gut macht bei ihr.“
„Ich fürchte nicht!“ sagte Shelby.
„Gott helf mir! Diese Geschöpfe sind ja nicht wie weiße Menschen; die kommen da bald drüber weg, wenn Ihr's richtig angreift. Da sagt das Volk,“ fügte er, eine vertrauliche Miene annehmend, hinzu, – „diese Art Geschäft mache Einen hartherzig; aber ich habe das nie gefunden. Die Sache ist, ich hab's nie so treiben können; wie es Manche thun. Ich habe Viele gesehen, die die Kinder den Weibern aus den Armen rissen, und zum Verkaufe ausstellten, während jene wie wahnsinnig schrieen; – große Thorheit, – schadet dem Artikel nur, – macht ihn zuweilen ganz unbrauchbar. Ich sah einmal in Orleans ein hübsches Weib, das durch solche Art Behandlung total drauf ging. Der Kerl, der sie in Handel hatte, wollte ihr Kind nicht haben, und sie war eine von der rechten, hohen Art, wenn ihr Blut heiß war. Ich sage Euch, sie drückte das Kind in ihre Arme, und schrie, und gebährdete sich auf eine schrecklich Weise. Es läuft mir noch jetzt kalt über, wenn ich daran denke; und als sie das Kind fortschleppten und sie einsperrten, fing sie an zu rasen, und war acht Tage nachher todt. Tausend Dollar, Herr, gradezu weggeworfen, – nur durch unrichtige Behandlung, – so ist's. Es ist am besten, die Sache menschlich zu betreiben; das ist meine Erfahrung.“
Nach diesen Worten lehnte sich der Händler, mit verschränkten Armen und einer Miene tugendhafter Entschlossenheit, zurück in seinen Stuhl, und hielt sich augenscheinlich für einen zweiten Wilberforce. Der Gegenstand schien indeß den Ehrenmann zu interessiren, denn während Mr. Shelby gedankenvoll eine Orange abschälte, hub er von Neuem an, zwar mit bescheidener Zurückhaltung, aber als wenn er von der Gewalt der Wahrheit unwiderruflich getrieben würde, noch einige Worte hinzuzufügen.
„Es sieht zwar nicht gut aus, wenn ein Mensch sich selbst rühmt, aber ich sage es nur, weil's die Wahrheit ist. Ich glaube, ich bin bekannt dafür, daß ich die besten Negerzüge auf den Markt bringe; wenigstens hat man mir so gesagt: alle in gutem Stande, – fett und gesund, und ich verliere weniger als irgend Einer im Geschäfte. Alles das kommt aber nur von der Art her, wie ich das Geschäft betreibe, Herr! Menschlichkeit, Herr, kann ich sagen, ist die große Säule meines Geschäfts.“
Mr. Shelby wußte nicht, was er eben dazu sagen sollte, und sagte deshalb nur: „Wirklich?“
„Ja, seht, man hat mich ausgelacht wegen dieser Ideen, und hat mir Vorwürfe gemacht. Sie wären nicht populär, und nicht allgemein, hieß es; aber ich blieb dabei, – blieb dabei, und habe guten Profit damit gemacht; – ja, Herr, sie haben sich bezahlt gemacht, kann ich sagen,“ fügte er, über seinen eigenen Witz lachend, hinzu.
Es lag etwas so Pikantes und Originelles in dieser Anschaulichmachung von Menschlichkeit, daß Mr. Shelby unwillkürlich mitlachen mußte. Vielleicht lachst Du auch, lieber Leser; allein Du weißt, daß Menschlichkeit sich heut zu Tage unter sehr verschiedenartigen Formen und Gestalten zeigt, und daß die Sonderbarkeiten des menschlichen Thuns und Treibens nie aufhören werden.
Mr. Shelby's Lachen ermuthigte den Händler, fortzufahren.
„S'ist kurios! aber ich habe das niemals den Leuten in den Kopf bringen können. Da war Tom Locker, mein alter Compagnon, in Natchez, – ein gewandter, geschickter Kerl, dieser Tom, – aber ein wahrer Teufel bei den Negern; – und aus Grundsatz, – aus Grundsatz, denn einen gutherzigeren Kerl hat es nie gegeben; – aber s'war sein System, Herr. Ich pflegte mit ihm zu reden. ‚Tom,‘ sagte ich, ‚wenn Deine Weiber an zu schreien fangen, was nützt es dann, ihnen mit der Peitsche um die Ohren zu hauen? S'ist lächerlich,‘ sagt' ich, ‚und thut nicht gut. Ich nehm's ihnen nicht übel,‘ sagt' ich, ‚s'ist Natur,‘ sagt' ich, – ‚und muß sich Bahn machen so oder so. Und nebenbei, Tom,‘ – sagt' ich – ‚verdirbt's Dir die Weiber, sie werden kränklich und lassen's Maul hängen; – und manchmal werden sie häßlich, – besonders die gelben, – oder der Teufel holt sie ganz und gar. Warum‘ – sagt' ich – ‚kannst Du sie nicht lustig machen, und freundlich mit ihnen reden? Glaube mir, Tom, so ein Bischen Menschlichkeit mit hineingeworfen in's Geschäft, ist ein gut Theil besser, als Dein Fluchen und Peitschen; und außerdem bringt's mehr ein,‘ – sagt' ich, – ‚glaube mir.‘ Aber Tom wollte nichts davon wissen, und verdarb mir so Viele, daß ich zuletzt mit ihm abbrechen mußte, obgleich er ein gutherziger Kerl war, und ganz vortrefflich im Geschäfte.“
„Und findet Ihr, daß Eure Art das Geschäft zu betreiben, vortheilhafter ist, als Tom seine?“ sagte Mr. Shelby.
„Ja, ich glaube. Seht, wenn ich irgend kann, so geb' ich wohl Acht, bei den unangenehmen Theilen des Geschäfts, wie Kinder verkaufen, – schaffe die Weiber aus dem Wege, – aus den Augen, aus dem Sinn, Ihr wißt ja, – und wenn Alles abgemacht ist, und Nichts mehr dran geändert werden kann, so gewöhnten sie sich natürlich daran. S'ist ja nicht, als wenn es Weiße wären, die dazu erzogen worden sind, für ihre Weiber und Kinder zu sorgen, und alles das. Neger, wißt Ihr wohl, die richtig aufgebracht worden sind, wissen von allem Dem nichts und so wird's ihnen viel leichter.“
„Dann fürchte ich, daß die meinigen nicht richtig aufgebracht worden sind,“ sagte Mr. Shelby.
„Wahrscheinlich. Ihr Kentucky Leute verderbt alle Eure Neger. Ihr meint's ganz gut, aber das heißt nicht ihnen wirklich Gutes thun. Seht, ein Neger, der in der Welt herumgestoßen und geworfen, und an Tom, und Dick, und Gott weiß wen, verkauft werden soll, – für den ist's keine Wohlthat, Begriffe zu bekommen und Hoffnungen, oder zu gut aufgebracht zu werden, denn das Rauhe und Harte fällt ihm nachher um so schwerer. Die Sache ist, Mr. Shelby, jeder Mensch hält natürlich seinen eigenen Weg für den besten; und ich denke, ich behandle meine Neger gerade so gut, als es ihnen zuträglich ist.“
„Es ist eine schöne Sache, mit sich selbst zufrieden zu sein,“ sagte Mr. Shelby mit einem leichten Schauder und einer lebhaften Empfindung von Abscheu.
„Wohl,“ sagte Haley, nachdem Beide eine Zeit lang stillschweigend ihre Nüsse geschält hatten, „was meint Ihr dazu?“
„Ich will die Sache mit meiner Frau überlegen und besprechen,“ sagte Mr. Shelby. „Inzwischen, Haley, wenn Ihr wünscht, daß die Sache in aller Stille abgemacht werden soll, wie Ihr vorhin erwähntet, so würdet Ihr am besten thun, Euch nichts davon hier in der Nachbarschaft merken zu lassen. Es könnte sonst unter meine Leute kommen, und es möchte kein sehr ruhiges Geschäft sein, einen von ihnen von hier wegzubekommen, wenn sie es vorher wissen, – darauf verlaßt Euch.“
„Versteht sich, auf jeden Fall, nichts gesprochen. Aber hört, ich hab's teufelmäßig eilig, und muß es so schnell wie möglich wissen, woran ich bin,“ sagte er indem er aufstand und sich seinen Ueberrock anzog.
„Wohl, kommt diesen Abend zwischen sechs und sieben Uhr, dann sollt Ihr meine Antwort haben,“ sagte Mr. Shelby, worauf der Händler sich mit einer Verbeugung aus dem Zimmer entfernte.
„Ich wollte, ich hätte den Kerl die Treppe hinunter werfen können,“ sagte Shelby zu sich selbst, als die Thür wieder fest geschlossen war, – „mit seiner Unverschämtheit! allein er weiß, welchen Vortheil er über mich hat. Wenn Jemand jemals zu mir gesagt hätte, daß ich den Tom an einen dieser schuftigen Händler im Süden verkaufen sollte, so würde ich gefragt haben: ‚Ist Dein Diener ein Hund, daß das mit ihm geschehen soll?‘ – und nun muß es doch geschehen, so viel ich sehen kann. Und Elisa's Kind dazu! Ich weiß im voraus, daß ich deshalb bei meiner Frau einen harten Strauß zu bestehen haben werde: und eben so wegen Tom's. Alles wegen der fatalen Schulden! – Der Kerl sieht seinen Vortheil und will so viel Nutzen wie möglich davon ziehen.“
Die mildeste Form von Sklaverei ist vielleicht in Kentucky zu finden, wo die ausgedehntere Betreibung eines ruhigen Feldbaues in regelmäßigen Abstufungen nicht jene periodischen Ueberhäufungen von Arbeit herbeiführt, die in den südlicheren Provinzen so gewöhnlich sind, und deshalb das Loos des Negers ein unerträglicheres ist, während der Herr, zufrieden mit einem allmählicheren Erwerbe, nicht jenen Versuchungen, hartherzig zu werden, ausgesetzt ist, die stets den Sieg über die schwache menschliche Natur davon tragen, sobald die Aussicht auf einen schnellen und plötzlichen Gewinn in die Wagschaale fällt, und kein schwereres Gegengewicht vorhanden ist, als die Rücksicht auf Hülflose und Schutzlose.
Wer gewisse Besitzungen dort besucht, und die nachsichtige, wohlwollende Behandlung einzelner Herren und Herrinnen, und die aufrichtige Anhänglichkeit einzelner Sklaven sieht, möchte sich versucht fühlen, von der oft wiederholten poetischen Fabel patriarchalischer Institutionen zu träumen; allein über diesen Scenen hängt ein schwarzer Schatten, – der Schatten des Gesetzes. So lange das Gesetz alle diese menschlichen Wesen mit schlagenden Herzen und regen Empfindungen nur als eben so viel Dinge ansieht, die einem Herrn gehören, – so lange das Falissement, oder sonstiges Unglück, oder Unklugheit, oder der Tod eines menschenfreundlichen Herrn die Ursache werden kann, daß dieselben ein Leben freundlichen Schutzes und Wohlwollens gegen ein Leben voll harter Arbeit und endloses Elend vertauschen müssen, – so lange ist es unmöglich, auch das bestverwaltete Sklavenverhältniß zu einem schönen, angenehmen Loose zu machen.
Mr. Shelby war ein gewöhnlicher, gutmüthiger Mensch, freundlich und stets bereit, den Wünschen seiner Umgebung zu entsprechen, so daß den Negersklaven seiner Besitzung nie etwas mangelte, was zu ihrem körperlichen Wohlbefinden beitragen konnte. Er hatte sich aber in bedeutende und unvorsichtige Speculationen eingelassen, hatte sich dabei tief verwickelt, und seine Wechsel waren zu einem bedeutenden Betrage in Haley's Hände gefallen. Dieser Umstand diene als Schlüssel zu der vorangegangenen Unterhaltung.
Inzwischen hatte es sich zugetragen, daß Elisa, als sie sich der Thür nahte, genug von obiger Unterhaltung hörte, um zu erfahren, daß der Händler ihrem Herrn Anerbietungen für irgend Jemanden mache. Sie hätte gern an der Thür gehorcht, als sie das Zimmer wieder verließ, allein ihre Herrin rief gerade nach ihr und zwang sie davon zu eilen. Dennoch glaubte sie gehört zu haben, daß der Händler ein Gebot für ihr Kind gemacht habe; – konnte sie sich geirrt haben? Ihr Herz schlug fieberhaft, und unwillkürlich preßte sie ihn so gewaltsam an sich, daß das Kind ihr erstaunt ins Gesicht blickte.
„Elisa, Mädchen, was ist heut mit Dir?“ fragte ihre Herrin, als Elisa das Waschbecken ausgeschüttet, die Wasserkaravine umgestoßen hatte, und endlich ihrer Herrin in voller Gedankenlosigkeit ein langes Nachthemde an Stelle des seidenen Kleides brachte, welches sie ihr aufgetragen hatte, aus der Garderobe zu holen.
Elisa erschrack, und kam zur Besinnung. „O Mistreß!“ sagte sie, indem sie ihre Augen aufschlug, und dann in Thränen ausbrechend, sich schluchzend auf einen Stuhl niedersetzte.
„Elisa, Kind, was fehlt Dir?“ fragte ihre Herrin.
„O Mistreß, Mistreß,“ sagte Elisa, „ein Sklavenhändler ist bei dem Herrn im Zimmer, und hat mit ihm gesprochen. Ich hörte ihn.“
„Nun, dummes Mädchen, wenn auch, was ist's weiter?“
„O Mistreß, glauben Sie, daß der Herr meinen Harry verkaufen könnte?“ Und das arme Wesen fiel von Neuem in einen Stuhl, und begann convulsivisch zu schluchzen.
„Ihn zu verkaufen! Nein, albernes Mädchen! Du weißt, daß Dein Herr nie mit diesen südlichen Händlern Geschäfte macht, und nicht Willens ist, je einen seiner Dienstboten zu verkaufen, so lange diese sich gut betragen. Wer denkst Du denn, thörichtes Kind, würde Deinen Harry kaufen wollen? Glaubst Du denn, daß die ganze Welt in ihn so vernarrt ist, wie Du, Gänschen? Komm her, sei munter, und hake mein Kleid zu. Nun lege mein Haar in die hübsche Flechte, die Du vor ein paar Tagen gelernt hast, und horche nie wieder an den Thüren.“
„Ja, aber nicht wahr, Mistreß, Sie würden nie Ihre Einwilligung dazu geben, daß – daß –“
„Dummes Zeug! Kind. Gewiß, nimmer. Wozu sind diese Schwatzereien? Eben so wenig, wie daß eins meiner Kinder verkauft würde. Aber wahrhaftig, Elisa, Du wirst mir beinahe zu stolz auf den Buben. Kein Mensch darf seine Nase zur Thüre hinein stecken, ohne daß Du glaubst, Dein Bube soll verkauft werden.“
Beruhigt durch den zuversichtlichen Ton ihrer Herrin fuhr Elisa flink und gewandt mit ihren Toilettengeschäften fort, und lachte selbst über ihre Befürchtungen.
Mistreß Shelby war eine Frau von hoher geistiger und moralischer Bildung. Mit jener angeborenen Hochherzigkeit, welche so häufig als ein charakteristisches Merkmal der Weiber in Kentucky gefunden wird, verband sie ein religiöses Gefühl, welches sich in allen ihren Handlungen praktisch kund gab. Ihr Mann, der keinen Anspruch auf besondere Religiosität machte, achtete und ehrte nichts destoweniger diese Seite in ihrem Charakter, und hegte vielleicht sogar eine Art Scheu vor ihrer Meinung. Gewiß ist, daß er ihr unbegränzte Machtvollkommenheit in allen ihren Bestrebungen für das Wohl und den Unterricht ihrer Dienstboten gab, obgleich er selbst keinen direkten Antheil daran nahm. In der That, wenn er auch nicht an die Lehre von der Wirksamkeit der besondern guten Werke der Heiligen glaubte, so schien er doch gewissermaßen anzunehmen, daß seine Frau Frömmigkeit und Wohlthätigkeit genug für zwei besitze, – und die schwache Hoffnung zu hegen, durch Vermittlung derjenigen Tugenden in den Himmel zu gelangen, welche seine Frau in so großem Maaße besaß, obgleich er selbst darauf keinen besondern Anspruch machen konnte.
Die schwerste Last auf seiner Seele jetzt, nach der Unterredung mit dem Sklavenhändler, war die von ihm vorempfundene Nothwendigkeit, seiner Frau die getroffenen Verabredungen mitzutheilen, und den dringenden Gegenvorstellungen zu begegnen, auf die er, wie er wußte, mit Sicherheit rechnen konnte.
Da Mistreß Shelby von den finanziellen Verlegenheiten ihres Ehemannes durchaus keine Ahnung hatte, und die gewöhnliche Gutmüthigkeit seines Herzens kannte, so war sie in dem Ausdrucke ihrer Ungläubigkeit rücksichtlich des von Elisa geäußerten Verdachtes ganz aufrichtig gewesen. Sie hatte in der That mit keinem Gedanken weiter daran gedacht; und da sie überdieß mit den Vorbereitungen zu einem Abendbesuche beschäftigt war, so entschwand der Gegenstand gänzlich aus ihrem Kopfe.
Die Mutter
Elisa war von ihrer Kindheit an bei ihrer Herrin als ein gehätschelter und verwöhnter Günstling auferzogen worden.
Der Reisende im Süden wird oft jene Zartheit und Sanftheit der Stimme und des ganzen Wesens bemerkt haben, welche sehr häufig eine besondre Gabe der Mestizen und Mulattenweiber zu sein scheint. Die natürliche Grazie der Mulattin ist oft mit einer blendenden Schönheit, und stets wenigstens mit einem äußerst angenehmen und einnehmenden Aeußeren verbunden. Elisa, wie wir sie geschildert haben, ist kein Phantasiebild, sondern der Erinnerung entnommen, wie wir sie vor Jahren in Kentucky gesehen haben. Sicher unter der schützenden Sorge ihrer Herrin hatte sie ihre körperliche Reife ohne jene Versuchungen erlangt, welche die Schönheit einer Sklavin so häufig zu einer so unheilvollen Erbschaft machen. Sie war an einen hübschen und talentvollen jungen Mulatten verheirathet worden, der Sklave auf einer nachbarlichen Besitzung war, und den Namen Georg Harris führte.