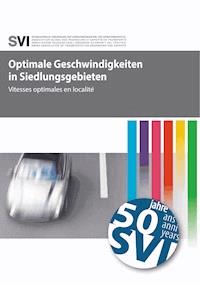
Optimale Geschwindigkeiten in Siedlungsgebieten E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Problematik der Geschwindigkeiten in Siedlungsgebieten wird von unterschiedlichen Gesichtspunkten aus betrachtet und beurteilt: Welche Auswirkungen haben herabgesetzte Höchstgeschwindigkeiten auf den öffentlichen, den Fuß- und den Veloverkehr? Wie werden die Netzfunktionen von Hauptstraßen für den motorisierten Individualverkehr durch Tempo 30 beeinflusst? Wie wirken sich reduzierte signalisierte Höchstgeschwindigkeiten auf die Reisegeschwindigkeiten und in Folge auf die Erreichbarkeit aus? In dem Band werden Vorträge und Diskussionen aus einer Veranstaltungsreihe zum Thema und die daraus postulierten 12 Thesen publiziert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 321
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Éditorial
Editorial
In der Schweizerischen Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI) haben sich Verkehrsfachleute zusammengeschlossen, die sowohl in privaten Büros als auch in der öffentlichen Verwaltung tätig sind. Die SVI vertritt derzeit über 500 Verkehrsfachleute mit abgeschlossener Ausbildung im Verkehrsingenieurwesen und/oder mehrjähriger Berufserfahrung in der Verkehrsplanung.
Seit der Gründung der SVI vor 50 Jahren hat die Mobilität nichts an ihrer Bedeutung als Triebfeder der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung eingebüsst. Die Planung, Steuerung und Bewirtschaftung der Mobilität entwickelte sich hingegen zu einer zunehmend vielschichtigeren und anspruchsvolleren Aufgabe, die auch eine verstärkt interdisziplinäre Zusammenarbeit bedingt. Heutige und künftige Verkehrsprobleme sind optimal zu lösen, das heisst nicht nur aus verkehrstechnischer Sicht sondern auch in Abstimmung mit der Siedlungsstruktur und -entwicklung. Nur so kann die Standort- und Lebensqualität in den Städten und Gemeinden langfristig gewährleistet werden. Darin bestehen die heutigen und künftigen Herausforderungen im Verkehrswesen, denen sich die SVI annimmt, um zukunftsorientierte Lösungsansätze zu entwickeln.
Im Jahr 2009 wurde gestützt auf einer Umfrage bei den Mitgliedern der SVI das Thema "Wie viel Mobilität ist effizient" als Schwerpunktthema ausgewählt. Die Auseinandersetzung mit diesem Thema an einem 2-teiligen Kongress in den Jahren 2011 und 2012 hatte zum Ziel, im Planungsalltag innezuhalten und über unser Mobilitätsverhalten, die Verkehrsentwicklung und deren Folgen nachzudenken. In einer gesamtheitlichen und auch fachfremden Spiegelung wurde analysiert, wo wir heute stehen und wie wir dahin gekommen sind. Gedankenanstösse und Rückschlüsse für den zukünftigen Umgang mit Verkehrsentwicklung und Mobilität wurden erörtert und mögliche Strategien aufgezeigt.
Bei den interdisziplinären Diskussionen stand das Thema "Geschwindigkeit" immer wieder im Fokus, sei es bezogen auf unseren Anspruch, immer schneller vorwärts zu kommen, oder aber auch in Bezug auf die gefahrenen Geschwindigkeiten innerorts. Der Vorstand hat daher beschlossen, das Thema "Optimale Geschwindigkeiten in Siedlungsgebieten" weiter zu bearbeiten und zu vertiefen. Die Fragestellung betrifft vielfältige Aspekte der Verkehrsplanung und hat Auswirkungen auf alle Verkehrsarten bzw. Verkehrsteilnehmenden. Zudem stossen bei dem Thema unterschiedliche Auffassungen und Grundhaltungen nicht nur in der Politik sondern auch in der Fachwelt aufeinander.
Der vorliegende Tagungsband beinhaltet die Zusammenfassungen der 33 Referate und die Synthesen, die die SVI aus der breitangelegten Diskussion gebildet hat. Die SVI will mit den formulierten Thesen einen Beitrag zur Lösung der erkannten Herausforderungen leisten. Den Entscheidungsträgern und den Verkehrsingenieuren sollen sie als Leitlinie oder zumindest als Grundlage für ihre Planungen dienen. Aufbauend auf den bisherigen Erkenntnissen soll aber auch geprüft werden, welche Fragestellungen vertieft zu diskutieren und weiter zu erforschen sind.
Der SVI Vorstand möchte an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten richten, die es ermöglicht haben, das vorliegende Schlussdokument zu erarbeiten. Im Speziellen möchten wir hier den Referentinnen und Referenten, den Organisatoren in den Regionalgruppen sowie dem Redaktionsteam danken. Mit ihrem grossen Einsatz haben sie aus den zahlreichen Diskussionen Synthesen gebildet und die vorliegenden zwölf Thesen formuliert.
Wir sind auch gespannt auf die nachfolgenden Diskussionen zum Thema "Optimale Geschwindigkeiten in Siedlungsgebieten" und hoffen mit dem Schwerpunktthema einen Anstoss zu einem zukunftsgerichteten Umgang mit den vielfältigen Herausforderungen in der Verkehrsplanung geben zu können.
Christian Camandona Präsident der SVI
L’association suisse des ingénieurs et experts en transports (SVI) réunit des professionnels de la branche travaillant aussi bien dans les bureaux d’étude privés qu’au sein de l’administration publique. La SVI représente actuellement en Suisse plus de 500 professionnels, diplômés en ingénierie des transports et/ou au bénéfice d’une pratique de plusieurs années dans la planification des transports.
Depuis la fondation de la SVI il y a 50 ans, la mobilité n’a rien perdu de son importance comme moteur du développement économique et social. La gestion de cette mobilité est en revanche devenue une tâche de plus en plus complexe et interdisciplinaire, nécessitant une étroite collaboration avec les spécialistes d’autres domaines. Trouver des solutions optimales aux problèmes des transports actuels et à venir ne se limite donc pas à l’aspect technique, mais doit viser aussi, et surtout, à être en adéquation avec la forme et l’évolution urbaines pour garantir une qualité de vie durable au sein des villes et des communes. Tels sont les défis professionnels du domaine des transports relevés par la SVI pour développer des solutions tournées vers l’avenir.
En 2009, un sondage mené auprès des membres de la SVI a conduit au choix du thème principal suivant: „Mobilité: oui – mais combien?“ Les discussions autour de ce thème ont eu lieu au cours de deux journées de congrès en 2011 et 2012. L’objectif était que les planificateurs fassent une pause pour prendre le temps de réfléchir à la manière d’aborder à l'avenir l’évolution des transports et ses conséquences ainsi qu'aux comportements au sein du trafic. L’analyse a été menée de manière à refléter divers points de vue et à obtenir une vue d'ensemble aussi large que possible afin de déterminer où nous nous situons actuellement et comment nous en sommes arrivés là. Toutes les propositions et les conclusions en rapport avec la gestion future de l’évolution des transports et de la mobilité ont été discutées et les stratégies envisageables ont été esquissées.
Au cours des discussions interdisciplinaires, le thème de la vitesse revenait fréquemment, que ce soit en lien avec notre désir d’avancer toujours plus vite ou concernant les vitesses pratiquées à l’intérieur des localités. Il a donc été décidé de poursuivre et d’approfondir le thème „Vitesses optimales en localité“. Il s’agit d’un thème complexe, touchant à de nombreux domaines de la planification des transports et ayant un impact sur l’ensemble des usagers et des modes. C'est aussi un sujet sur lequel les philosophies et les avis divergent, tant au sein du monde politique que de la profession.
Le présent recueil présente les résumés des 33 exposés et les conclusions, sous forme de thèses, que la SVI a tirées de ce large débat: ces thèses représentent la contribution concrète de la SVI à la résolution des problèmes reconnus. Aux ingénieurs en transports et aux décideurs, elles serviront de base de travail ou orienteront leurs réflexions. Il s'agira également d'examiner quelles suites sont à donner aux enseignements tirés de ce processus, quelles discussions et quelles recherches sont encore à mener.
Le comité de la SVI en profite pour remercier vivement toutes celles et ceux qui ont permis à ce document de voir le jour, avec une mention spéciale à tous les intervenants, les organisateurs des groupes régionaux et l’équipe de rédaction. C'est grâce à leur engagement sans faille que les nombreuses discussions ont pu être condensées dans les 12 thèses présentées à la fin de ce volume.
Nous nous réjouissons d’avance de poursuivre les débats sur le sujet des vitesses optimales en localité et espérons avoir ainsi encouragé une approche prospective des multiples défis de la planification en transports d'aujourd'hui.
Christian Camandona Président de la SVI
Sommaire
Inhalt
1 Einleitung
Introduction
2 Gesellschaftliche Entwicklungen und Rahmenbedingungen
Évolution de la société et conditions-cadres
2.1 Entschleunigung innerorts
Décélération en ville
René Schaffhauser
2.2 Schlüsse aus den Tempo 30-Urteilen
Conclusion de la juridiction sur la limitation à 30 km/h
Stefan Huonder
2.3 Tempo 30-Zonen auf Berner Kantonsstrassen
Zones limitées à 30 km/h sur les routes cantonales bernoises
Ueli Weber
2.4 Schneller und weiter
Plus vite, plus loin
Ueli Haefeli
2.5 Verkehr und Emotionen
Déplacements et émotions
Albert Zeyer
2.6 Mobilité et justice sociale
Mobilität und soziale Gerechtigkeit
Vincent Kaufmann
,
Ander Audikana
2.7 Synthese
Synthèse
3 Siedlungsstrukturelle und wirtschaftliche Wechselwirkungen
Corrélations avec les formes urbaines et l’économie
3.1 Dichte und Mobilitätsverhalten
Densité et comportement de mobilité
Jonas Bubenhofer
3.2 Mobilité, vitesse et territoire
Mobilität, Geschwindigkeit und Raum
Pierre-Alain Rumley
3.3 Einflüsse auf die Verkehrsentwicklung
Influences sur le développement des transports
Milenko Vrtic
3.4 Welches Geschwindigkeitsniveau braucht eine Stadt?
À quelle vitesse a-t-on besoin de rouler en ville?
Kay Axhausen
3.5 Synthese
Synthèse
4 Nutzen einer Entschleunigung
Les avantages de la décélération
4.1 Langsamer, sicherer und angenehmer
Plus lentement, plus sûrement et plus agréablement
Klaus Zweibrücken
4.2 Effekte der Geschwindigkeit auf den Veloverkehr
Impacts de la vitesse sur les déplacements à vélo
Kathrin Hager
4.3 Vitesse de circulation, sécurité des usagers et culture de la cohabitation
Fahrgeschwindigkeit, Verkehrssicherheit und Koexistenz
Dominique von der Mühll
4.4 Mehr Sicherheit für die alternde Gesellschaft?
Plus de sécurité pour une société vieillissante?
Timo Ohnmacht
4.5 Wie schnell sind wir im Alter?
Effets de l’âge sur la vitesse de déplacement
Simone Gretler Heusser
4.6 Strassenlärmsanierung durch Temporeduktion
Limitation de vitesse et réduction des nuisances sonores
Erich Willi
4.7 Synthese
Synthèse
5 Fokus auf ÖV-Reisezeiten legen
Mettre les temps de parcours TC au coeur de la réflexion
5.1 Speed is the name of the game – auch in der Schweiz
La vitesse à l’ordre du jour – en Suisse aussi
Ulrich Weidmann
5.2 Wird der ÖV-Kunde durch Tempo 30 ausgebremst?
La limitation à 30 km/h affecte-t-elle l’usager des TC?
Hans Konrad Bareiss
5.3 Beschleunigte ÖV-Stadtnetze
Réseaux de TC accélérés en ville
Roman Steffen
5.4 Wechselwirkungen Tempo 30 und ÖV-Förderung
Relation entre limitation à 30 km/h et promotion des TC
Alain Groff
5.5 Synthese
Synthèse
6 Interaktion Städtebau, Strassenraum und Architektur
Interaction urbanisme – espace-rue – architecture
6.1 Space of flows
Espace des flux
Han van de Wetering
6.2 Oui à la cohabitation – non à la domination
Ja zum Zusammenleben – Nein zur Alleinherrschaft
Rolf Steiner
6.3 Ortsgerechte Strassen versus autogerechte Ortschaften
Des routes adaptées au contexte local ou des localités façonnées par le trafic motorisé?
Samuel Flükiger
6.4 Unterschiedliche Geschwindigkeiten auf Hauptstrassen
Vitesses différenciées sur les routes principales
Tobias Etter
6.5 100 Wünsche – 1 Strasse
100 souhaits – 1 rue
Roland Koch
6.6 Synthese
Synthèse
7 Netzhierarchien und Kapazität
Hiérarchie du réseau et capacité
7.1 Folgen für die Netzfunktion bei Tempo 30 auf Hauptstrassen
Routes principales: impacts de la limitation à 30 km/h sur la fonction de liaison
Ruedi Häfliger
7.2 Speed versus capacity
Geschwindigkeit versus Kapazität
Monica Menendez
7.3 Geschwindigkeiten in städtischen Netzen
La vitesse à l’intérieur des réseaux urbains
Christian Hasler
7.4 Netzhierarchien und Geschwindigkeiten in Basel-Stadt
Hiérarchie du réseau et vitesse en ville de Bâle
Barbara Auer
7.5 Netzhierarchien und Geschwindigkeiten im Kanton Zürich
Hiérarchie du réseau et vitesse dans le canton de Zurich
Markus Traber
7.6 Kapazität von Strassen des Basisnetzes
Capacité du réseau routier primaire
Fritz Kobi
7.7 Synthese
Synthèse
8 Fazit
Conclusion
Die Thesen der SVI zu optimalen Geschwindigkeiten in Siedlungsgebieten
Les thèses de la SVI concernant les vitesses optimales en localité
Introduction
1Einleitung
Geschwindigkeiten begegnen uns in der täglichen Planungspraxis
Das Thema Geschwindigkeiten hat in den letzten Jahren zunehmend in der Verkehrsplanung an Aktualität gewonnen. Sei es im Zusammenhang mit der Aufwertung von Ortsdurchfahrten oder Quartierzentren oder bei der Umsetzung der Lärmschutzverordnung. Hierbei wird das Thema sehr kontrovers diskutiert. Die Leistungsfähigkeit des Hauptverkehrsstrassennetzes wird der Aufenthaltsqualität und Querbarkeit gegenüber gestellt. Kann eine niedrigere Geschwindigkeit bei engen Platzverhältnissen ein Ersatz für eine separate Veloführung sein? Ist eine Strecke mit Tempo 30 für den öffentlichen Verkehr noch wirtschaftlich bedienbar? Dies alles sind Fragen, die am konkreten Ort in der Strasse entstehen.
Doch wie werden sie beeinflusst durch unseren Umgang mit Geschwindigkeit, Eile und Schnelllebigkeit als allgemeine gesellschaftliche Tendenzen? Erreichbarkeit ist ein wichtiger Standortfaktor und funktionsfähige Verkehrsinfrastrukturen sind Voraussetzung für eine arbeitsteilige Wirtschaft.Gleichzeitig zeigt sich ein Bedürfnis der Menschen nach attraktiven Aufenthaltsräumen und kurzen Wegen zu Fuss. Wie viel Freiheit bedeutet es, eine etwas höhere Geschwindigkeit mit dem Auto fahren zu dürfen? Wie viel schneller sind wir dadurch am Ziel? Geschwindigkeiten hängen zusammen mit den Dichten – auf den Strassen aber auch in den Städten, Agglomerationen und Gemeinden als Ganzes.
Mit dem Schwerpunktthema 2014/15 hat die Schweizerische Vereinigung der Verkehrsingenieure und Verkehrsexperten (SVI) die Thematik aufgegriffen. Der Fokus des Schwerpunktthemas wurde hierbei auf die Geschwindigkeiten in Siedlungsgebieten gelegt, d.h. in unseren Ortschaften, Gemeinden und Städten. Bewusst wurden die Geschwindigkeiten ausserhalb der Siedlungsgebiete, d.h. auf den Autobahnen und Hauptstrassen ausserorts sowie die Geschwindigkeiten auf dem nationalen und regionalen Schienennetz ausgeklammert.
Doch welche Geschwindigkeiten sind gemeint? Schon hier ist eine differenzierte Betrachtung erforderlich. Der Diskurs hat gezeigt, dass nicht einfach von Geschwindigkeiten gesprochen werden kann. Es ist zu unterscheiden zwischen den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten, den tatsächlichen Fahrgeschwindigkeiten sowie den Reisegeschwindigkeiten.
Ziel dieser Veranstaltungsreihe war es, einen schweizweiten Fachdiskurs zum Thema Geschwindigkeit zu führen. Fakten zum Thema in Punkto historischer Entwicklung und gesetzlicher Rahmenbedingungen sollen durchleuchtet, die Auswirkungen auf den Strassenraum sowie die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmenden untersucht und somit eine Versachlichung der Diskussion angestrebt werden. Wo und wann sind niedrigere Geschwindigkeiten nötig, was bedeutet dies für den Gesamtverkehr, wie sind sie in Konzepte einzubetten? Welchen Beitrag können Geschwindigkeiten leisten, was nicht und wo sind die Grenzen? Hierzu wurde eine kontroverse Diskussion geführt.
In 28 Veranstaltungen in Basel, Bern, Lausanne, Luzern, St. Gallen und Zürich haben 36 Referenten Inputs geliefert und 750 Teilnehmende mit ihnen diskutiert. Alle Referate sind auf der SVI-Webseite www.svi.ch/geschwindigkeit aufgeschaltet. Im vorliegenden Tagungsband haben die Referenten und Referentinnen die wesentlichen Punkte ihrer Ausführungen zu-
Die Veranstaltungsreihe und ihre hier vorliegende textliche Zusammenfassung haben ein aktuelles Thema der Verkehrsplanung von allen Seiten, historisch und aus heutiger Sicht be- und hinterleuchtet. Die SVI möchte einen fachlichen Beitrag zur Diskussion in den Kantonen, den Städten und Gemeinden leisten. Die verkehrlichen Herausforderungen werden sich mit der Gesellschaft ändern, wachsen, und in einer dicht besiedelten Schweiz wird die Antwort auf die Frage: „Welches ist die richtige, die optimale Gechwindigkeit?“ ein wesentlicher Schlüssel sein. Die am Schluss abgeleiteten zwölf Thesen sollen dafür als Leitlinien dienen.
Ces dernières années, la vitesse est devenue un thème de plus en plus actuel dans la planification des transports, que ce soit en rapport avec la revalorisation de traversées de localités, le réaménagement de quartiers ou encore avec l’application de l’ordonnance sur la protection contre le bruit. Les débats sur ce thème sont très animés. La capacité du réseau routier principal est opposée à la qualité du séjour dans l'espace public et aux possibilités pour les piétons de traverser dans de bonnes conditions. Lorsque la place est réduite, une vitesse plus basse offre-t-elle une alternative satisfaisante à la séparation des cyclistes du trafic motorisé? Un tronçon avec une vitesse limitée à 30 km/h peut-il encore être exploité de manière rentable par les transports collectifs? Ces diverses questions se posent de manière concrète lors du réaménagement d’un axe routier.
Et comment notre rapport à une société tendant à être de plus en plus rapide, pressée et frénétique influence-t-il ces interrogations? La qualité de l’accessibilité est déterminante dans le choix d'une implantation sur un site,et une économie basée sur la division du travail, et donc sur les interactions entre acteurs, nécessite des infrastructures de transport effi-caces. Parallèlement à cela, la population éprouve un réel besoin d’espaces publics en ville et de cheminements piétons courts. Pouvoir circuler en voiture à une vitesse un peu plus élevée rend-il réellement plus libre? Le gain de temps sur un trajet donné est-il vraiment significatif? La vitesse est liée à la densité – du trafic, d’une part, mais également des villes dans leur ensemble.
L’association suisse des ingénieurs et experts en transports (SVI) a abordé le sujet en en faisant son thème principal 2014/2015. Elle a centré la réflexion sur les vitesses en localité, c.-à-d. à l’intérieur de nos villages, de nos communes et de nos villes. La question des vitesses hors localité, c.-à-d. sur les autoroutes et les routes principales, de même que celle des vitesses sur le réseau ferroviaire national et régional ont délibérément été laissées de côté.
Mais de quelles vitesses parle-t-on exactement? À ce stade, un point de vue différencié est déjà nécessaire, les débats ayant montré les limites du terme générique «vitesses». Il faut en effet faire la distinction entre les vitesses maximales autorisées, les vitesses pratiquées ponctuellement et les vitesses moyennes.
L’objectif de la série de manifestations proposée était de susciter, au niveau national, un débat d’experts sur la thématique de la vitesse. Les diverses conférences ont mis en lumière l’évolution historique et le cadre légal en la matière, tout en favorisant l’objectivité de la discussion. Où et quand des vitesses réduites sont-elles nécessaires? Quelles en sont les conséquences pour l’ensemble du trafic? Comment ces vitesses peuvent-elles être intégrées dans des concepts de mobilité? Qu’apportent les vitesses réduites et quelles sont leurs limites? Une discussion ouverte a été ainsi menée sur cette thématique.
Au cours des 28 manifestations qui ont eu lieu à Bâle, Berne, Lausanne, Lucerne, St-Gall et Zurich, 36 intervenants ont apporté leur contribution et 750 personnes ont participé aux discussions. Tous les exposés sont disponibles sur le site internet de la SVI www.svi.ch/geschwindigkeit. Dans la présente publication, les intervenants et les intervenantes ont résumé les points essentiels de leurs exposés. Les textes publiés n’engagent que leurs auteurs. Ils sont le reflet de leurs opinions personnelles, qui ne correspondent pas forcément à celles de leurs organisations. L'émettrice du présent document assumesammengefasst. Die abgedruckten Texte liegen in der Verantwortung der Autoren, sie spiegeln deren persönliche Meinungen wider und nicht unbedingt diejenige ihrer Organisationen. Die Verantwortung für die Synthesen liegt bei der Herausgeberin des Tagungsbandes. Sie sind aus den Vorträgen und den anschliessenden Diskussionen im Plenum entwickelt worden.l’entière responsabilité des synthèses et thèses tirées des exposés et des discussions plénières qui ont suivi.
La série de manifestations et les résumés ci-après permettent d’éclairer cette thématique très actuelle sous divers angles, que ce soit d’un point de vue historique ou contemporain. L’objectif de la SVI est d’apporter son expertise au débat dans les cantons, les villes et les communes. Les enjeux des transports vont évoluer avec la société et prendre de l'importance. Dans une Suisse densément peuplée, la réponse à la question: «Quelle est la vitesse de déplacement appropriée, voire optimale?» représentera une des clés de la réussite. Les 12 thèses énoncées à la fin de ce document sont issues de cette expérience, et pourront servir de lignes directrices.
Évolution de la société et conditions-cadres
2Gesellschaftliche Entwicklungen und Rahmenbedingungen
2.1 Entschleunigung innerorts
Décélération en ville
2.2 Schlüsse aus den Tempo 30-Urteilen
Conclusion de la juridiction sur la limitation à 30 km/h
2.3 Tempo 30-Zonen auf Berner Kantonsstrassen
Zones limitées à 30 km/h sur les routes cantonales bernoises
2.4 Schneller und weiter
Plus vite, plus loin
2.5 Verkehr und Emotionen
Déplacements et émotions
2.6 Mobilité et justice sociale
Mobilität und soziale Gerechtigkeit
2.7 Synthese
Synthèse
Décélération en ville
2.1Entschleunigung innerorts
Fokus auf die rechtlichen Aspekte
René Schafhauser
Rechtliche Grundlagen und ihre Charakteristika
Im Jahr 1984 wurde die heute im schweizerischen Recht geltende Höchstgeschwindigkeit innerorts von 50 km/h festgeschrieben, im Jahr 1990 folgten die Höchstgeschwindigkeiten ausserorts (80 km/), auf Autostrassen (100 km/h) und auf Autobahnen (120 km/h). Erst im Jahr 2002 trat die folgende Bestimmung der Strassensignalisationsverordnung (SSV) in Kraft:
Art. 22a Tempo 30-Zone
Das Signal „Tempo 30-Zone“ (2.59.1) kennzeichnet Strassen in Quartieren oder Siedlungsbereichen, auf denen besonders vorsichtig und rücksichtsvoll gefahren werden muss. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.
Gleichzeitig wurde in die SSV Art. 2a „Zonensignalisation“ eingeführt. Nach dessen Abs. 5 sind Tempo-30- und Begegnungszonen nur auf Nebenstrassen mit möglichst gleichartigem Charakter zulässig. Wird nach Abs. 6 auf einem Hauptstrassenabschnitt auf Grund der Voraussetzungen nach Art. 108 SSV die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt, so kann dieser Abschnitt ausnahmsweise bei besonderen örtlichen Gegebenheiten (z.B. in einem Ortszentrum oder in einem Altstadtgebiet) in eine Tempo 30-Zone einbezogen werden.
Schliesslich regelt Art. 108 SSV die Voraussetzungen für Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten. Danach kann die zuständige Behörde zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten (von Art. 4a VRV) anordnen (Art. 108 Abs. 1 SSV). – Absatz 2 konkretisiert (bzw. repetiert oder paraphrasiert teilweise) die Gründe, die zu einer Herabsetzung führen können, und zählt abschiessend vier Gründe auf: Besondere Gefahr, besonderes Schutzbedürfnis bestimmter Strassenbenützer, Verbesserung des Verkehrsablaufs auf Strecken mit grosser Verkehrsbelastung sowie Verminderung einer übermässigen Umweltbelastung (beim letztgenannten Grund führt der Verordnungstext – in beinahe neckischer Weise – an, es sei dabei der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu wahren – wie wenn dieser Grundsatz des Verfassungsrechts keine durchgängige Geltung hätte).
Schliesslich ist auf Art. 32 Abs. 2 und 3 SVG hinzuweisen, wonach der Bundesrat die Geschwindigkeit der Motorfahrzeuge auf allen Strassen beschränkt und die zuständige Behörde diese Höchstgeschwindigkeit für bestimmte Strassenstrecken nur auf Grund eines Gutachtens herab- oder heraufsetzen kann. Dazu hat das ASTRA Weisungen erlassen.
Lässt man diese rechtlichen Grundlagen Revue passieren, fällt folgendes auf:
(1) Der Bund möchte grundsätzlich eine schweizweit möglichst einheitliche Verkehrsordnung – auch bezüglich der Höchstgeschwindigkeiten – durchsetzen. Die Kantone und Gemeinden sollen keine Befugnis haben, diese Verkehrsordnung nach ihrem Gutdünken abzuändern, zu durchbrechen oder gar zu unterlaufen. Solchem Föderalismus soll durch die Bundesordnung ein Riegel geschoben werden. Diesem Ziel dient etwa die Bestimmung von Art. 2a Abs. 5 SSV, wonach Tempo 30-Zonen grundsätzlich nur auf Nebenstrassen mit möglichst gleichartigem Charakter zulässig sind (mit Ausnahmen in Abs. 6) oder die Bestimmung, wonach Abweichungen von der allgemeinen Ordnung nur auf Grund eines Gutachtens erfolgen können (Art. 32 Abs. 3 SVG).
(2) Dennoch besteht aus den bereits genannten Gründen die Notwendigkeit, auf besondere Situationen in Abweichung vom grundsätzlich schweizweit geltenden Regime angemessen reagieren zu können. Die Unterschiede vor Ort insbesondere bezüglich Gefahren, Überlastung von Strassen und Umweltbelastung sind zu gross, als dass sich ein uniformes System durchsetzen liesse.
(3) Aus dieser Notwendigkeit, auf besondere Fälle angemessen reagieren zu können, hat der Bund mit einem differenzierten System von (gewissermassen) ‚Ausnahmebewilligungen‘ reagiert: Aufzählung der Gründe/Motive, die eine Abweichung allenfalls rechtfertigen können, Erfordernis eines Gutachtens, das u.a. von der technischen, aber etwa auch von der finanziellen Seite die Erforderlichkeit und gewissermassen ‚Alternativlosigkeit‘ der gewünschten Beschränkung aufzeigt usw.
(4) Diese Ausnahmeregelungen enthalten eine grosse Zahl von unbestimmten Rechtsbegriffen (es finden sich eigentliche Schulbuchbeispiele dafür; die folgende Kurzaufzählung nennt der Einfachheit halber die Rechtsquellen nicht, nimmt aber auch Bezug auf die Weisungen): Verminderung besonderer Gefahren; besonders schutzbedürftige Strassenbenützer; besondere örtliche Gegebenheiten; Verminderung übermässiger Umweltbelastung; Strassen mit möglichst gleichartigem Charakter; gegebenenfalls – je nach Zweck und Situation – Erfordernis genauerer Analysen des Unfallgeschehens usw. usf.
Die Verwendung unbestimmter Rechtsbegrife rechtfertigt sich meist dann, wenn die Spezifika der Rechtswirklichkeit rechtlich nicht mit genügender Bestimmtheit abgebildet werden können, weil sie zu unterschiedlich – und auch oft nicht vorhersehbar – sind (man denke etwa auch an den verschiedenenorts verwendeten Terminus des ‚besonders schweren Falls‘ oder der ‚wichtigen Gründe‘). Für den Rechtsetzer gewissermassen eine Entlastung, stellen sie den Rechtsanwender aber regelmässig vor besondere Auslegungsprobleme. Daraus ergeben sich, gerade wenn so unterschiedliche Rechtsanwender das Parkett bevölkern, verschiedenste Unsicherheiten.
Anwendungsfragen am Beispiel des Urteils „Sumvitg“ (BGE 139 II 145)
1. Prozessgeschichte
Durch den Ortskern von Sumvitg führt die Hauptstrasse Brig-Furkapass-Andermatt-Oberalp-Disentis-Ilanz-Flims-Reichenau (H19).
Nachdem dem Gemeindevorstand Sumvitg eine Petition für die Einführung einer Tempo 30-Zone im Ortskern eingereicht worden war, beauftragte dieser ein Planungsbüro mit der Erstellung eines Gutachtens iSv Art. 108 Abs. 4 SSV. Das Gutachten kam zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen dafür erfüllt seien. In der Folge ersuchte der Gemeindevorstand die zuständige kantonale Behörde um die Einführung einer Tempo 30-Zone in Sumvitg.
„Zum nötigen Schutze unserer Mitmenschen sollte es trotz einem Zeitverlust von 5 Sekunden kein Tabu-Bruch sein, eine Ortsdurchfahrt zu verlangsamen .“ (R. Schafhauser)
Die kantonale Kommission für differenzierte Höchstgeschwindigkeiten lehnte die Einführung von Tempo-30 auf der Hauptstrasse H19 ab, befürwortete hingegen das Gesuch für das übrige Gemeindegebiet. Das zuständige Departement genehmigte das Gesuch der Gemeinde innerorts, lehnte jedoch den Einbezug der Hauptstrasse H 19 ab. Gegen diese Verfügung gelangten 5 Einwohner von Sumvitg mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht. Dieses führte einen Augenschein durch und erteilte gleichentags der Gemeinde Sumvitg die Bewilligung, auf der Hauptstrasse H 19 eine Tempo 30-Zone einzuführen.
Gegen diesen Entscheid führte der TCS Beschwerde ans Bundesgericht mit dem Antrag, der angefochtene Entscheid sei aufzuheben und die Sache sei zur weiteren Beweiserhebung und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz bzw. an die Genehmigungsbehörde zurückzuweisen.
2. Anwendbare Kriterien / Einschätzung der Gefahrenlage
Der TCS rügt zunächst, das Verwaltungsgericht hätte nicht selbst den Einbezug der H 19 in die Tempo 30-Zone genehmigen dürfen; hiefür sei nach der kantonalen Zuständigkeitsordnung ausschliesslich das Departement zuständig. Dies trifft – so das Bundesgericht – zu, doch kann das Verwaltungsgericht bei der Aufhebung eines Departementsentscheids selbst in der Sache entscheiden, wenn diese spruchreif ist. Dies ist nur dann der Fall, wenn der Einbezug der H 19 in die Tempo 30-Zone nicht nur zulässig, sondern geboten ist. Nur in diesem Fall wäre das Departement verpflichtet, dem Gesuch der Gemeinde stattzugeben, ohne dass ihm hinsichtlich des Ob noch ein Ermessensspielraum zustehen würde.
Der TCS macht weiter geltend, zwar regle Art. 108 SSV abschliessend die Voraussetzungen für die Einführung einer Tempo 30-Zone, doch bestehe kein justiziabler Anspruch auf Einführung einer solchen Zone; den zuständigen kantonalen Behörden verbleibe ein grosser Ermessensspielraum. Er verweist u.a. auf von der Regierung genehmigten Richtlinien „Verkehrsberuhigung innerorts“, welche als ein zwingendes Kriterium den V 85-Wert definiere, d.h. die Geschwindigkeit, die von 85 % der gemessenen Fahrzeuge nicht überschritten werde. Dieser Wert dürfe bei Hauptstrassen nicht mehr als 42 km/h betragen. Da das Kriterium in Sumvitg nicht eingehalten worden sei, habe das Departement darauf verzichtet, die weiteren Voraussetzungen zu prüfen und habe sich insbesondere nicht mit dem Gutachten befasst. Das Verwaltungsgericht habe festgehalten, der V 85-Wert dürfe für die Einführung einer Tempo 30-Zone keine Rolle spielen, er diene vielmehr dazu, die Zahl und Art der baulichen Massnahmen festzulegen (auch das ASTRA stimmte dem Verwaltungsgericht zu, dass dieser Wert wenig geeignet sei, um die Erforderlichkeit des Einbezugs eines Hauptstrassenabschnitts in eine Tempo 30-Zone zu klären). Damit habe das Verwaltungsgericht sein Ermessen an die Stelle desjenigen des Departements gesetzt.
Das Bundesgericht geht die Frage des Einbezugs der H 19 folgendermassen an. Da der Abschnitt der H 19, der in die Tempo 30-Zone einbezogen werden soll, mitten durch das Ortszentrum von Sumvitg verläuft und auf beiden Seiten von der (bereits vom Departement genehmigten) Tempo 30-Zone umschlossen wird, liegen besondere örtliche Gegebenheiten i.S.v. Art. 2a Abs. 2 SSV vor, bei denen der Einbezug der Hauptstrasse in eine Tempo 30-Zone in Betracht kommen kann, sofern die übrigen Voraussetzungen vorliegen.
Im Gutachten wird festgehalten, dass die Ortsdurchfahrt von Sumvitg über bedeutende Strecken über gar kein oder nur ein einseitiges Trottoir verfügt (wo es ein Trottoir gibt, entspricht es nicht der Norm von 1,5 m Breite). Viele Fussgänger, die sich entlang der Ortsdurchfahrt bewegen, sind ausserordentlich gefährdet (ältere Leute, Eltern mit Kleinkindern im Kinderwagen, Kindergärtner und Schulkinder, die zur Haltestelle des Schulbusses am westlichen Dorfende laufen müssen).
Längs der Ortsdurchfahrt gibt es wichtige Querungen für Fussgänger (Dorfladen, Kirche usw.). Das teilweise sehr enge Strassentrassee verunmöglicht die Kreuzung grosser Fahrzeuge. Viele Hauseingänge führen direkt auf die Strasse. Personen mit Kinderwagen oder Rollstuhlfahrende sind teilweise gezwungen, sich ausschliesslich auf der Strasse zu bewegen. Diese Sicherheitsdefizite werden durch kurze Sichtdistanzen noch verstärkt.
Das Departement ging mit der Kommission davon aus, dass keine eigentlichen Sicherheitsdefizite erkennbar und durch Unfallzahlen belegbar seien.
Es trifft zu, dass sich diese Gefahrensituation bisher nicht in Verkehrsunfällen niedergeschlagen hat. „Bestehen jedoch erhebliche Sicherheitsdefizite im Strassenverkehr, darf nicht zugewartet werden, bis sich die ersten Unfälle ereignet haben, sondern es müssen präventive Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit getroffen werden“ (Erwägung 5.6 des Urteils des Bundesgerichts).
Streitig ist noch, ob es aus der Sicht des Strassenverkehrs mildere Massnahmen gibt.
Der Bau der fehlenden Trottoirs wäre gemäss Gutachten mit grossen Eingriffen in die Siedlung und das Ortsbild verbunden (Abbruch bzw. Teilabbruch von Gebäuden). Die bereits zu enge Fahrbahn kann auch nicht zugunsten breiterer Trottoirs reduziert werden. Damit sind keine baulichen Massnahmen zur Verbesserung der Gehwegsituation ersichtlich. Andere Möglichkeiten (z.B. Umgehungsstrasse, Tunnellösung) wären nicht nur mit sehr hohen Kosten verbunden, sondern würden Entscheide auf politischer Ebene voraussetzen, weshalb sie nicht als mildere bauliche Massnahmen in Betracht gezogen werden können.
Damit ist der Einbezug der H 19 das einzige Mittel, um die gravierende Gefährdung von Fussgängern im Ortskern zu reduzieren. Daher „war das Departement nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, das Gesuch der Gemeinde (im Grundsatz) zu bewilligen. Es wäre ermessensmissbräuchlich, unter diesen Umständen den Interessen am möglichst ungehinderten Durchgangsverkehr Vorrang vor der physischen Integrität der Bewohner von Sumvitg zu geben. Das Verwaltungsgericht war daher berechtigt, den Einbezug der Hauptstrasse in die Tempo 30-Zone an Stelle des Departements anzuordnen“ (Erwägung 5.10 des Urteils des Bundesgerichts).
Abschliessende Bemerkungen
Der Einbezug von Hauptstrassenabschnitten in Tempo 30-Zonen – der nur ausnahmsweise und bei besonderen örtlichen Gegebenheiten erfolgen kann – sowie die Prüfung der Verhältnismässigkeit der Massnahme in einem umfassenden Sinn stellten hier (wie auch in anderen Fällen) eine besondere Knacknuss dar. Der dabei den zuständigen Behörden zustehende Ermessensspielraum scheint mancherorts in Gefahr zu laufen, ideologisch missbraucht zu werden.
Dass kantonale Verwaltungsstellen sich bei der Prüfung auf ein (umstrittenes) Erfordernis einer regierungsrätlichen Richtlinie festlegen und sich damit einer integralen Prüfung gewissermassen verweigern, erstaunt in hohem Masse.
Dass der TCS (dem der Schreibende auch als Mitglied angehört) vermeint, die Interessen seiner Mitglieder mit dem rechtlichen Kampf um eine möglichst ungehinderte Dorfdurchfahrt trotz schwerwiegender Gefährdungen der Dorfbewohner zu vertreten, ist nicht minder ideologiegeladen.
In einer einigermassen ‚reifen‘ Zivilgesellschaft sollte es sowohl für die verantwortlichen Behörden wie auch für grosse Interessengruppen möglich sein, elementare Fragen der Sicherheit unserer Mitmenschen gefahrenangemessen – und das heisst hier: sachlich, emotions- und ideologiefrei – abzuhandeln. Es ist kein Tabu-Bruch, wenn auf einem kleinen Stück einer Hauptverkehrsader zum nötigen Schutz unserer Mitmenschen statt 50 km/h nur 30 km/h gefahren werden kann, selbst wenn – wie das Gutachten aufzeigt – ein Zeitverlust von etwa 5 Sekunden in Kauf zu nehmen ist.
Conclusion de la juridiction sur la limitation à 30 km/h
2.2Schlüsse aus den Tempo 30-Urteilen
Tempo 30 auf verkehrsorientierten Strassen
Stefan Huonder1
Konzept des Bundes / Aktuelle Rechtsgrundlagen1
Im Jahr 1989 hat der Bundesrat die Möglichkeit der Zonensignalisation eingeführt. Diese erlaubt im Innerortsbereich die Signalisierung von Verhaltensvorschriften für mehrere gleichartige Nebenstrassen eines abgegrenzten Gebiets, ohne dass dafür eine grosse Anzahl von Signalen verwendet werden muss. Unter anderem wurde damit auch ermöglicht, eine Geschwindigkeitsreduktion auf 30 km/h mittels Zonensignalisation anzuordnen. Die Anordnung von Tempo 30-Zonen war aber nur in Ausnahmefällen zulässig. Trotz der klaren Ablehnung der Volksinitiative "für mehr Verkehrssicherheit durch Tempo 30 innerorts mit Ausnahmen (Strassen für alle)", welche innerorts flächendeckend Tempo 30 im Sinne einer allgemeinen Höchstgeschwindigkeit einführen wollte, wurde erkannt, dass ein Bedürfnis nach einer einfacheren Einführung von Tempo 30-Zonen auf bestimmten Strassen im Innerortsbereich, für die 30 km/h aufgrund von Ausbaugrad und Erscheinungsbild sachgerecht ist2, nicht von der Hand zu weisen ist. Daher wurden im Jahr 2002 neue Bestimmungen ins Verordnungsrecht eingeführt sowie die Verordnung des UVEK über die Tempo 30-Zonen und die Begegnungszonen ins Leben gerufen, welche die Voraussetzungen für die Einführung von Tempo 30-Zonen und Begegnungszonen konkretisieren und im Ergebnis erleichtern sollten3. Die Anforderungen an die Gestaltung solcher Zonen wurden herabgesetzt und das von Gesetzes wegen verlangte Gutachten erschöpft sich in einem Kurzbericht. Für die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit weiterhin vorausgesetzt ist das Vorliegen eines Grundes nach Artikel 108 Absatz 2 der Signalisationsverordnung (SSV). Als Gründe kommen somit die Verkehrssicherheit, die Verbesserung des Verkehrsablaufs oder die Verminderung einer übermässigen Umweltbelastung in Betracht.
Nach Artikel 2a Absatz 5 SSV sind Tempo 30-Zonen nur auf Nebenstrassen mit möglichst gleichartigem Charakter zulässig, welche auch als siedlungsorientierte Strassen bezeichnet werden4. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Zonensignalisation erfahrungsgemäss nur auf siedlungsorientierten Strassen mit gleichartigen Merkmalen die gewünschte Wirkung entfaltet, nicht aber auf sogenannten verkehrsorientierten Strassen (z.B. signalisierte Hauptstrassen).
„Zur Vermeidung oder Verminderung besonderer Gefahren im Strassenverkehr, zur Reduktion einer übermässigen Umweltbelastung oder zur Verbesserung des Verkehrsablaufs kann die Behörde oder das Bundesamt für bestimmte Strassenstrecken Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten anordnen.“ (Art. 108 Abs. 1 SSV)
Siedlungsorientierte Strassen sind Erschliessungsstrassen mit geringer Verkehrsmenge, welche aufgrund ihres Erscheinungsbildes bzw. ihrer Ausgestaltung nur mit geringeren Geschwindigkeiten befahren werden. Sie werden auch als Strassen, die für den Motorfahrzeugverkehr von untergeordneter Bedeutung sind, bezeichnet. Im optimalen Fall soll die Gestaltung des Strassenraums dem Verkehrsteilnehmer aufzeigen, dass er sich auf einer siedlungsorientierten Strasse befindet.
Verkehrsorientierte Strassen sind hingegen auf die Anforderungen des Motorfahrzeugverkehrs ausgerichtet, haben primär Durchleitungs- sowie Verbindungsfunktion und müssen eine grosse Verkehrsmenge bewältigen. Zu den verkehrsorientierten Strassen zählen alle Hauptstrassen, aber auch Nebenstrassen mit Durchleitungs- und Verbindungsfunktion.
Auf den verkehrsorientierten Strassen ist die Anordnung von Tempo 30-Zonen somit grundsätzlich nicht zulässig. Hier ist eine Temporeduktion auf 30 km/h bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Artikel 108 SSV grundsätzlich mittels des Signals "Höchstgeschwindigkeit" und nicht mittels des Signals "Tempo 30-Zone" anzuzeigen. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz ist in Artikel 2a Absatz 6 SSV normiert, welcher besagt, wann der Einbezug eines Hauptstrassenabschnittes in eine Tempo 30-Zone zulässig ist. Auch hier ist der Begriff Hauptstrassenabschnitt nicht in dem Sinne zu verstehen, dass sich diese Bestimmung nur auf signalisierte Hauptstrassen bezieht, sondern davon erfasst werden alle verkehrsorientierten Strassen. Voraussetzung für diesen Einbezug einer verkehrsorientierten Strasse in eine Tempo 30-Zone ist, dass eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h auf diesem Abschnitt den Anforderungen nach Artikel 108 SSV entspricht, besondere örtliche Gegebenheiten vorliegen und, – wie das Wort Einbezug schon vermuten lässt – dass der fragliche Hauptstrassenabschnitt unmittelbar an eine bereits bestehende Tempo 30-Zone angrenzt. Trotz des Einbezugs behält der Strassenabschnitt aber seinen verkehrsorientierten Charakter bei, weshalb die Verordnung über Tempo 30-Zonen und Begegnungszonen hier keine Anwendung findet. Daher müssen dort Abweichungen vom Rechtsvortritt nicht mit der Verkehrssicherheit begründet werden und Fussgängerstreifen sind nicht grundsätzlich unzulässig. Diese Möglichkeit des Einbezugs verkehrsorientierter Strassen existiert nur bezüglich der Tempo 30-Zonen. Ein Einbezug einer verkehrsorientierten Strasse in eine Begegnungszone ist von vornherein ausgeschlossen.
Rechtsprechung
Das Bundesgericht hat sich wiederholt zur Zulässigkeit der Anordnung von Tempo 30-Zonen geäussert. Umstritten waren in der Praxis vor allem der Einbezug von verkehrsorientierten Strassen, aber auch die Anforderungen an das Gutachten und die zulässigen Gründe für eine Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit. Über die Jahre ist so eine Rechtsprechung entstanden, welche die Voraussetzungen für die Einführung von Tempo 30-Zonen konkretisiert hat.
Im Bundesgerichtsentscheid 2A.38/2006 vom 13. Juli 2006 bezüglich der Anordnung einer Tempo 30-Zone in der Stadt St. Gallen wurde festgehalten, dass Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten nur gestützt auf die in Artikel 108 Absatz 2 SSV abschliessend aufgeführten Gründe angeordnet werden können, nicht aber gestützt auf die in Artikel 3 Absatz 4 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG) genannten Gründe. Artikel 32 SVG, der die gesetzliche Grundlage für Artikel 108 SSV bildet, sei gegenüber Artikel 3 Absatz 4 SVG als lex specialis zu verstehen. Kantonen und Gemeinden bleibe daher kein Raum mehr, Abweichungen von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten gestützt auf Artikel 3 Absatz 4 SVG anzuordnen. Auch eine Tempo 30-Zone stelle kein eigenes Verkehrsregime, sondern eine Abweichung von den allgemeinen Höchstgeschwindigkeiten dar, weshalb für deren Anordnungen die Voraussetzungen nach Artikel 108 Absatz 2 SSV erfüllt sein müssen. In casu seien die Voraussetzungen für die Herabsetzung der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit aber nicht erfüllt, da es im betroffenen Wohngebiet keinen Durchgangsverkehr gebe und nur eine geringe Verkehrsdichte bestehe, sodass weder eine Gefährdungssituation noch eine übermässige Umweltbelastung bestehe.
In seinem Entscheid 1C_370/2011 vom 9. Dezember 2011 betreffend der Umwandlung einer Tempo 30-Zone in eine Begegnungszone führte das Bundesgericht aus, dass die Voraussetzungen von Artikel 108 SSV zudem nicht nur bei der erstmaligen Abweichung von der allgemeinen Höchstgeschwindigkeit, sondern auch für jede weitere Geschwindigkeitsreduktion gegeben sein müssen. Auch die Anordnung einer Begegnungszone innerhalb einer Strasse, auf der eine Tempo 30-Zone signalisiert ist, muss sich daher an den Voraussetzungen gemäss Artikel 108 SSV messen lassen. Es ist aber nicht von vornherein ausgeschlossen, sich für die Umwandlung der Tempo 30-Zone in eine Begegnungszone auf das Gutachten zu stützen, welches anlässlich der Anordnung der Tempo 30-Zone erstellt wurde.
Im Entscheid 1C_206/2008 vom 9. Oktober 2008 bezüglich der Anordnung einer Tempo 30-Zone in der Gemeinde Wahlern hat das Bundesgericht bestätigt, dass für die Herabsetzung der Geschwindigkeit auch bei der Anordnung einer Tempo 30-Zone die Erstellung eines Gutachtens erforderlich ist. Darin ist darzulegen, dass die Massnahme dem Verhältnismässigkeitsprinzip entspricht. Mit Verweis auf die Rechtsprechung des früher in diesem Bereich zuständigen Bundesrats hält das Bundesgericht fest, dass Inhalt und Umfang des Gutachtens vom Zweck der Geschwindigkeitsbeschränkung und von den örtlichen Gegebenheiten abhängen. Deshalb können die Anforderungen an das Gutachten von Fall zu Fall unterschiedlich ausfallen. Das Gutachten sei zudem nicht isoliert zu betrachten, sondern es könne auch auf andere Erhebungen zurückgegriffen werden. Zwar prüft das Bundesgericht die Zulässigkeit einer Tempo 30-Zone grundsätzlich frei, es übt aber Zurückhaltung bei der Würdigung der örtlichen Verhältnisse. Bezüglich der Abwägungen der von der Massnahme betroffenen Interessen kommt der Behörde ein erheblicher Ermessensspielraum zu. Zur Beurteilung von bestehenden und absehbaren Sicherheitsdefiziten war in casu kein Nachweis von statistisch signifikanten Unfallzahlen erforderlich. Die gefährlichen Stellen ergaben sich aus der kartographierten Analyse der Gefahrenstellen und dem Fotodossier. Angesichts der örtlichen Verhältnisse mit fehlenden oder nur einseitigen Trottoirs, gefährlichen Querungen sowie unübersichtlichen Kurven ging die Fachbehörde davon aus, dass es keine geeigneteren Massnahmen gebe, um einen umfassenden Schutz der Fussgänger und der Schulkinder zu erreichen. Im vorliegenden Fall hat das Gutachten somit aufgezeigt, dass bestimmte Strassenbenützer eines besonderen, nicht anders zu erreichenden Schutzes bedürfen und die Voraussetzungen für die Einführung einer Tempo 30-Zone erfüllt sind.





























