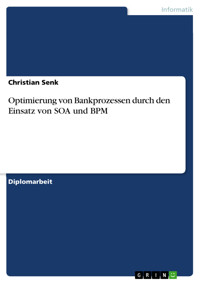
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Informatik - Wirtschaftsinformatik, Note: 1,0, Universität Regensburg (Wirtschaftsinformatik), Sprache: Deutsch, Abstract: Das Bankengeschäft befindet sich gegenwärtig in einer Umbruchphase. Stetig zunehmende Dynamik bei gleichzeitig steigenden marktlichen und regulatorischen Anforderungen erfordern sowohl die strukturelle Anpassungsfähigkeit als auch die Transparenz von Kreditinstituten und deren Leistungserstellung. Gleichzeitig sehen sich Banken einem enormen Kostendruck ausgesetzt. Als Konsequenz wurde begonnen, Konzepte der fertigenden Industrie auf das Bankengeschäft anzuwenden. Im Fokus steht hierbei das Business Process Management (BPM) als Systematisierung von Methoden zur nachhaltigen Verbesserung von Geschäftsprozessen. Eine Problematik ergibt sich hier jedoch aus der traditionell hohen Abhängigkeit zwischen Bankprozessen und der unterstützenden IT. Während auf fachlicher Ebene Fexibilität gefordert wird, weisen bankbetriebliche IT-Landschaften historisch bedingt einen hohen Grad an gewachsener Änderungsresistenz auf, der der Optimierung von Prozessen frontal entgegensteht. Der Einsatz Serviceorientierter Architekturen (SOA) zeigt sich hier als probater Lösungsweg. Durch die Strukturierung der Bank-IT in lose gekoppelte fachliche Services werden Prozess- und die unterstützende Anwendungsebene logisch entkoppelt. Motivation ist hierbei zunächst die Flexibilisierung der IT; allerdings nicht als Selbstzweck. Ultimatives Ziel ist die schrittweise Ausrichtung der Informationssysteme an den Prozessen, um diese effizienter und effektiver unterstützen zu können. Sowohl BPM als auch SOA eignen sich zur Optimierung von Bankprozessen. Gleichzeitig zeigt sich, dass klare Schnittstellen und einhergehend diverse wechselseitige Potenziale zueinander bestehen. In der Praxis haben beide Ansätze eine sehr hohe Relevanz, werden jedoch isoliert betrachtet, BPM vornehmlich aus einer fachlich-organisatorischen, SOA aus einer primär technischen Perspektive. Mögliche Potenziale werden hier verschenkt. Um diese effektiv freisetzen zu können, bedarf es einer strategisch ausgerichteten Systematik zur methodischen, technischen und organisatorischen Harmonisierung der beiden Ansätze. Die durchgängige Implementierung geeigneter Steuerungsstrukturen von der Strategie- bis zur Systemebene ermöglicht hierbei die kontrollierte Evolution einer integrierten BPM-/SOA-Organisation, die auf lange Sicht Business-IT-Alignment steigern wird und im gleichen Zug eine effektive Optimierung von Bankprozessen ermöglicht. In Form eines Governance-Modells werden hierfür geeignete Ansätze geliefert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt bei www.grin.com
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Management Summary
1. Einführung
1.1 Motivation und Problemstellung
1.2 Zielsetzung der Arbeit
1.3 Aufbau der Arbeit
2. Kritische Betrachtung von Bankprozessen
2.1 Theoretische Grundlagen der Geschäftsprozessbetrachtung
2.1.1 Prozessorientierung als Optimierungsparadigma
2.1.2 Geschäftsprozessdefinition
2.1.3 Klassifizierung von Geschäftsprozessen
2.1.4 Beschreibung von Geschäftsprozessen
2.2 Bankbetriebliche Leistungserstellung
2.2.1 Produkte einer Universalbank
2.2.2 Prozesstypen einer Bank
2.2.3 Industrialisierung der Bank als zentrale Herausforderung
2.2.3.1 Industrialisierung der Bankenbranche
2.2.3.2 Produktentwicklung
2.2.3.3 Vertrieb
2.2.3.4 Abwicklung
2.2.3.5 Transformation
2.2.4 Notwendigkeit einer ganzheitlichen Prozessoptimierung
3. Management bankbetrieblicher Geschäftsprozesse
3.1 Begriffsdefinition Business Process Management
3.2 Phasen eines integrierten BPM
3.2.1 Strategisches Geschäftsprozessmanagement
3.2.2 Entwurf von Geschäftsprozessen
3.2.3 Umsetzung von Geschäftsprozessen
3.2.4 Geschäftsprozesscontrolling
3.2.5 Zusammenfassung
3.3 Einsatz und Grenzen von BPM bei Finanzdienstleistern
4. Serviceorientierte Architekturen in Banken
4.1 Architekturbegriff
4.2 IT als Treiber flexibler Bankarchitekturen
4.3 Grundlagen serviceorientierter Architekturen
4.3.1 Definition und Zielsetzung von SOA
4.3.2 Service als zentraler SOA-Baustein
4.3.3 SOA-Infrastruktur
4.3.4 Organisatorische SOA-Umsetzung
4.3.5 SOA-Reifegradmodelle
4.3.5.1 SOA Maturity Model
4.3.5.2 SOA-Bewertungsmodell von Krafzig et al.
4.4 Einsatz und Entwicklung von SOA in Banken
4.5 Notwendigkeit eines Ansatzes für verbessertes Alignment
5. Business-IT-Alignment als Integrationskontext
5.1 Wertbeitrag der IT
5.2 Begriffsdefinition Business-IT-Alignment
5.2.1 Systemisches Alignment
5.2.2 Temporales Alignment
5.2.3 Kognitives Alignment
5.2.4 Strategisches Alignment
5.2.5 Architektonisches Alignment
5.3 Unternehmensarchitekturen als Alignmentinstrument
5.3.1 Begriffsdefinition Integration
5.3.1.1 Integrationsgegenstand
5.3.1.2 Integrationsrichtung
5.3.1.3 Integrationsreichweite
5.3.1.4 Automationsgrad
5.3.2 Unternehmensarchitekturansätze im Detail
5.3.2.1 Zachman Framework
5.3.2.2 The Open Group Architecture Framework (TOGAF)
5.3.2.3 Architektur integrierter Informationssysteme (ARIS)
5.3.2.4 Business Engineering
5.3.2.5 Zusammenfassung
5.3.3 Einordnung von BPM und SOA in die Unternehmensarchitektur
5.3.3.1 Strukturelle Einordnung
5.3.3.2 Konstruktive Einordnung
5.3.4 Eignung von BPM und SOA als Alignmentinstrumente
6. Integrierte Betrachtung von SOA und BPM in Banken
6.1 Organisatorisches Kontrollsystem
6.1.1 Corporate Governance
6.1.2 IT-Governance
6.1.3 Einordnung der SOA-/ BPM-Governance
6.2 Aufgabenfelder von BPM- und SOA-Governance
6.2.1 Aufgaben der SOA-Governance
6.2.2 Aufgaben der BPM-Governance
6.3 Integrierte BPM-/ SOA-Organisation
6.3.1 Rollen und Verantwortlichkeiten
6.3.2 Prozesse
6.3.2.1 Strategische Zieldefinition
6.3.2.2 Ressourcenbereitstellung und Konfliktbeseitigung
6.3.2.3 Zielverfolgung und kontrollierte Entwicklung
6.3.2.4 Infrastruktur und Standardisierung
6.3.2.4.1 Spezifizierung einer Referenzarchitektur
6.3.2.4.2 Auswahl der SOA-Infrastruktur
6.3.2.4.3 Werkzeuge und Methoden für serviceorientiertes BPM
6.3.2.4.4 Spezifizierung von Standards und Richtlinien für SOA
6.3.2.5 Architekturmanagement
6.3.2.5.1 Logische Identifizierung von Services
6.3.2.5.2
6.3.2.6 Serviceorientierter Prozessentwurf
6.3.2.7 Serviceorientierte Prozessumsetzung
6.3.2.8 Betrieb und Controlling serviceorientierter Prozesse
6.3.3 Schnittstellen operativer Prozesse
6.4 Zusammenfassung und Bewertung des Ansatzes
7. Fazit
7.1 Zusammenfassung und Ausblick
7.2 Einschränkungen und Forschungsbedarf
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1‑1. Aufbau der Arbeit
Abbildung 2‑1. Unterscheidung Funktions- und Prozessorientierung
Abbildung 2‑2. Prozessdefinition [Fischermanns 2006, S. 12]
Abbildung 2‑3. Komponenten eines Geschäftsprozesses
[Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 65]
Abbildung 2‑4. Prozessklassifizierung, [Fischermanns 2008, S. 100]
Abbildung 2‑5. Geschäftsprozessebenen, in Anlehnung an [Weske 2007, S. 18]
Abbildung 2‑6. Übersicht von Bankleistungen [Tolkmitt 2007, S. 97]
Abbildung 2‑7. Wertschöpfungskette einer Universalbank [Disselbeck 2007, S. 375]
Abbildung 2‑8. Rentabilität und Kosteneffizienz im europäischen Vergleich (Stand: 2005) [Capgemini 2006, S. 8]
Abbildung 2‑9. Vergleich der Produktionslogistik von Banken und der fertigenden Industrie [Beitel/ Leukert/ Walter 2005, S. 814]
Abbildung 2‑10. Kanalspezifische Entwicklung des Kundenservice
[Capgemini 2006, S. 10]
Abbildung 3‑1. PDCA-Zyklus der ständigen Verbesserung [Korbmann 2008, S. 228]
Abbildung 3‑2. Struktureller Vergleich verschiedener zyklischer BPM-Ansätze auf operativer Ebene
Abbildung 3‑3. Integriertes Business Process Management
Abbildung 3‑4. Vorgehensmodell der BPM-Governance
[Fischermanns 2008, S. 28]
Abbildung 3‑5. Zielsetzungen des BPM [Fischermanns 2008, S. 45]
Abbildung 3‑6. Vorgehensmodell der strategischen Prozessorganisation
[Fischermanns 2008, S. 21]
Abbildung 3‑7. Aufgaben des Geschäftsprozessentwurfs
Abbildung 3‑8. Aufgaben der Geschäftsprozessumsetzung
Abbildung 3‑9. Aufgaben des Geschäftsprozesscontrollings
Abbildung 4‑1. Gewachsene IT-Landschaft einer typischen deutschen Bank
[Petzel 2005b, S. 22]
Abbildung 4‑2. Entwicklung von IT-Architekturen [Masak 2007, S. 88]
Abbildung 4‑3. IT-Kostenstruktur einer Bank,
in Anlehnung an [Moormann 2007, S. 29ff]
Abbildung 4‑4. Ebenen der Serviceorientierung, in Anlehnung an [Erl 2007, S. 281]
Abbildung 4‑5. Bestandteile eines Service, in Anlehnung an [Krafzig 2005, S. 59]
Abbildung 4‑6. Abstraktion von der Serviceimplementierung,
in Anlehnung an [Erl 2007, S. 236]
Abbildung 4‑7. SOA-Interaktionsdreieck [Heutschi 2006, S. 29]
Abbildung 4‑8. Technische Komponenten einer SOA-Infrastruktur
[Dunkel/ Koschel 2007, S. 508]
Abbildung 4‑9. Einordnung SOA-Governance
Abbildung 4‑10. SOA Maturity Model, in Anlehnung an [Sonic 2006, S. 1]
Abbildung 4‑11. SOA-Bewertung [Krafzig/ Banke/ Slama 2007, S. 15]
Abbildung 4‑12. SOA-Technologien auf der Hype-Kurve [Keller 2007, S. 290]
Abbildung 5‑1. Wertbeitrag der IT, in Anlehnung an [Krcmar 2005, S. 399]
Abbildung 5‑2. Beziehung zwischen IT und Geschäftswelt [Masak 2006, S. 13]
Abbildung 5‑3. Einflussmodell von IT-Strategie und Business-strategie
[Masak 2006, S.165]
Abbildung 5‑4. Strategic Alignment Model, in Anlehnung an [Masak 2006, S. 171]
Abbildung 5‑5. Geschäftsstrategiesicht,
in Anlehnung an [Henderson/ Venkatraman 1993, S. 477; Masak 2006, S. 178]
Abbildung 5‑6. Technologiepotenzialsicht,
in Anlehnung an [Henderson/ Venkatraman 1993, S. 478; Masak 2006, S. 178f]
Abbildung 5‑7. Integrationsproblematik der Unternehmensarchitektur,
in Anlehnung an [Aier 2007, S. 135]
Abbildung 5‑8. Integrationsklassifizierung, in Anlehnung an [Kupsch 2006, S. 41]
Abbildung 5‑9. Integrationspyramide, in Anlehnung an [Scheer 1997, S. 5]
Abbildung 5‑10. Elemente eines Informationssystems [Sinz 1999, S. 4]
Abbildung 5‑11. Zachman Framework [Zachman 2008, S. 2ff]
Abbildung 5‑12. Architecture Development Method (ADM)
[The Open Group 2006, S. 1]
Abbildung 5‑13. ARIS-Haus, in Anlehnung an [Scheer 2002, S. 4; Allweyer 2005, S. 151]
Abbildung 5‑14. Teilarchitekturen des Business Engineering,
in Anlehnung an [Heutschi 2007, S. 9, Leist 2008a, S. 19]
Abbildung 5‑15. Aufgaben des Business Engineering nach PROMET,
in Anlehnung an [Leist 2008d, S. 12]
Abbildung 5‑16. Bewertung ausgewählter Architekturansätze,
in Anlehnung an [Leist 2008d, S. 27]
Abbildung 5‑17. Metamodell des Business Engineering,
in Anlehnung an [Österle/ Blessing 2003, S. 81; Winter/ Fischer 2006, S. 30]
Abbildung 5‑18. Top-Down-Konstruktion einer Unternehmensarchitektur,
in Anlehnung an [Winter/ Fischer 2006, S. 30]
Abbildung 6‑1. Einordnung von Corporate- und IT-Governance,
in Anlehnung an [Fröhlich/ Glasner 2007, S. 28]
Abbildung 6‑2. Einordnung von SOA- und BPM-Governance
in das organisatorische Kontrollsystem
Abbildung 6‑3. Rollenhierarchie
Abbildung 6‑4. Governance-, Management- und operative Prozesse von SOA und BPM
Abbildung 6‑5. Entscheidungsprozess, in Anlehnung an [Fiedler/ Seufert 2007, S. 30]
Abbildung 6‑6. Prozessassessment-Modell für Unternehmen (PAU-Modell)
[Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 317]
Abbildung 6‑7. BPMM-Modell [Bruin 2007, S. 3]
Abbildung 6‑8. SOA-Metamodell [Heutschi 2007, S. 25]
Abbildung 6‑9. Bedeutung einzelner SOA-Infrastrukturkomponenten [ibi 2008]
Abbildung 6‑10. PASS-Haus der HypoVereinsbank [Jung 2006, S. 14]
Abbildung 6‑11. Brüche zwischen fachlicher Prozessbeschreibung und Ausführung [Thomas/ Leyking/ Dreifus 2007, S. 38]
Abbildung 6‑12. Bedeutung und Umsetzung serviceorientierter Designprinzipien in Großbanken [ibi 2008]
Abbildung 6‑13 . Top-Down-Vorgehen zur Serviceidentifikation,
in Anlehnung an [Höß et al. 2007, S. 43]
Abbildung 6‑14. Meet-in-the-Middle-Ansatz [Höß et al. 2008, S. 45]
Abbildung 6‑15. Domänenbildung am Beispiel der HypoVereinsbank [Penzel 2004, S. 122]
Abbildung 6‑16. Hierarchisches Servicemodell [Müller 2007, S. 152]
Abbildung 6‑17. Service-Portfolio, in Anlehnung an [Stutz/ Aier 2007, S. 25]
Abbildung 6‑18. SOA-Scorecard der Sparkassen Informatik [Stutz/ Aier 2007, S. 24]
Abbildung 6‑19. Serviceallokation im Prozessmodell [Brabänder/ Klückmann 2006, S. 35]
Abbildung 6‑20. Service-Lebenszyklus [Josuttis 2007, S. 175]
Abbildung 6‑21. Gestaltungskontext der Macro-Governance
Abbildung 6‑22. SOA-BPM-Governance als ebenenübergreifender Regelkreis
Tabellenverzeichnis
Tabelle 2‑1. Charakteristika der Prozessklassen [Fischermanns 2008, S. 101]
Tabelle 2‑2. Vergleich von Workflow und Geschäftsprozess [Gadatsch 2001, S. 35]
Tabelle 2‑3. Basisnotation der EPK, in Anlehnung an [Gadatsch 2008, S. 97]
Tabelle 3‑1. Gegenüberstellung von BPM und BPR
[Neumann/ Probst/ Wernsmann 2005, S. 300]
Tabelle 4‑1. Anforderungen an die IS-Architektur [Birkhölzer/ Vaupel 2003]
Tabelle 5‑1. Beschreibung externer Alignment-Bewertungsgrößen [Masak 2006, S.174f]
Tabelle 6‑1. Inhaltliche Aspekte von SOA-Governance im Überblick
Tabelle 6‑2. Inhaltliche Aspekte von BPM-Governance,
in Anlehnung an [IDS Scheer 2008, S. 1; Rosemann 2005, S. 49]
Tabelle 6‑3. Hierarchische Governanceausprägungen,
in Anlehnung an [Keller 2007, S. 306; Neri 2007, S. 48ff].
Tabelle 6‑4. Rollen auf Strategie- und Managementebene
Tabelle 6‑5. Operative Rollen und Verantwortlichkeiten,
in Anlehnung an [Neri 2007, S. 47ff; Strnadl 2008, S. 528]
Tabelle 6‑6. Rollen und Prozesse auf Governance- und Managementebene
Tabelle 6‑7. Zuordnung von operativen Rollen und Prozessen,
in Anlehnung an [Strnadl 2008, S. 522ff]
Abkürzungsverzeichnis
Management Summary
Gegenstand dieser Arbeit ist die systematische Entwicklung eines Ansatzes für den integrierten Einsatz von Business Process Management (BPM) und ser-viceorientierten Architekturen (SOA) zur Optimierung von Bankprozessen.
1. Einführung
It is not the strongest […], nor the most intelligent that survives, it is the most adaptable to change.”
[Charles Darwin 1809-1882]
Dieses einführende Kapitel soll zunächst an die Themenstellung der Arbeit heranführen. Das Problem der Schnelllebigkeit der Bankenindustrie und die daraus resultierende Anforderung der Anpassungsfähigkeit von Kreditinstituten stellt im Rahmen dieser Arbeit die Motivation für die Anwendung der Konzepte BPM und SOA sowie deren integrierten Betrachtung zur Optimierung von Bankprozessen dar (Kapitel 1.1 „Motivation und Problemstellung“). Abschließend werden Zielsetzung (Kapitel 1.2) und Aufbau der Arbeit (Kapitel 1.3) spezifiziert.
1.1 Motivationund Problemstellung
Im heute von steigender Dynamik geprägten Markt hängt der Erfolg eines Unternehmens signifikant von dessen Fähigkeit ab, auf Veränderungen mög-lichst effizient und effektiv reagieren zu können. [Vogler 2006, S. 30; Österle/ Winter 2003, S. 5; Baumöl/ Winter 2003, S. 46]. Die Steuerung der betrieblichen Leistungserstellung orientiert sich hierbei an den Geschäftsprozessen einer Organisation [Becker/ Kahn 2005, S. 4f; Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 47ff]. Ändern sich extern implizierte Anforderungen laufend, so müssen Unternehmen entsprechend in der Lage sein, Veränderungsbedarfe zu erkennen und ihre Geschäftsprozesse entsprechend zu reoptimieren. Eine solche Art der proakti-ven Anpassungfähigkeit einer Organisation wird als Agilität bezeichnet [McCoy/ Plummer 2006, S. 2].
Gerade in der heute konsolidierten Bankenbranche ist Agilität von essenzieller Bedeutung [Löschenkohl 2005, S. 112]. Ursachen hierfür sind im Wesentlichen die zunehmende Wettbewerbsdynamik, ein „Wertewandel“ seitens des Kunden sowie Strukturänderungen im Zuge der Globalisierung. [Heinrich/ Leist 2003, S. 330]
Um den gewachsenen Anforderungen gerecht werden zu können, haben deut-sche Kreditinstitute begonnen, Konzepte der Industrialisierung auf die eigene Wertschöpfung anzuwenden. Die Maßnahmen umfassen einerseits die Opti-mierung operativer Bankprozesse, aber auch die Herstellung von Strukturen für eine nachhaltige Verbesserbarkeit der Leistungserstellung. [Disselbeck 2007, S. 102; Moormann 2007, S. 6; Petzel 2005a, S. 39f]
Business Process Management (BPM) ist ein probates Konzept, um flexibel auf neue Ansprüche im Sinne dieser Geschäftsprozessoptimierung reagieren zu können [Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 2; Allweyer 2005, S. 2]. Im Banken-kontext stellt sich allerdings die Informationstechnologie (IT) als begrenzender Faktor dar. Zum einen besteht eine starke Abhängigkeit der bankbetrieblichen Leistungserstellung von der IT, gleichzeitig weist diese jedoch historisch bedingt einen hohen Grad an Komplexität auf [Aier/ Schönherr 2007, S. 5]. Der gefor-derten fachlichen Flexibilität steht somit die inhärente Änderungsresistenz auf technischer Seite entgegen. [Rill/ Koch 2005, S. 22; Slama/ Weber 2006, S. 14; Riese 2006, S. 60ff; Berensmann 2005, S. 90; Moormann 2007, S. 2].
Genau diese Problematik adressiert das Konzept der serviceorientierten Archi-tektur (SOA) [Tilkov/ Starke 2007, S. 11f; Heutschi 2007, S. 61; Kempf 2008b, S. 31; Capgemini 2006, S. 5]. Durch Restrukturierung der IT mittels fachlicher Softwarebausteine wird die Bankinformatik potenziell sowohl flexibler als auch effizienter. Somit bildet SOA theoretisch die technische Grundlage für die Opti-mierung von Bankprozessen. [Rill/ Koch 2005, S. 22; Slama/ Weber 2006, S. 14; Riese 2006, S. 60ff; Berensmann 2005, S. 90; Moormann 2007, S. 2].
Die wechselseitige Abstimmung von Banken-IT und Bankgeschäft (Business-IT-Alignment) wird als Erfolgsfaktor für die Optimierung der bankbetrieblichen Leis-tungserstellung identifiziert [ibi 2008; Slama/ Weber 2006, S. 14f]. SOA und BPM sind Ansätze, die aus jeweils unterschiedlicher Perspektive heraus Busi-ness-IT-Alignment anstreben [Slama/ Weber 2006, S. 14f]. Aufgrund der ge-meinsamen Orientierung an der fachlichen Leistungserstellung sowie der gleichzeitigen Betrachtung unterschiedlicher, und für die Optimierung von Bank-prozessen relevanter Aspekte, wird ein Zusammenwachsen der beiden Kon-zepte prognostiziert [Gartner 2006, S. 1; Slama/ Weber 2006, S. 14f; Quantz 2006, S. 1]. Auf technischer Seite zeigt sich dies durch das steigende Angebot an kombinierten SOA-BPM-Plattformen [Quantz 2006, S. 1]. In der Praxis sind diesbezüglich jedoch noch diverse, sowohl technische als auch organisatori-sche Herausforderungen zu bewältigen [Brahe 2007, S. 105ff]. Für die integrier-te Betrachtung von BPM und SOA existierten in der Literatur keine holistischen Ansätze für Finanzdienstleister und somit auch keine zur Schaffung einer nach-haltig effizienten und agilen Bank.
An dieser Stelle soll diese Arbeit ansetzen.
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Ansatzes für den integrierten Einsatz von Business Process Management (BPM) und service-orientierten Architekturen (SOA) zur Optimierung von Bankprozessen.
Heranführend ist zunächst zu untersuchen, welche Anforderungen an bank-betriebliche Geschäftsprozesse gestellt werden und inwiefern diese überhaupt Defizite bzgl. Effektivität und Effizienz aufweisen. Identifizierte Verbesserungs-potenziale bieten in erster Linie mögliche Ansatzpunkte für einen Optimierungs-ansatz, aber auch die Rechtfertigung sich mit einem solchen auseinanderzu-setzen.
Essenziell für die Integration der beiden Konzepte SOA und BPM ist ein ganz-heitliches und unverzerrtes Verständnis. Dies erfordert zum einen eine jeweils umfassende theoretische Betrachtung von Business Process Management und serviceorientierten Architekturen, zum anderen aber auch eine aktuelle Bewer-tung der praktischen Anwendung im Bankenkontext.
Sobald Möglichkeiten und Grenzen der beiden Konzepte spezifiziert sind, müs-sen potenzielle Schnittstellen ermittelt werden. Diese sind als Voraussetzung für eine reibungslose Integration zu betrachten.
Für den zu entwickelnden Integrationsansatz soll die Perspektive einer strate-gischen Steuerung (Governance) eingenommen werden. Hierdurch wird die systematische Ableitung relevanter Aspekte und vorhandener Synergien geför-dert. Das Ergebnis dieser Arbeit wird schließlich in Form eines Regelkreises dargestellt, das überblicksweise den Gesamtzusammenhang eines integrierten Einsatzes von SOA und BPM repräsentiert.
1.3 Aufbau der Arbeit
Die vorliegende Arbeit teilt sich in sieben Kapitel, die alle direkt oder indirekt miteinander in Beziehung stehen. Abbildung 1-1 illustriert den strukturellen Aufbau und wesentliche Zusammenhänge zwischen den einzelnen Abschnitten.
Kapitel 1 „Einführung“ beschreibt einleitend die Dynamik der Bankenbranche und die hierdurch implizierte Anforderung der Anpassungsfähigkeit von Kredit-instituten. Diese ist als Motivation für den integrierten Einsatz von BPM und SOA zur Optimierung von Bankprozessen anzusehen.
Gegenstand des zweiten Kapitels „Kritische Betrachtung von Bankprozessen“ ist zunächst die Vermittlung eines grundlegenden Verständnisses für die Be-trachtung von Geschäftsprozessen. Hierauf aufbauend erfolgt eine Bewertung der bankbetrieblichen Leistungserstellung. Die anhaltende Bedeutung der In-dustrialisierung der Bankenbranche erweist sich hierbei als zentrale Heraus-forderung, die einen holistischen Prozessoptimierungsansatz erfordert.
Hierzu wird das Business Process Management (BPM) näher betrachtet. Im dritten Kapitel („Management bankbetrieblicher Geschäftsprozesse“) werden zunächst Grundlagen des BPM dargelegt, um anschließend eine Bewertung der Anwendung in Banken vorzunehmen. Hierbei zeigt sich, dass sich das Manage-ment von Bankprozessen primär auf organisatorische Belange beschränkt. Bei gleichzeitig immenser Abhängigkeit der Prozesse von der Informationstechno-logie werden hier wesentliche Verbesserungspotenziale vernachlässigt.
Um die Optimierung von Geschäftsprozessen aus technischer Perspektive konzeptionell zu betrachten, befasst sich Kapitel 4 „Serviceorientierte Bank-architekturen“ mit SOA. Hierzu erfolgt erst eine theoretische Betrachtung. Die anschließende Evaluierung des Einsatzes von serviceorientierten Architekturen in Banken führt zu dem Ergebnis, dass gegenwärtige Ausprägungen eine höhe-re fachliche Ausrichtung erfordern, um entsprechende Potenziale freisetzen zu können.
Kapitel 5 („Business-IT-Alignment als Integrationskontext“) behandelt das Busi-ness-IT-Alignment und adressiert somit direkt die fehlende technische Ausrich-tung von BPM und die mangelhafte fachliche Ausrichtung von SOA. Als wesent-liches Alignmentinstrument können Unternehmensarchitekturen identifiziert wer-den, die potenziell einen Integrationrahmen für BPM und SOA darstellen.
Das sechste Kapitel, „Integrierte Betrachtung von SOA und BPM in Banken“, widmet sich dem eigentlichen Integrationsansatz. In diesem Zuge werden sys-tematisch Aspekte einer integrierten Betrachtung von BPM und SOA herge-leitet und anschließend im Gesamtzusammenhang dargestellt.
Kapitel 7 „Fazit“ rundet diese Arbeit durch einen knappen Ausblick und exem-plarische Ansätze für zukünftige Arbeiten ab.
Abbildung1‑1. Aufbau der Arbeit
2. Kritische Betrachtung von Bankprozessen
Zentraler Gegenstand dieser Arbeit ist die Verbesserung bankbetrieblicher Ge-schäftsprozesse. In diesem Kapitel sollen zunächst allgemein die theoretischen Grundlagen der Geschäftsprozessbetrachtung vermittelt werden, um ein Grund-verständnis für Geschäftsprozesse zu schaffen (Kapitel 2.1). Anschließend wird auf die Charakteristika von Bankprozessen und auf spezifische Anforderungen an die bankbetriebliche Leistungserstellung eingegangen (Kapitel 2.2). Die we-sentliche Erkenntnis dieses Kapitels ist die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Geschäftsprozessmanagements. Es wird aufgezeigt, dass ein solches zur Realisierung optimierter Bankprozesse zwingend erforderlich ist (Kapitel 2.3).
2.1 Theoretische Grundlagen der Geschäftsprozessbetrachtung
Ausgangspunkt für die theoretische Betrachtung von Geschäftsprozessen ist das Paradigma der Prozessorientierung (Kapitel 2.1.1). Nach einer Definition des Geschäftsprozessbegriffs (Kapitel 2.1.2) werden Möglichkeiten zur Klassi-fizierung und Beschreibung von Geschäftsprozessen (Kapitel 2.1.3) erläutert.
2.1.1 Prozessorientierung als Optimierungsparadigma
In der Vergangenheit bemühten sich Unternehmen, einzelne Funktionsbereiche nach Effizienzkriterien zu optimieren, was beispielsweise durch den Einsatz neuer Technologien lokal zu signifikanten Produktivitäts- und Qualitätssteige-rungen führte [Becker/ Kahn 2005, S. 4]. Maßgebendes Paradigma war hier die Funktionsorientierung [Becker/ Kahn 2005, S. 4]. Diese stellte sich jedoch als strukturelles Problem dar. Der Aufwand zur Abstimmung und Koordination getrennt optimierter, autonomer Funktionseinheiten verursachte so hohe Kosten, dass realisierte Effizienzpotenziale egalisiert wurden [Becker 2005, S. 4; Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 73]. Die heutige Anforderung, „flexibel auf die sich schnell verändernden Märkte, Kundenbedürfnisse und Technologien“ reagieren zu müssen, bereitete so funktional orientierten Organisationen Schwierigkeiten [Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 75]. Aus diesem Grund hat, beginnend mit den 1980er Jahren, die Prozessorientierung Einzug in die Praxis genommen [Becker/ Kahn 2005, S. 4f] und ist gegenwärtig, wie diverse Studien belegen, von hoher Bedeutung [Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 47ff].
Vorteil der Prozessorientierung gegenüber der Funktionsorientierung ist eine Konzentration auf betriebswirtschaftliche Leistungen, die extern für Markt und Kunden einen Wert haben und hierdurch Umsatz und Ergebnis positiv beein-flussen [Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 65]. Somit werden nicht isoliert einzelne interne Funktionsinseln optimiert; die effektive und effiziente Erstellung von Produkten und Dienstleistungen, also die Optimierung der Geschäftspro-zesse, steht im Vordergrund (Abbildung 2-1). [Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 73ff].
Abbildung2‑1. Unterscheidung Funktions- und Prozessorientierung
2.1.2 Geschäftsprozessdefinition
Generisch ist ein Prozess „eine Struktur, deren Elemente Aufgaben, Aufgaben-träger, Sachmittel und Informationen sind, die durch logische Folgebeziehungen verknüpft sind. Darüber hinaus werden deren zeitliche, räumliche und mengen-mäßige Dimensionen konkretisiert. Ein Prozess hat ein definiertes Startereignis (Input) und Ergebnis (Output) und dient dazu, einen Wert für [Prozess-]Kunden zu schaffen“ (Abbildung 2-2). [Fischermanns 2006, S. 12]
Abbildung2‑2. Prozessdefinition [Fischermanns 2006, S. 12]
Die Summe aller Prozesse eines Betrachtungsraumes wird als Prozess-organisation definiert [Fischermanns 2006, S. 12].
Liegt eine konkrete Verknüpfung eines Prozesses zu einer Unternehmens-tätigkeit oder zum Erfolg eines Unternehmens vor, so spricht man von einem Geschäftsprozess [Zellner 2004, S. 44].
Zentrale Charakteristika eines Geschäftsprozesses sind:
Zeitlogische Abfolge von Aktivitäten [Scheer/ Jost 1996; Österle/ Winter 2003 S. 103; Gadatsch 2008, S. 46; Staud 2006, S. 5; Staud 2006, S. 9]
Verteilte Ausführung durch organisatorische Einheiten und Informations-technologie [Österle 1995; Gadatsch 2008, S. 46; Rump 1999, S. 18f; Staud 2006, S. 9; Weske 2007, S. 18; Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 90]
Verbrauch von Unternehmensressourcen [Österle/ Winter 2003 S. 103; Rump 1999, S. 18f; Staud 2006, S. 9]
Strategiekonforme und kundenorientierte Wertschöpfung [Österle/ Winter 2003 S. 103; Gadatsch 2008, S. 46; Staud 2006, S. 5; Schmelzer/ Sesselmann 2008, S. 64]
Im Rahmen dieser Arbeit wird folgende Definition dem Verständnis des Begriffs zugrunde gelegt:
Ein Geschäftsprozess (Business Process) ist „eine logisch zusammenhängende Kette von Aktivitäten, die in einer vorgegebenen Ablauffolge durchzuführen sind und auf die Erzeugung einer bestimmten Prozessleistung ausgerichtet sind. Ausgelöst durch ein definiertes Ereignis werden bestimmte Einsatzgüter unter Beachtung bestimmter Regeln und durch Einsatz verschiedener Ressourcen zu (Arbeits-) Ergebnissen transformiert." [Österle/ Winter 2003 S. 103]





























