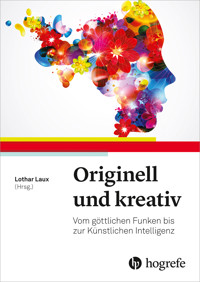
Originell und kreativ E-Book
39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was macht die Einzigartigkeit kreativer Lösungen aus? Ist Originalität das Hauptmerkmal von kreativen Produkten und Personen? Kann Kreativität durch Training und Techniken gefördert werden? Lothar Laux und sein Team beantworten diese und weitere Fragen auf anschauliche und abwechslungsreiche Weise. Mit vielen Beispielen und Abbildungen bringen sie ihre Faszination für originelle Ideen kreativer Persönlichkeiten zum Ausdruck. Sie laden die Leserinnen und Leser zudem ein, ihre eigenen kreativen Möglichkeiten für sich zu entdecken. Die Beispiele stammen aus Anwendungsbereichen wie Architektur, Theater, Fernsehen, Film, Literatur, Kunst, Medien und Produktentwicklung. Die Spannweite der Einzelthemen reicht vom antiken göttlichen Funken bis zur aktuellen Frage, ob die mithilfe von Künstlicher Intelligenz geschaffenen Werke wirklich die Qualität menschlicher Kreativität erreichen. Zwischen diesen beiden Polen liefert das Buch Ideen und Material zu folgenden Aspekten der Kreativitätsforschung: •Kreativität: Modebegriff zwischen Euphorie und Skepsis •Originalität: qualitative Kernkompetenz der Kreativität •Bisoziation: das Grundprinzip von Humor, Kunst und Wissenschaft •Originalitäts-Plus-Modell: Powertechniken •Think inside the box: das neue überlegene Paradigma? •Entdeckerqualitäten: vom Hinterfragen bis zum Verknüpfen •Grüne Wiesen im grauen Alltag: individuelle Kreativitätsförderung •Hochkreative Personen unter der Lupe: auf drei Ebenen und acht Stufen •Weibliche Kreativität: lange Zeit verkannt, jetzt neu entdeckt •Postdramatisches Regietheater: Zerschlagen von Klassikern Als roter Faden zieht sich das Schlüsselkonzept Transformation - auf dem die Originalität basiert - durch alle Kapitel. Mit dem Buch lässt sich der Zauber von Transformationen entdecken: Fixierte Bedeutungen werden aufgelöst, Ideen und Dinge schöpferisch umgewandelt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Lothar Laux
(Hrsg.)
Originell und kreativ
Vom göttlichen Funken bis zur Künstlichen Intelligenz
unter Mitarbeit von
Lisa Gäbelein
Nora-Corina Jacob
Lucas Laux
Anja S. Postler
Originell und kreativ
Lothar Laux (Hrsg.)
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Anregungen und Zuschriften bitte an:
Hogrefe AG
Lektorat Psychologie
Länggass-Strasse 76
3012 Bern
Schweiz
Tel. +41 31 300 45 00
www.hogrefe.ch
Lektorat: Dr. Susanne Lauri
Bearbeitung: Mihrican Özdem, Landau
Herstellung: Daniel Berger
Umschlagabbildung: © Rogotanie, GettyImages.com
Umschlag: Claude Borer, Riehen
Satz: Claudia Wild, Konstanz
Format: EPUB
1. Auflage 2022
© 2022 Hogrefe Verlag, Bern
(E-Book-ISBN_PDF 978-3-456-96111-8)
(E-Book-ISBN_EPUB 978-3-456-76111-4)
ISBN 978-3-456-86111-1
https://doi.org/10.1024/86111-000
Nutzungsbedingungen
Der Erwerber erhält ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das ihn zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf von dem Kunden vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere darf er Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, das E-Book – auch nicht auszugsweise – anderen Personen zugänglich zu machen, insbesondere es weiterzuleiten, zu verleihen oder zu vermieten.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
AuftaktLothar Laux
Teil I: Kreativität und Originalität
1 Plädoyer für Originalität als Kernkonzept der KreativitätLothar Laux
1.1 Was ist Kreativität?
1.1.1 Musenkuss: göttlich und digital
1.1.2 Der Begriff Kreativität: geheimnisvolle Attraktivität oder totgerittenes Pferd
1.1.3 Die vier Cs
1.1.4 Die vier Ps
1.1.5 Das kreative Produkt: Neuheit und Angemessenheit
1.1.6 Die Schattenseite der Kreativität
1.1.7 Innovation als verwandter Begriff
1.2 Originalität als Kernkonzept der Kreativität
1.2.1 Divergentes und konvergentes Denken
1.2.2 Originalität als Transformation
1.2.3 Abschaffen der Originalität in zwei Schritten
1.2.4 Plädoyer für das Nichtabschaffen von Originalität
1.2.5 Wege aus der Krise: das Auswaschen von Goldkörnern
2 Originalität: der transformative ImpetusLothar Laux
2.1 Einzelfälle zur Phänomenbeschreibung von Originalität
2.1.1 Aufgabe: Zeichnung interpretieren
2.1.2 Einzelfallanalyse: Einfälle und Einsichten
2.2 Transformation im Kontext von Motiven und Emotionen
2.3 Kreative Produkte: Merkmale, Maßstäbe und ästhetisch-affektive Reaktionen
2.3.1 Vier Bewertungskriterien des kreativen Produkts
2.3.2 Die Wirkung des Produkts: vier Arten ästhetischer Reaktionen
2.3.3 Beispiel: Es Devlins Skulptur für „Carmen“ am Bregenzer See
2.3.4 Erweiterung um das gesamte Spektrum von Emotionen
2.4 Kriterien für Kreativität und Originalität: eine Rahmenkonzeption
2.4.1 Kreativitätsstufe 1: Basiskriterien
2.4.2 Kreativitätsstufe 2: Muss- und Kann-Kriterien der Originalität
2.4.3 Fazit und Blick auf andere Wissenschaften
3 Kreativität und Originalität im Film am Beispiel Wes AndersonNora-Corina Jacob und Lothar Laux
3.1 Wie wäre es, wenn wir es ganz anderes machten?
3.2 Die einzigartigen Filme von Wes Anderson
3.2.1 Die Ungewöhnlichkeit des Wes Anderson – Person und Werk
3.2.2 Transformation und weitere Originalitätskriterien im Anderson-Werk
3.3 Fazit
Teil II: Theorie und Anwendung von Methoden der Ideenfindung
4 Von göttlichen Funken und KreativitätstechnikenLothar Laux und Anja S. Postler
4.1 Förderung von Transformationen: Osborn-Liste und SCAMPER-Technik
4.2 Verknüpfungskonzeptionen
4.3 Der göttliche Funke: die Bisoziationstheorie von Koestler
4.3.1 Der Monsignore und der Ehemann
4.3.2 Drei Felder des Schöpferischen
4.3.3 Multi- und Metaassoziation
4.3.4 Bisoziative Kreativitätstechniken
4.3.5 Stimulierung von außen: Zufallswortmethode und Analogie
4.3.6 Stimulierung von innen: Umkehrung, Verdrehung und Übertreibung
4.4 Bisoziationstheorie neu überdacht
4.4.1 Selektive Strategien
4.4.2 Elaboration der Originalität
4.4.3 Die Bisoziation ohne Knall
4.4.4 Bisoziation und Transformation
4.4.5 Bisoziation als Desk Safari – Invers
5 Ideengenerierung im TV-Bereich: Mückenschwarm der BisoziationenAnja S. Postler und Lothar Laux
5.1 Der unsichtbare Fernseher – oder: Wie originell darf ein TV-Gerät sein?
5.2 Mückenschwarm der Bisoziationen
5.2.1 „Crazy Ideas“ entwickeln durch Umkehrung und Übertreibung
5.2.2 Mit Force-Fit-Techniken originelle Bisoziationen erzwingen
5.2.3 Punktuelle Verknüpfungen als Zugang zur analogen Welt
5.3 Analytische Elaboration von Multi- und Metaassoziationen
5.3.1 Von Bisoziationen zu Multiassoziationen
5.3.2 Zusammenführung auf Metaebene
5.4 Rückblick: die Autoren im Dialog
6 Die Schoko-Mikado-Sticks von Oma Riebmann: mit Kreativitätstechniken zu originellen IdeenLisa Gäbelein & Lothar Laux
6.1 Fragestellungen und Überblick
6.2 Rahmenbedingungen zur Anwendung von Kreativitätsstrategien
6.2.1 Kreativitäts-Knigge
6.2.2 Auftakt: Originalitätstraining
6.3 Kreativitätsstrategien am Fallbeispiel Katrin
6.3.1 Systematik von Kreativitätsstrategien
6.3.2 Fallbeispiel Katrin im Fokus von Anwendung und Auswertung
6.4 Sechs-Hüte- bzw. Vier-Hüte-Methode
6.4.1 Ursprungsversion: die Sechs-Hüte-Methode
6.4.2 Anwendungsbereiche der sechs Hüte
6.4.3 Verdichtung der sechs Hüte auf vier Hüte
6.4.4 Die vier Hüte in Aktion
6.5 Reizwortanalyse
6.5.1 Anwendung der Reizwortmethode auf die Strichzeichnung
6.5.2 Die Reizwortanalyse in Aktion
6.6 Originalitätssteigerung durch den Einsatz von Kreativitätsstrategien?
6.6.1 Feedback von Katrin zum Trainingsmodul
6.6.2 Welche Faktoren bedingen die Originalitätssteigerung?
6.6.3 Das Originalitätstraining als weiterer Wirkfaktor?
6.6.4 Erste Hilfe für „Nicht-Hochoriginelle“
Teil III: Über gängige Kreativitätstechniken hinaus
7 Originalitätssteigerung: zwei Stufen und zwei PrinzipienLothar Laux, Anja S. Postler und Nora-Corina Jacob
7.1 The End of Sitting
7.2 Das Originalitätplus-Modell im Überblick
7.3 Das Originalitätplus-Modell im Detail
7.3.1 Direkte Bisoziation: Basistechniken und Erweiterungen
7.3.2 Vorbereitete Bisoziation: Verfremdungen
7.4 Die Rolle des Humors
7.5 Das Originalitätplus-Modell in Theorie und Anwendung
7.6 Zugabe: Originalitätssteigerung durch die Kombination von Kreativitätstechniken
7.6.1 Simultane Kombination von zwei Kreativitätstechniken
7.6.2 Flexible Kombination von Kreativitätstechniken (FLEXKOM)
7.7 Fazit
8 Die Entdeckerqualitäten als besondere Strategien der IdeengenerierungNora-Corina Jacob und Lothar Laux
8.1 Die Entdeckerqualitäten nach Dyer, Gregersen und Christensen
8.1.1 Hinterfragen
8.1.2 Beobachten
8.1.3 Experimentieren
8.1.4 Vernetzen
8.1.5 Verknüpfen
8.2 Förderung von Kreativität anhand der Entdeckerqualitäten
8.3 Prozessmodell der Entdeckerqualitäten
8.3.1 Voraussetzungen für Kreativität
8.3.2 Die Sonderstellung des Hinterfragens
8.3.3 Verknüpfen: Geht das etwas genauer, bitte?
8.3.4 Kreativität ist ein Prozess
8.4 Bringen wir alles zusammen: originelle Theaterinszenierung mithilfe der Entdeckerqualitäten und der Analogiemethode
8.4.1 Hinterfragen von Konventionen
8.4.2 Beobachten von anderen Inszenierungen
8.4.3 Vernetzen über den Theater-Tellerrand
8.4.4 Verknüpfen und die Analogiemethode
8.4.5 Experimentieren mit diesem neuen Theater
9 Think inside the box – das neue überlegene Paradigma?Lothar Laux
9.1 Vom Outside-the-box-Denken zum Inside-the-box-Denken
9.1.1 Paradigmenwechsel?
9.1.2 Denken mit Vorlagen
9.1.3 Sweeney Todd – frisches Blut mit dem orchesterlosen Thrillermusical
9.1.4 Technik der Funktionsvereinigung im Detail
9.1.5 Kritische Fragen zum Inside-the-box-Ansatz
9.2 Alternative Verfahren zum Inside-the-box-Denken
9.2.1 Outside-the-box-Verfahren
9.2.2 Bewährte Inside-the-box-Verfahren
9.2.3 Nutzung von Wissen – Ideengenerierung ohne Kreativitätstechniken
9.3 Fazit
Teil IV: Kreativität und Persönlichkeit
10 Originelle Persönlichkeiten: dem Besonderen auf der SpurLothar Laux
10.1 „Ich wollte unverwechselbar sein“
10.1.1 Einzigartigkeit
10.1.2 Einzigartigkeit und Originalität
10.1.3 Originalität und Persönlichkeit: der idiografische Ansatz
10.2 Drei-Ebenen-Modell der Kreativität
10.2.1 Drei Ebenen von Gesetzmäßigkeiten
10.2.2 So genial wie Einstein, Freud, Picasso, Strawinsky, Eliot, Graham und Gandhi
10.2.3 Die exemplarische Kreatorin
10.3 Transformative Persönlichkeiten im 8-Stufen-Modell
10.3.1 Antriebsmodell mit acht Stufen
10.3.2 Was fällt auf?
10.4 „Frauen sind gut im Töpfern“ – ein Blick auf das Gender-Thema
11 Grüne Wiesen im grauen Alltag: personzentrierte Kreativitätsförderung am ArbeitsplatzAnja S. Postler und Lothar Laux
11.1 Kreativität fördern: vom Wollen, Sollen und Können
11.1.1 Vordenker im Großen und Kleinen
11.1.2 Annahmen zur Trainierbarkeit von Alltagskreativität – ein Überblick
11.2 Grüne-Wiese-Effekte und das Dilemma der Alltagsroutine
11.2.1 Ideengenerierung fernab vom Tagesgeschäft
11.2.2 Routine tötet Inspiration! – Wirklich?
11.3 Individuumszentrierung als Chance für mehr Alltagskreativität
11.3.1 Entwicklung einer transferoptimierten Trainingskonzeption
11.3.2 Kreativitätsförderung im Einzelfall
11.4 Fazit: Wie lässt sich Kreativität im Arbeitsalltag fördern?
11.4.1 Direktvergleich der Einzelfälle
11.4.2 Leitfaden für die individuelle Kreativitätsförderung
12 Originalität im postdramatischen Regietheater: Frank CastorfLothar Laux
12.1 Drei ungewöhnliche Theaterinszenierungen
12.2 Transformation des Dramas in die Aufführung
12.2.1 Inszenierung
12.2.2 Gestaltungsprinzipien der Transformation
12.2.3 Transformation und Stimulierung
12.3 Originalität: der Regisseur im Fokus
12.3.1 Regietheater
12.3.2 Regieeinfall: Hamlet im Frack
12.3.3 Postdramatisches Theater
12.4 Frank Castorf: „Meine Grundtechnik ist: Zerschlagen“
12.4.1 Beispiel: Frank Castorfs Faust an der Berliner Volksbühne
12.4.2 Originalität in Castorfs postdramatischem Theater
12.5 Regiefrauen
13 Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein?Lothar Laux und Lucas Laux
13.1 Auftakt
13.2 Grundbegriffe im Bereich der Künstlichen Intelligenz
13.3 Künstliche Intelligenz in den schönen Künsten
13.4 Kann Künstliche Intelligenz kreativ sein?
13.4.1 Zwei-Kriterien-Ansatz der Kreativität
13.4.2 Computerkreativität von M. A. Boden
13.4.3 Zwei Kernfragen zur „künstlichen Kreativität“
13.5 Das Zusammenspiel von menschlicher Kreativität und Künstlicher Intelligenz als Kokreation
13.6 Fazit und Ausblick
Anhang
EpilogLothar Laux
Zugabe: Originell und kreativ in Zeiten von Corona und Klimawandel
Dank
Autoren und Autorinnen
Sachwortverzeichnis
|11|Auftakt
Lothar Laux
Kreativität als Faszination
„Die Freude im Moment des kreativen Einfalls ist ein märchenhaftes, paradiesisches Gefühl, das Lebensintensität in höchstem Ausmaß schenkt. Ein Gefühl, in dem unser Denken, Fühlen und Wollen zu einer Einheit verschmilzt, wie es uns sonst kaum gegeben ist und sich auch nur sehr selten einstellt.“ Das ist das Resümee des Kreativitätsforschers Norbert Groeben auf den letzten Seiten seines Sachbuchs über Kreativität (2013, S. 246). Mit allen denkbaren Anstrengungen und einem Maximum der uns möglichen Beharrlichkeit, so fährt er fort, würden wir versuchen, dieses Gefühl, das eine solch intensive, fast mystische Faszination auslöst, immer wieder zu erleben. Die Aussage von Groeben gilt für die kulturell bedeutsame „große“ Kreativität ebenso wie für die Alltagskreativität. In einer Untersuchung, an der 750 Personen (Studierende und Angestellte) teilnahmen, wurde „Freude am Tun“ als stärkstes Motiv für kreative Betätigung ermittelt (Benedek, Bruckdorfer & Jauk, 2020). Die Freude, wenn vielleicht auch in weniger ausgeprägter Form, entsteht nicht nur bei den kreativ Schaffenden selbst, sondern auch bei den Zuschauenden, die sich von der brillanten Idee oder dem originellen Produkt überraschen und erfreuen, oft auch stimulieren lassen. Mit diesem Buch möchten wir Ihnen solche Ideen oder Produkte zusammen mit dem wissenschaftlichen Hintergrund nahebringen. Damit Sie einen ersten Eindruck bekommen, mit wem Sie es tun haben, möchte ich (Lothar Laux) als Herausgeber Ihnen unser Team ganz kurz vorstellen.
Autorinnen sind Lisa Gäbelein, Nora-Corina Jacob und Anja S. Postler (geb. Meier). Alle drei studierten Psychologie an der Universität Bamberg und schrieben während des Studiums ihre Qualifikationsarbeiten zum Thema Kreativität, die ich betreut habe. Nora und Anja haben sich außerdem diesem Thema in ihren Dissertationen gewidmet. Meinen Sohn Lucas Laux habe ich bei der Vorbereitung des Kapitels über „Künstliche Intelligenz“ gebeten, als Autor mitzuwirken. Als Medienwissenschaftler betreut er den „KI-Campus“, eine Lernplattform für Künstliche Intelligenz. Ausführlichere biographische Angaben für alle Teammitglieder insbesondere zu ihren beruflichen Erfahrungen im Bereich von Kreativität finden Sie im Anhang.
Wir möchten Ihnen als Einstieg und Illustration ein paar Beispiele für brillante Ideen skizzieren. Gestützt auf ähnliche Beispiele wollen wir in den verschiedenen Buchkapiteln einen Blick hinter die Kulissen der zugrundeliegenden kreativen Strukturen und Prozesse werfen:
Von Anne Klinge stammt das Fußtheater (Abb. 0-1). Theater spielen mit den Füßen? Vom Körpertheater kommend hat Klinge (2017) ausprobiert, was sich mit den Füßen alles anstellen lässt und dabei ihre eigene Form des Fußtheaters entwickelt:
Fußtheater ist inszenierte Körperbeherrschung auf allerhöchstem Niveau. Dabei geht es nie um den Effekt verkleideter Füße. Ausgestattet mit Nasen, Mützen und Gewändern verwandeln sich die Füße unversehens zu eigenständigen Persönlichkeiten, die die Spielerin dahinter beinahe vergessen machen. In einer Mischung |12|aus Erfindungsgeist und Fantasie „erzählen“ ihre Fußhelden bekannte und unbekannte Geschichten, mit Ironie und in kluger, humorvoller Dramaturgie durchleben sie Beziehungsdramen, Märchen, sogar Opern.
Das Fußtheater konnte entstehen, weil die Künstlerin konventionelle Beschränkungen im Gebrauch der Füße überwand. Sie erkannte, dass sich die Füße für ganz neue Funktionen nutzen lassen. Wenn man zusätzlich ihre Beweglichkeit erhöht und sie anders „ausstattet“ als bisher, ergeben sich unglaubliche Ausdrucksmöglichkeiten.
Abbildung 0-1: Fußtheater von Anne Klinge (Bild: Anne Klinge, mit freundlicher Genehmigung)
Manches Grundmuster einer kreativen Idee im heutigen Theater und Film ist uralt, belustigt und fesselt uns aber noch immer, z. B. das Durchbrechen der vierten Wand. Die vierte Wand: Das ist die zum Publikum hin offene Seite einer Bühne. Es handelt sich also nur um eine imaginäre Wand. Bei einer Theateraufführung wird so getan, als ob sie vorhanden wäre. Wenn ein Schauspieler aber aus der Rolle fällt, z. B. auf Zurufe des Publikums reagiert, das eine Änderung des Stücks verlangt, durchbricht er die vierte Wand.
Das Durchbrechen der vierten Wand ist ein beliebtes Stilmittel für komische Effekte in Serien und Filmen, z. B. im Kinofilm „Die Ritter der Kokosnuß“ von Monty Python. Wir erinnern uns: König Artus zieht mit seinen edlen Rittern durch Britannien, um den heiligen Gral zu suchen. Dabei müssen sie mit vielen Gefahren fertig werden. In einer Trickfilmszene werden die (animierten) Ritter von einem (animierten) vieläugigen Monster mit riesigem Maul und messerscharfen Zähnen verfolgt. Kurz bevor sie das Monster verschlingen kann, also genau im entscheidenden Moment, erleidet der Trickfilmzeichner, der für die Zuschauer kurz eingeblendet wird, beim Zeichnen einen Herzinfarkt, wodurch die Trickfilmszene abrupt beendet wird. Die edlen Ritter sind gerettet. Eine fantastische pythoneske Szene.
Gut inszeniert funktioniert das Durchbrechen der vierten Wand auch in TV-Serien. In „Fleabag“ (2018–2019), einer britischen Dramedyserie, durchbricht die Hauptdarstellerin im Lauf jeder Folge mehrmals die vierte Wand und spricht oder sieht die Zuschauer direkt an – selbst in intimen Szenen. Als ihr Freund nach einem Streit frustriert aus der Wohnung auszieht und dramatisch ankündigt, es sei für immer, teilt sie dem Publikum mit einem Seitenblick vertraulich mit: „He’ll be back.“
Die bisherigen Beispiele stammen aus Film und Theater, also aus Bereichen mit einem großen Gestaltungsspielraum. Hier sind die Möglichkeiten für ausgeprägt kreative Lösungen besonders günstig. Faszinierende Ideen und Produkte finden wir aber auch im biologischen oder ökonomischen, besser gesagt im bioökonomischen Bereich (siehe auch Abb. 0-2):
Wenn Vera Meyer Antworten auf drängende Zukunftsfragen sucht, zieht es sie in Brandenburgs Wälder. An Birken oder Buchen finden die Berliner Biotechnologin und ihr Team Pilze wie den Zunderschwamm, der nun in einem Labor an der Technischen Universität kleine Wunder vollbringt: Auf Hanf-, Pappel- oder Rapsresten gezüchtet verwandeln sich winzige Pilzfäden innerhalb von rund zwei Wochen in Baumaterial, einen Lampenschirm oder einen Fahrradhelm – ganz natürlich. […]
Auch Studenten ganz unterschiedlicher Fachrichtungen sprängen auf die Idee an. „Mind the Fungi!“ (Beachtet Pilze!) hat Meyer ihre Forschungswerkstatt genannt, |13|bei der auch interessierte Bürger und Künstler mitmachen können. Mit Blick auf künftiges „Pilzdesign“ holte sie eine Berliner Kunsthochschule mit ins Boot. „Schwarmintelligenz ist bei uns gefragt.“ Die Forscherin kommt ursprünglich aus der biotechnologischen Grundlagenforschung. Heute erschafft sie filigrane Skulpturen aus Pilzen und stellt sie aus. Für Meyer gibt es keine harten Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst. (von Leszczynski, 2020, o. S.)
Abbildung 0-2: Links: Pilzforscherin Vera Meyer (Bild: Martin Weinhold, mit freundlicher Genehmigung von Vera Meyer). Rechts: Quader aus Pilzpflanzen-Komposit (Bild: Kustrim Cerimi, mit freundlicher Genehmigung)
Bestechend an den Vorschlägen von Vera Meyer ist nicht nur die Kernidee, die Züchtung von Pilzen auf Bäumen, sondern die Verknüpfung mit vielen Ideenimpulsen und Perspektiven aus diversen Bereichen, wie z. B. Architektur, Materialwissenschaft und bildender Kunst. An ihrem Ideenkomplex fällt auch der positive Wertebezug besonders auf, der sich in der Zielsetzung von Ressourcenschonung und Nutzung nachwachsender Rohstoffe zeigt. Wertschätzung in pointierter Form drückt sich ebenfalls im nächsten Beispiel aus:
Nicolas Chabanne, Retter der krummen Früchte, verkauft in Paris Obst und Gemüse zu einem Sonderpreis, da es sonst in den Müll wandern würde:
Besonders rührend sind die beiden Teile einer verwachsenen Karotte, die aussehen wie ein Menschenpaar, das sich umschlingt. Hübsch erscheinen auch jene Kartoffeln mit Herzform oder die Aubergine, von deren runden Bauch zwei Auswüchse wie Arme abstehen. Doch solche Spielereien der Natur sind zwar amüsant – aber selten verkäuflich. Zumindest galt das, bis der Unternehmer Nicolas Chabanne kam: Bei seinem Start-up „Les Gueules Cassées“, was sich übersetzen lässt mit „Die kaputten Visagen“, kommt auch kurios verformtes Obst und Gemüse auf Werbeplakate und in die Regale der Supermärkte.
Seit der 45-jährige Franzose vor einem Jahr gemeinsam mit seinem Geschäftspartner seine Idee umgesetzt hat, die sie mit Crowdfunding finanzierten, verzeichnet er einen beachtlichen Erfolg: Innerhalb von acht Monaten wurden mehr als 10 000 Tonnen schief gewachsenes Obst und Gemüse verkauft. Chabanne verspricht den Kunden einen Preisnachlass von mindestens 30 Prozent, während die Handeltreibenden sich nicht um die Entsorgung von bisher unverkäuflicher Ware kümmern müssen. […]
Der Ausdruck „Gueules Cassées“ bezeichnete ursprünglich die entstellten Gesichter der Soldaten, die verwundet aus dem Ersten Weltkrieg zurückkamen. Dieser Name und das Logo eines verwachsenen Apfels mit breitem Grinsen und Zahnlücke brachte der Geschäftsidee den entscheidenden Kick, sagt Chabanne: „Wir versuchten es zunächst mit kleinen Etiketten für verwachsenes Obst und Gemüse, auf denen stand ‚Auch wenn ich nicht perfekt bin, schmecke ich genauso gut‘. Aber das reichte nicht. Es brauchte eine Marketing-Idee.“ Und als diese geboren war, zogen die Kunden sofort mit. (Holzer, 2015, o. S.; siehe Abb. 0-3)
Abbildung 0-3: Das Logo von „Les Gueules Cassées“ und das kurios geformte Obst und Gemüse: die Erdbeere als Hand und die Karotten – mal lasziv oder in inniger Umarmung (Bilder: Les Gueules Cassées, mit freundlicher Genehmigung)
Zuletzt noch ein Blick auf Ideen, in denen sich Originalität mit Ästhetik und Eleganz verbindet: rudimentär in der erfolgreichen Bierwerbung von Astra (siehe Abb. 0-4), verfeinert in den kinetischen Skulpturen des Künstlers Theo Jansen, die er „Strandbeesten“ (Strandtiere) nennt (siehe Abb. 0-5). Die an Fabelwesen erinnernden skelettartigen Gebilde befinden sich nach Angaben des Künstlers bereits in der siebten Generation einer Evolution in Richtung „eigenständig lebender Wesen“. Es handelt sich um vom Wind angetriebene gehende Maschinen, die aus gelben Plastikrohren, Kabelbindern, Nylonfäden und Klebebändern konstruiert sind (Schauen Sie sich das bitte als Video an: z. B. bei YouTube unter dem Stichwort „Theo Jansen“).
Abbildung 0-4: Bierwerbung (Bild: Carlsberg Deutschland GmbH, mit freundlicher Genehmigung)
Was ist den ausgewählten Beispielen gemeinsam? Die kreativ Schaffenden sind in der Lage, sich über gedankliche Beschränkungen hinwegzusetzen, Zwänge der Realität zu überwinden: Füße kann man in Köpfe verwandeln, die vierte Wand lässt sich lustvoll durchbrechen. Pilze können so gezüchtet werden, dass aus ihnen Baumaterial und Kunstgegenstände entstehen. Das Prinzip: Ideen werden aus eingefahrenen Denkmustern befreit und in neue Denkmuster umgewandelt, also transformiert. So entstehen besondere, einzigartige Lösungen. Originalität als Transformation ist ein Hauptthema dieses Buchs. Wir stellen Originalität aber nicht nur als Konzept dar, das einem bestimmten Denkprinzip folgt. Es geht uns auch um die emotionale Erfahrung. Emotion |15|und Verstand müssen zusammenkommen, damit intensive Faszination entstehen kann – besonders dann, wenn eigenes schöpferische Handeln angestrebt wird (Groeben, 2013).
Abbildung 0-5: Strandtiere des Künstlers Theo Jansen (Bild: Theo Jansen, mit freundlicher Genehmigung)
Die als qualitatives Merkmal verstandene und erfasste Originalität findet in der derzeitigen Kreativitätsforschung zu wenig Beachtung. Wir kritisieren, dass Originalität in den vergangenen Jahrzehnten fast immer als statistisch verstandene Seltenheit (statistical uniqueness) definiert wurde. Die seltene Antwort wird damit als originelle Antwort aufgefasst. Das ist nicht falsch, kann aber nur ein erster, vorläufiger Schritt sein. Ganz im Sinne unserer bisher dargestellten Beispiele werden wir empfehlen, Originalität als schöpferische Transformation zu bestimmen und damit Qualitätsmerkmale in den Mittelpunkt von Theorie und Anwendung der Kreativität zu stellen. Die anziehende Wirkung, die von einer so verstandenen Originalität ausgeht, hoffen wir, Ihnen anschaulich durch Text und Bilder vermitteln zu können (Abb. 0-6).
Abbildung 0-6: Science Cartoon von Tom Gauld (Bild: Tom Gauld, mit freundlicher Genehmigung)
Die Möglichkeit zur Transformation beschränkt sich nicht auf kreative Produkte oder Prozesse, sie kann sich auch auf die persönliche Identität, auf das persönliche Selbstgefühl erstrecken. Wenn der eigene Körper so wichtig ist, was erleben wir dann, wenn wir virtuell in den Körper eines anderen eintauchen? Das Projekt „Machine to be another“ (Hartung, 2017; siehe Abb. 0-7) macht diesen Perspektivenwechsel möglich. Dazu dient ein interaktives System aus Webcams, Virtual-Reality-Brillen und Kopfhörern. Die Wechselwirkung mit der zweiten Person wird über die Software so gesteuert, dass man glaubt, sich in ihrem Körper zu befinden. Das Körpertausch-Projekt, bei dem man sogar das Geschlecht wechseln kann (gender swap), versucht also, eine tief in der menschlichen Persönlichkeit verankerte Beschränkung zu überwinden.
Abbildung 0-7: The machine to be another (Bild: BeAnotherLab, mit freundlicher Genehmigung)
Bei der Auswahl dieser Beispiele haben wir uns bewusst nicht von den bekannten Ideen oder Erzeugnissen „großer“, genialer Kreativität mit epochaler kulturhistorischer Bedeutung leiten lassen. Wie viele Kreativitätsforscher heute vertreten wir das „Demokratieprinzip“ des Kreativitätskonzepts (Groeben, 2013). Nach dieser Auffassung hat jeder von uns das Potenzial, kreativ zu sein – wohlgemerkt das Potenzial, das nicht mit der Ausführung der kreativen Leistung gleichzusetzen ist. Intensives Trainieren sowie ein hohes Maß an Motivation und Disziplin sind notwendig, damit sich die manifeste kreative Leistung entwickeln kann.
Methoden der Ideenfindung
Der originelle glänzende Einfall fällt nicht einfach so vom Himmel. Das märchenhafte, paradiesische Gefühl, von dem Groeben spricht, er|16|gibt sich oft erst nach längerem mühevollen Einsatz. Wie entwickelt man gute originelle Ideen? Das ist die große Stunde für die Methoden der Ideenfindung bzw. Kreativitätstechniken. Ihre Befürworter versprechen uns, dass sie die Ideenentwicklung ankurbeln: Mit ihnen überwinden wir das passive Warten auf den Einfall. Sie sorgen für einen leicht zu bewältigenden Einstieg in den kreativen Prozess. Wir kommen in Gang. Wir führen die ersten noch tastenden Schritte durch, und schon kurze Zeit später bringen wir die ersten eigenen Ideenimpulse zu Papier: Ein hilfreicher, aufbauender Prozess, Qualität spielt noch keine Rolle. Mit regelmäßigem Training lernen wir schließlich, die jeweilige Kreativitätsmethode zu beherrschen und ihr Potenzial auszuschöpfen, sodass auch die Ideen an Zahl, Vielfalt und Originalität zunehmen. Keine Frage, dass sich mit den immer besser werdenden Ideen auch Zuversicht und Freude erhöhen. Im Laufe eines längeren Zeitraums nutzen wir die Techniken dann nicht mehr bloß als Denkstützen, sondern wir haben sie in unser persönliches Repertoire an kreativen Methoden integriert.
Wie hoch im Kurs die Methoden der Ideenfindung stehen, geht auch daraus hervor, dass grob geschätzt mindestens die Hälfte aller Publikationen zum Thema Kreativität (bzw. verwandter Begriffe wie Innovation) Kreativitätstechniken oder -trainings zum Inhalt haben (Groeben, 2013). Der Soziologe Reckwitz (2013) bringt Belege dafür, dass Berufstätige – und nicht nur in den im engeren Sinn kreativen Berufen – heute „kreativ sein“ müssen. Zum Wunsch des Kreativseins tritt der Imperativ hinzu. Nehmen wir als ein Beispiel „Das große Handbuch Innovation: 555 Methoden und Instrumente für mehr Kreativität und Innovation im Unternehmen“ (van Aerssen & Buchholz, 2018). Das Buch enthält gut organisiertes, geballtes Wissen für Laien und Experten. Es umfasst 900 Seiten und wird mit dem Einführungssatz vorgestellt: „Immer mehr Mitarbeiter müssen Innovationsprozesse, Kreativitätsworkshops und Design-Thinking-Projekte organisieren, moderieren oder begleiten und benötigen einen Überblick bei der Auswahl zielführender Instrumente“ (S. 3). Davon leiten wir die These ab: Viele Berufstätige erwarten offenbar, dass Studium und Training der Kreativitätstechniken ihnen hilft, die Kreativitätsanforderungen im beruflichen und privaten Bereich besser zu bewältigen.
Das sturzbachartige Auftreten von Publikationen zu Kreativitätstechniken wird in der Forschungsliteratur ganz unterschiedlich beurteilt. Manche sehen in den Kreativitätstechniken gelungene Simulationen kreativitätsfördernder Prinzipien und leiten davon praxisnahe Kreativitätsstrategien ab (z. B. Sternberg, 2019). Andere sind skeptisch und behaupten, dass die herausragenden, kulturhistorisch wertvollen Ideen und Werke eben nicht durch Kreativitätstechniken generiert wurden. Dem widerspricht Michalko (2001), der in seiner Monografie mit dem Titel „Cracking Creativity“ die Kreativitätstechniken von mehr als hundert genialen Kreativen aufgespürt hat, darunter Leonardo da Vinci, Walt Disney, Pablo Picasso, Thomas Edison und Martha Graham. So geht z. B. aus Leonardos Notizbüchern hervor, dass er die Gesichter auf seinen bekannten Gemälden mithilfe einer Methode entworfen hat, mit der er unterschiedliche Kombinationen von Merkmalen erzeugen konnte. Vielleicht ist das unergründliche rätselhafte Gesicht der Mona Lisa aus einer Kombination solcher Elemente hervorgegangen (Michalko, 2001).
Genuin wissenschaftliche Publikationen streifen das Thema Kreativitätstechniken oft nur am Rande. Ein Anliegen unseres Buchs ist es, dieses Missverhältnis zwischen wissenschaftlicher Literatur zur Kreativität und anwendungsbezogener Literatur zu den Kreativitätstechniken zu überwinden und häufig gedankenlos eingesetzte Methoden der Ideenfindung gezielt von einer theoretischen Basis aus zu beleuchten. Wir werden uns auch ausführlich mit der Frage befassen, ob Kreativität trainiert werden kann und in welchem Ausmaß Kreativitätstechniken dabei helfen können. Zu |17|welchem Fazit werden wir kommen? So viel sei schon verraten: Wir sprechen uns am Ende für die Trainierbarkeit von Kreativität aus – allerdings unter der Voraussetzung, dass Maßnahmen der Individualisierung getroffen werden, also die Persönlichkeit der Person in den Mittelpunkt gestellt wird.
Schnelldurchgang
Teil I: Kreativität und Originalität
Ob Kreativität als Freude am Schöpferischen oder aber als Anforderung verstanden wird – der Begriff scheint eine besondere Faszination auszuüben. In Teil I dieses Buchs wollen wir die wichtigsten Begriffe und Theorien als Basis für die nachfolgenden Teile ansprechen. In Kapitel 1 befassen wir uns mit einer Reihe grundsätzlicher Fragen: Was ist Kreativität? Welche Arten von Kreativität können unterschieden werden? Was sind die am häufigsten in der Literatur aufgeführten Kriterien für die Definition des kreativen Produkts? Was bedeutet der verwandte Begriff Innovation? Wie definiert man die Komponenten der Kreativität Ideenflüssigkeit, Flexibilität und Originalität, und wie kann man sie erfassen? Wir setzen uns dann mit der Forderung einiger Autoren auseinander, auf die Erfassung von Originalität aus psychometrischen Gründen zu verzichten. Unser eigener Vorschlag beinhaltet, Originalität nicht länger auf statistische Seltenheit zu reduzieren, sondern als Transformation, also als schöpferische Umwandlung von herkömmlichen Ideen oder Materialien in etwas Neuem zu verstehen. Das Kapitel schließt mit einem Plädoyer dafür, die Originalität nicht abzuschaffen, sondern sie als qualitatives Merkmal individuumszentriert zu erfassen.
Im Mittelpunkt von Kapitel 2 stehen die Eigenschaften kreativer Produkte (Ungewöhnlichkeit, Angemessenheit, Transformation und Verdichtung) und die ästhetisch-emotionalen Reaktionen bei der Beurteilung (Überraschung, Zufriedenheit, Stimulierung, Genießen). Als ausführliches Beispiel dient uns das Bühnenbild der Oper „Carmen“ bei den Bregenzer Festspielen. Anschließend definieren wir Originalität bzw. Transformation mithilfe von Muss- und Kann-Kriterien als höherwertige Kreativitätsform.
Nach so viel Theorie konzentriert sich Kapitel 3 ganz auf die Ästhetik der einzigartigen Filme von Wes Anderson, mit denen wir unsere Konzepte veranschaulichen.
Teil II: Theorie und Anwendung von Methoden der Ideenfindung
In Teil II versuchen wir, die Kluft zu überwinden, die zwischen wissenschaftlicher Literatur zur Kreativität und anwendungsbezogener Literatur zu den Kreativitätstechniken besteht. Wir sprechen uns in Kapitel 4 dafür aus, bei der Interpretation von Kreativitätstechniken theoretische Konzepte wie Transformation und Bisoziation einzubeziehen. Nach unserer Auffassung kann der gezielte Einsatz solcher Techniken einen bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung von Kreativitätstheorien liefern, denn die Techniken basieren meist auf spezifischen theoretischen Annahmen kreativen Denkens, ohne dies immer explizit zu deklarieren. Bei einigen Techniken z. B. wird ein fremder Erfahrungsbereich mit dem Ausgangsproblem verknüpft, wodurch eine schöpferische Transformation zwischen beiden erreicht werden kann. Das entspricht ziemlich genau dem, was Arthur Koestler (1966) als „Bisoziation“ definiert. Eben dieses Verständnis von Bisoziation legen wir den häufig eingesetzten Kreativitätstechniken als einheitliche theoretische Basis zugrunde.
In Kapitel 5 wenden wir die im vorigen Kapitel beschriebenen Kreativitätstechniken systematisch auf eine Fragestellung aus unserer Coaching- und Workshop-Praxis an: Es geht um die Weiterentwicklung des Fernsehers sowie seiner Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten. Das erlaubt anschauliche vergleichende Aussagen über die Anwendbarkeit der Techniken und das Ausmaß der erzielbaren Originalität.
|18|In Kapitel 6 explorieren wir im Rahmen einer Einzelfallstudie, wie sich die Anwendung von Kreativitätstechniken gestützt auf ein Trainingsmodul von Lisa Gäbelein möglichst ideenfördernd gestalten lässt und welche Funktion einer „Originalitätstrainerin“ dabei zukommt.
Teil III: Über gängige Kreativitätstechniken hinaus
In diesem Teil geht es um Ansätze, denen bei aller Verschiedenheit das Ziel gemeinsam ist, eine Steigerung der Kreativität bzw. der Originalität von Ideen zu erreichen. Als Rahmen schlagen wir in Kapitel 7 das Originalitätplus-Modell vor, in dem wir zwischen Basis- und Erweiterungstechniken sowie zwischen direkter und vorbereiteter Bisoziation unterscheiden. Besonders originelle Ergebnisse erwarten wir von Verfahren, die das Verlassen einer vorgegebenen gedanklichen Ordnung fördern oder sogar erzwingen, um eingefahrene Lösungsmuster zu überwinden. Als weitere aussichtsreiche Strategie schlagen wir die Verknüpfung von Kreativitätstechniken vor. In den beiden folgenden Kapiteln geht es dann um spezifische Ansätze, die praktische Kreativitätstechniken von einer basalen theoretischen Konzeption ableiten.
In Kapitel 8 untersuchen wir den Beitrag der fünf Entdeckerqualitäten von Dyer, Gregersen und Christensen (2011) – Hinterfragen, Beobachten, Experimentieren, Vernetzen und Verknüpfen – für die Förderung kreativer Leistungen. Daran schließt sich die Einordnung in ein Prozessmodell der Kreativität von Nora Jacob an. Zuletzt veranschaulichen wir den Einsatz der Entdeckerqualitäten am Beispiel einer neuen Regiekonzeption.
In Kapitel 9 setzen wir uns mit der provokanten These des Autorenduos Boyd und Goldenberg (2019) auseinander, dass nur „inside the box thinking“, also das strikte Beschränken auf den eigentlichen Problemraum, zu hervorragenden kreativen Ideen führe. Wir analysieren den Ansatz der Autoren und vergleichen ihn mit bewährten Kreativitätstechniken des „outside the box thinking“.
Teil IV: Kreativität und Persönlichkeit
Im letzten Teil verlassen wir die Ebene der allgemeinen Aussagen über Kreativität, die für (fast) alle Menschen gelten sollen, und wenden uns der Individualität einzelner Persönlichkeiten zu, denn Kreativität drückt sich in jedem Individuum in einmaliger, unverwechselbarer Weise aus. Dies schließt nicht aus, dass sich die verschiedenen Individuen hinsichtlich der Ausprägung bestimmter Merkmale (z. B. Persönlichkeitseigenschaften wie Gewissenhaftigkeit oder Offenheit) vergleichen lassen, was ihre kreativen Leistungen angehen. Als entsprechendes Ordnungssystem stellen wir in Kapitel 10 ein Drei-Ebenen-Modell der Kreativität vor, das wir auch für die von Howard Gardner durchgeführten exemplarischen Einzelfallstudien von sieben genialen Persönlichkeiten heranziehen: Einstein, Freud, Picasso, Strawinsky, Eliot, Graham und Gandhi. Das zweite Schwerpunktthema dieses Kapitels betrifft das Antriebsmodell von Robert Sternberg, in dem schöpferische Personen als Wirkgrößen für die Entwicklung von kreativen Ideen oder Produkten in der jeweiligen Domäne angenommen wird. Die Personen unterscheiden sich nach dem Grad, in dem sie die Weiterentwicklung vorhandener Ideen oder Produkte bzw. deren Überwindung durch überlegenere vorantreiben. Abschließend werfen wir einen Blick auf das Gender-Thema und fragen nach Erscheinungsweisen und Ursachen geschlechtsbezogener Unterschiede in der Kreativität. In den drei folgenden Kapiteln suchen wir kreative Persönlichkeiten in ganz unterschiedlichen Bereichen auf:
In Kapitel 11 berichten wir über das von Anja S. Postler (in Vorb.) konzipierte „personzentrierte Kreativitäts-Intensivtraining“ (p-Kit), das eng mit dem Arbeitsalltag der teilnehmenden Personen verzahnt ist. Über ein reines Training hinausgehend berücksichtigt es auch ihre Persönlichkeit – besonders ihre persönlichen Stärken und individuell erprobten Kreativitätsstrategien. So kann es sich ihrem gewachsenen kreativen Lebensstil anpassen.
|19|Kapitel 12 befasst sich mit dem Regietheater, einer Theaterform, in der die Originalität des inszenierenden Regisseurs eine dominierende Rolle spielt und der dramatische Text nur als Rohmaterial dient. Als Repräsentant und Musterbeispiel dient Theatermacher Frank Castorf, der sich selbst in Interviews als Regisseur inszeniert, dessen Grundtechnik „Zerschlagen“ ist. Abschließend gilt unsere Aufmerksamkeit den Regiefrauen und ihren verblüffenden Inszenierungen.
Kapitel 13 schlägt die Brücke zur Künstlichen Intelligenz (KI). KI-Techniken kommen in Forschung, Industrie und Wirtschaft heute bereits im großen Stil zum Einsatz. Aber auch in Kunst, Musik und Literatur entstehen erstaunliche „Werke“ mithilfe von KI. Unsere zentralen Fragen lauten: Lassen sich die von KI-Programmen erzeugten „Werke“ als kreativ interpretieren? Können KI-Maschinen menschliche Kreatoren ersetzen? Kann Künstliche Intelligenz als nützliches Werkzeug im humanen Kreationsprozess eingesetzt werden?
Epilog
Im ersten Teil des Epilogs formulieren wir die theoretischen Erkenntnisse, die sich in den einzelnen Kapiteln zum Thema Transformation ergeben haben. Den zweiten Teil bilden Empfehlungen für die Praxis, die alle den übergreifenden Gesichtspunkt der Individualisierung von Maßnahmen betreffen: Es geht darum, die Einzigartigkeit der einzelnen Persönlichkeit zu berücksichtigen, wenn wir ihre Ideenfindung mit Kreativitätstechniken fördern. Nach unserer Überzeugung gehört die Individualisierung zu den wirkungsvollsten Möglichkeiten der Kreativitätssteigerung.
Schwerpunkt des Buchs
Dieses Buch führt in die zentralen Begriffe und Themen der wissenschaftlichen Kreativitätsforschung ein. Dabei streben wir aber keine systematische Bestandsaufnahme an. Die gibt es nämlich schon: Der Kreativitätsforscher Krampen (2019) hat sich dieser Aufgabe gewidmet und Theorien, Erhebungsmethoden sowie empirische Befunde dargestellt – und das in beeindruckender Breite und Qualität. Wir teilen seine Auffassung, dass Kreativität im Vergleich zu anderen Konstrukten schwerer zu erfassen ist, was ein multimodales Vorgehen verlangt, das möglichst viele unterschiedliche Datenquellen einbezieht. Einzelfallorientierte Zugänge und qualitative Erhebungs- und Auswertungsverfahren sollten unter anderem die quantitativen Mainstreamverfahren ergänzen. Ein anderes aktuelles Werk, das wir ebenfalls oft heranziehen, ist das „Cambridge Handbook of Creativity“ (Kaufman & Sternberg, 2019). Beide Bücher eignen sich auch zum Nachschlagen von Informationen über Themengebiete, die nicht im Zentrum dieses Buches stehen, z. B. Theorienüberblick, Erhebungsmethoden, neuropsychologische, entwicklungspsychologische und genetische Ansätze. Vom Erkenntnisziel her gesehen, liegt der Schwerpunkt unseres Buches nicht auf Theorienprüfung, sondern auf Theorienbildung. Es geht uns also um Ideen, Einfälle oder Einsichten als Quellen für die Erarbeitung theoretischer Vorstellungen (siehe Kap. 2). Mit dieser Zielsetzung vor Augen haben wir viele Impulse von Hans Lenk (2000) aufgenommen, der in seinem Buch „Kreative Aufstiege“ grundverschiedene Kreativitätskonzeptionen miteinander verglichen und in seinen eigenen Denkansatz integriert hat.
Wir haben uns bemüht, die Beispiele in diesem Buch, darunter auch eigene, so darzustellen, dass sie das Verständnis von originellen Ideen vertiefen und ihre Einbettung in theoretische Rahmenvorstellungen erleichtern. Ziel ist eine verständliche Darstellung, ohne dass die Komplexität der wissenschaftlichen Fragestellungen verharmlost wird. Die Beispiele sollen auch diejenigen motivieren, die ihre Kreativität weiterentwickeln und ausleben wollen.
Ein Wort zum Gendern: Mit dem Ziel, eine geschlechtergerechte Sprache umzusetzen, haben wir uns für einen mittleren Weg entschie|20|den. Einerseits realisieren wir durchgängig eine wertschätzende Sichtbarmachung von Frauen und Männer, d. h., wir verwenden in zufälliger Reihenfolge mal die weibliche, mal die männliche Form (z. B. die Psychologin, der Proband), andererseits legen wir keinen Wert auf auffällige alternative Schreibweisen. Wichtiger als die sprachliche ist uns die inhaltliche Sichtbarmachung, für die die Kreativitätsforschung viel Zündstoff bietet: So wollen wir z. B. herausarbeiten, welche gesellschaftlichen Ursachen es für die Fehleinschätzung gibt, dass Frauen im Allgemeinen den Männern in der Kreativität unterlegen sind (siehe Kap. 10).
Literatur
Benedek, M., Bruckdorfer, R. & Jauk, E. (2020). Motives for creativity: Exploring the what and why of everyday creativity. The Journal of Creative Behavior, 54, 610–625. Crossref
Boyd, D. & Goldenberg, J. (2019). Inside the box. Warum die besten Innovationen im Geschäftsleben direkt vor Ihren Füßen liegen (3. Aufl.). Berlin: Springer. Crossref
Dyer, J. H., Gregersen, H. H. & Christensen, C. M. (2011). The Innovator‘s DNA. Mastering the five skills of disruptive innovators. Boston: Harvard Business Review Press.
Groeben, N. (2013). Kreativität. Originalität diesseits des Genialen. Darmstadt: Primus.
Hartung, E. (2017). Visionen gestalten. Neue interdisziplinäre Denkweisen und Praktiken in Design, Kunst und Architektur. Stuttgart: av edition.
Holzer, B. (2015, 8. Juli). Retter der krummen Früchte. Fränkischer Tag.
Kaufman, J. C. & Sternberg, R. J. (Hrsg.). (2019). The Cambridge handbook of creativity (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. Crossref
Lenk, H. (2000). Kreative Aufstiege. Zur Philosophie und Psychologie der Kreativität. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Klinge, A. (2017). Fußtheater Anne Klinge (Website der Autorin, Startseite). Verfügbar unter http://www.fusstheater.de
Koestler, A. (1966). Der göttliche Funke. Der schöpferische Akt in Kunst und Wissenschaft. München: Scherz.
Krampen, G. (2019). Psychologie der Kreativität. Göttingen: Hogrefe. Crossref
Michalko, M. (2001). Cracking creativity. The secrets of creative genius. Berkeley: Ten Speed Press.
Reckwitz, A. (2013). Die Erfindung der Kreativität. Zum Prozess gesellschaftlicher Ästhetisierung (3. Aufl.). Berlin: Suhrkamp.
Sternberg, R. J. (2019). Enhancing people’s Creativity. In J. C.Kaufman &R. J.Sternberg (Eds.), The Cambridge handbook of creativity (2nd ed., pp. 88–104). Cambridge: Cambridge University Press.
van Aerssen, B., & Buchholz, C. (Hrsg.). (2018). Das große Handbuch Innovation. 555 Methoden und Instrumente für mehr Kreativität und Innovation im Unternehmen. München: Vahlen. Crossref
von Leszczynski, U. (2020, 12. Januar). Die Zukunft wächst an brandenburgischen Bäumen. Der Tagesspiegel. Verfügbar unter https://www.tagesspiegel.de/wissen/pilze-statt-plaste-und-elaste-die-zukunft-waechst-an-brandenburgischen-baeumen/25424384.html
|21|Teil I: Kreativität und Originalität
|23|1 Plädoyer für Originalität als Kernkonzept der Kreativität
Lothar Laux
1.1 Was ist Kreativität?
Blamberger (1991) beschreibt das Bild „Der Traum des Dichters oder, Der Kuss der Muse“ von Paul Cézanne (siehe Abb. 1-1) wie folgt:
Die Szene ist einfach: Ein schöner Jüngling sitzt in gelöster Haltung auf einem Stuhl […] Auf dem Pult liegt ein Blatt Papier, halb über die Kante des Tischchens gebogen. Vermutlich hat der Jüngling die obere Hälfte des Blattes beschrieben. Seine Augen sind nun geschlossen […] In die Kammer ist auf Zehenspitzen ein weiblicher Engel getreten, mit der rechten Hand rafft er sein helles Gewand zusammen, daß es die Toga des Jünglings nicht berührt, die linke Hand ist, während er sich über den Kopf des Träumenden beugt, vorsichtig abgespreizt, die geschlossenen Lippen des Engels deuten den Kuß auf die Stirn nur an. (S. 1)
1.1.1 Musenkuss: göttlich und digital
Das Frühwerk von Cézanne dient Günter Blamberger als Titelbild für sein 1991 erschienenes Buch „Das Geheimnis des Schöpferischen oder: Ingenium est ineffabile?“. Es handelt sich um einen Streifzug durch die Literaturgeschichte der Kreativität zwischen Goethe und der Moderne – mit Betonung des Geniekults. Der göttliche Musenkuss als Quelle schöpferischen Schaffens geht auf die griechische Mythologie zurück: Ideen stammten nicht vom Menschen selbst, sondern wurden von den Göttern bzw. den Musen eingegeben. So gibt der Kreativitätsforscher Arthur Koestler (1966) seinem Buch über den schöpferischen Akt den Titel „Der göttliche Funke“ (siehe Kap. 4). Es handelt sich offenbar um eine starke wirkungsvolle Metapher. Sie bestimmt die Kulturgeschichte der Kreativität bis heute.
Abbildung 1-1: „Der Traum des Dichters oder, Der Kuss der Muse“ (Creative Commons, Lizenz: CC0 1.0)
In neuer Formulierung als „digitaler Musenkuss“ taucht sie inzwischen im Übergangsbereich von Kunst und Künstlicher Intelligenz (KI) auf. Wie kann Künstliche Intelligenz den kreativen Schaffensprozess beeinflussen? Und wie funktioniert eine digitale Muse? Kurz an einem Beispiel verdeutlicht: Der Maler Roman Lipski erzeugt gemeinsam mit dem Digitalkünstler Florian Dohmann ein Gesamtkunst|24|werk: In das KI-Programm werden als erstes die Daten von Lipskis fertigen Gemälden eingespeist. Das Programm analysiert seinen Stil und lernt selbstständig, neue einzigartige Gemälde zu schaffen, die stilistische Variationen der bestehenden Bilder, aber auch ganz neue Aspekte enthalten können (siehe Abb. 1-2). Als „artifizielle Muse“ inspiriert sie den Künstler und bietet ihm neue Bildkompositionen an. Im Laufe der partnerschaftlichen Zusammenarbeit transformiert Lipski seine künstlerische Sprache. Er entdeckt neue Wege des Selbstausdrucks. Am Anfang und am Ende des Dialogs steht also der Mensch als Maler und nicht das KI-Programm (Kathmann, 2016).
Abbildung 1-2: Roman Lipski: von der künstlichen Muse geküsst (Bild: Roman Lipski, mit freundlicher Genehmigung)
In unserer Buchkonzeption steht der Musenkuss am Anfang und am Ende: Wir beginnen damit und enden mit einem Kapitel zur Künstlichen Intelligenz als Kokreatorin des Menschen (siehe Kapitel 13).
1.1.2 Der Begriff Kreativität: geheimnisvolle Attraktivität oder totgerittenes Pferd
Auch wenn die Musen inzwischen irdischer Natur sind und die Kreativität nicht mehr mit der Vorstellung eines Schöpfergotts verbunden ist, bleibt doch eine „geheimnisvolle Attraktivität“ zurück (Schuler & Görlich, 2007, S. 1). Das hängt sicherlich mit den plötzlichen kreativen Einfällen als Folge unbewusster Verarbeitungen zusammen, die unserer Selbstkontrolle weitgehend entzogen sind. So ist der säkularisierte Begriff Kreativität für viele auch heute noch von einer Aura des Unergründlichen und Rätselhaften umgeben:
Was meinte Cicero mit „göttlicher Eingebung“? Was meinte Schiller mit „Freude schöner Götterfunken?“ Doch nichts anderes, als dass es Bereiche unseres Seins gibt, die sich einer rationalen, vernünftigen, rein verstandesmäßigen Beschreibung entziehen. Zu diesem Bereich gehört immer noch die Kreativität. Sie mag durch vielen Gebrauch abgenutzt und profanisiert sein, trotzdem bezeichnet sie etwas Höheres. (Finger, 2015) (o. S.)
Dies ist aber nur eine Sichtweise unter vielen anderen, denn der Begriff der Kreativität ist durch einen „schillernden, sehr breiten und unterschiedlichen Bedeutungshof“ gekennzeichnet (Krampen, 2019, S. 17).
Eine andere Sichtweise vertreten Autoren, die sich für eine Demokratisierung des Schöpferischen stark machen und im Kontrast zu den herausragenden Leistungen von Genies die Kreativität auch im Alltagsleben zum Forschungsthema machen (Groeben, 2013; Schuster, 2016). Ganz radikal dachte Robert Weisberg (1986) über Kreativität: Er sprach den herausragenden Erfindern und Künstlern sogar ihre Genialität ab. Ihre Werke seien nicht Produkte genialer Intuition, sondern des gewöhnlichen Denkens in Verbindung mit einem fundierten Spezialwissen und großer Hartnäckigkeit im Verfolgen ihrer Ziele. Er konnte unter anderem mit Falldarstellungen belegen (z. B. durch Picassos „Guernica“ und die Entdeckung der DNA), dass höchste kreative Leistungen meist nicht in einem großen Sprung, sondern in vielen kleinen Schritten erfolgen. Wie Lück (2016) berichtet, hat der deutsche Psychologe Julius Bahle bereits 1930 in der Auseinandersetzung mit dem vorherrschenden Geniekult eine vergleichbare These vertreten. |25|Er konnte bei Komponisten empirisch belegen, dass künstlerische Inspiration keine unerklärliche „göttliche“ Eingebung, sondern Ergebnis zielgerichteter Arbeit (z. B. Improvisation) ist.
Auch unabhängig von der Nähe zur Genialität wird Kreativität als eines der positiv bewerteten Konzepte der Psychologie verstanden. Insgesamt gesehen hat sich das Fach mehr mit menschlichen Unzulänglichkeiten und Defiziten (z. B. Neurosen, Persönlichkeitsstörungen, Destruktivität) befasst. (Dabei darf nicht übersehen werden, dass Kreativität auch Schattenseiten aufweist, siehe Kap. 1.1.6). Kreativität gilt heute vielen als höchstes Gut. Ökonomisch und kulturell gesehen scheint Kreativität die wichtigste Ressource im 21. Jahrhundert zu sein (Florida, 2002). Es überrascht daher nicht, dass der Begriff eine besondere Faszination ausübt und ausgreifend, fast inflatorisch verwendet wird. Die unterschiedlichsten Ideen, Produkte und Ereignisse werden mit dem positiv konnotierten Begriff „kreativ“ benannt, wobei der Begriff häufig gar nicht definiert wird. Der Umfang des Begriffs wird so immer weiter aufgebläht, und Kreativität wird zu einem Modewort, ja zu einer Art Containerbegriff. Das ruft dann kritische Stimmen auf den Plan. So urteilt der Modedesigner Wolfgang Joop (2015):
Kreativität ist eigentlich ein verkommenes Wort. Ich würde niemals sagen, etwas sei meine „kreative Leistung“. Heute sind ja alle kreativ. Man sagt „Ich mach was Kreatives“, wie man früher sagte „Ich habe Kopfschmerzen“. (o. S.)
Der Journalist Harald Martenstein formuliert es noch drastischer: „Dieses Wort ist ein zu Tode gerittenes Pferd“ (2015. o. S.). Kaum zu übertreffen in rigoroser Kritik ist der Reformpädagoge Hartmut von Hentig (1998), der die „hohen Erwartungen an einen schwachen Begriff“ durchleuchtete. Die von ihm behandelten Einwände, wie z. B. Forschungs- oder Praxismängel, wurden allerdings schon 1997 im Erscheinungsjahr seines Buchs von der wissenschaftlichen Kreativitätsforschung als notwendige Problemstellungen begriffen und empirisch untersucht. Sie rechtfertigen es nicht, wie von Hentig von einem „(be-)trügerischen“ Begriff zu sprechen. Unbestritten ist aber die Heterogenität der Assoziationen, die der Begriff bei Laien und Fachleuten unterschiedlicher Wissenschaften auslöst (Krampen, 2019; Weinert, 1990).
Überblick: Wir schlagen vor, von wissenschaftlichen Definitionen der Kreativität mit klar formulierten Kriterien auszugehen. Dies bringt eine Diskussion der einzelnen Bestimmungsstücke von Kreativität mit sich. Wichtigstes theoretisches Kernkonzept ist unserer Meinung nach die Originalität, deren Bedeutung und Erfassung wir im Rahmen des divergenten Denkens (siehe Kap. 1.2.1) beschreiben. Originalität basiert auf Transformation, der Umwandlung von Materialien und Ideen.
Hier geraten wir in eine spannende paradoxe Situation: Einige Testautoren haben die „bahnbrechende“ Idee vorgeschlagen, Originalität wegen der Problematik ihrer Erfassung ganz abzuschaffen. Wir fragen zurück: Wenn auf Originalität verzichtet wird, beraubt sich die Kreativitätsforschung damit nicht ihres eigentlichen Gegenstands? Sägt sie nicht den Ast ab, auf dem sie sitzt? Im Gegenzug plädieren wir dafür, die Originalität als unverzichtbare Kerneigenschaft der Kreativität aufzufassen.
Bevor wir uns damit im Einzelnen auseinandersetzen, bieten wir Ihnen erst einmal einige Erläuterungen zu den Grundbegriffen der Kreativitätsforschung an.
1.1.3 Die vier Cs
Um die Fülle und Vielfalt unterschiedlicher Kreativitätsphänomene zumindest grob zu ordnen, hat die Kreativitätsforschung von Anfang an |26|zwischen einer historisch-kulturellen Kreativität und einer Kreativität im normalen alltäglichen Lebensvollzug unterschieden. Beiden gemeinsamist das zentrale Kriterium Neuheit.
Kreative Höchstleistungen von Genies, wie z. B. Leonardo da Vinci, Marie Curie, Freud, Einstein, Picasso und Virginia Woolf, sind Musterbeispiele für eine historisch-kulturelle Kreativität. Gardner (1999) und Michalko (2001) sehen die Erforschung genialer Menschen mit epochaler kultureller Bedeutung als Schlüssel zum Verstehen des kreativen Denkens im Allgemeinen an. Ihre Leistungen stellen besonders sinnfällige Beispiele für kreative Produkte dar, die sich im kleineren Maßstab auch für die Kreativität im alltäglichen Vollzug anstreben lassen.
Im Vier-C-Modell der Kreativität von Kaufman und Beghetto (2009) werden Theorien, Ideen und Produkte, die sich auf einem hohen Niveau befinden, als Big-C, als „große“, herausragende oder eminente Kreativität bezeichnet. Es handelt sich z. B. um bahnbrechende Innovationen zur Erschließung neuer Märkte, preisgekrönte Theaterstücke oder wegweisende wissenschaftliche Leistungen.
Den Gegenpol dazu stelltlittle-c, die „kleine“, begrenzte Kreativität dar. Groeben (2013, S. 48) nennt sie auch die „persönlich-psychologische Kreativität“, die „nur“ Bedeutung für eine bestimmte Person und ihr unmittelbares soziales Umfeld hat. Es geht dabei um alltägliche kreative Tätigkeiten im Beruf (z. B. Organisation des Büros) oder in der Freizeit (z. B. Dekoration von Blumen, Bearbeiten von Familienfotos, Erproben neuer Kochrezepte, Malen, aktive Teilnahme an unterschiedlichsten Gruppenaktivitäten). Publikumszeitschriften und Magazine greifen das Thema Kreativität hinsichtlich Theorie und Praxis auf und wenden sich an breite Zielgruppen. Special-Interest-Zeitschriften liefern zudem Informationen zum kreativen Gestalten in einzelnen Freizeitbereichen, wie Einrichtungsmagazine, die Do-it-yourself-Tipps bieten. So wirbt z. B. die Zeitschrift „Tina Kreativ“ (Heft 2, 2018) mit „92 Ideen für drinnen und draußen“. Eine Idee z. B. wird mit folgenden Worten eingeführt: „Ich war mal ein Handtuch. Zu schade zum Abtrocknen. Jetzt bin ich ein Kleidchen für die Kaffeekanne“. Ebenso bietet „Pinterest“ – ein soziales Netzwerk, in dem User Bilder mit Beschreibungen an virtuelle Pinnwände heften können – kreative Anregungen. Man kann sich z. B. die besten Ideen für verschiedene Hobbys, Interessen, Tätigkeiten anzeigen und sich dadurch anregen lassen, eigene Ideensammlungen in Form von Pinnwänden zu erstellen und sie mit anderen Usern von Pinterest auszutauschen.
Little-c kommt sogar auf dem Friedhof zum Ausdruck. So sagt Friedhofsgärtner Thomas Götz von sich: „Das ist ein sehr kreativer Beruf, auch wenn man das auf den ersten Blick nicht erwartet“ (Staffen-Quandt, 2016, S. 3). Den Kunden sei Individualität heute wichtig; eine immer gleiche oder zu ähnliche Standardbepflanzung auf mehreren Gräbern sei undenkbar.
Die Dichotomie von Big-C/little-c wird in der neueren Kreativitätsforschung als zu restriktiv angesehen. In ihrem Vier-C-Modell haben Kaufman und Beghetto (2009) daher den herkömmlichen Kategorien die mini-c und die Pro-c hinzugefügt.
Minikreativität steht für neue persönliche Einsichten, für den Aufbau neuer kognitiver Strukturen, also für allererste Erfahrungen mit dem kreativen Bereich, die noch nicht den Standard von little-c erreichen (z. B. wenn ein Kind ein neues Konzept begreift): „mini-c wird definiert als die neue und persönlich bedeutsame Interpretation von Erfahrungen, Handlungen und Ereignissen“ (Kaufman & Beghetto, 2009, S. 3, übersetzt vom Verf.). Minikreativität erweitert die Konzeption von Kreativität, indem anerkannt wird, dass Einsichten und Interpretationen einer Person bereits kreative Akte darstellen, auch wenn sie nicht zum Ausdruck gebracht werden und unabhängig davon, ob sie bei anderen schon vorhanden sind.
Was bei der Dichotomie von Big-C/little-c lange vermisst wurde, ist eine Kategorie für die vielen professionellen Kreativen, die aber den |27|herausragenden Status von Big-C nicht erreichen. Eine solche Mittelstellung nimmt Pro-c ein (Kaufman & Beghetto, 2009). Die Kreativität der in Pro-c-Schaffenden hat sich in speziellen beruflichen oder gesellschaftlichen Bereichen entwickelt und wird in der Regel auch von ihrer Umwelt anerkannt. Manche Amateure lassen sich ebenfalls der Pro-c-Kategorie zuordnen, wenn ihre kreativen Leistungen über little-c hinausgehen.
Tabelle 1-1: Das Vier-C-Modell der Kreativität von Kaufman und Beghetto (2009). (Die von den Autoren vorgenommene Klein- bzw. Großschreibung entspricht der inhaltlichen Bedeutung der Abkürzungen, z. B. Big-C für „große“ Kreativität, little-c für „kleine“.)
Herkömmliche Kategorien
Zusätzliche Kategorien
Big-C
Pro-c
little-c
mini-c
Ein aktuelles Beispiel für Pro-c sind gedruckte Lautsprecher: Im Institut für Print- und Medientechnik der Technischen Universität Chemnitz wurde ein großformatiger Bildband mit gedruckter Elektronik ausgestattet (siehe Abb. 1-3). Öffnet man dieses „T-book“ – das „T“ steht für Ton – und blättert eine Seite um, beginnt diese Seite durch einen unsichtbar im Inneren des Blatt Papiers befindlichen Lautsprecher zu tönen. „Das T-book ist ein Meilenstein in der Entwicklung gedruckter Informationen“, meint Professor Dr. Arved C. Hübler, und er ist sich sicher, dass das von seinem Team entwickelte T-book die Tür zu vielen weiteren Entwicklungen öffnet: „Die Tablets der Zukunft werden auf Papier gedruckt, und das T-book gibt einen ersten Ausblick, was alles möglich sein wird“ (Thehos, 2015, o. S.).
Abbildung 1-3: Gedruckte Lautsprecher bringen Fotos zum Klingen (Bild: Bildarchiv der Pressestelle und Crossmedia-Redaktion der TU Chemnitz/Pressefoto Schmidt, mit freundlicher Genehmigung)
Stellungnahme und Fazit: Die über die basale Unterscheidung von Big-C und little-c hinausgehenden mini-c und Pro-c stellen sicherlich eine wertvolle Ergänzung dar. Mit den vier Kategorien erlaubt es das Modell, den kreativen Werdegang einer Person über die Lebensspanne hinweg darzustellen, wobei der Big-C-Bereich als Höhepunkt eben nur für eminent Kreative infrage kommt. Für treffend und notwendig halten wir die Feststellung der Autoren, dass little-c und „everyday creativity“ nicht synonym sind: „Die Idee der Alltagskreativität kann sich von mini-c bis little-c und durch Pro-c hindurch erstrecken“ (Richards, 2011, S. 6, übersetzt vom Verf.). Wir schließen uns der Konzeption von Richards an, der die Alltagskreativität als „universell“ definiert, aus der heraus sich die eminente Kreativität als Teilbereich entwickeln kann, wenn die Leistung außergewöhnliche soziale Anerkennung erfährt. Schuster (2016) wählt in seinem Buch „Alltagskreativität“ auch den umgekehrten Weg, indem er untersucht, wie sich aus den Entstehungsbedingungen großer Entdeckungen oder Kunstwerke Anregungen für die Alltagskreativität gewinnen lassen. Er führt Salvator Dalí an, der häufig zwei Objekte verschmolz, z. B. erschuf er |28|aus einer Giraffe und einem Elefanten ein Elefantenwesen mit spindeldürren Beinen. Das zugrundeliegende sogenannte homospatiale Denken (zwei getrennte Objekte im gleichen Raum schaffen eine neue Identität) kann auch die Kreativität beim Fotografieren und Schreiben im Hobbybereich anregen.
Alltagskreativität sorgt für flexible Improvisation und Anpassung an wechselnde Umgebungen. Sie ist ein Stil, der sich in vielen Inhaltsbereichen zeigt, und keine hochspezifische Einzelfähigkeit. Alltagskreativität zeigte sich auch im Umgang mit Corona. Als die Maskenpflicht für ganz Bayern verordnet wurde, machten zwei fränkische Künstlerinnen aus der Not eine Tugend: Sie kreiierten Masken aus alten BHs. Oder: Auf den Kölner Rosenmontagszug wurde 2021 nicht verzichtet: „D’r Zoch kütt“. Er kam als Puppenspiel im Miniaturformat über eine Bühne und wurde im Fernsehen übertragen.
Evolutionsbiologen sprechen sogar von einer besonderen Überlebensfunktion der Alltagskreativität (Richards, 2011). Dies deckt sich mit der in neuerer Zeit vertretenen These der „Demokratisierung“ des Kreativitätskonzepts, das eine Strukturidentität von „kleiner“ und „großer“ Kreativität annimmt und das geniale Schöpfertum entzaubert. Groeben (2013) resümiert, dass Kreativität allgemein erreichbar sei: „Kreativität ist daher einer der seltenen Fälle, in denen der Garten Eden wirklich und wahrhaftig im ‚diesseits‘ liegt“ (S. 262).
1.1.4 Die vier Ps
Mit der Klassifizierung nach Niveau und Spannweite im Rahmen des 4-C-Modells haben wir eine erste Sortierung vorgenommen, aber die detaillierte wissenschaftliche Definition von Kreativität steht noch aus. Von welchem Forschungsschwerpunkt oder Ansatz aus wollen wir unsere definitorischen Bemühungen starten?
Weit verbreitet ist die Unterscheidung von vier Schwerpunkten, den „vier Ps“ (Runco & Kim, 2011), die ursprünglich von Rhodes (1962) stammt:1
Person: Wer ist kreativ? Welche Fähigkeiten, Eigenschaften, Selbstkonzepte, biografischen Merkmale etc. weisen kreative Personen auf? Sind es die gleichen Merkmale in unterschiedlichen Domänen, wie z. B. Kunst oder Wissenschaft?
Prozess: Wie werden Ideen und Produkte entwickelt? Oft wird das „Wie“ näher untersucht durch die Aufschlüsselung des Problemlöseprozesses in vier Phasen. Inspiriert durch die Schriften von Herrmann von Helmholtz hat sie Wallas bereits 1926 publiziert:
Vorbereitung: Bekanntwerden mit dem Problem und seinem Hintergrund
Inkubation: auf Distanz zum Problem gehen, ohne die mehr oder weniger bewusste weitere Beschäftigung mit dem Problem aufzugeben
Illumination: plötzliches Bewusstwerden des Einfalls (Aha-Erlebnis)
Verifikation: Überprüfung und Optimierung des Einfalls
Zu beachten ist, dass die Phasen nicht nur nacheinander, sondern auch parallel ablaufen können, z. B. wenn während der Inkubation weitere Informationen aufgenommen werden. Da das Phasenmodell die vielfältigen Vorgänge bei der Entwicklung kreativer Lösungen nur rudimentär wiedergibt, wurden im Zusammenhang mit der Entwicklung von neuen Kreativitätstheorien viele Differenzierungen vorgenommen (Cropley, 1996; Kaufman & Glăveanu, 2019).
|29|Press (oder Platz): Welche Umweltbedingungen fördern oder hemmen kreative Leistungen? Wo sind wir kreativ? Neben unmittelbaren Einflüssen müssen auch distale, wie Evolution, Kultur und Zeitgeist, berücksichtigt werden.
Produkt: Was ist kreativ? Welche Merkmale muss ein Produkt aufweisen, um als kreativ klassifiziert werden zu können?
Neuere Kreativitätstheorien gehen über die klassischen vier Ps hinaus: Runco und Kim (2011) sehen die Notwendigkeit, soziale Einflüsse einzubeziehen. Sie fügen daher als fünften Schwerpunkt Persuasion hinzu: Meist werden nur solche Leistungen als kreativ anerkannt, die Fachleute auf dem jeweiligen Gebiet überzeugen. Dazu bedarf es auch der Überzeugungsarbeit der kreativ Schaffenden selbst (siehe Kap. 12 zum Thema „Künstler-Kreateure“). Ihr sechster Schwerpunkt ist das kreative Potenzial. Es sollte in allen Schwerpunkten entwickelt werden und sich dann möglichst immer deutlicher als Produkt und Performanz manifestieren.
Wir beginnen in diesem Kapitel mit der Frage, welche Merkmale ein Produkt aufweisen muss, um das Gütemerkmal „kreativ“ zu erhalten. Das sichtbare oder mitteilbare kreative Produkt ist nämlich der eigentliche Angelpunkt innerhalb der vier Ps und ist daher in der Forschungsliteratur der am häufigsten gewählten Einstieg in die Definition von Kreativität (Preiser, 1976):
Denn nur diejenige Person wird sich als kreativ erweisen, die kreative Ideen produziert; nur dann kann man einen Prozeß kreativ nennen, wenn er durch das Hervorbringen eines kreativen Produkts beobachtbar wird; nur dann kann man von einer kreativen Atmosphäre oder Umwelt sprechen, wenn sie im erhöhten Maße kreative Ideen ermöglicht. (S. 2)
1.1.5 Das kreative Produkt: Neuheit und Angemessenheit
Man kann sich gut vorstellen, dass die schillernde Verwendung des Begriffs Kreativität ein Pendant in einer Unzahl von Definitionen findet und damit die begriffliche Klärung erschwert. Tatsächlich gibt es in der wissenschaftlichen Literatur „Hunderte“ von unterschiedlichen Begriffsbestimmungen. Zwei Kernmerkmale von Kreativität sind jedoch so gut wie allen Definitionen gemeinsam, was die Begriffsklärung überschaubar macht. Diese beiden Kernmerkmale gelten seit vielen Jahrzehnten als Kriterien, die mindestens erfüllt sein müssen, damit eine Idee, eine Problemlösung, ein Werk, ein Produkt etc. als kreativ bezeichnet werden kann (Groeben, 2013; Kaufman, 2016). Es handelt sich um Neuheit und Angemessenheit. Explizit kommt das bereits in der frühen Definition von Stein (1953) zum Ausdruck: „Ein kreatives Produkt ist ein neues Produkt, das von einer Gruppe als brauchbar oder nützlich oder befriedigend zu einem Zeitpunkt akzeptiert wird“ (S. 311).
1.1.5.1 Neuheit
Neuheit (oder Ungewöhnlichkeit, Seltenheit oder Originalität) gilt als das unverzichtbare Hauptkriterium für Kreativität, das sine qua non. Eine Idee muss neu sein; sie muss zumindest einige neue Elemente enthalten. Wann aber ist eine Idee neu? Die Spannbreite reicht von absoluter Neuheit, wenn eine Idee zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte auftritt, bis hin zum individuellen subjektiven Neuheitserlebnis eines Kindes, das zum ersten Mal einen Feuerwehrmann aus Knete herstellt (Abschnitt 1.1.3). Beide Extreme werfen Fragen auf: Eine Beschränkung auf absolut neue Ideen schließt die vielen anderen glänzenden Ideen aus, die nur relativ neu sind. Groeben (2013) verweist außerdem auf die vielen Entdeckungen, die mehrfach oder zumindest doppelt ge|30|macht wurden: So wurde z. B. die Evolutionstheorie von Charles Darwin und dem britischen Biologen Alfred R. Wallace unabhängig voneinander begründet. Es wäre unfair, einem von den beiden Kreatoren die kreative Leistung abzusprechen, nur weil er ein paar Monate oder Jahre später auf dieselbe Idee gekommen ist und die Idee daher nicht mehr neu im strengen Sinne ist. Entscheidend ist das Kriterium der individuellen subjektiven Neuheit.
Abbildung 1-4: Der Parthenon der Bücher auf der documenta 14 in Kassel (Bild: Getty Images)
Nicht mehr neu ist der „Parthenon der Bücher“ von Marta Minujín auf der documenta 14 in Kassel 2017 (siehe Abb. 1-4). Die monumentale Installation nach dem Vorbild des antiken Tempels auf der Akropolis besteht aus fast 100 000 Büchern aus der ganzen Welt, die einst oder gegenwärtig verboten waren oder sind. Die Installation steht für die Freiheit des Wortes, die immer wieder neu zu fordern ist. Die Idee wurde aber 1983 in Argentinien formuliert und auch realisiert. Der Kasseler Parthenon steht also für eine brillante Idee, die aber als schon bekannte Idee übernommen wurde. Neu ist sie nicht mehr, aber sie behält ihren Wert als stimulierende Idee.
Neuheit muss nicht Einmaligkeit bedeuten. Wenn ein Kind eine allgemein bekannte Gesetzmäßigkeit in einem selbstständigen Denkprozess für sich neu entdeckt, handelt es sich um eine kreative Leistung. Die Zeichnung in Abbildung 1-5 soll das veranschaulichen.
Der Kreativitätsforscher Edward de Bono stellte der 9-jährigen Eva folgende Aufgabe: „Zeige, wie du einen Kampf zwischen Hund und Katze verhindern würdest.“ Die traditionelle Lösung anderer Schüler war, Hund und Katze in getrennte Käfige zu setzen. Eva dagegen wählte eine hochwertige Lösung, in dem sie einen schrittweisen Prozess zu einer gegenseitigen kulturellen Assimilation anstrebte. In den Worten von de Bono (1973):
Hund und Katze leben in getrennten Behausungen. Aber von der Katze führt ein Schlauch bis in die Nähe des Hundefutters. Das bedeutet, dass die Katze beim Fressen den Geruch des Hundes um ihr Futter herum wahrnimmt und auf diese Weise den Hundegeruch mit guten Dingen zu verbinden lernt. Entsprechend kann der Hund, wenn er frisst, die Katze riechen und so lernen, den Katzengeruch mit gutem Futter zu verbinden. (S. 32)
Somit hat Eva für sich das Prinzip entdeckt, dass man Hund und Katze aneinander gewöhnen kann, wenn man ihre Eigeninteressen (z. B. Futter zu bekommen) anspricht. De Bono (1973) resümiert, dass Kinder mehr als Erwachsene in der Lage sind, eine größere Vielfalt solcher Ideen zu generieren, weil sie weniger durch gängige erfahrungsabhängige Schemata festgelegt sind (vgl. Groeben, 2013).
Abbildung 1-5: „Zeige, wie du einen Kampf zwischen Hund und Katze verhindern würdest.“ Die detailreiche Originalzeichnung wurde vereinfacht und adaptiert von Karl und Peter Köhler (7- bzw. 5-jährig).
|31|Die individuelle subjektive Neuheit besagt, dass Kreativität im Prinzip für alle erreichbar ist und nicht auf herausragende schöpferische Personen aus Wissenschaft, Kulturgeschichte und Wirtschaft beschränkt bleibt (Groeben, 2013). Mit diesem „demokratischen“ Neuheitskriterium wird allerdings die Möglichkeit einer intersubjektiv ausgehandelten Definition eingeschränkt.
1.1.5.2 Angemessenheit
Neuheit allein ist nicht ausreichend, um ein Produkt als kreativ anzuerkennen. Das Kriterium der Angemessenheit muss ebenfalls erfüllt sein. Es bezieht sich darauf, ob die Ideen oder Lösungen die Anforderungen der Aufgabenstellung erfüllen, ob sie also brauchbar, nützlich, wertvoll, realitätsangepasst, sinnvoll, effektiv etc. sind. Antworten, die nach dem ersten Kriterium als neu oder selten beurteilt wurden, können durchaus irrelevante Ideen oder Lösungen enthalten, die nicht den Erfordernissen der Aufgabenstellung gerecht werden. Wie die Anforderungen verdeutlichen, handelt es sich bei der Angemessenheit um ein sehr heterogenes Kriterium. Die einzelnen Kreativitätsfachleute heben auch ganz unterschiedliche Aspekte hervor. Nicht immer wird der Oberbegriff „angemessen“ (appropriate) verwendet. Häufig wird brauchbar, nützlich oder sogar sinnvoll oder wertvoll vorgezogen (zusammenfassende Darstellung bei Kaufman & Glăveanu, 2019).
Auf den ersten Blick scheint es nicht allzu schwierig zu sein, absurde oder andere irrelevante Antworten zu identifizieren und anschließend auszusortieren. Dies gilt auch für zufällige und damit neue Anordnungen von Worten, Zeichen und anderen beliebigen Elementen. Ein zweiter Blick zeigt, dass sich die Produkte im Widerspruch zur konventionellen Einschätzung befinden können. Die Angemessenheitseinschätzung muss der Intention der kreativ Schaffenden gerecht werden. Das Problem stellt sich besonders in der Kunst. Bestimmte Kunstrichtungen streben es an, aus herkömmlichen Denkmustern auszubrechen, wie z. B. im Dadaismus und Surrealismus.
Abbildung 1-6: „Fountain“ von Marcel Duchamp (1917, Bild: Alfred Stieglitz, Creative Commons Lizenz: CC0 1.0)
Ein prominentes Beispiel mag das veranschaulichen: Marcel Duchamp reichte 1917 in New York ein Objekt für eine Ausstellung ein: ein handelsübliches weißes Urinal, gekennzeichnet mit einem fiktiven Namen „R. Mutt“. Duchamp präsentierte das Urinal um 90 Grad gekippt liegend, also entgegen seiner eigentlichen Funktion (siehe Abb. 1-6). Die Verantwortlichen für die Ausstellung lehnten die Arbeit ab, was zu einer heftigen Kontroverse über den Kunstbegriff führte. Duchamp und seine Fans argumentierten, dass der Künstler allein durch seine Auswahl eines beliebigen Gegenstands diesen in den Status eines Kunstwerkes erheben könne. Damit vertraten sie eine grundsätzlich neue Kunstauffassung. Kurze Zeit später wurde das Werk von einem Sammler gekauft und ausgestellt. Es gilt bis heute als eines der Schlüsselwerke des 20. Jahrhun|32|derts, das den Ursprung der modernen Kunst markiert (Sawyer, 2012). Die bewusste Erklärung eines Alltagsgegenstands als Kunstobjekt bedeutet das Aufstellen einer neuen Regel, eines neuen generellen Interpretationsvorschlags. Dies macht den Unterschied aus zum Präsentieren von „Kunst“, um in erster Linie aufzufallen, wenn z. B., wie Lenk (2000) kritisiert, eine Berliner Cellistin ihre Stücke nackt spielt. Lenk spricht von der „Neuigkeitssucht“ der Kunstpräsentation, dem manchmal fast zwanghaften Wunsch aufzufallen.
Unserer Auffassung nach sollte man bei der Beurteilung von kreativen Produkten grundsätzlich eine großzügige Haltung einnehmen, damit nicht Antworten vorschnell als unangemessen aussortiert werden. Im Zweifelsfall dürfen die Beurteilenden keinesfalls auf ihren eigenen Prinzipien beharren, sonst übersehen sie möglicherweise besonders kreative Antworten, deren Angemessenheit sich ihnen aber (noch) nicht erschließt. Die Gefahr ist dann besonders groß, wenn die kreativ Schaffenden eine ganz neue Sichtweise zugrunde legen, die als nicht vereinbar mit der Aufgabenstellung erscheint (siehe Beispiel „Fountain“ von Marcel Duchamp, 1917). Hinsichtlich der Anwendungsbereiche lässt sich sagen, dass die Angemessenheit im technischen Bereich meist enger definiert wird (z. B. als Nützlichkeit, Machbarkeit, Umsetzbarkeit) als im künstlerischen Bereich, für den eine große Offenheit in der Angemessenheitseinschätzung charakteristisch ist.
Wir halten fest, dass nach Auffassung vieler Forschenden beide Kriterien, Neuigkeit und Angemessenheit, erfüllt sein müssen, damit ein Produkt als kreativ eingeschätzt werden kann. Dies vorausgesetzt, lässt sich die Frage aufwerfen, welches von beiden Kriterien wichtiger für die Kreativität eines Produkts ist. In einer Studie wurde genau diese Frage untersucht (Diedrich, Benedek, Jauk & Neubauer, 2015). Es wurden Teilnehmende befragt, wie neuartig, nützlich und kreativ sie verschiedene Einfälle beurteilten. Die Ergebnisse sprachen für einen großen Einfluss von Neuigkeit auf die Kreativitätseinschätzung. Das Neue, das Ungewöhnliche ist für die meisten Menschen für die Kreativitätseinschätzung bedeutsamer als die Nützlichkeit.
Wenn es um die Einschätzung von Angemessenheit geht, ist es unabdingbar, das Systemmodell vonCsíkszentmihályi (1997) vorzustellen. Danach resultiert Kreativität aus der Interaktion von drei Instanzen: Person, Feld und Domäne. Der Zugang zur Domäne (inhaltlicher Bereich, z. B. künstlerische Disziplin) wird vom Feld





























