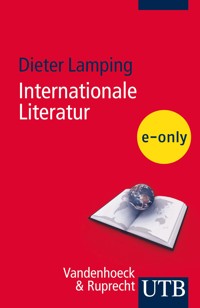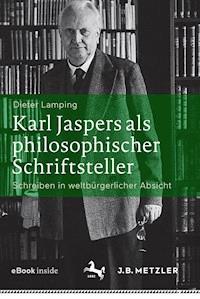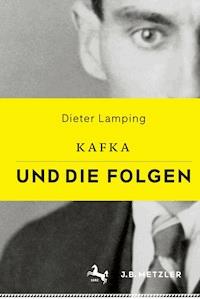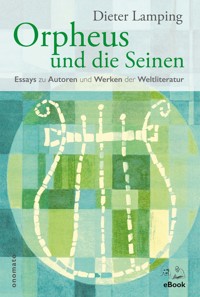
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: onomato
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Essays dieses Bandes gelten Büchern und Autoren der Weltliteratur - von Sophokles bis Goethe, von Horaz bis Peter Handke und von Dante bis Bob Dylan. Ausgehend vom Schicksal des Ahnherrn der Dichter, des mythischen Orpheus, kreisen sie, knapp und pointiert, um die Fragen, was große Werke ausmacht und was sie uns zu sagen haben, was Dichter auszeichnet und was wir ihnen verdanken - und was ihnen trotzdem widerfahren kann. Dabei zeigen die Essays auch, welchen Gewinn die Lektüre von Klassikern haben kann: Sie verbindet einen Leser mit der Welt und der Menschheit, schenkt ihm einen Reichtum an Vorstellungen, Sätzen und Gedanken und hilft ihm, sich und andere besser zu verstehen. In ihnen kann noch der aufgehoben sein, der von seinesgleichen verfolgt und ausgestoßen wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Impressum
ISBN
ISBN der Druckversion 978-3-949899-20-1
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
© onomato Verlag Düsseldorf 2025
Alle Rechte vorbehalten
onomato.de
Dieter Lamping
Orpheusund die Seinen
Essays zu Autoren undWerken der Weltliteratur
Mit Graphiken von Simone Frieling
Ich bot den Toten meine Dienste an.Sie dankten nie, doch manches Wort von ihnenwar Trost. Und ich gewannein Reich durch jenes ungelohnte Dienen.
Eckart Peterich: Sextinen von Porto d‘Ischia
Vorspiel im Fegefeuer
Als Dante im Ersten Gesang des Inferno Vergil begegnet, stellt er fest, dass der von ihm am meisten verehrte römische Dichter ein Schatten ist: ein Toter aus dem ersten Kreis der Hölle. Denn dort, im Limbus, halten sich unerlöst die großen Gestalten der Antike auf, die Christus noch nicht gekannt haben. Vergil führt Dante durch die Hölle bis auf den Läuterungsberg, wo Beatrice ihn erwartet und weiter zu Gott geleitet. Vergil bestätigt, dass er nur ein Schatten vom Höllenrand sei, mit einer klassischen Formel: „Non uomo; uomo già fui“: Ich bin kein Mensch, ein Mensch bin ich gewesen.
Vergil sagt das wieder von sich, als sie im 21. Gesang des Purgatorio dem römischen Dichter Statius begegnen, der zu Dantes Zeit noch mehr als ein Name war und heute kaum noch das ist. Statius lobt Dante gegenüber Vergil, ohne zu wissen, dass er ihn vor sich hat. Als Dante ihm lächelnd Vergil vorstellt, kniet Statius vor ihm nieder und will seine Füße umarmen. Doch Vergil wehrt diese Geste der Verehrung ab: „Mein Bruder,/ Laß ab, denn du bist so wie ich ein Schatten.“ Statius antwortet ihm daraufhin:
[...] Nun kannst du ermessenDer Liebe Macht, mit der ich für dich brenne,Wenn ich selbst unsere Nichtigkeit vergessend,den Schatten wie ein festes Ding ergreife.
Die Geste des Statius hat eine Bedeutung, die über die Commedia hinaus reicht. Denn mit ihr bezeugt er Vergil die Liebe, die wir alle – ob Autoren oder Leser – den großen Dichtern schulden. Sie sind Schatten für uns: Tote, die wir nie gekannt haben, von denen wir nur ahnen, was und wie sie einmal waren. Zugleich sind sie aber für uns lebendig durch ihre Worte und Werke. Statius zum Beispiel, der mehr als hundert Jahre nach Vergil geboren wurde, verdankt dessen vierter Ekloge seine Abkehr von der Sünde der Verschwendung, wodurch er für Dante zum heimlichen Christen wurde und, anders als Vergil, ins Purgatorium kam.
So wie Statius und Dante lenken auch uns die Worte mancher Dichter, bereichern uns und leben in uns weiter. Deshalb ist noch immer mancher bereit, ihnen zu Füßen zu fallen, selbst wenn sie keinen Körper mehr haben und selbst wenn sie ihrer Verfehlungen wegen in die Hölle gehören oder im Fegefeuer ausharren müssen.
Literaturhinweise:
Dante ist oft ins Deutsche übersetzt worden. Nicht zuletzt durch ihren Kommentar bietet sich die folgende Ausgabe an:
Dante Alighieri: Die Göttliche Komödie. Band II: Zweiter Teil. Purgatorio – Der Läuterungsberg. Übersetzt von Herman Gmelin. Mit Anmerkungen und einem Nachwort von Rudolf Baehr. Stuttgart 1966.
Der Ahnherr der Dichter
Die Anfänge der Dichtung verlieren sich im Dunkel vorgeschichtlicher Zeit. Was wir über sie wissen oder zu wissen meinen, ist nicht viel. Überliefert ist vor allem, was der Mythos über den Ahnherrn der Dichter erzählt: den Thraker Orpheus, Sohn der Muse Kalliope und des Flußgottes Oiagros. Sein Mythos ist weniger eine Geschichte als eine Sammlung von Geschichten. In der einen begleitet er die Argonauten in den Kaukasus, auf ihrer Fahrt nach dem Goldenen Vlies, besänftigt dabei mit seinem Gesang das tobende Meer und übertönt die Sirenen. In der anderen Geschichte verliert er seine junge Frau Eurydike, macht sich in die Unterwelt auf, um sie zurückzuholen, stimmt die Herrscher des Hades um und verliert Eurydike wieder, als er sich, gegen das Verbot der Götter, kurz vor dem Aufstieg aus der Schattenwelt nach ihr umsieht. Daraufhin zieht er sich zurück und trauert in der Einsamkeit um die Tote, in Klageliedern, die selbst die Bäume und die Tiere des Waldes verzaubern. Schließlich wird er von den Frauen, die er verschmäht hat, den Mänaden, Anhängerinnen des Gottes Dionysos, in rauschafter Wut getötet. Sie zerreißen seinen Körper, sein Kopf aber treibt singend im Wasser zur Insel Lesbos.
Der Mythos von Orpheus steckt voll kleiner und großer Dramen. Um Liebe, Tod und Kunst geht es in ihm ebenso wie um Schuld und Trauer, Sexualität und Gewalt. Sein mythisches „Mysterium“, wie es Ernst Cassirer genannt hat, ist die Macht des Gesangs: als Verbindung von Dichtung und Musik. Orpheus, der Archetyp des Lyrikers, der seine Gedichte selbst singt und sich dabei auf der Lyra begleitet, ist Dichter, Sänger und Musiker in Personalunion. Die Schönheit seiner Lieder überwindet den Tod, beruhigt die Elemente, bannt Gefahren, rührt Tiere und Pflanzen ebenso wie die Götter. Apollo schenkte Orpheus dafür als Lohn eine Leier, die nach seinem Tod als Sternbild an den Himmel versetzt wurde: das Zeichen seiner Unsterblichkeit.
In der Geschichte von Orpheus und Eurydike ist die Macht der Dichtung unauflöslich mit der Liebe verbunden. Orpheus handelt und dichtet aus Liebe. Seine Trauer um den Verlust der Geliebten verleiht seiner Kunst ihre letzte Macht. Doch die Liebe, vom Dichter besungen, ruft Hass hervor, bei denen, die von ihr ausgeschlossen sind. Die Anhängerinnen des Dionysos, die sich von Orpheus verschmäht fühlen, werden seine Todfeinde. Mit seiner Ermordung endet ein Leben zwischen Abenteuer und Liebe, Gemeinschaft und Einsamkeit, Schönheit und Schrecken, Zauber und Gewalt. Seine Dichtung ist nicht zufällig elegisch: wesentlich Klage, dem Tod nicht weniger als dem Leben zugewandt.
Der Orpheus-Mythos erzählt davon, was ein Dichter ist und was ihn zum Dichter macht, wie Dichtung entsteht und wirkt. An ihn anzuknüpfen heißt immer auch, das Nachdenken über Dichter und Dichtung fortzusetzen: über den Dichter als Erkunder der Welt, seine Nähe zu den Toten und seine Wendung zu den Göttern, seine Erfahrung der Liebe und ihres Verlustes, die er wie keiner sonst auszudrücken vermag. Nicht nur künstlerische Vollkommenheit, auch persönliche Schwäche gehört zu ihm, ebenso die Abkehr von den Menschen und der Rückzug in die Natur: ein Moment von Menschenfeindschaft bei dem unbedingt Liebenden. Noch der tödliche Haß auf die Existenz des Dichters, der zu seiner Verfolgung und Vernichtung führt, zieht sich durch die Geschichte. Diese Konstellation mag nicht auf dieselbe Weise für alle Dichter gelten, aber doch für sie im Ganzen. Sie umreißt ihre künstlerische Existenz.
Literaturhinweise:
Robert von Ranke-Graves: Griechische Mythologie. Qullen und Dichtung 1. Übersetzt von Hugo Seinfeld unter Mitwirkung von Boris von Borresholm. Reinbek bei Hamburg 1968.
Ernst Cassirer: Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil: Das mythische Denken. Darmstadt 3. Aufl. 1958.
Der gute Gott und seine Schäflein: Psalm 23
ist einer der bekanntesten und beliebtesten Texte der Bibel, in der Übersetzung Luthers auch ein klassischer deutscher Text:
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser.Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar.
Der Psalm ist dem sagenhaft-schillernden König und Dichter-Sänger David zugeschrieben. Seine pastoralen Motive sind alle topisch: die grüne Au, das frische Wasser, der Weg, das finstere Tal, schließlich der gute Hirte. Im fünften und sechsten Vers wechseln die Bilder in den häuslichen Bereich: gedeckter Tisch, Salböl und Trank für den Gast, der noch als der Wanderer zu erkennen ist, der durch das Tal gegangen ist. Am Ende ist er im Haus des Herrn angekommen, in dem er „immerdar“ bleiben wird.
Das ist alles formelhaft und doch elementar. Ur-Bilder aus dem pastoralen wie dem häuslichen Bereich werden miteinander verknüpft. Die Mitte, auf die sie alle bezogen sind, ist der Glaube an die Geborgenheit in Gott. Gott führt die Gläubigen wie der Hirte seine Herde. ER richtet und straft nicht, sondern ist gut und barmherzig, fraglos nimmt Er jeden auf. Wie man den Psalm weiterliest, mag davon abhängen, wo man sich gerade auf seinem Lebensweg befindet: auf der grünen Au, im finstern Tal oder vor dem Haus des Herrn.
Psalm 23 ist in der jüdisch-christlichen Tradition das schönste Beispiel für Gottvertrauen. Schön ist schon der Vergleich des Herrn mit einem Hirten. Das Pastoral, anziehend in seiner friedvollen Anschaulichkeit, läßt den Menschen demütig erscheinen, wenn er, Gott ergeben, sich zu Ihm verhalten möchte wie ein Schaf zum Hirten. Unübersehbar ist der Wunsch, wieder Natur zu sein, zurückzukehren in den Zustand vor dem Sündenfall, ja der Menschwerdung. Er ist in diesen Versen sogar stärker als das Verbot, sich von Gott ein Bildnis zu machen.
Aber waren Menschen jemals so sehr Natur wie die Tiere, gar die Schafe? Und ist Gott wie ein Hirte? Verkleinert der Psalm nicht Gott und den Menschen zugleich? Und überhöht er nicht den Hirten – als wäre sein Verfasser selbst einer gewesen? Der Vergleich Gottes mit ihm dürfte eine bis heute vorhandene Verehrung dieses Berufes begründet haben, die ansonsten schwer erklärlich ist.
Die Verse des Psalms mögen auch so schön erscheinen, weil wir uns zu oft eben nicht wie die behüteten Lämmer fühlen, die sie beschreiben: sondern allein und anders, anders alle übrigen Lebewesen – als wäre das der Grund menschlicher Existenz.
›Nichts ungeheurer als der Mensch‹ Die Weisheit des Chores in der Antigone des Sophokles
Literatur, zumal Dichtung, war immer auch eine Wissenschaft von Menschen und vom Menschen. Wissenschaft dabei großzügig verstanden: als Bezeichnung für Einsichten und Erkenntnisse, die teilbar sind, festgehalten und weitergegeben werden können. Eine Wissenschaft von Menschen ist die Literatur, insofern sie in vielerlei Gestalten menschliche Vielfalt und Verschiedenartigkeit zeigt; eine Wissenschaft vom Menschen, insofern sie immer wieder Antworten auf die Frage zu geben versucht, was er sei. Eine solche Ansicht vom Menschen findet sich schon in der Antigone des Sophokles, die Kenner, Hegel allen voran, mit guten Gründen für das vollkommenste Drama halten.
„Ungeheur ist viel, doch nichts/ Ungeheuerer als der Mensch“: Mit diesem selbst ungeheuren Satz, in der Übersetzung von Heinrich Weinstock, beginnt das erste Standlied des Chores, der eben die Bühne betreten hat. In großen, sinnschweren Worten zählt er auf, was der Mensch zu leisten vermag: Er fährt zur See, auch im Sturm; er bewirtschaftet das Land, „Der Götter Ursprung, Mutter Erde“; er fängt Vögel, jagt Wild und fischt Meerestiere, „Der überkluge Mann“ zähmt das Pferd und den „Bergstier“; er besitzt Sprache und „windschnellen Sinn“; er meidet den Frost und den Sturmregen; er ist auf alles vorbereitet, „ratlos trifft/ ihn nichts was kommt“, selbst gegen „heillos Leiden“ weiß er sich zu helfen: „Nur vorm Tod/ Fand er keine Flucht.“ Sein Wissen, „Ihm über Verhoffen zuteil“, treibt ihn „bald zum Bösen und wieder zum Guten“. Er achtet „Landesart/ und Götterrecht“, doch kann sich auch „Aus Frevelmut bösem Sinn“ ›zugesellen‹.
Was als Lob der menschlichen Leistungen einsetzt, endet als Warnung: die Fähigkeiten des Menschen können ihm zum Glück wie zum Unglück ausschlagen. Ungeheuer ist, was er zu schaffen vermag, ungeheuer, was er zum Schlechten wendet, wenn er die Gesetze überschreitet, die ihm gesetzt sind.
Weinstock hat das Standlied auch „das Hohelied der Kultur“ genannt. Es ist noch mehr: eine poetische Anthropologie in 40 Versen. Vor ungefähr 2500 Jahren entworfen, ist dieses Bild vom Menschen nicht widerlegt, sondern Mal um Mal durch die Zeiten hindurch bestätigt worden. Heute würde es sogar noch schärfer ausfallen, angesichts dessen, was der Mensch seither alles gemeistert und angerichtet hat.
Das Lied des Chores ist allerdings nicht schon das Fazit des Stücks, nicht seine Lehre. Kreon, der König von Theben, hat eben erst erfahren, dass sein Verbot übertreten wurde, Polyneikes zu bestatten. Sohn und Nachfolger von König Ödipus, war Polyneikes vom Thron gestürzt worden; daraufhin griff er die Stadt an und fiel im Zweikampf mit seinem Bruder Eteokles. Der Chor weiß, wenn er sein Standlied singt, dass die Leiche des Staatsfeindes mit Erde bedeckt wurde. Er weiß noch nicht, dass die Tat von Antigone, der Schwester der beiden, begangen wurde, und er weiß auch noch nicht, was Kreon tun wird. Er kennt weder die Motive der Täterin noch die starrsinnige Strenge des Königs. Sie beruft sich auf die Götter, er auf den Staat: Der Konflikt ist nicht aufzulösen. Das Unglück nimmt schnell seinen Lauf.
Zum Hungertod verurteilt, tötet Antigone sich in ihrer Zellengruft selbst. Kreon, unnachgiebig und unbelehrbar, verliert die Seinen: Haimon, seinen Sohn, Antigones Verlobten, und Eurydike, seine Frau, die sich beide auch das Leben nehmen. Die Tochter des früheren Königs und der jetzige König haben schließlich beide Schuld auf sich geladen.
Das letzte Wort des Stücks hat wieder der Chor:
Von allen Glücksgaben ist Einsicht ins RechtDie erste. Nie darf gegen GottesgebotMan freveln. Es tilgt sich vermessenes WortIn unvermeßlichem SchicksalsschlagUnd lehrt im Alter noch Einsicht.
Die Verse sind gewissermaßen ein Zusatz und Nachtrag zum ersten Standlied. Dass der Chor am Schluß erwähnt, dem Einzelnen könne „im Alter noch Einsicht“ zuteil werden, ist nicht bloß dem Publikum gesagt. Mit der Betonung von Erkenntnis und Erfahrung bringt der Chor in die mythische Fabel ein Moment von Rationalität: Der Wille der Götter ist nicht unerforschlich; dem Menschen ist es möglich, das Richtige – für Sophokles: Gottgewollte – zu erkennen.
Mit seinem Schlußwort erinnert der Chor zugleich an die Fehlbarkeit und die Vernunftbegabtheit des Menschen. Aus Selbstüberschätzung und Verblendung kann er fehlen, aber durch Einsicht kann er das Verderben auch abwenden. Immer muß er sich fragen, ob er im Sinn aller Ordnung herstellt und bewahrt oder sie stört und zerstört.
Literaturhinweise:
Die Dramen des Sophokles sind oft übersetzt worden. Nicht in jedem Punkt überzeugend, im Ganzen aber noch immer lesbar ist:
Sophokles: Die Tragödien. Übersetzt und eingeleitet von Heinrich Weinstock. 5., unveränderte Auflage. Stuttgart 1967.
Heinrich Weinstock: Sophokles. 3., überarbeitete Auflage. Wuppertal 1948.
Die Kunst des Horaz nach Wieland
Wer heute, ungefähr 250 Jahre nachdem seine Verehrung hierzulande ihren Höhepunkt erreichte, Horaz liest, mag sich weniger fragen, was für ein Mensch, als was für ein Dichter er war. Lessing hat in seinen „Rettungen des Horaz“ noch gemeint, das Bild des „ehrlichen Mannes“ wiederherstellen zu müssen, während er den Ruf des Lyrikers für ungefährdet hielt. Viele haben ihn tatsächlich gelobt, gelegentlich selbst Goethe; Klopstock, Herder, Novalis und andere haben ihn übersetzt: ein kanonischer Autor, ohne Zweifel.
Doch was soll man heute halten von einem „Dichter“, der nach Lessing „Witz und Vernunft“ mit der „Feinheit eines Hofmanns“ verband, der durch die „entzückenden Harmonien“ seiner Verse „Eingang in das Herz“ seiner Leser fand – uns aber durch die Zeiten entrückt ist? Zu seinen bekanntesten Versen gehört, in der Übertragung August von Platens, die vierte Strophe seines – im Deutschen Ode genannten – Carmen Neun des ersten Buchs:
Frage nicht, was morgen sein wird,Zieh Gewinn von jedem Tage,Und verscheuche nicht die süßenMusen, Knabe, nicht den Tanz,Bis das Alter trüb dich heimsucht!
Sind das Verse eines großen Dichters ?
Über Autoren haben andere Autoren meist ein sicheres Urteil, zumal wenn sie sich der Mühe unterzogen haben, sie zu übersetzen. Das ist bei Christoph Martin Wieland der Fall. Er hat Horaz aber nicht nur ins Deutsche übertragen, sondern bei der Gelegenheit auch kommentiert – scharfsinnig und kenntnisreich.
In dem Band der von ihm übersetzten und kommentierten Satiren hat er an zehneinhalb Versen die horazische Kunst beispielhaft aufzuweisen versucht. Sie gehören zur ersten der Satiren, und in ihnen geht es um ein moralphilosophisches Lieblingsthema des Römers: den Unverstand des Geizigen, der in seiner Gier – Wieland führt dafür das Wort „Gierde“ ein – nicht aufhören kann, Reichtum anzuhäufen. Diesen Charakterzug stellt Horaz in einem ausführlichen Vergleich dar:
[…] Es ist, als wenndu einen Kübel oder Becher Wassers brauchtest,und sprächst: ich möchte doch aus einem großen Flußihn lieber als aus diesem Quellchen füllen.Da kömmts dann gerne so, daß einen, deran größerm Überfluß als Recht ist Freud hat.der schnelle Waldstrom samt dem morschen Uferdavon führt: da hingegen, wer nicht mehrbegehret als das Bischen was er braucht,dafür auch weder leimicht Wasser trinkennoch einen nassen Tod befürchten muß.
Die Verse zeigen, Wieland zufolge, was Horaz „in seinen versificierten Diskursen zum Dichter macht“. Zwar könnten sie zuerst, „dem Anschein nach“, kunstlos wirken, „aber es ist mehr Kunst in der Art, wie er es behandelt, als man beym ersten Anblick denken sollte“. Der Vergleich sei „Embryon einer sehr schönen Äsopischen Fabel; welcher nichts als der epische Vortrag, oder die Erzählung fehlt, um von jedermann dafür erkannt zu werden.“
Diese Fabel konstruiert Wieland kurzerhand, um seine eigene Behauptung zu beweisen, betont aber den Unterschied zu den Versen des Horaz. Er bestehe darin,
daß er [Horaz, D.L.] die Erzählung in die Nutzanwendung, die er davon auf den Geizigen macht, unmittelbar verwebt, und, indem er das Geschichtchen nur durch leichte Striche andeutet, dafür die darin liegende Allegorie mehr entwickelt, und jeden kleinen Umstand zum Vortheil seines moralischen Zweckes geltend macht, – nehmlich, den alten Erfahrungssatz anschaulich zu machen: daß der Geizige [...] ein Thor und ein armer Teufel ist.
Was nach Wieland den Dichter Horaz ausmacht, ist letztlich die gekonnte und geschickte Veranschaulichung einer Wahrheit. Das mag an ein poetologisches Programm erinnern, das Aufklärer wie Johann Christoph Gottsched hochhielten. Christian Fürchtegott Gellert hat dafür die berühmt gewordene Formel gefunden: „die Wahrheit durch ein Bild zu sagen“, allerdings diesem Vers noch den anderen vorangestellt: „Dem, der nicht viel Verstand besitzt“. So nüchtern-respektlos dem Leser gegenüber ist Wieland nicht.
In den Gedichten des Horaz findet er vor allem eine Wahrheit. Ihre „herrschende Idee“ sei die „Inconsequenz der Menschen“. Das sei „der Geist seiner Philosophie, der Mittelpunct aller seiner moralischen Begriffe und Gesinnungen, der feste Grund seines eigenen Lebens“. Horaz avanciert in dieser Charakteristik, wie bei Lessing, zum Muster „des philosophischen Dichters“ – der die Wahrheit sogar „lächelnd“ zu sagen versteht, was seiner moralischen Wirkung noch einmal zugute komme.
Den zehneinhalb Versen der ersten Satire, die Wieland anführt, kann vielleicht nicht jeder soviel abgewinnen wie er. Sind sie nicht etwas zu wortreich und dabei digressiv? Hätten die konzisen ersten dreieinhalb Zeilen nicht allein einen stärkeren Eindruck hinterlassen? Mußte man sie noch weiter entfalten? Wieland stellt diese Fragen nicht, weil es ihm zuallerst um die ›Wahrheit‹ der Verse geht, die ihm unbezweifelbar ist.
Der Dichter als Moralphilosoph ist zwar ein vernünftiges Programm – aber kann es Dichtung gerecht werden? Was Wieland sonst noch an Horaz rühmt: gute Laune, Urbanität und Klugheit, macht dessen Verse sympathisch – aber auch poetisch? Bezeichenderweise tut es Wielands Bewunderung keinen Abbruch, dass man etwa „einen eigentlich künstlerischen Plan“ und eine „Genauigkeit im Zusammenhange des ganzen Räsonnements“ in der ersten Satire – aber nicht nur in ihr – „nicht suchen“ müsse. Das könnte man auch strenger beurteilen.
Was Wieland über Horaz zu sagen weiß, ist meist treffend und durchweg selbst anschaulich ausgedrückt. Aber es beweist geradezu das Gegenteil dessen, was er sich vorgenommen hat zu zeigen. Horaz – und nicht nur der Horaz der Satiren – ist Dichter vor allem in dem einen Sinn: dass er Verse schrieb, technisch versiert, geistreich und originell, manchmal frech und derb, manchmal elegant, manchmal zum Lachen reizend, manchmal zum Nachdenken, manchmal auch verletzend, aber immer nur die Richtigen. Weder mit seinem Gönner Maecenas noch mit seinem Kaiser Augustus wollte er es sich verderben.
Ein direkter Nachkomme des Orpheus war er nicht. Allerdings ist dessen Familie sehr groß geworden, weit verzweigt über die Jahrtausende, inzwischen kaum noch überschaubar, durch die vielen nahen und noch mehr entfernte Verwandte, zu denen man dann mit Wieland selbst Horaz zählen kann, auch ohne genaueren Herkunfts-Nachweis.
Literaturhinweise:
Von den Satiren des Horaz in der Übersetzung Wielands – ebenso von den Briefen – gibt es eine handliche und schöne Ausgabe aus dem nicht mehr existenten Greno Verlag:
Horazens Satiren aus dem Lateinischen übersetzt und mit Einleitungen und erläuternden Anmerkungen versehen von C.M. Wieland. Nördlingen 1985.
Lessings Werke. Herausgegeben von Kurt Wölfel. Zweiter Band: Schriften I. Schriften zur Poetik. Dramaturgie, Literaturkritik. Frankfurt a.M. 1967.
Das Verhältnis der Dichter zur Wahrheit erörtert:
Wolfgang Kayser: Die Wahrheit der Dichter. Wandlungen eines Begriffes in der deutschen Literatur. Hamburg 1959.
Der erste Mäzen
Gaius Cilnius Maecenas ist eine geradezu legendäre Gestalt geworden – als Mann von ungeheurem Reichtum und als Gönner der großen Dichter seiner Zeit. Aus seinem Namen hat man, ihn ehrend, einen bis heute gebräuchlichen Begriff gemacht: den des Mäzens. Dessen guter Klang hat dem Namen des Maecenas einen eigenen Nimbus verliehen. Horaz, dem er ein Landgut schenkte, eine Handvoll Pächter und acht Sklaven inbegriffen, hatte daran großen Anteil. Vor allem in seinen Briefen und Satiren, aber auch in seinen Oden, hat er den Gönner als ebenso guten wie verständnisvollen und großzügigen Freund geschildert.
Maecenas entstammte einem Rittergeschlecht aus Arretium, dem heutigen Arrezo, und mehrte sein Vermögen als getreuer Gefolgsmann Oktavians, des Neffen und Adoptivsohns Caesars, der den Bürgerkrieg, der auf dessen Ermordung folgte, für sich entscheiden konnte und zum Kaiser Augustus wurde. Maecenas schloß sich ihm schon früh an, diente ihm als politischer Ratgeber, wurde sein Freund und enger Vertrauer; später erfüllte er für ihn auch verschiedene diplomatische Missionen.
Für all das wurde er von seinem Fürsten fürstlich belohnt. So unbestimmt seine hohe Stellung am Hof war – ein offizielles Amt hatte er nicht inne –, so einträglich war sie. Er wurde der reichste Mann Roms. Die „Villa“, die er sich auf dem Esquilin bauen ließ, würde man heute ein Schloß nennen. Er lebte prächtiger als sein eigener Kaiser, der persönlich nicht so anspruchsvoll war.
Die Urteile über Maecenas gehen und gingen auseinander. Von Seneca bis Theodor Mommsen ist Maecenas als Dichter verhöhnt worden. Vielen Historikern gilt er jedoch bis heute als edler und selbstloser Gönner. Sie sprechen über ihn kaum anders, als Freunde wie Horaz es taten. Wieland hat dazu schon spöttisch bemerkt,
daß die Gelehren eine sehr gutherzige Art von Menschen sind; und die lobbegierigen Großen unserer Zeit haben alle Ursache, sich dieß zum Beweggrunde dienen zu lassen, dem guten Kaiser August und seinem tugendhaften Minister Maecen in ihrer Freygebigkeit und Achtung gegen so dankbare Seelen rühmlichst nachzuahmen.
Die dankbaren Seelen waren zunächst die beschenkten Dichter, Horaz allen voran.
Wieland zeichnet ein anderes Bild von Maecenas als sie. Nüchtern stellt er fest, dass nie zuvor, „wenn man die Sache genau untersuchen wollte, ein größerer Ruhm wohlfeiler erkauft worden, als der seinige“. Die Geschenke, die Maecenas Dichtern machte, seien für ihn „eine Kleinigkeit“ gewesen, Augustus habe ihn „aus der Beute der Proscriptionen und Bürgerkriege unermeßlich reich gemacht“. Am Ende sei es „doch weit weniger sein eignes Licht, als der Glanz, der von den Verdiensten und dem Ruhm seiner Freunde auf ihn zurückfiel, woraus der Nimbus entstand, in welchem die Nachwelt diesen vermeinten Musageten zu sehen gewohnt ist“.
Maecenas sei nicht das gewesen, „was man einen großen Mann nennt“. Sein Glück habe er – „dem Glücke zu danken“. Dabei spricht er ihm Talente und gewinnende Züge nicht ab; er sei etwa „angenehm von Person, jovialisch im Umgang“ gewesen, „mit einem guten Theil Gefälligkeit und Gutmüthigkeit“. Augustus sei ihm „immer wohl“ gewesen, „denn er fand da immer alles, woran es ihm gerade fehlte, Rath, Auswege, Entschlossenheit, guten Muth, frohe Laune“.
Doch diese Art hatte ihre Kehrseite. Weil „Witz und Liebe zum Vergnügen die Hauptzüge seiner Sinnesart waren“, habe Maecenas keinen „Heroismus der Tugend“ gekannt, „der immer bereit ist das Edelste zu thun und einer hohen Idee von moralischer Schönheit oder Größe jedes Opfer zu bringen“. Er habe lediglich darauf geachtet, was für den Staat „das nützlichste, und zugleich für „seine eigne Person das sicherste sey“. Durch diese Art habe er es verstanden, „sich zu gleicher Zeit in der Gunst des Fürsten und des Volkes zu erhalten“.
Den persönlichen Eigenarten des Maecenas widmet Wieland einige Aufmerksamkeit. Seine „liebsten Ergötzungen und Zeitvertreibe“ seien durch „Üppigkeit und Frivolität“ gekennzeichnet gewesen. Die „Schlaffheit des Geistes» hätte sich nicht nur „in seiner Kleidung, seinem Gang, in der Art, wie er seinen Kopf trug“, gezeigt, sondern „auch in seiner Schreibart“, etwa seiner „Affectation sich ungewöhnlich auszudrücken“. Alles das habe den „Weichling“ verraten.
Wieland bleibt aber nicht bei der moralischen Beurteilung des Maecenas als eines habgierigen Bürgerkriegsgewinnlers und dekadenten Opportunisten stehen. Dem Verhalten noch des Privatmanns mißt er vielmehr eine politische Bedeutung bei. Er erkennt sie darin,
daß in allem diesem die Politik des Maecenas mit seinem eignen natürlichen Hang in Einem Punct zusammengetroffen sey. Eine so große Veränderung in der Staatsverfassung, wie er dem August hatte bewirken helfen, machte eine allgemeine Abspannung der Sitten, bis auf einen gewissen Grad, politisch nothwendig; und es wäre ungereimt gewesen, wenn man vor dem, was in der freyen Republik anständig geheißen hatte, mehr Respect hätte tragen wollen, als vor den Gesetzen selbst.
In der Lässig- und Nachlässigkeit des Maecenas drückt sich für Wieland eine Verachtung überkommener Umgangsformen aus, eine Respektlosigkeit gegenüber Verhaltensweisen, die für Bürger der Republik zuvor verbindlich waren. Sich so zu verhalten war mehr als nur eine Frage des persönlichen Stils oder der Stillosigkeit. Es entsprach der neuen Politik. Denn die römischen Bürger hatten durch die Monarchie politisch viel verloren. Um gleichwohl gefügige Untertanen des neuen Herrschers sein zu können, mußten sie nach Wieland
unter allen Arten von Ergötzungen und Zerstreuungen abgeartet, weichlich gemacht, und zu dem kindischen, parasitischen und sclavischen Charakter umgestimmt werden, den der leidende Gehorsam voraussetzt und nothwendig macht.
Eben diese Art hat der Super-Reiche ihnen vorgeführt: Das war seine kulturpolitische Rolle.
Wielands Charakteristik des Maecenas hat eine geradezu materialistische Voraussetzung. Wandlungen der Kultur sieht er in politischen – und ökonomischen – Veränderungen begründet: Ein neues Regime verlangt eine neue Moral, die auch eine neue Unmoral sein kann. Maecenas war, nach dieser Lesart, nicht nur der im Hintergrund agierende politische Stratege des Augustus. Er war auch einer der neuen Menschen, die der neue Machthaber sich wünschte für sein Prinzipat, das mit der Republik und ihren Traditionen Schluß machen wollte. Der Rittersohn Maecenas führte noch als Privatmensch, der parvenügleich auffiel, wo immer er erschien, die neue Moral sichtbar bis ins Detail der Kleidung vor.
Das wäre schon genug, um den Charakter des edlen Gönners in Zweifel zu ziehen. Es läßt aber auch sein angeblich selbstloses Maezenatentum in einem anderen, erheblich trüberen Licht erscheinen, auf das Wieland schließlich seine Analyse ausweitet:
Daß er [Maecenas, D.L.] Dichter, witzige Köpfe und Gelehrte aller Arten (wenn sie Leute von guter Gesellschaft waren) gern um sich leiden mochte, und sie gelegentlich dem August empfahl, hatte, vors Erste, einen sehr in die Augen fallenden politischen Grund.
Maecenas, bei „seinem natürlichen Hang zur Ruhe und zum Vergnügen”, hätte es zu den Künsten gezogen, weil sie „Mütter und Töchter des Vergnügens sind“. Dafür, dass sie das auch bleiben sollten, förderte er Künstler – ohne „für die hohen Schönheiten der Werke des Genies einen vorzüglichen Sinn zu haben“ und ohne dessen „ganzen Werth“ erfassen zu können. Seinem Gönnertum lag ein Verständnis von Kunst zugrunde, das durch seine Interessen und seinen Geschmack beschränkt war. Indem er das aufzeigt, entzaubert Wieland den Mythos vom reichen Mann als uneigennützigem Liebhaber und Förderer der Künste.
Maecenas’ Mäzenatentum mag aber nicht nur eine Parallelaktion zu der Belohnungspolitik des neuen Kaisers gewesen sein. Er dürfte noch einen weiteren, ebenso persönlichen Grund für seine Gunstbezeugungen gehabt haben. Maecenas hatte selbst literarischen Ehrgeiz; doch sein eigener Versuch, als Dichter zu Ruhm zu gelangen, scheiterte. Sogar Augustus, der ein schnöder Freund sein konnte und Maeceanas die erste Frau ausspannte, verspottete dessen schnörkelhafte Ausdrucksweise. Um Ruhm zu ernten, reichte es aber auf die Dauer nicht, nur reich zu sein, wie reich auch immer. Sicher wird Maecenas eines gewußt haben: dass man am besten denen Gutes tut, die darüber reden können, und zwar öffentlich. So kann man auch als Gönner berühmt werden. Maecenas ist durch die Erwähnungen seines Freundes Horaz sogar fast so unsterblich geworden wie der selbst. Dass das ein leicht verdienter Ruhm ist – wer wüßte das, wenn nicht einer wie er?
Literaturhinweise:
Horazens Briefe aus dem Lateinischen übersetzt und mit historischen Einleitungen und andern nöthigen Erläuterungen versehen von C.M. Wieland. Nördlingen 1986.
Das heute vorherrschende Maecenas-Bild findet sich etwa in:
Bernard Andreae: C. Cilnius Maecenas. Urbild aller Förderer der Kunst. Sonderdruck aus den Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 2006 anlässlich der Ausstellung C. Cilnius Maecenas. Urbild aller Förderer der Kunst in der Deutsche Akademie Rom Villa Massimo 7.-23. Juni 2006. Rom 2006.
Nachwort
Dieser Band sammelt literarische Essays über große Autoren und Bücher, die um das kreisen, was Dichtung ist und leisten kann, von der Antike bis in unsere Zeit. Im Großen sind sie mehr oder weniger chronologisch angeordnet. Man kann sie jedoch in jeder beliebigen Reihenfolge lesen. Die Zusammenhänge zwischen ihnen werden allerdings leichter erkennbar, wenn sie so gelesen werden, wie sie angeordnet sind.
Die Essays sind über einen längeren Zeitraum entstanden. Manche sind bereits veröffentlicht worden, so die zu Boccacio, Montaigne, Chamisso, Pound, Böll und García Márquez in Literaturkritik.de. Thomas Anz sei für die freundliche Genehmigung zum Wiederabdruck gedankt. Andere Essays wie die zu Goethe, Kafka und Grete Weil schließen an frühere Veröffentlichungen an. Alle sind für dieses Buch noch einmal überarbeitet, ergänzt und erweitert worden.
Ich danke meinen ersten Lesern: Simone Frieling und Axel Grube.
Mainz, im Frühjahr 2023