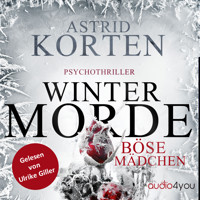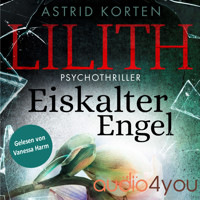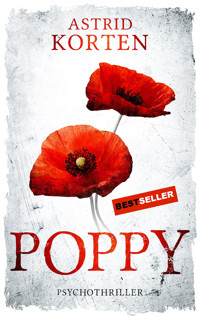4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
„Ich habe über Dinge nachgedacht, die mit dem Buchstaben M anfangen: Miststück, Meuterei, Missetat, Mord.“ (Hutmacher – Alice im Wunderland) Hauptkommissarin Mo Celta kehrt traumatisiert aus der Ukraine zurück und lässt sich für einige Monate vom Dienst beurlauben. Doch als eine junge Frau ermordet im Münchener Auwald aufgefunden wird, erinnert der Fall Mo an die Opfer des „Puppenspielers“. Und an Viktoria Wittensee, die Frau des Münchener Anwalts Alexander Wittensee, die seit drei Jahren verschwunden ist und dem Opfer ähnlich sieht. Gemeinsam mit Thomas Berger, ihrem Kollegen von der Vermisstenstelle 'Letzte Spur', ermittelt Mo auf eigene Faust und kommt einem ungeheuerlichen Verbrechen auf die Spur. Geprägt von den Horrorszenarien ist sie fest entschlossen, den Täter zu fassen - notfalls mit Gewalt. In Mo Celtas viertem Fall „Der Puppenspieler“, in dem die Indizien die Form von Scharaden annehmen, entwirft Astrid Korten ein Spiel aus Täuschungen, Irreführungen und Fallgruben, das so faszinierend ist wie ein teuflisches Kindermärchen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Über das Buch
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Teil II
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Teil III
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Teil IV
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil V
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Teil VI
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Teil VII
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Teil VIII
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Teil IX
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Teil X
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Teil XI
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Teil XII
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Epilog
Kapitel 79
Kapitel 80
Weitere Bücher der OVERKILL-Serie um die Ermittlerin Mo Celta
Impressum
Über das Buch
„Ich habe über Dinge nachgedacht, die mit dem Buchstaben M anfangen: Miststück, Meuterei, Missetat, Mord.“
(Hutmacher – Alice im Wunderland)
Hauptkommissarin Mo Celta kehrt traumatisiert aus der Ukraine zurück und lässt sich für einige Monate vom Dienst beurlauben. Doch als eine junge Frau ermordet im Auwald aufgefunden wird, erinnert der Fall Mo an die Opfer des „Puppenspielers“. Und an Viktoria Wittensee, die Frau des Münchener Anwalts Alexander Wittensee, die seit drei Jahren verschwunden ist und dem Opfer ähnlich sieht.
Gemeinsam mit Thomas Berger, ihrem Kollegen von der Vermisstenstelle „Letzte Spur“, ermittelt Mo auf eigene Faust und kommt einem ungeheuerlichen Verbrechen auf die Spur. Geprägt von den Horrorszenarien ist sie fest entschlossen, den Täter zu fassen - notfalls mit Gewalt.
In Mo Celtas viertem Fall „Der Puppenspieler“, in dem die Indizien die Form von Scharaden annehmen, entwirft Astrid Korten ein Spiel aus Täuschungen, Irreführungen und Fallgruben, das so faszinierend ist wie ein teuflisches Kindermärchen.
Teil I
„Es tut mir leid. Ich bin nicht mit Absicht die falsche Alice.“
(Alice im Wunderland)
Kapitel 1
Alexander Wittensee war in dieser Nacht spät ins Bett gegangen und hatte von Superhirnen aus Plastik, blauen Schmetterlingen und blonden Frauen im Wunderland, einem Hutmacher und Hasen geträumt, die in der Menge verschwanden, als das Handy im Schlafzimmer klingelte.
Reflexartig nahm er den Hörer ab, ohne sich den Namen auf dem Display anzusehen.
Eine kultivierte Frauenstimme ohne hörbaren Akzent drang an sein Ohr. „Spreche ich mit Rechtsanwalt Alexander Wittensee?“
Alexander antwortete mit einem Grunzen und richtete sich im Bett auf. Der Wecker zeigte zwei Uhr nachts. Er knipste die Nachttischlampe an und kniff die Augen zusammen, um sich an das Licht zu gewöhnen. Das Display seines Handys zeigte eine unbekannte Nummer.
„Am Apparat“, antwortete er und unterdrückte ein Gähnen. „Einen Moment, bitte, ich brauche etwas zum Schreiben.“
Für gewöhnlich weckte man ihn um diese Zeit nur, um ihm mitzuteilen, dass er sich auf der Polizeiwache einfinden solle, dass dort jemand einen Pflichtverteidiger brauche. Also griff er nach dem Notizbuch, das auf seinem Nachttisch lag, und trug Datum und Uhrzeit des Anrufs ein. Dabei fiel ihm auf, dass es Montag war und er keinen Bereitschaftsdienst hatte.
„Wer sind Sie?“, fragte er sofort.
„Mein Name ist Myriam Huber, ich bin Krankenschwester in der Notaufnahme des Klinikums Dritter Orden.“
Er spürte, wie sein Herz in seiner Brust wild zu schlagen begann.
„In der Notaufnahme?“, wiederholte er überrascht.
Gesichter tauchten vor seinem inneren Auge auf: Freunde, Verwandte, Frank Gruber, sein Geschäftspartner, seine Sekretärin Julie Pistoria, Schulfreunde, denen er letzte Woche bei einem Klassentreffen seine Visitenkarte gegeben hatte, sein Schwiegervater Benedikt Kleaver.
„Vor einer Stunde kam eine Frau in die Notaufnahme des Klinikums“, fuhr sie leise fort. „Sie weigerte sich, ihren Namen zu nennen oder sich auszuweisen, aber…“ Myriam zögerte einen Moment. Im Hintergrund durchbrachen das Klappern von Computertasten und das Rattern eines Hefters die Stille.
„Was ich Ihnen jetzt sage, Herr Wittensee, ist im Kontext zu verstehen. Es könnte sein, dass diese Frau Ihre Frau Viktoria ist.“
Adrenalin schoss durch seinen Körper. „Sie … Sie sind sich sicher?“, stammelte er.
„Ich habe ihr Foto in der U-Bahn gesehen, aber ich kann nicht garantieren, dass sie es ist, aber die Ähnlichkeit ist verblüffend.“
Kein Wunder, dachte er. Das Foto, das er für die Vermisstenanzeige gemacht hatte, war schon ein paar Jahre alt.
„Wie schwer sind ihre Verletzungen?“
„Sie ist nicht lebensgefährlich verletzt“, antwortete Myriam sofort. „Sie hat Schnittwunden an den Knien, Wunden an den Händen und ein großes Hämatom im Gesicht.“
„Wurde sie überfallen?“
Die Stimme der Krankenschwester wurde noch sanfter. „Dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Sie spricht nicht viel und…“ Myriam atmete tief durch. „Aber als wir ihr sagten, dass wir einen Polizisten von der Wache nebenan holen würden, damit sie Anzeige erstattet, riss sie sich die Infusion aus dem Arm und versuchte, das Krankenhaus zu verlassen. Wir konnten sie zur Vernunft bringen. Im Moment ruht sie sich in einem Zimmer aus. Ich bin aber nicht überzeugt, dass sie dort lange bleiben wird. Wenn Sie vorbeikommen wollen, um sie zu identifizieren…?“
„Dreißig Minuten. In einer halben Stunde bin ich im Krankenhaus. Lassen Sie sie nicht gehen, ich bitte Sie.“
Kaum hatte er aufgelegt, suchte er im Telefonbuch seines Handys nach der Nummer eines Taxifahrers, den er immer anrief, wenn er nachts unterwegs war. Es fiel ihm nicht schwer, den Fahrer zu überreden, ihn innerhalb von zehn Minuten gegen ein gutes Entgelt von zu Hause abzuholen. Dann eilte er ins Bad und spritzte sich kaltes Wasser ins Gesicht. Im Ankleidezimmer überlegte er lange, was er anziehen sollte, damit Viktoria ihn erkennen würde. Es war Mitte April und die Nacht war lau. Er entschied sich für einen dunklen Anzug und ein schlichtes weißes Hemd.
Als er sich im Spiegel des Kleiderschranks betrachtete, stellte er sich vor, wie Viktoria ihn nach all den Jahren finden würde. Vermutlich abgemagert, obwohl er immer schlank gewesen war. Vom Leben gezeichnet, das war offensichtlich. Vielleicht würde sie in seinen schwarzen Augen ein metallisches Funkeln entdecken, das sie von ihm nicht kannte. Sie würde über die große Narbe auf seiner linken Wange staunen. Ansonsten hatte er immer noch dieses jugendliche Aussehen und das widerspenstige Haar, das die dreiunddreißig Jahre, die sein Personalausweis bescheinigte, Lügen zu strafen schien.
Eine Dreiviertelstunde nach dem Anruf der Krankenschwester setzte ihn ein Taxi vor dem Klinikum Dritter Orden München-Nymphenburg ab. Große Scheinwerfer fluteten die Fassade mit Licht und hoben jedes Detail der Architektur hervor. Die Verdammten auf dem Portal des Jüngsten Gerichts, die Heiligen und die Könige Israels blickten ihn streng an, als er seine Schritte verlangsamte und auf das Klinikgebäude zuging, das im Schatten des großen gotischen Kirchenschiffs lag. An der Rezeption bat man ihn, sich in einem überfüllten Warteraum zu gedulden. Kein Platz war frei, aber das war ihm egal. Er wollte sich ohnehin nicht hinsetzen. Seit er aufgelegt hatte, fühlte er sich, als würde eine Feder seinen Magen zusammenziehen. Drei Jahre lang hatte niemand etwas von Viktoria gehört. Und niemand wusste, warum sie verschwunden war. In seinem Kopf spielten sich die verrücktesten Szenarien ab. Sie wurde entführt und drei Jahre lang gefangen gehalten. Erst jetzt hatte sie sich befreien können. Sie war verängstigt und verwirrt.
Er ging auf und ab. Mach, dass sie es ist, betete er still. Mach, dass sie es dieses Mal ist.
Endlich betrat eine kleine, mollige Krankenschwester den Warteraum. Sie trug eine weiße Schwesterntracht und apfelgrüne Gummischuhe. Das Namensschild auf ihrer großen Brust verriet Alexander, dass es Myriam war. Ihr müder Blick wanderte von einem Patienten zum nächsten und blieb schließlich an ihm hängen. Sie kam auf ihn zu.
„Herr Wittensee?“
Er nickte. Seine Kehle war wie zugeschnürt, kein Wort kam über seine Lippen.
„Ich bin Myriam. Kommen Sie bitte mit.“
Die Krankenschwester führte ihn aus dem Warteraum in einen Flur, in dem es nach Blut, Gips und Chlor roch. An den Wänden standen Rollbetten. Viele waren belegt.
„Wir haben zu wenig Platz. Wir sind zu 120 Prozent ausgelastet. Und es kommen immer mehr Patienten.“
„Können Sie die Ambulanzen nicht woanders hinschicken?“, fragte er mit angespannter Stimme.
„Nein. Laut Rettungsdienst ist es in ganz München dasselbe. Wahrscheinlich wegen des Vollmonds.“
Sie fuhren mit dem Aufzug in den zweiten Stock. Gedämpfte Schritte, das gleichmäßige Piepen unsichtbarer Maschinen – im Vergleich zum hektischen Treiben im Erdgeschoss war es hier seltsam ruhig. Myriam ging den Flur entlang und blieb vor einer angelehnten Tür stehen.
„Ich möchte allein hineingehen“, sagte Alexander, als sie das Zimmer betreten wollte.
„Das geht nicht“, sagte sie entschieden. „Ich bin für sie verantwortlich, ich kann nicht…“
Er zog vier Hunderter aus seiner Brieftasche und drückte sie ihr in die Hand.
„Bitte. Ich habe fast drei Jahre auf diesen Moment gewartet.“
Die Schwester betrachtete das Geld mit einem seltsamen Gesichtsausdruck. „Wissen Sie, Herr Wittensee, ich mache das nicht wegen des Geldes“, sagte sie und stemmte die Fäuste in ihre breiten Hüften. „Ich fahre jeden Morgen mit der U-Bahn und habe Ihre Plakate gesehen. Ich versuche nur zu helfen. Also lassen Sie das bitte.“ Sie gab ihm die Scheine zurück.
Verlegen steckte Alexander das Geld wieder ein.
„Wir machen Folgendes: Sie gehen allein rein und lassen die Tür offen. Ich werde im Flur warten. Ist das in Ordnung?“
„Das ist perfekt“, antwortete Alexander und versuchte zu lächeln. Sein Herz klopfte ihm heftig in der Brust, als er das kleine verblasste, beige getünchte Zimmer betrat. Die Deckenlampe war ausgeschaltet, eine einfache Nachttischlampe erhellte den Raum. Auf dem Bett saß eine blonde Frau. Sie wandte ihm den Rücken zu. Ihr halb geöffnetes Krankenhaushemd entblößte einen schmerzhaft mageren Körper. Unter der bleichen Haut konnte er hervortretende Knochen und Sehnen erkennen, die wie Ankerseile gespannt waren. Als sie seine Anwesenheit spürte, wandte sie den Kopf. Hinter dem blonden Vorhang ihres strähnigen Haares sah er hohe Wangenknochen mit großen, violettfarbenen Blutergüssen und eine übel zugerichtete Stirn. Dann blickte sie ihm in die hellblauen Augen. Alexander spürte, wie seine Schultern nach unten sanken. Diese Frau war nicht Viktoria.
„Wer sind Sie?“, fragte die Fremde.
„Ich … mein Name ist Alexander Wittensee.“
„Sind Sie Arzt?“
„Nein, überhaupt nicht.“
„Polizist?“
„Nein.“
„Hat Fred Sie geschickt?“
„Fred? Wer ist Fred? Nein, ich bin … ich bin …“ Er wusste nicht, was er sagen sollte.
„Wer sind Sie?“, wiederholte sie.
Sein Kopf dröhnte. Ihm wurde schwindelig. Er setzte sich neben sie auf die Bettkante.
Sie sah ihn erstaunt an. „Geht es Ihnen nicht gut?“, fragte sie.
„Doch, ich … ich hatte nur erwartet … ich hatte nur gehofft, hier jemand anderen zu treffen“, stammelte er.
Er hätte es dabei belassen und das Zimmer verlassen können. Stattdessen begann er ihr von Viktoria zu erzählen, wie sie vor drei Jahren verschwunden war, wie er all die Jahre verzweifelt nach ihr gesucht hatte, von den Internetseiten, auf denen er Nachrichten gepostet hatte, in der Hoffnung, dass sie sie lesen würde, und von den Suchanzeigen, die er in der Stadt aufgehängt hatte. Die Frau hörte ihm schweigend zu. Hinter ihren trüben Augen war kein Licht. Ihr Körper war da, aber ihr Geist schien woanders zu sein. Als Alexander seinen Monolog beendet hatte, verlor sie das Interesse an ihm und wandte sich wieder dem Fenster zu. Ihr Blick verlor sich in den „Botanischen Garten“ und den Umrissen von Schloss Nymphenburg, die sich zu den Sternen zu strecken schienen. Er spürte, dass es Zeit für ihn war, aufzubrechen.
Er stand auf und ging auf die halb offene Tür zu. Bevor er den Raum verließ, konnte er nicht umhin, sich noch einmal umzudrehen und die Fremde ein letztes Mal anzusehen. Sie hatte die Arme um die Knie geschlungen. Er vermied es, auf den großen Bluterguss an ihrem Oberschenkel zu starren. Mit einer leichten Bewegung wiegte sie sich hin und her, wie ein verlorenes Kind, das fern von zu Hause darauf hoffte, von seinen Eltern abgeholt zu werden. Er spürte, wie sich sein Herz zusammenzog.
„Ich habe vergessen, Sie nach Ihrem Namen zu fragen“, sagte er zu ihr.
Sie musterte ihn lange mit ihren verwaschenen blauen Augen. „Valerie. Ich heiße Valerie Römer“, gab sie fast widerwillig zu.
Alexander zog eine zerknitterte Visitenkarte aus den Tiefen seiner Sakkotasche und reichte sie ihr.
„Ich bin Rechtsanwalt, Valerie. Ich arbeite in der Kanzlei Wittensee und Gruber.“ Er deutete mit einer vagen Handbewegung auf einen imaginären Punkt im Westen des Raumes.
Sie betrachtete die Visitenkarte wie einen seltsamen und gefährlichen Gegenstand.
„Ich kann Ihnen helfen“, beharrte er.
„Ich werde keine Anzeige erstatten“, sagte sie. „Ich bin die Treppe hinuntergefallen.“
Sie gab ihm ihre Visitenkarte zurück.
„Nein. Bitte behalten Sie sie. Für den Fall, dass Sie es sich anders überlegen.“
„Sie meinen: Für den Fall, dass ich meine Treppe verklagen will?“ Ihr Lächeln war freudlos.
„Sie wissen genau, was ich meine … aber ja, so etwas in der Art.“
Sie wandte sich von ihm ab und betrachtete den Mond über dem Botanischen Garten Nymphenburg, der gegenüber der Klinik Dritter Orden lag.
„Auf Wiedersehen, Herr Rechtsanwalt“, sagte sie.
Es klang endgültig.
Sie wussten nicht, wie sehr sie sich beide täuschten.
Kapitel 2
Dreißig Minuten.
So viel Zeit gab Alexander Wittensee den Angeklagten im Raum P12, bevor er sie zurück ins ‚Depot‘, das Gefängnis unter dem Gerichtsgebäude, schickte. Die Beschuldigten standen noch am selben Nachmittag vor Gericht – er hatte nur wenige Stunden Zeit, ihre Verteidigung aufzubauen. Um sicherzustellen, dass er seine Zeit gleichmäßig auf seine sieben Mandanten an diesem Vormittag verteilte, startete er die Stoppuhr, sobald einer von ihnen sein Büro betrat, und versuchte, die knappen dreißig Minuten einzuhalten.
Büro war ein gewagter Begriff für die drei Quadratmeter großen Boxen, in denen sich Angeklagte und Pflichtverteidiger trafen. Die schmalen Wände bestanden aus undurchsichtigem, milchigem Glas, so dass die Bezeichnung ‚Einweckglas‘ treffender gewesen wäre. Auch bei der Möblierung des Raumes hatte sich die Verwaltung zurückhaltend gezeigt: Es gab nur zwei abgewetzte Stühle, einen knarrenden Tisch und ein altes Schnurtelefon, das den Anwälten, die vergessen hatten, die Akkus ihrer Handys aufzuladen, freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde. Ansonsten war es Sache der Verteidigung, sich zu organisieren.
Neben Gesetzbüchern, Notizblöcken und Stiften war das Nützlichste für Alexander an diesem Morgen die große Thermoskanne mit Kaffee, die er sich vor der Arbeit zubereitet hatte. Nach seinem nächtlichen Ausflug in die Klinik war er nicht wieder eingeschlafen, und mit weniger als vier Stunden Schlaf konnte er nur mit einer Koffeininfusion richtig funktionieren.
Die ersten fünf Termine an diesem Morgen absolvierte er mit heißem Kaffee. Er hielt sich an die vorgeschriebenen dreißig Minuten, und alles lief gut, bis Verdächtiger Nummer sechs sein Einweckglas betrat. Es war ein junger Mann, wie er ihn in der Voruntersuchung oft zu Gesicht bekam: ein puppenhaftes Gesicht, ein großer, noch nicht ganz ausgereifter Körper und ein abwesender Blick. Seine Kleidung – ein helles Sweatshirt im Kontrast zu seiner dunklen Haut, Jogginghose und Turnschuhe, die Uniform der Siedlung Harthof – war zerknittert, seine Haut glänzte. Er hatte gerade zwei Tage in Polizeigewahrsam verbracht, ohne die Gelegenheit, sich zu waschen oder umzuziehen. Dror Monaro war gerade achtzehn Jahre alt und lebte mit seinen Eltern in einer Wohnung im Münchner Problemviertel Harthof. Sein Strafregisterauszug enthielt dreizehn Verhaftungen, die meisten davon im Zusammenhang mit Drogenhandel. Aus dem Haftbefehl ging hervor, dass Monaro zwei Tage zuvor von Polizisten in der Landwehrstraße festgenommen worden war. Sie hatten ihn beim Dealen mit Gras in der Nähe der Realschule Sabel erwischt. Die bei der Festnahme beschlagnahmten Drogenmengen waren gering, aber bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung fanden die Polizisten zwei Kilogramm Cannabisharz, das Monaro gehörte.
Als Alexander den Jungen fragte, warum er nach fast einem Jahr Abstinenz wieder in den Drogenhandel eingestiegen sei, zuckte Dror Monaro mit den Schultern und fragte: „Haben Sie schon einmal aus Liebe verrückte Dinge getan?“
Überrascht von der Antwort des jungen Mannes, dachte Alexander an seinen nächtlichen Besuch im Krankenhaus und an all die Nächte, in denen er im Schritttempo durch die dunklen Straßen Münchens gefahren war und sich in besetzten Häusern, Frauenhäusern, Drogenzentren und Bordellen herumgetrieben.
„Das ist mir auch passiert“, antwortete er und lächelte traurig.
Seit Viktoria verschwunden war, hatte er es sich zur Aufgabe gemacht, jeder Spur nachzugehen, die sich ihm bot. Die meisten Hinweise bekam er von Leuten, die seine Vermisstenplakate in der Stadt gesehen hatten. Oder von Internetnutzern, die die Websites besuchten, auf denen er Zeugenaufrufe gepostet hatte. Jeden Monat erhielt er drei bis vier interessante Meldungen, die er an Max Dronte weiterleitete, einen Detektiv, den seine Kanzlei gelegentlich für besonders heikle Fälle engagierte.
Der Teenager strich mit der Daumenspitze eine Falte in seiner Jogginghose glatt. „Ich bin nur wegen meines Kindes wieder in die Szene eingestiegen“, murmelte er mit müder Stimme. „Meine Freundin ist schwanger.“
Alexander verkniff sich einen Kommentar. In den Vorgesprächen gab es viele absurde Begründungen für eine Straftat, und Dror Monaro war nicht der erste jugendliche Straftäter mit Familie, den er traf. Und auch nicht der jüngste. Vor ein paar Jahren, zu Beginn seiner Karriere als Anwalt, hätte er Dror gesagt, dass es keine gute Idee sei, in seiner Situation ein Kind zu bekommen. Heute begnügte er sich mit der Frage: „Wann ist die Geburt?“
„In einem Monat“, antwortete Dror.
Alexander notierte sich die Information auf seinem Notizblock. Vielleicht würde das den Richter dazu bringen, milder zu urteilen, aber das bezweifelte er. Monaro hatte zu viele Probleme, und er war gerade achtzehn Jahre alt geworden. Diesmal gab es keine Chance, dass er eine Gefängnisstrafe vermeiden konnte. Und es kam noch schlimmer.
„Wir haben ein großes Problem, Dror“, sagte er in professionellem Ton. „In der Landwehrstraße, wo Sie festgenommen wurden, gibt es im Umkreis von einem Kilometer mehrere Schulen. Wenn die Staatsanwaltschaft Ihnen nachweisen kann, dass Sie Drogen an Schüler dieser Schulen verkauft haben, verdoppelt sich Ihre Strafe von fünf auf zehn Jahre.“
Sein Mandant erstarrte. „Zehn Jahre? Ich … ich soll zehn Jahre ins Gefängnis?“
„Das habe ich nicht gesagt“, wandte Alexander ein. „Zehn Jahre sind das Maximum, das der Staatsanwalt fordern kann. Es kann sein, dass er eine mildere Strafe fordert, aber Sie sollten sich auf eine lange Zeit im Gefängnis einstellen.“
Monaro wischte sich mit dem Ärmelaufschlag über die feuchte Stirn. Sein Blick war starr und seine vollen Lippen zitterten. Satzfetzen fielen in stockendem Rhythmus: „Nein, nein, nein … ich kann mich da nicht einbetonieren lassen … nicht jetzt … das geht nicht … nicht jetzt …“
Monaro rutschte auf seinem Stuhl hin und her.
Alexander versuchte ihn zu beruhigen: „Dror, ich weiß, es ist hart, aber Sie wussten, dass Sie diesmal eine fette Gefängnisstrafe kassieren würden. Ich werde mein Bestes tun, damit Sie eine gerechte Strafe bekommen, aber ich kann keine Wunder vollbringen und…“
Monaros Gesicht hellte sich plötzlich auf.
„Aber Sie, Herr Wittensee, Sie haben es geschafft. Sie haben nicht gesessen.“
Alexander runzelte die Stirn. „Wie bitte?“ Er verstand nicht, was der junge Mann meinte.
„Der Staatsanwalt hat gesagt, dass Sie Ihre Frau umgebracht haben, aber deswegen nicht gesessen haben. Sie wissen doch, wie das läuft. Sie sind gut, nicht wahr? Sie werden etwas für mich finden, ich habe nur mit Gras gedealt, das ist alles! Ich verdiene keine zehn Jahre!“
Die Überraschung ließ Alexander für einige Sekunden verstummen. Dann begann das Blut in seinen Schläfen zu pulsieren. Wut kochte in ihm hoch, aber er wies den Jungen nicht in seine Schranken. Er dachte einen Moment nach.
Nach seiner Verhaftung war Dror Monaro dem Staatsanwalt oder einem seiner Stellvertreter vorgeführt worden, um ihn über das weitere Verfahren zu informieren.
„Mit wem haben Sie vor unserem Gespräch gesprochen?“, fragte Alexander.
„Das weiß ich nicht mehr. Irgendwas mit Er …“
„Erik Dumont?“, fragte Alexander.
„Ja, ja, genau, so hieß er.“
Er hätte es wissen müssen. Erik Dumont war vor drei Jahren mit der Untersuchung von Viktorias Verschwinden betraut worden. Der Staatsanwalt hatte ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes eingeleitet und ihn – im Gegensatz zum Untersuchungsrichter – stets als Hauptverdächtigen betrachtet. Dumont scheute sich nicht, dies im Gerichtssaal jedem zu sagen, der es hören wollte, aber es war das erste Mal, dass er sein Gift vor einem seiner Mandanten verspritzte.
„Was für ein Mistkerl“, zischte Alexander und schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte. Das Klatschen hallte durch den kleinen Raum. Monaro zuckte erschrocken auf seinem Stuhl zusammen und stammelte eine Entschuldigung.
„Es tut mir leid … ich hätte das nicht sagen sollen … ich hätte nicht über Ihre Frau sprechen sollen …“
„In der Tat“, erwiderte Wittensee trocken.
„Ich glaube nicht wirklich, dass Sie … nun, ich bin sicher, dass Sie es nicht getan haben …“
„Nein, habe ich nicht“, entgegnete Alexander verärgert. „Und auch wenn ich es getan hätte, hätte das keinen Einfluss auf Ihren Fall.“
Er tobte innerlich vor Wut. Alle Wärme war aus seiner Stimme gewichen. Er brannte darauf, aus diesem Einweckglas zu springen und Dumont zu sagen, was er von seinen dubiosen Praktiken hielt. Sein Blick fiel auf den Chronometer. Vierundvierzig Minuten. Perfekt! In zwei Minuten würde er im Büro des Staatsanwalts sein, am anderen Ende der Abteilung P12.
„Wir belassen es dabei“, sagte er und klappte das Strafgesetzbuch zu. „Wir sehen uns bei der Verhandlung.“
Bevor er dem Wärter, der die Angeklagten in ihre Zellen begleiten sollte, ein Zeichen geben konnte, streckte Dror Monaro die Hand aus und griff nach seinem Handgelenk.
„Was soll das? Lassen Sie mich sofort los!“, fuhr er den jungen Mann an.
„Sie verstehen nicht … Sie müssen mir helfen“, flehte Monaro. „Ich habe meinen Vater nicht gekannt. Ich möchte nicht, dass es meinem Sohn so ergeht, nicht vom ersten Tag seines Lebens an.“
Alexander verstand ihn sehr gut. Auch er hatte weder Vater noch Mutter gekannt. Seine ersten Lebensjahre hatte er in Waisenhäusern und Pflegefamilien verbracht. Alles, was er über seine Herkunft wusste, war, dass er an einem trüben Frühlingstag, dem sechsten März, in einem Münchener Krankenhaus geboren worden war und dass man ihm den Namen Alexander Dumas gegeben hatte, nach dem berühmten Autor der Drei Musketiere und des Grafen von Monte Christo. Ein prädestinierter Name, wenn man bedachte, dass der Großteil seiner beruflichen Tätigkeit darin bestand, dem Recht Geltung zu verschaffen, indem er zwielichtige Klienten verteidigte. Aber er schätzte die Gerechtigkeit, die Wahrheit. Vielleicht hatte er sich deshalb entschieden, den Vornamen zu behalten und den Nachnamen seiner leiblichen Mutter anzunehmen: Wittensee. Dennoch dachte er oft schmunzelnd an den Schriftsteller Alexandre Dumas. Wenigstens in seinem Privatleben sollte die Wahrheit siegen.
Als Dror Monaro spürte, dass er seine Aufmerksamkeit hatte, lockerte er seinen Griff und setzte zu einem langen Monolog an.
„Ich habe in meinem Leben einige hässliche Dinge getan, sogar schlimmere, als in meiner Akte stehen. Ich bin nicht stolz darauf, aber … aber ich habe mich geändert. Seit Emily schwanger ist, habe ich mit allem aufgehört. Ich habe eine Maurerlehre begonnen. Um meinen Lebensunterhalt zu verdienen, ohne den üblichen Ärger. Ich habe Mist gebaut, das ist klar. Auch wenn es nur Cannabis ist! Manche Leute nehmen es, um sich zu heilen … aber gut … ich hätte mich nicht wieder in die Scheiße reiten sollen. Aber in der Lehre verdient man nicht viel, ich wollte mich absichern. Für meinen Sohn, damit es ihm an nichts fehlt. Dafür hat man keine zehn Jahre Knast verdient!“
Ein streng dreinblickender Mann klopfte an die Glastür des Büros. Alexander erkannte Sober, den Vertrauensanwalt, der die Gespräche zwischen den Pflichtverteidigern und ihren Mandanten koordinierte. Sober tippte mit dem Zeigefinger auf seine Uhr, ein Zeichen, dass er das Gespräch mit Monaro so schnell wie möglich beenden musste. Draußen war die Justizmaschinerie ins Stocken geraten. Zu viele Menschen saßen in den Käfigen, den vergitterten Zellen, in denen die Angeklagten auf ihre Anwälte warteten.
„Wir haben nicht mehr viel Zeit“, sagte Alexander, „deshalb werde ich mich so kurz wie möglich fassen. Ich kann Ihnen das Gefängnis nicht ersparen. Das Beste, was ich tun kann, ist, für eine Strafe zu plädieren, die dem Gericht angemessen erscheint, und Ihnen zwei oder drei Jahre weniger zu geben, als der Staatsanwalt fordert. Und glauben Sie mir, mit dem Rückfall und der großen Menge an Drogen, die bei Ihnen sichergestellt wurden, ist das alles andere als ein Erfolg.“
„Und wenn ich darum bitte, später vor Gericht gestellt zu werden? Dann könnte ich bei der Geburt dabei sein…“, flüsterte Monaro.
Alexander überlegte kurz. „Man kann eine Vertagung beantragen, aber der Staatsanwalt wird Untersuchungshaft beantragen. Und die wird er wegen der Schwere der Vorwürfe auch bekommen.“
Monaro sank mit leerem Blick in seinen Stuhl zurück. Wenige Augenblicke später wurde er von einem Sicherheitsbeamten unsanft aus dem Büro gezerrt.
Allein in dem gläsernen Büro zögerte Alexander einen langen Moment vor dem Chronometer, der unaufhörlich die Sekunden schluckte. Er wusste, dass er sie auf null stellen und einen neuen Angeklagten aufrufen musste. Aber er brachte es nicht über sich. Die Akte, die die Polizei gegen Dror Monaro angelegt hatte, war wasserdicht, aber irgendetwas störte ihn an dem Strafbefehl. Er griff zum Hörer des alten Festnetztelefons und rief seine Sekretärin Julie an.
„Kanzlei Wittensee und Gruber“, meldete sich ihre warme, melodische Stimme.
Ein fruchtiger Duft stieg ihm in die Nase. Julie trug seit ein paar Wochen ein neues Parfum. Ein Eau de Parfum, das nach Mandarine, Bergamotte und Neroli duftete. Wenn sie durch die Kanzlei ging, um die Akten zu ordnen, war es, als würde eine Frühlingsbrise durch einen sonnigen Obstgarten wehen.
„Ich bin es, Julie. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Fahren Sie bitte zur Realschule Sabel.“
„Um was zu tun?“, fragte sie überrascht.
„Um einen meiner Klienten vor dem Gefängnis zu bewahren, wenn das Glück auf unserer Seite ist.“
Kapitel 3
Drei Mandanten, ein Schinken-Butterbrot, zwei Tassen Kaffee und ein Fax von Julie später stieß Alexander die Tür zur III. Strafkammer auf. Im großen Sitzungssaal mit der vergilbten Holzvertäfelung richteten sich alle Augen auf den Angeklagten, einen Algerier, der in Milbertshofen geschmuggelte Zigaretten verkauft hatte.
Alexander nutzte das Plädoyer seines Kollegen, um die üblichen Aufgaben zu Beginn des Prozesses zu erledigen. Dann ging er ohne Eile in das Büro des Staatsanwalts, um ihm eine Kopie der Unterlagen zu übergeben, die er für die Verteidigung seines Mandanten verwenden würde.
„Sie sehen müde aus, Wittensee“, begrüßte ihn Dumont mit gekünstelter Stimme. „Was machen Sie nachts?“
Alexander hielt sich zurück. „Was ich außerhalb dieses Gerichts tue, geht Sie wirklich nichts an, Herr Staatsanwalt.“
Dumont schürzte die schmalen Lippen. „Zweifellos, Wittensee. Zumindest, wenn sich Ihr Handeln im Rahmen des Gesetzes bewegt.“
Alexander legte seine Akten auf den Tisch und nannte die Namen der Angeklagten, die er verteidigte, dann drehte er sich um und verließ mit schnellen Schritten das Büro, um sich wieder in der III. Strafkammer einzufinden. Mit jeder Sekunde, die er Erik Dumont gegenüberstand, wuchs in ihm der Wunsch, den Mann zu erwürgen.
Einer der Anwaltskollegen, die ein paar Reihen vor dem Zeugenstand Platz genommen hatten, winkte ihn heran. Es war Frank Gruber, die andere Hälfte der Kanzlei Wittensee und Gruber: südländischer Teint, dichtes schwarzes Haar, mit Gel nach hinten gekämmt. In der linken Hand hielt er ein Telefon, ein weiteres lag auf seinem Schoß. Alexander setzte sich zu ihm.
Gruber beugte sich vor. „Ich habe gerade eine SMS von den Kollegen der Juristenakademie bekommen. Sie veranstalten morgen Abend einen Umtrunk, hast du Lust?“, flüsterte er ihm mit seiner rauen, von einem korsischen Akzent durchzogenen Stimme ins Ohr.
„Ohne mich“, antwortete Alexander. „Ich hatte eine beschissene Nacht und heute wird es wieder eine Pyjama-Sitzung. Wenn ich morgen aus dem Büro komme, will ich nur noch schlafen.“
Aufgrund des Personalmangels und der Vielzahl der Verfahren war es nicht ungewöhnlich, dass die Strafverhandlungen erst nach 22 Uhr endeten, weshalb sie auch Pyjama-Sitzung genannt wurden.
„Soll ich ihnen einen anderen Tag vorschlagen?“
Alexander lächelte. Er ließ sich nicht auf das Spiel seines Freundes ein. Frank Gruber gab sich in letzter Zeit große Mühe, seine Abende zu füllen. Es war Mitte April. Viktoria war vor drei Jahren um diese Zeit verschwunden.
„Nein, ich muss mich ausruhen. Aber geh ruhig.“
„Wie du willst“, erwiderte Frank Gruber und wandte sich wieder seinem Telefon zu.
Alexander bemerkte, wie sich Franks bernsteinfarbene Augen nach jeder Nachricht vom Display hoben und in Richtung der Gerichtsschreiberin blickten, einer hübschen Brünetten, die noch keine dreißig war. Irgendwann kicherte sie, als sie auf ihr Handy schaute.
Frank flirtet mit ihr, dachte er. Sie war genau sein Typ, üppig, mit langen braunen Haaren und großen, klaren Augen. Bei aller Sympathie für Frank hoffte Alexander insgeheim, dass sie ihn zum Teufel jagen würde. Er hatte schon hinreichend Ärger mit Erik Dumont. Da brauchte er nicht auch noch eine Gerichtssekretärin, die wegen der Untreue seines Geschäftspartners hysterisch wurde. Frank hatte noch nie dem Charme eines hübschen Mädchens widerstehen können, vielleicht war er deshalb mit seinen vierunddreißig Jahren schon zum zweiten Mal geschieden. In absehbarer Zeit würde er sich wieder nach etwas anderem umsehen. Nicht umsonst besaß er mehrere Handys, um zwischen zwei Eroberungen nicht den Überblick zu verlieren.
Als er sich zum x-ten Mal dem Objekt seiner Begierde zuwandte, kniff Gruber die Augen zusammen und starrte einen Mann im Publikum an.
„Ist das nicht Roman Arenberg?“
Alexander reckte den Hals und blickte in die Richtung, in die sein Freund zeigte. Unter den Rentnern, die zum Prozess gekommen waren, erkannte Alexander das längliche Gesicht von Roman Arenberg, Viktorias letztem Arbeitgeber.
„Was, glaubst du, macht seine Eminenz hier?“
Gute Frage, dachte Alexander. Roman Arenberg leitete eine renommierte und erfolgreiche Anwaltskanzlei im Herzen Münchens und eine Dependance in New York. Für die Dienste seiner Wirtschaftsanwälte verlangte er über neunhundert Euro pro Stunde plus Mehrwertsteuer. In der III. Strafkammer, mit ihren Drogenabhängigen, illegalen Einwanderern und rückfälligen Dealern hatte der Staranwalt nichts zu suchen.
„Vielleicht kennt er ja zufällig einen Angeklagten“, mutmaßte Alexander.
Frank Gruber servierte Alexander seinen üblichen Sarkasmus. „Das ist es! Er ist hier, um den Penner zu sehen, der wegen Ladendiebstahls verhaftet wurde, aber in Wahrheit Geld für das kolumbianische Drogenkartell wäscht.“
Grubers Handy vibrierte, er konzentrierte sich wieder auf seinen Flirt mit der Gerichtsschreiberin. Ein paar Minuten später wurde Monaro angerufen. Alexander erhob sich und ging zum Richterpult.
Er hatte schon dutzende Male auf Nichtigkeit plädiert, aber diesmal wollte er sie um jeden Preis durchsetzen. Sein Mandant sollte das Gericht als freier Mann verlassen. Er musste Dumont eine ähnliche Demütigung zufügen, wie er sie am Morgen erlitten hatte.
In dem für die Untersuchungshäftlinge reservierten Glaskäfig hörte Monaro schweigend zu, als der Vorsitzende seine Personalien nannte und an die Tatsachen erinnerte, die ihn vor Gericht gebracht hatten. Als der Richter ihn schließlich fragte, ob er damit einverstanden sei, sofort vor Gericht gestellt zu werden, antwortete er mit einem schüchternen „Ja.“
In diesem Moment warf Alexander mit tiefer Stimme ein: „Herr Vorsitzender, ich möchte eine Nichtigkeit geltend machen.“
Staatsanwalt Dumont runzelte die Stirn, griff nach den Schriftsätzen auf seinem Schreibtisch und blätterte sie hastig durch.
„Mein Mandant wurde angeblich auf frischer Tat von Polizeibeamten festgenommen, die angaben, aus ihrem Streifenwagen heraus gesehen zu haben, wie Monaro – ich zitiere: in der Schwanthaler Straße neben der Sabel-Realschule Drogen gegen Geld tauschte, worauf sie einschritten. Im Protokoll steht, dass ihr Streifenwagen in der Landwehrstraße geparkt war.“
Alexander sah Dumont an. Der Staatsanwalt überprüfte den Stadtplan und die Fotokopie der Fotos, die Julie gemacht hatte.
„Aus den Unterlagen, die ich Ihnen zur Verfügung gestellt habe, geht hervor, dass diese Straße einen Block von dem Ort entfernt ist, den der Strafzettel vermuten lässt. Das Sabel-Gymnasium liegt in der Schwanthalerstraße. Wenn man dann noch bedenkt, dass es zum Zeitpunkt der Festnahme dunkel war, die Gegend schlecht beleuchtet war und zwischen den beiden Straßen zudem noch ein Häuserblock liegt, ist es für mich offensichtlich, dass sie nicht sehen konnten, wie die Drogen den Besitzer wechselten.“
Dumont wurde blass. Ihm war gerade klar geworden, dass die Polizisten ihren Bericht gefälscht hatten, um zu rechtfertigen, dass sie den Angeklagten ohne rechtmäßigen Grund kontrolliert hatten.
„Unter diesen Umständen“, fuhr er fort, „beantrage ich, die Festnahme und Beschlagnahme für nichtig zu erklären, da die Voraussetzungen für eine Festnahme auf frischer Tat nicht erfüllt waren.“
Wenn das Gericht diesen Formfehler akzeptierte, würde der ganze Fall zusammenbrechen, da die Hausdurchsuchung, bei der die Drogen bei den Eltern seines Mandanten gefunden worden waren, illegal durchgeführt worden war.
Dumont stand wütend auf. „Herr Vorsitzender, lassen Sie uns Maß halten! Was der Anwalt gerade gesagt hat, ist nichts weiter als ein banaler Schreibfehler. Nichts, was ernsthaft eine Annullierung rechtfertigen würde. Vielleicht haben die Polizisten den Straßennamen verwechselt, na und? Wir dürfen das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren; es gab konkrete Anhaltspunkte, die es den Ordnungshütern ermöglichten, davon auszugehen, dass der Angeklagte mit Drogen handelt und…“
„Welche konkreten Anhaltspunkte?“, unterbrach ihn Alexander. „Die Tatsache, dass mein Mandant schwarz ist und sich an einer schlecht beleuchteten Straßenecke mit einem Araber unterhalten hat?“
Arenberg funkelte ihn an, während der Vorsitzende Richter mit den Beisitzern tuschelte. Die Behauptung einer rechtswidrigen Hausdurchsuchung hatte immer eine gewisse Wirkung.
Der Vorsitzende knurrte: „Ruhe im Saal! Und Sie, Herr Wittensee, unterlassen Sie unverschämte Äußerungen und halten Sie sich an die Fakten.“
„Die Fakten? Die Tatsachen sprechen für sich, Herr Vorsitzender. Tatsache ist, dass es keine eklatanten Verstöße gegeben hat. Das Gesetz ist eindeutig; die Ordnungskräfte können nicht jeden, der auf einer öffentlichen Straße herumläuft, ohne triftigen Grund festnehmen. Die Polizisten haben ihre Befugnisse überschritten, indem sie meinen Mandanten ohne objektiven Grund angehalten und durchsucht haben. Die Festnahme war daher ebenso rechtswidrig wie die anschließende Durchsuchung der elterlichen Wohnung des Beschuldigten. Ich beantrage daher den sofortigen Freispruch meines Mandanten.“
Es wurde wieder still. Monaro hielt den Atem an. Der Staatsanwalt lehnte sich in seinem Stuhl zurück. Alexander bemühte sich, überzeugend und ruhig zu wirken. Die Richter flüsterten. Endlich, nach endlosen Sekunden, ergriff der Vorsitzende wieder das Wort.
Kapitel 4
Während die Verhandlung unterbrochen wurde, unterhielt sich Roman Arenberg mit dem Vertrauensanwalt Sober in der Halle vor den Gerichtssälen, direkt unter einem der großen Glasdächer. Viktorias ehemaliger Vorgesetzter trug einen eleganten grauen Anzug mit feinen weißen Streifen und perfekt gewachste und polierte Schuhe. Von hinten sah man, dass sein gefärbtes Haar kunstvoll frisiert war, um eine Glatze zu kaschieren. Alexander vermutete, dass früher oder später eine Haartransplantation fällig war.
Arenberg war Mitte fünfzig, sah aber dank einer Schönheitsoperation fast zehn Jahre jünger aus. Wenn man nah genug an ihn herantrat, konnte man hinter seinen Ohren die feinen Narben seines letzten Facelifts erkennen.
Als sich die Tür der III. Strafkammer knarrend schloss, drehte sich Arenberg um, erblickte ihn und verabschiedete sich sofort von Sober. Mit lässigen Schritten kam er auf ihn zu.
„Alexander Wittensee!“, rief Arenberg lächelnd. „Das schwarze Schaf unter den Staatsanwälten.“
Viktorias ehemaliger Chef streckte ihm eine sorgfältig manikürte Hand entgegen. In seinem Griff lag Kraft und pure Energie. Arenberg war ein schlanker, durchtrainierter Mann, der mehrere anspruchsvolle Sportarten betrieb. Jeden Tag lief er zehn Kilometer, bevor er die Kanzlei betrat, in der er bis zu zwölf Stunden arbeitete. Er spielte Polo und ritt, wann immer er konnte – Pferde waren seine große Leidenschaft; er besaß ein Gestüt am Starnberger See und Stallungen in seiner schlossähnlichen Villa am Stadtrand von München. Wenn der Tag noch genügend Stunden hatte, trainierte er sogar zweimal in der Woche mit Säbel oder Florett. Jetzt, da er zwei durch den Atlantik getrennte Kanzleien leitete, hatte er kaum noch Zeit, das Eisen zu schwingen.
„Ich war im Gerichtssaal, als Sie die Nichtigkeit erwirkt haben. Das war ein guter Schachzug. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit Sie hatten, Ihre Verteidigung vorzubereiten.“
Alexander dachte an das missmutige Gesicht des Staatsanwalts, als die Richter den Fehler in der Klageschrift festgestellt hatten, und es erfüllte ihn immer noch mit Genugtuung. Der Fall war wie ein Kartenhaus zusammengebrochen, und Erik Dumont hatte nichts dagegen tun können. Am Ende konnte sein Mandant den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.
„Der Staatsanwalt muss Sie hassen“, kommentierte Viktorias Ex-Chef schmunzelnd.
„Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr, Herr Kollege.“
Roman Arenbergs Gesicht verzog sich zu einem breiten Grinsen. „Nennen Sie mich doch beim Vornamen! Roman sollte genügen, finden Sie nicht?“
Er war Roman Arenberg zwei- oder dreimal auf gesellschaftlichen Cocktailpartys oder Wohltätigkeitsveranstaltungen begegnet, aber nie hatte er sich erdreistet, ihn beim Vornamen zu nennen. Den Anwaltskollegen umgab die Aura eines Honoratioren, die ihn veranlasste, ihn stets mit Kollege anzusprechen.
Alexander nickte. „Und was machen Sie hier, Roman? Weit weg von der Herzog-Wilhelm-Straße?“
Dort befand sich die Kammer für Wirtschafts- und Finanzstrafsachen des Landgerichts München. Arenbergs Kanzlei war auf Steuerrecht spezialisiert.
„Ich liebe den Justizpalast, diesen wunderschönen neobarocken Bau. Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sage, dass ich einfach nur wehmütig an meine jungen Jahre zurückdenke, als ich in diesem Saal Witwen und Waisen verteidigt und vertreten habe?“
Alexander rang sich ein Lächeln ab. „Nicht im Geringsten.“
Arenberg stammte aus einer der reichsten Anwaltsfamilien Münchens und hatte nicht viel Zeit damit verbracht, vor Strafgerichten zu plädieren. Er hatte sich schnell dem Steuerrecht zugewandt, das weitaus lukrativer war. Nach einigen Stationen im Strafrecht trat er als Partner in die Kanzlei seines Vaters ein.
Arenbergs Augen funkelten verschmitzt. „Ich muss gestehen, dass ich aus beruflichen Gründen hier bin. Hätten Sie ein paar Minuten Zeit für mich, bevor wir weitermachen?“
„Selbstverständlich“, antwortete Alexander überrascht.
„Dann sollten wir zu Fuß gehen, wenn Sie nichts dagegen haben. Mein Fahrer wartet draußen. Ich fliege in ein paar Stunden nach New York.“
Sie gingen den langen Flur entlang in Richtung Prielmayerstraße.
„Wissen Sie, mit welchen Klienten ich es zu tun habe, Alexander?“
„Steueroptimierung“, antwortete er und dachte: was sonst!
Bei der Steueroptimierung ging es darum, legale Strategien zu entwickeln, damit ein Unternehmen oder eine Privatperson so wenig Steuern wie möglich zahlen musste. Damit hatte sich auch Viktoria beschäftigt, als sie für Arenberg arbeitete.
„Das ist unser Kerngeschäft, aber wir haben auch noch andere Spezialgebiete“, antwortete Arenberg. „Wir beschäftigen uns mit Rechtsstreitigkeiten zwischen Unternehmen, Green Business, Lobbying, geistigem Eigentum … wir haben sogar Anwälte, die sich auf Wirtschaftsstrafrecht spezialisiert haben.“
Alexander verstand, worauf Arenberg hinauswollte, als sie das Atrium unter der sechsundsechzig Meter hohen Kuppel mit dem aufwendigen Treppenaufgang passierten.
„Ich will nicht um den heißen Brei herumreden, Alexander. Einer meiner Mitarbeiter, der für die Strafrechtsabteilung zuständig ist, wird uns bald verlassen und in den Ruhestand gehen. Ich habe ihn gebeten, mir eine Liste von Anwälten zu geben, die er für geeignet hält, ihn zu ersetzen. Ihr Name stand ganz oben auf der Liste.“
Sie trafen auf zwei Anwälte mit grauen Schläfen und faltigen Stirnen. Arenberg blieb einen Moment stehen, um sie zu begrüßen. Arenberg kannte die meisten Juristen im Justizpalast. Er war zwei Jahre lang Präsident der Anwaltskammer gewesen.
„Ich habe die meisten Anwälte auf dieser Liste kennengelernt“, fuhr Arenberg fort. „Ich habe ihnen beim Plädieren zugesehen und zugehört. Sie waren alle gut, aber ich muss zugeben, dass Sie mich am meisten beeindruckt haben. Viktoria sagte immer, Sie seien ein ausgezeichneter Jurist. Sie hatte Recht, Sie sind begabt.“
Alexander runzelte die Stirn. Arenberg bemerkte seine Verwirrung. „Es tut mir leid. Ich hätte wissen müssen, dass die Wunde noch schmerzt. Ich habe Ihre Frau in besonderem Maße geschätzt, Alexander. Bevor sie verschwand, hatte ich ihr die Partnerschaft angeboten. Sie war eine brillante Juristin.“
Roman Arenberg musste sein Unbehagen gespürt haben, denn er wechselte das Thema.
„Meine Kanzlei expandiert im Strafrecht. Ich brauche einen erfahrenen Anwalt, der diesen Zweig leitet. Jemanden, der stark genug ist, um am Ende mein achtzehnter Partner zu werden.“
Für einen Moment dachte Alexander an die Höhe der Rückvergütungen, die eine große Kanzlei wie Arenberg ihren Partnern gewährte, an die Boni, an den Firmenwagen, den Viktoria hatte, als sie dort arbeitete, dann dachte er wieder an sie, an den Privatparkplatz, auf dem sie parkte, und ihm wurde klar, dass er jeden Tag daran vorbeifahren würde, wenn er bei Arenberg unterschrieb. Und dann war da noch Frank Gruber. Sie waren seit sieben Jahren Geschäftspartner und seit dem ersten Studienjahr befreundet. Ihn im Stich zu lassen, konnte er sich nicht vorstellen.
„Ich weiß nicht, ob ich der Richtige für Sie bin“, antwortete Alexander diplomatisch.
Sie verließen den Justizpalast in Höhe des Kunstpavillons und erreichten die Elisenstraße. „Und ich bin sicher, dass Sie das sind, Alexander.“
„Zu meinem Bedauern fürchte ich, dass mir die Zeit fehlt, um Sie zu überzeugen“, schloss Arenberg. Er ging zu einem großen grauen Bentley, der in zweiter Reihe parkte. „Wie wäre es, wenn wir das alles später noch einmal besprechen? Wie wär's mit dem Frühlingsball der Kanzlei?“
Alexander erinnerte sich, dass er vor fünf Jahren mit Viktoria dort gewesen war. Das Fest fand in der Arenberg-Villa vor den Toren Münchens statt. Alles, was in Justiz, Politik und Finanzwelt Rang und Namen hatte, war damals dort zusammengekommen.
„Vielen Dank für die Einladung. Ich werde versuchen, es zu arrangieren“, antwortete Alexander höflich.
Arenberg nahm das Versprechen mit einem warmen Lächeln entgegen. „Ausgezeichnet“, sagte er und stieg in seinen Bentley, der glänzte wie ein Panzer aus poliertem Stahl. Der Wagen fuhr los und verschwand schnell im Verkehr.
Alexander hielt sich nicht lange vor dem Gerichtsgebäude auf. Bevor die Pause zu Ende war, ging er in die Anwaltsgarderobe, um seine Post aus dem Fach zu holen. Sein Briefkasten quoll wie immer über. Trotz der zunehmenden Entmaterialisierung der Verfahren wurden viele Schriftstücke ausschließlich in Papierform übermittelt.
Beim Sortieren der Post fiel ihm ein blauer Umschlag auf. Er war an ihn adressiert und trug in großen Buchstaben die Aufschrift Lies mich. Vorsichtig öffnete er den Umschlag und fand darin eine Karte mit einem einfachen Satz in violettfarbener Tinte.
Wie sieht ein Rabe aus?
Neugierig steckte er die Karte wieder in den Umschlag und legte sie zu seinem Poststapel, um sie später durchzusehen. In wenigen Minuten würde die Verhandlung beginnen.
Schnell ging er zurück zur Strafkammer.
Der Staatsanwalt traf fast gleichzeitig mit ihm ein und verpasste ihm im Vorbeigehen einen scharfen Seitenhieb. „Sie sind wirklich ein löblicher Mann, Wittensee. Dank Ihnen kann wieder ein Verbrecher sein Gift an unsere Jugend verkaufen.“
Alexander musterte Dumont einen Augenblick. „So ist das Gesetz, Herr Staatsanwalt. Wären Sie besser vorbereitet gewesen, wäre Ihnen dieser Fehler nicht unterlaufen.“
Dumont biss die Zähne zusammen, seine Kiefermuskeln zuckten unter der dünnen Haut.
„Ihre Anwesenheit hier ist eine permanente Beleidigung der Werte dieser Institution, Wittensee. Sie sind der Wurm im Apfel … ein Verbrecher, der den Geist des Gesetzes pervertiert, um Verbrecher zu verteidigen.“
Alexander spürte, wie ihm das Blut ins Gesicht schoss.
„Hüten Sie sich, Herr Staatsanwalt. Ich weiß, was Sie heute Morgen zu einem meiner Mandanten gesagt haben. Noch ein Wort, und ich zeige Sie wegen Verleumdung an.“
Dumont öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, überlegte es sich dann aber anders. Seine Gesichtszüge entspannten sich und ein spöttisches Lächeln umspielte seine Lippen.
„Genießen Sie Ihren kurzlebigen Triumph, Herr Anwalt. Bald wird jeder begreifen, was für ein Mensch Sie wirklich sind. Ich reibe mir schon mal die Hände.“
Alexander spürte ein unangenehmes Kribbeln im Nacken. In den schwarzen Augen des Staatsanwalts lag ein böses Funkeln, das Alexander ahnen ließ, dass seine Worte keine leeren Drohungen waren.
Teil II
„All das Gerede von Blut und Erschlagen verdirbt mir den Appetit auf Tee.“
(Alice im Wunderland)
Kapitel 5
Ich laufe die verschneite Straße am Waldrand entlang und zittere vor Kälte und Angst. Die Stille des Waldes ist unheimlich. Sie ist so groß und rein, alles in ihr ist tot. Und wenn doch ein Geräusch aus der Dunkelheit dringt, hinterlässt es eine Spur in meinem Kopf, so deutlich wie ein Stiefelabdruck im Schnee.
Ich erstarre. Ein Schrei aus dem Unterholz zerreißt die Stille. Ich richte meine Taschenlampe in den Wald. Die Strahlen erhellen eine gespenstische Welt aus sterbenden Bäumen, die ihre schwarzen Äste im Halbdunkel ineinander verkeilen.
„Ist da jemand?“, flüstere ich.
Keine Antwort. Und doch bewegt sich ein Schatten durch die Dunkelheit. Er huscht zwischen den schwarzen Baumstümpfen hindurch, die wie drohende Eckzähne die Böschung durchbrechen.
Da, wieder ein Schrei. Sein Echo kriecht meine Nervenbahnen entlang, nachdem er längst in der Dunkelheit verklungen ist und eine beklemmende Stille an seine Stelle getreten ist. Ich verlasse die Asphaltzunge, betrete den Wald und laufe in Richtung der entsetzlichen Schreie.
Nach etwa dreißig Metern erreiche ich einen kleinen zugefrorenen Teich, wo ein kleines Mädchen auf dem Boden liegt. Sie hat Bisswunden am Hals, an den Knöcheln und an den Handgelenken. Ausgestopfte hässlich grinsende Clownspüppchen ragen aus ihrem kleinen Brustkorb. Die Stille des Todes umgibt sie.
Dann sehe ich es. Im Wald leuchten zwei Augen auf und starren mich an. Ein Mensch in Gestalt eines Wolfes, mit messerscharfen Zähnen und einem langen, stacheligen Schwanz.
Ein Flüstern. „Mo … Mo … Komm, spiel mit mir…“
Ich schaue genauer hin.
Keine gelben Augen. Nein, die hellblauen Augen meiner Schwester Elisa…
Schweißgebadet erwache ich in meinem Bett. Die Deckenlampe, die die ganze Nacht gebrannt hat, strahlt noch immer ein warmes, orangefarbenes Licht aus. Der Radiowecker spuckt die Nachrichten aus wie ein wütender Drache: Freitag, der vierzehnte April. Und die Welt da draußen ist immer noch schlecht. Die Arbeitslosigkeit steigt. Unfall auf der Ringstraße. Verstopfte Straßen. Die Bahn streikt. Eine Frau wird tot im Auwald gefunden.
Ich stehe auf, strecke mich und gehe zum Fenster. Die letzten Bilder meines Traumes bleiben in meinem Kopf, bis ich die Vorhänge weit zur Seite ziehe. Die warmen Strahlen der Frühlingssonne durchfluten das Zimmer und vertreiben endgültig die Geister der Nacht: Der Frühlingstag verströmt bereits einen Hauch von Sommer, überall sind grüne Rasenflächen vor den Häusern zu sehen. Der Himmel leuchtet rosa, was besser ist als rot – da hat man Angst…
Zwei Eier, Haferflocken, fettarme Milch und zwei Brötchen mit Käse. Vor dem Frühstück ein Blick auf die Waage: ganze sechzig Kilo bei einer Körpergröße von 1,73 Meter. Zwei Kilo zugenommen. Langsam nähere ich mich wieder meinem Normalgewicht.
Seit meiner Rückkehr aus der Ukraine habe ich jeden Morgen einen Bärenhunger. Der Einsatz in Kiew, die grausamen Morde im Sperrgebiet und der Krieg haben mir viel abverlangt. Aber nicht der Gewichtsverlust von acht Kilo macht mir zu schaffen, sondern meine psychische Verfassung. Es fällt mir schwer, die Fratze des Todes zu vergessen. München eine Oase, ein richtiger Erholungsort. Ich bin froh, wieder hier zu sein und habe meine Teilnahme am Austauschprogramm der Europäischen Union für Kriminalbeamte erst einmal auf Eis gelegt und mich für einige Monate vom Polizeidienst beurlauben lassen. Meine Seele soll heilen…
Der Blick in den Spiegel zeigt mir jedenfalls ein angenehmeres Bild als vor drei Monaten: kurz geschnittene braune Haare, die beim Boxtraining nicht stören, Sommersprossen, kleine feste Brüste, lange, sehnige Muskeln unter der Haut. Wieder akzeptabel. Manchmal hat mein ehemaliger Freund Nico gesagt, dass mich von einem hübschen Mädchen nur das kleine Muttermal auf meinem linken Knöchel unterscheidet, das er so gerne geküsst hat. Am Ende unserer Beziehung sagte er aber öfter, dass mich von einem Mann nur ein paar Eier trennen. Vielleicht ist das auch ein Grund für meine Auszeit. Ich muss mich wieder finden.
Nico … Manchmal telefonieren wir. Er weiß, dass ich mein Gleichgewicht noch nicht gefunden habe und ihm gefällt meine Entscheidung, eine Zeit lang nicht arbeiten zu wollen. Er ist froh, dass ich die Episode Ukraine, den Schwalbenmörder, den Krieg und die Gefahr, in verstrahlten Landschaften ermitteln zu müssen, hinter mir gelassen habe. Und dass meine Eltern und ich das Kapitel Elisa endlich abschließen konnten.
Elisa… Einst meine kleine, beste Freundin, meine Vertraute, meine Schwester, die im Alter von zwölf Jahren plötzlich verschwand und als Erwachsene wieder in mein Leben trat – mutiert zu einer empathielosen, psychopathischen Mörderin. Elisa, die in der Ukraine ermordet und nach der Überführung ihres Leichnams in die Heimat auf dem Friedhof in Aschheim zu Grabe getragen wurde.
Elisa ist tot. Meine Schwester wird nie wieder einen Menschen quälen oder töten können. Sie liegt in der kalten Erde.
In meinem Kleiderschrank nehmen Shorts, Boxhandschuhe und Trainingsshirts fast den gesamten Platz ein. Zwischen den Tank-Tops liegt ein weißes Kleid, das so deplatziert wirkt wie ein Segeltuch auf dem Deck eines Motorboots – das Geschenk einer Freundin, das ich drei Tage zuvor an meinem dreiunddreißigsten Geburtstag bekommen und achtlos zur Seite gelegt hatte. Der französische Chic passt nicht zu meiner momentanen Gemütslage. Ich rolle es zusammen und werfe es ins oberste Regal des Kleiderschranks, wo es sich zu anderen ähnlichen Kleidungsstücken gesellt, schwarz oder bunt, mit Vichy-Karos oder Blümchenmuster, makellos, ungetragen. Ich entscheide mich für den Jogginganzug, schnüre meine Laufschuhe und verlasse meine Wohnung.
München ist bereits erwacht. Der Geruch von Schießpulver und Tränengas liegt in der Luft. In der Nacht hatten Polizisten Milbertshofen nach Drogen und Waffen durchsucht. Die Jugendlichen des Viertels hatten sie mit einem großen Feuerwerk aus Mörsern empfangen.