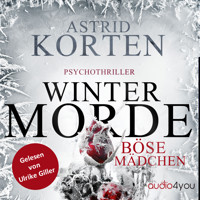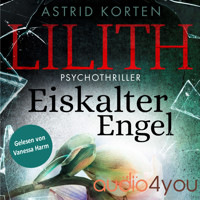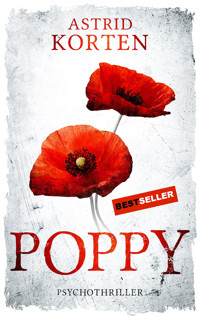4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
EINIGE LESERSTIMMEN: MACHT SPRACHLOS - UNBEDINGT LESEN! * EIN GRANDIOSER THRILLER, ATEMLOSE SPANNUNG * NICHTS ERZEUGT MEHR GRAUEN ALS DIE REALITÄT * MEIN THRILLER HIGHLIGHT DES JAHRES * EINFACH GRANDIOS, REALITÄTSNAH UND ERSCHÜTTERND! Ein teuflischer Serienkiller Eine strahlenverseuchte Landschaft Ein dunkles Geheimnis, eiskalt und tödlich Ermittler - am Rande des Wahns: Ukraine, kurz nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges. Polizeihauptmann Felix Bojko wird zu einem Tatort in die ukrainische Geisterstadt Pripyat gerufen und mit einer grausam verstümmelten Leiche konfrontiert. Es ist Janik, der Sohn des russischen Ex-Ministers Kanyukov. Da Kanyukov den ukrainischen Ermittlungsbehörden misstraut, schickt er den russischen Polizisten Alexej Markow in die Ukraine, um den Täter ausfindig zu machen. Hauptmann Bojko wird von Mo Celta begleitet, die an einem Austauschprogramm der EU-Ermittlungsbehörden in Kiew teilnimmt und in der Ukraine ihre Schwester sucht. Als die Kommissare einem Cold-Case auf die Spur kommen, ermitteln sie mit Hochdruck, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Sie stehen dabei einem wahnsinnigen Mörder gegenüber, der am Ort seiner Verbrechen stets eine präparierte Schwalbe hinterlässt... Astrid Korten hat mit Tod der Schwalben, Band 3 der Serie OVERKILL, einen atemberaubenden Thriller in einer zerrütteten Ukraine geschrieben, in der sich bewaffnete Konflikte, ein wirtschaftlicher Zusammenbruch und ökologische Forderungen vermischen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
ÜBER DAS BUCH
Einige Personalien
Kapitel 1
DIE STILLE STADT
KAPITEL 2
DIE SPRACHE DER NACHTIGALLEN
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
DIE SCHWALBEN VON TSCHERNOBYL
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
DONBASS, UKRAINE
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
DER RUSSISCHE GRÜNSPECHT
KAPITEL 14
KAPITEL 15
NEUE NACHRICHTEN VOM ENDE DER WELT
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
DAS LEBEN EINES ANDEREN
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
TOTE NATUR
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
AUS DEM NEST GEFALLEN
KAPITEL 31
KAPITEL 32
KAPITEL 33
KAPITEL 34
KAPITEL 35
DAS REVIER DER WÖLFE
KAPITEL 36
KAPITEL 37
KAPITEL 38
KAPITEL 39
KAPITEL 40
INMITTEN DER WEISSEN STILLE
KAPITEL 41
KAPITEL 42
KAPITEL 43
KAPITEL 44
KAPITEL 45
DIE, DIE STERBEN WERDEN
KAPITEL 46
KAPITEL 47
KAPITEL 48
KAPITEL 49
KAPITEL 50
KAPITEL 51
KAPITEL 52
EPILOG
Impressum
Danksagung
ÜBER DAS BUCH
„Seine unberechenbare mörderische Wut ist wie eine nukleare Apokalypse, die alles zerstört.“
(Hauptmann Bojko)
Kiew, Ukraine
Ein teuflischer Serienkiller
Eine strahlenverseuchte Landschaft
Ein dunkles Geheimnis, eiskalt und tödlich
Ermittler - am Rande des Wahns
Ukraine, kurz nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges.
Polizeihauptmann Felix Bojko wird zu einem Tatort in die ukrainische Geisterstadt Pripyat gerufen und mit einer grausam verstümmelten Leiche konfrontiert. Es ist Janik, der Sohn des russischen Ex-Ministers Kanyukov. Da Kanyukov den ukrainischen Ermittlungsbehörden misstraut, schickt er den russischen Polizisten Alexej Markow in die Ukraine, um den Täter ausfindig zu machen.
Hauptmann Bojko wird von Mo Celta begleitet, die an einem Austauschprogramm der EU-Ermittlungsbehörden in Kiew teilnimmt und in der Ukraine ihre Schwester sucht.
Als die Kommissare auch einem Cold-Case auf die Spur kommen, ermitteln sie mit Hochdruck, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. Sie stehen dabei einem wahnsinnigen Mörder gegenüber, der am Ort seiner Verbrechen stets eine präparierte Schwalbe hinterlässt…
Astrid Korten hat mit Tod der Schwalben, Band 3 der Serie OVERKILL, einen atemberaubenden Thriller in einer zerrütteten Ukraine geschrieben, in der sich bewaffnete Konflikte, ein wirtschaftlicher Zusammenbruch und ökologische Forderungen vermischen.
Einige Personalien
Mo Celta, Hauptkommissarin Kripo München (derzeit in Kiew)
Elisa Celta, Mos Schwester
Felix Bojko, Polizeihauptmann Kiew, Ukraine
Alexander Markow, Polizeileutnant, Moskau
Nikita Stachin, Freund von Alexander
Vektor Kanyukov, russischer Ex-Minister und Oligarch
Janik, Sohn von Kanyukov,
Daya & Olga, Cold-Case 1986
Pjotr Burow
Anton Winograd, Slavutich
Ninela – Verein 1989
Irma Girkin – Verein 1968
Maria – Ärztin Kinderkrankenhaus
Arseni Agopian, Ex-Ermittler der Miliz, Stracholissja
Sergej Kobrov, tätowierte Handlanger.
Kapitel 1
Moskau, Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis
In der schmutzigen, armseligen, von Gott und der Stadt vergessenen Malaja-Grusinskaja-Straße erhob sich das wunderschöne, hoch künstlerische Massiv der römisch-katholischen Kirche, geweiht der Heiligen Jungfrau Maria. Riesig in seinen Ausmaßen und Höhe, hinterließ das Gotteshaus stets einen tiefen Eindruck auf Domenico Celtana. Jedes Detail fand der gebürtige Italiener beeindruckend und bedeutend: Er sah und fühlte beim Anblick nicht den geringsten stilistischen Makel.
Hundertachtundachtzig Meter bis zur Kirche, dann weitere dreißig bis zum prunkvollen Hauptaltar. Bei vielen Gelegenheiten hatte Domenico sie gezählt. Er konnte nicht sagen, wie oft. Tausend Mal? Vielleicht mehr. Er hatte genug Zeit gehabt.
Das allererste Mal war es vor dreißig Jahren gewesen, als er sich um einen Wohnsitz in Moskau bemüht hatte. Daran konnte er sich noch gut erinnern. Er hatte damals das Gefühl, über den russischen Seelen zu schweben, getragen von den Tausenden von Blicken, die ihn anstarrten und die er wohl im Auftrag zur Erlösung führen sollte: Der Gedanke war der Grundstein und der Beginn einer verbrecherischen Karriere.
Damals hatte er sich der Solnzewo-Bruderschaft angeschlossen, einer Vereinigung, die der russischen Mafia zugerechnet wurde. Ihr Name bezog sich auf den Bezirk Solnzewo in Moskau. Sie war international verbreitet und bestand aus kriminellen Gruppen, die den Nachfolgestaaten der Sowjetunion entstammten. Im Zuge des Zerfalls der Sowjetunion zu Beginn der 90er Jahre und dem damit einhergehenden wirtschaftlichen Niedergang erhielten die verbrecherischen Zusammenschlüsse Russlands immer mehr Zulauf von verzweifelt nach Arbeit suchenden Menschen, wozu auch er als italienischer Einwanderer gehörte.
Domenico wollte nicht arm sein, er wusste, was Armut bedeutete, er hasste sie. Sein Vater war der Sohn eines transalpinen Immigranten, der Blut und Wasser geschwitzt hatte, um seiner Familie ein ärmliches Zuhause in einem neuen Land fern der Heimat zu schaffen. Nach einem kurzen Aufenthalt in Marseille hatten seine Eltern sich in Deutschland niedergelassen, wo heute sein Bruder Thomasz mit seiner Frau lebte. Domenico hatte kaum Kontakt zu den beiden, obwohl er in Aschheim auch ein Haus besaß. Selbst den Namen Celtana hatte sein Bruder Thomasz abgelegt, er nannte sich nur noch Celta.
Manchmal träumte Domenico in Moskau von Italien, genauer gesagt von den sardischen Landschaften. Dann hatte er am nächsten Morgen das Gefühl, dass die warme Luft Sardiniens seine Wangen streichelte, obwohl er die Insel nicht kannte. Doch durch die Erzählungen seiner Mutter hatte er sie oft vor Augen. Er konnte das Licht und die Intensität der Farben erahnen. Er wusste alles über die wohlhabenden Häuser mit Blick auf den Golf von Cugnana, die von traumhaften Gärten umgeben waren. Von der klaren Luft, in der Adler über Hirschen und Wildpferden kreisten, von den smaragdgrünen Buchten, die von weißem Sand gesäumt waren und zum Baden einluden. Das Dorf Bosa im Süden von Alghero, mit seinen pastellfarbenen Häusern, die sich am Fuße der mittelalterlichen Festung ausbreiteten. Das Viertel Castello in Cagliari, wo er in Gedanken auf der Bastion San Remy ein Glas Chianti trank. Eines Tages würde er dorthin fahren, vielleicht sogar mit Thomasz‘ Tochter Mo, die auch von Sardinien träumte. Zumindest hatte sie ihm das einmal anvertraut.
Die Familie war für Domenico stets unantastbar gewesen, er liebte vor allem seine Nichte Mo, die er hatte aufwachsen sehen und die heute als Polizistin für die Kripo München arbeitete. Ihre Schwester Elisa mochte er weniger. Als das Kind plötzlich verschwand und nie wieder auftauchte, war er darüber insgeheim erleichtert. Sie trug schon immer den Teufel in sich.
Jetzt wollte er in der Kathedrale der Unbefleckten Empfängnis für Mo, die sich momentan in Kiew aufhielt, beten. Die Gründe kannte Domenico. Er hätte seiner Nichte am Telefon nicht sagen dürfen, dass sich Elisa im Donbass aufhielt. Vektor Kanyukov, ein enger Freund, hatte es ihm gesteckt, und dass Elisa etwas im Schilde führte.
Seit Moskau sein Hauptwohnsitz war, besaß Domenico viele Kontakte, der Austausch von Informationen war sein Kapital und füllte sein Bankkonto. In der mafiösen Hierarchie der Solnzewo-Bruderschaft war er schnell aufgestiegen, hatte bedeutende Persönlichkeiten kennengelernt und ein Vermögen gescheffelt. Der Preis war hoch: Sein Leben war mit Bildern von Gewalt und Kriminalität verbunden, von Mafia und Blutrache geprägt. Es war einfach: Er beging Verbrechen, weil er den Luxus liebte.
Mos Schwester Elisa hingegen tötete aus Lust, quälte aus Lust, missbrauchte und zerstörte aus Lust. Er verabscheute Elisa, die schon als Kind abgrundtief böse, teuflisch böse war. Nur war es nie jemandem aufgefallen.
Mittlerweile gehörte das Miststück zu Prigoschins Elite-Einheit und bestrafte und tötete im Donbass nach Wagner-Tradition. Jewgeni Prigoschin wäre ganz vernarrt in die bildschöne Elisa, hatte Vektor gesagt.
Domenico seufzte. Verdammt, warum hatte er Mo gesagt, wo sich Elisa aufhielt?
Er musste für Mo beten. Jeder Schritt wurde aber mühsamer. Im Laufe der Jahre waren die Schmerzen immer häufiger aufgetreten. Seine müden Gelenke trugen das Gewicht seines Körpers immer weniger und die Entfernung zur Kathedrale erschien ihm jedes Mal größer. So sehr, dass er sich auch heute, bevor er den Spaziergang angetreten hatte, fragte, ob er es alleine schaffen würde. Der Schmerz hatte die Gelassenheit der letzten Jahre verdrängt. Manchmal stellte er sich vor, dass seine Leiden eine von Gott gewollte Strafe waren und dass jeder seiner Schmerzen einen Teil der Sühne für die Welt in sich trug. Natürlich war das maßlos übertrieben, er selbst war sich dessen bewusst, er war nur ein alter Mann geworden.
Domenico nahm sein Handy aus seiner Hosentasche. Er musste Mo warnen.
Mit zittriger Hand tippte er ein paar Worte für Mo und drückte auf ‚senden‘. Dann ging er langsam weiter. Etwas stimmte nicht…
Mit jedem Schritt zum Altar nahm der Druck in seiner Brust zu. Neben ihm lief ein imaginäres, monströses junges Mädchen mit sonnenblondem Haar und einem teuflischen Lächeln, das mit seinen blauen Augen dem Verlauf der kalten Bodenfliesen folgte: Elisa. Du alter Narr, hörte er sie in Gedanken flüstern.
Das Handy fiel ihm aus der Hand. Er spürte: Mo schwebte in höchster Gefahr, seit sie das Geheimnis um ihre Schwester Elisa gelüftet hatte.
Ich muss für Mo beten.
Schnell, schneller.
Ich muss für sie eine Kerze anzünden, nein, viele Kerzen!
Ich m…uss ….
Domenicos Herz setzte vor dem Altar aus. Sein letzter Gedanke galt Mo.
DIE STILLE STADT
KAPITEL 2
Pripyat, Ukraine
Polizeihauptmann Felix Bojko
Mo Celta drückte ihre Wange an das eisige Fensterglas, um sich für einen Augenblick in den grauen, von Tropfen gepeitschten Windungen zu verlieren.
„Das ist wirklich der schlimmste Ort, um zu sterben“, sagte sie.
Hauptmann Bojko schaute kurz zu seiner Beifahrerin und zuckte die Schultern. Sie fuhren in Richtung Pripyat, einer Geisterstadt, die seit 1986 wegen der Explosion des Kernkraftwerks Tschernobyl verlassen und strahlenverseucht war.
Die Polizistin richtete sich wieder auf und lehnte sich auf dem Beifahrersitz zurück. Die Scheibenwischer des Streifenwagens kämpften gegen den auf die Windschutzscheibe krachenden Regenvorhang. Im Norden, in Richtung der weißrussischen Grenze, ballten sich weitere schwarze Wolken am Horizont zusammen und entluden kalte Regenschauer über den Wäldern Polesiens. Mo Celta zog eine Zigarettenschachtel hervor und klopfte sie nervös auf ihr linkes Knie.
„Glauben Sie, dass es sich um Mord handelt?“
Von der Frage überrascht, nahm Felix Bojko seinen Blick für einen Moment von der Straße und richtete ihn auf seine Beifahrerin. Dunkles Haar, sorgfältig zu einem strengen Pferdeschwanz gebändigt, ein jugendliches Gesicht, eine brandneue Uniform mit einem entfernt amerikanischen Look … wieder einmal.
Durch eine tiefgreifende Reform wurde in der Ukraine die alte Strafverfolgungsbehörde Miliz, die mit Korruption, Gewalt und schweren Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht wurde, durch eine neue Elite-Polizei ersetzt. Die Hauptkommissarin aus Deutschland, die an einem Austauschprogramm zwischen ukrainischen und deutschen Kriminalisten teilnahm, hatte man ihm zugeteilt, sie wirkte aber fehl am Platz in der schäbigen Fahrgastzelle seines alten Dienst-Ladas. Warum hatte sie sich nur für die Ukraine und nicht für Polen entschieden? Vermutlich weil sie die Sprache perfekt beherrschte.
Bojko fragte sich, warum sich eine so erfolgreiche Polizistin – er hatte sich über sie erkundigt – für das Programm in einer von Kriegswirren geplagte Ukraine entschieden hatte. Warum kein anderes europäisches Land, das an dem Projekt der Europäischen Union teilnahm?
„Wer bringt denn jemand in dieser Einöde um?“, drängte sie weiter.
„Machen Sie sich darüber keine Gedanken, Mo.“
Bojko nannte seine Kollegin beim Vornamen. Im Dezernat duzte er alle Untergebenen, aber die Hauptkommissarin aus München, die damit kein Problem hatte, war die Einzige, die ihn auch beim Vornamen nennen durfte. Dennoch blieben sie beim offiziellen Sie.
„Ich wette mit Ihnen, dass es sich wieder um einen alten Säufer handelt, der vom Balkon gestürzt ist. Nichts Neues in dieser Gegend. Nicht nötig, sich das Schlimmste vorzustellen.“
Von Bojkos Worten wenig überzeugt, lehnte sich Mo in ihrem Sitz zurück und schob sich eine Belomorkanal-Zigarette zwischen die gespitzten Lippen.
„Das ist wirklich ein hässlicher Ort, um sein Leben zu beenden“, murmelte sie.
Eine erdrückende Stille, die nur durch das Quietschen der Scheibenwischer unterbrochen wurde, erfüllte den Innenraum. Mo Celta fühlte sich unwohl, dafür musste Bojko kein großer Ermittler sein, um das zu verstehen. Heute würde die Polizistin sich mit ihrer ersten richtigen Leiche in der Ukraine auseinandersetzen müssen. Keine aus dem Leichenschauhaus in Kiew, die den Austauschpolizisten während einer kurzen Einarbeitungszeit gezeigt wurden. Ein richtiger Toter mit einer Familie, die sie benachrichtigen mussten. Ein guter Grund, um sich eine ganze Packung dieser Belomorkanal-Dreckschleudern reinzuziehen.
Irgendetwas stimmt nicht mit ihr, sie ist manchmal völlig abwesend, dachte er. Die Leiche konnte nicht der Grund sein. Als Hauptkommissarin der Kripo hatte sie vermutlich schon alles gesehen.
Kiefern und Birkenhaine zogen im Wechsel mit weiten Grasflächen, die einst fruchtbare Felder gewesen waren, an ihnen vorbei. An einer Kreuzung musste er langsamer fahren, weil eine Gruppe von Przewalski-Pferden die Straße blockierte. Auf beiden Seiten des rissigen Asphalts graste die Herde das spärliche Gras ab.
„Dass diese verdammten Pferde aber auch überall im Weg stehen“, nuschelte Mo. „Wo kommen die nur her?“
„Ende der 1990er Jahre hat man im Naturschutzgebiet Askania-Nova etwa dreißig dieser Pferde eingefangen und hierher gebracht. Die damaligen Behörden hofften auf diese Weise zwei Probleme auf einmal lösen zu können.“
„Welche Probleme?“
„Eine vom Aussterben bedrohte Tierart sollte fernab der Menschen gedeihen, und das Wachstum der Tschernobyl-Vegetation, die zu unkontrollierter Vermehrung neigte, unter Kontrolle gebracht werden. Aber Umweltschützer sagen, es sei eine schlechte Idee gewesen, eine vom Aussterben bedrohte Art an diesen gefährlichen Ort zu bringen.“
„Wie sehen Sie das?“
„Ich genieße es, die Pferde auf den ehemaligen Feldern herumtollen zu sehen. Sie erwecken den Eindruck, dass fünfunddreißig Jahre nach der Atomkatastrophe wieder Leben in die evakuierte Zone einkehrt.“
Der Geländewagen fuhr an einem großen orthodoxen Kruzifix vorbei. Mos Dosimeter begann zu knistern. Die Anzeige zeigte die Strahlenbelastung eines Jahres in Moskau oder Kiew an. Neben dem Kreuz stand auch ein dreieckiges, rot-gelbes Schild am Straßenrand, das auf ein hochgradig verseuchtes Gebiet hinwies. Eine radioaktive Brutstätte, mit Cäsium, Strontium oder Plutonium gesättigt.
„Würden Sie bitte Ihr Unglücksgerät ausschalten!“, knurrte Bojko.
Er hasste die unheimlichen Knistergeräusche der Dosimeter. Seit vielen Jahren lag sein eigenes im Handschuhfach des Ladas. Es war eine Sache, an einem strahlungsverseuchten Ort zu arbeiten, eine andere aber, von einem Gerät ständig daran erinnert zu werden. Die schlimmsten Spots, die man meiden sollte, kannte er ohnehin. Ansonsten musste er nun mal aus beruflichen Gründen über verseuchte Erde laufen und die Luft einatmen, in der ab und zu radio-aktive Partikel herumflogen.
Mo verstaute widerwillig das Gerät in der Innentasche ihres Parkas. Bojko fragte sich, was für einen Mist seine Kollegin auf der Akademie in Kiew gebaut hatte, um für ihren ersten Einsatz nach Tschernobyl versetzt zu werden. Elitepolizisten träumten nicht davon, sich in einer Polizeistation zu vergraben, von der aus der Blick auf dreißig Kilometer verstrahlte Felder und Ruinen ging. Man hofft, in Kiew oder an der Schwarzmeerküste in der Sonne zu arbeiten. Sieben Jahre zuvor hätte er sich selbst nie vorstellen können, jemals in dieser Zone zu arbeiten, bis sein Vorgesetzter ihn in sein Büro zitiert und ihn vor die Wahl gestellt hatte, entweder zu kündigen oder nach Tschernobyl versetzt zu werden.
Sieben Jahre … Er betrachtete sich einen Moment lang im schief hängenden mittleren Rückspiegel. Schwerer Körperbau, dichtes buschiges Haar, verwaschene blaue Augen, ein dichter blonder Bart mit weißen Strähnen durchsetzt … Die Arbeit in der Zone hatte ihn in einen Waldmenschen verwandelt.
„Haben Sie einen Tipp für die … Strahlung?“, fragte Mo mit besorgter Stimme.
Ihm fiel auf, dass sie ihre Zigarette immer noch nicht angezündet hatte und mit den Zahnspitzen auf dem Pappfilter kaute.
„Kann man sich irgendwie vor Radioaktivität schützen?“
Bojko setzte eine durchdringende Miene auf, runzelte die Stirn und fuhr sie in ernstem Tonfall an: „Als ich vor einigen Jahren hierher kam, stellte ich die gleiche Frage. Ich bekam die Antwort: ‚Wenn du unbedingt Kinder haben willst, dann wickle deine Eier in Alufolie‘.“
Mo grinste und sah ihren Kollegen mit großen, weit aufgerissenen Augen an. „A… Alufolie? Funktioniert das wirklich?“
„Ob es funktioniert? Frag die anderen Jungs in der Brigade. Sie tun es alle.“
„Und Sie nicht?“
„Ich habe schon drei Kinder. Alufolie ist etwas für junge Leute.“
Bojko verkniff sich ein Lächeln. Die alten Hasen machten immer den gleichen Witz mit den neuen Rekruten, die daraufhin sofort die spärlich ausgestatteten Läden in Tschernobyl überfielen, um sich mit Alufolie-Rollen einzudecken, damit ihre männlichen Attribute vor der Strahlung geschützt waren. Diesmal war es sicher nicht so lustig - Mo Celta war eine Frau.
Nach einigen Kilometern tauchten die verfallenen Türme von Pripyat über den Baumwipfeln auf. Am Ende der Leninstraße erblickte Bojko einen Toyota-Kleinbus. Große Aufkleber an den Türen warben für einen Reiseveranstalter, der sich auf die Besichtigung der Gegend spezialisiert hatte. Er hielt den Lada am Straßenrand an und stieg innerlich betrübt aus. Mo tat es ihm gleich.
„Sie sind nur eine Beobachterin, Mo. Alles klar?“
Sie schmunzelte. „Aber sicher doch, Felix!“
Der Regenschauer hatte sich in einen Nieselregen verwandelt, der sich in die Kragen der Mäntel bohrte und die Hälse gefrieren ließ. Aber immerhin drückten die Wassertropfen den radioaktiven Staub, der die Straßen der Stadt verseuchte, zu Boden und machten sie vorübergehend weniger gefährlich.
Ein Dutzend Touristen stieg ohne Eile aus dem Kleinbus. Alle trugen ein gelbes Armband am Handgelenk, das bewies, dass sie vor der Einreise in das verseuchte Gebiet die vorgeschriebene Versicherung abgeschlossen hatten. Gott allein wusste, welche Gesellschaft solche Risiken übernahm.
Ein großer Typ in einer Tarnjacke des Militärs löste sich aus der Gruppe und sprach Bojko auf Ukrainisch an. Er war der offizielle Reiseführer.
„Ekh! Wir warten schon seit einer Stunde!“, beschwerte er sich.
„Stau“, antwortete Bojko, ohne auch nur ein einziges Mal zu lächeln. „Sind Sie der Reiseleiter? Wo ist die Leiche?“
„Sie sollen mit dem Auto dahin fahren. Der Körper ist…“
Bevor der Reiseleiter seinen Satz beenden konnte, trat einer der Touristen an Bojko heran und sprach ihn in gebrochenem Russisch an: „Wann können wir gehen? Wir wollen nicht bleiben!“
Bojko musterte ihn und antwortete in einem unfreundlichen Ton:
„Wenn ich mich dazu entscheide.“
„Hier gefährlich, nicht bleiben, wir wollen schnell gehen!“
Der Mann sprach schlechtes Russisch mit einem amerikanischen Akzent. Zwei ausgezeichnete Gründe, ihn zum Teufel zu jagen.
Bojko hörte, dass Mo eine Nachricht auf ihr Handy bekommen hatte und bemerkte, dass seine Kollegin danach immer wieder einen Blick über ihre Schulter warf.
„Alles okay, Mo?“, fragte er.
„J… Ja.“
Bojko wandte sich wieder den Touristen zu. „Sie wollten etwas, das von der Norm abweicht, den großen Kick?“, schnaubte Bojko. „Na, dann genießen Sie es! Das wird Ihnen eine gute Geschichte liefern, die Sie Ihrem Onkologen erzählen können.“
„Was ist ein Onkologe?“
„Ein Krebsspezialist“, antwortete Bojko.
Das Gesicht des Mannes nahm eine blasse Färbung an. Die anderen Touristen waren sich des Unbehagens bewusst und richteten ihre Blicke auf den Reiseführer. Dieser brabbelte ein paar Worte auf Englisch und fragte:
„Können sie wenigstens im Minibus warten?“
„Natürlich können sie das. Sobald sie meiner Kollegin ihre Ausweise gezeigt haben.“
Der Reiseführer gab die Information an die Touristengruppe weiter. Englische, amerikanische und baltische Pässe sprangen in ihre Hände.
Bojko beugte sich zu Mo vor und flüsterte ihr auf Ukrainisch zu. „Ihre Namen und ihre Aussagen können wir später aufnehmen. Wir werden uns zuerst die Leiche ansehen. Diese Bande von Geiern kann warten. Sie sind hier, um einen Adrenalinstoß zu bekommen, also sollen sie auf ihre Kosten kommen.“
Mo schmunzelte. „Das hätte ich jetzt nicht von Ihnen gedacht, Felix. “
„Oh, ich habe noch jede Menge auf Lager“, sagte er und bedeutete dem Reiseleiter, ihm zum Lada zu folgen.
Als er den Kleinbus überholte, bemerkte er zum ersten Mal den Slogan, der in großen Buchstaben auf den Seiten des Fahrzeugs stand: Die Reise, auf die ihre Freunde neidisch sein werden.
„Verdammte Idioten“, murmelte er in seinen Bart. „Wussten Sie, dass allein im letzten Jahr 30.000 Besucher die verstrahlte Zone erkundet haben? Um dorthin zu gelangen, muss man über achtzehn Jahre und nicht schwanger sein, und die Tür eines der unzähligen Reiseveranstalter öffnen, die in Kiew auf Tschernobyl-Touren spezialisiert sind. Dort bekommt man für ein paar hundert Dollar alle notwendigen Genehmigungen, die von der ukrainischen Verwaltung abgestempelt werden.“
Er schaute Mo direkt ins Gesicht. „Sie sind doch über achtzehn, Mo?“
„Ich durchschaue Sie, Felix. Sie haben sich zwar über mich erkundigt, aber mein Alter haben Sie nicht erfahren. Richtig?“
Er lächelte. „Kluges Mädchen!“
Der letzte Schrei war es, den Junggesellenabschied in Tschernobyl zu feiern. Fallschirmsprünge und Striptease-Besuche waren zu gewöhnlich. In den letzten Monaten kamen immer mehr betrunkene Arschlöcher, die durch die verlassenen Straßen von Pripyat grölten. Bojko vermisste fast die Zeit der russischen Touristen. Seit der Annexion der Krim durch Russland und dem Ausbruch des Krieges in der Donbass-Region im Osten der Ukraine waren sie selten geworden.
„Also, wo ist die verdammte Leiche?“, fragte er, während er sich in seinen Lada setzte.
„Es scheint Sie nicht zu stören, dass ein Mann gestorben ist“, wunderte sich der Reiseleiter.
„Was mir im Moment Kummer bereitet, ist, die Leiche zu finden, bevor die wilden Hunde anfangen, sie zu fressen.“
Ein freudloses Lächeln huschte flüchtig über das Gesicht des Reiseleiters.
„Keine Sorge: Dort, wo sie sich befindet, kann ihn nicht viel passieren.“
„Warum ist das so? Befindet sie sich in einem Gebäude?“, fragte Mo.
„Nicht in einem Gebäude. An einem Gebäude.“
Der Reiseleiter deutete auf ein großes Gebäude am Ende der Kurchatova-Straße. Es war mit dem Emblem der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik gekrönt, einem Hammer und einer Sichel, die von Weizengarben mit einem roten Stern eingerahmt wurden. Im vorletzten Stockwerk des Gebäudes hing eine Leiche mit weit ausgebreiteten Armen an der Außenfassade zwischen zwei Fenstern.
Bojko spürte, wie sich sein Magen aufbäumte.
„Blyad!“, fluchte er fassungslos, was auf Ukrainisch so viel wie verdammt bedeutete. Wie ein Gekreuzigter.
Er startete den Wagen und fuhr im Slalom zwischen den Baumschösslingen, die den Asphalt durchbrachen, die Straße hinauf. Sein Kopf arbeitete auf Hochtouren und zählte alles auf, was er in Gang setzen musste: Verstärkung von der Polizeiwache anfordern, den Staatsanwalt anrufen, die Leichenhalle informieren, dass eine potenziell radioaktive Leiche ankommen würde…
Vor dem Gebäude blickte Bojko zu der Leiche hoch und war erneut überwältigt von dem morbiden Anblick, der sich ihm bot. Metallkabel wickelten sich um die Handgelenke des Toten und verliefen diagonal in das Innere des Gebäudes, wo sie wahrscheinlich befestigt waren. Aus der Ferne hatte sich ihre Farbe mit dem Grau der Fassade vermischt. Das Opfer wirkte wie ein an der Fassade aufgeprallter Vogel. Nein, doch eher wie ein Gekreuzigter.
Für einen Moment hatte er das Gefühl, dass sich eines der Beine des Opfers bewegte. War es der Wind oder seine Fantasie? Oder vielleicht…
„Sind Sie reingegangen, um zu sehen, ob er wirklich tot ist?“, fragte er.
Der Führer öffnete die Arme und drehte seine Handflächen zum Himmel, während er mit den Schultern zuckte.
„Ich meine … es ist doch klar, dass der da tot ist, oder?“
„Für Sie ja, für uns nicht“, antwortete Mo.
Bojko betrachtete den Körper erneut. Das leichte Schaukeln, das er bemerkt hatte, hatte aufgehört. Vielleicht war es nur der Wind, aber der Gedanke, dass der Mann noch leben könnte, ließ ihn erstarren. Er dachte an die baufälligen Treppen, die in die oberen Stockwerke führten, an den radioaktiven Staub auf dem Betonboden, an das Gebäude an der Ecke, das im letzten Winter teilweise eingestürzt war, zögerte, entschied sich dann aber doch dafür, sich die Sache genauer anzusehen.
„Wir gehen nach oben. Warten Sie hier auf uns.“
„Ich bleibe hier“, antwortete der Reiseleiter, sichtlich erleichtert, das Gebäude nicht betreten zu müssen.
Die Kommissare gingen mit entschlossenen Schritten zum Eingang des alten sowjetischen Gebäudes. Im ersten Stock befand sich eine öffentliche Bibliothek, deren Bücher schon lange in alle Winde zerstreut waren. Hin und wieder fand man Blätter russischer Gedichte, die um die Äste der Bäume entlang der Straße gewickelt waren.
Im Inneren hatte Bojko keine Probleme, sich zu orientieren. „Das Gebäude ist relativ identisch mit dem, das meine Frau und ich in Kiew bewohnen“, erklärte er Mo. „Zu Zeiten der UdSSR war das ganze Land mit diesen billigen Betonwarzen bedeckt, von Berlin bis Wladiwostok.“ Die Gebäude waren so stereotyp, dass er mit verbundenen Augen in dieses Gebäude hätte gehen können.
Als sie im fünften Stock ankamen, brauchte Bojko eine Pause. Sein Atem ging schwer. Zu wenig Sport und zu viele Zigaretten. Während er wieder zu Atem kam, nahm er die Geräusche des verlassenen Gebäudes in sich auf. Das Pfeifen des Windes durch die zerbrochenen Fenster, das Knarren der Fensterläden, die zeitweise zuknallten…
Plötzlich erkannte er ein regelmäßiges Klirren. Die Krallen eines Hundes auf nacktem Beton. „Vorsicht Mo, die Tiere sind unberechenbar.“
Er zog seine Pistole und drückte sie gegen seinen Oberschenkel. „In Pripyat haben die Hunde schon lange keinen Respekt mehr vor den Menschen. Diejenigen, die die Tötungen nach der Evakuierung der Stadt überlebt haben, bildeten schließlich Rudel, die damals wie heute in den toten Gebäuden schlafen und nur zum Jagen herauskommen. Einige von ihnen sind dünn, haben lange Schnauzen und ähneln eher Wölfen als Hunden.“
Bojko setzte seinen Aufstieg mit seiner Kollegin fort. Im siebten Stock war die Luft mit wilden Gerüchen gesättigt.
„Bleiben Sie hinter mir, Mo. Man kann nie wissen.“
Er hörte ein gedämpftes Knurren und erkannte, dass sich die Höhle des Tieres irgendwo in der Nähe befand. Einen Moment lang dachte er daran, eine Etage höher zu gehen und eine Kugel durch ein Fenster zu schießen, damit der Knall das Tier erschreckte und es ins Erdgeschoss flüchtete. Dann dachte er daran, dass es keine Garantie dafür gab, dass der Mörder nicht mehr im Gebäude war. Angespannt setzte er seinen Aufstieg fort und richtete die Waffe vor sich auf den Boden.
Im vorletzten Stockwerk gingen sie zu der Wohnung, aus der die Leiche aufgehängt wurde. Vor der aufgebrochenen Eingangstür blieb Bojko stehen und achtete auf jedes verdächtige Geräusch: das Knirschen von Glasscherben unter Sohlen, einen Seufzer, ein knitterndes Kleidungsstück, alles, was auf eine feindliche Präsenz hinweisen konnte. Er wartete eine ganze Minute und entschied sich dann hineinzugehen.
Im Wohnzimmer war der Gestank bestialisch. Bojkos Augen weiteten sich, sein Körper fühlte sich taub an. Er starrte wie hypnotisiert die Szene vor sich an. Um ihn herum wandten und dehnten sich die Geräusche des Windes.
Tränen traten ihm vom Zug des Windes in die Augen. Er war ein Polizist, effektiv darin, das Übelste im Menschen aufzuspüren, Widersprüche und Lügen aufzudecken und fähig, dem Tod in die Augen zu sehen. Etwas verschob sich in ihm, etwas trudelte an die Oberfläche, etwas Böses. Er war so überrascht, dass sein Finger fast den Abzug seiner Waffe betätigt hätten.
Mo Celta zuckte zusammen. „Was ist das denn?“
In dem Raum befanden sich Dutzende Tiere. Fünfzehn, zwanzig, vielleicht dreißig. Füchse, Wölfe, Luchse, Wildschweine. Ein seltsames Rudel, das ihm den Rücken zuwandte. Erst allmählich wurde Bojko klar, dass es sich nur um ausgestopfte Tiere handelte. Er stand still und wartete, bis sich sein Herzschlag beruhigt hatte, dann ging er durch das Wohnzimmer und lehnte sich aus dem Fenster, um den hängenden Mann zu untersuchen. Mo blieb stehen.
„Sein nackter Körper weist Spuren von Misshandlungen auf: Verbrennungen, Schnitte, Hämatome. Schlimmer noch: Seine Augenlider und seine Lippen sind zugenäht.“
Bojko streckte seine Hand nach dem grauen Hals aus, aber er konnte kein Pulsieren feststellen. „Es war der Wind, der die Leiche bewegt hat“, sagte er und zwang sich, seinen Atem zu beruhigen und unterdrückte seine Übelkeit. Schlagartig war er wieder ganz ruhig und richtete sich auf, er brauchte ein paar Sekunden, um sich von dem Schock zu erholen.
„Schauen wir uns mal um, Mo.“
Ein Haufen Kleidung lag achtlos in einer Ecke des Raumes. In einer Hosentasche entdeckte Mo eine Brieftasche und einen russischen Pass auf den Namen Janik Vektorowitsch Kanyukov und reichte ihn Bojko.
„Das Passfoto stimmt mit dem Opfer überein: Der Mann hat ein rötliches Muttermal über den Augenbrauen, das ihn trotz der Nähte an Augen und Lippen eindeutig identifizierbar macht.“
Bojko öffnete die Brieftasche und fand eine große Menge Rubel und Hrywnja, die ukrainische Währung. Ein kleines Vermögen, etwa vier oder fünf Mal sein Monatsgehalt. Der Gedanke, ein paar Scheine zu ergattern, schoss ihm durch den Kopf. Er brauchte sie weiß Gott, und sei es nur für seinen Sohn Nikolai, der ohne kugelsichere Weste im Donbass kämpfte. Trotz allem legte er das Geld wieder an seinen Platz zurück. Bisher hatte er sein Leben anständig und ohne Korruption gelebt, er würde nicht in seinem Alter anfangen, ein Leichenfledderer zu werden. Er nahm sein Handy und wählte die Nummer des Polizeireviers. Einer seiner Kollegen nahm den Hörer ab.
„Wie sieht es mit der Leiche aus, Felix?“
„Eine richtige Schweinerei. Das ist ein Mordfall. Ich brauche Unterstützung. Der Mann hängt an der Fassade eines Gebäudes.“
„Ist es … ist es ein Landsmann?“
„Nein, ein Russe. Ein gewisser Janik Vektorowitsch Kanyukov. Check alles, was du über ihn finden kannst und ruf mich an, sobald du mehr weißt.“
Dann wandte er sich wieder an seine Kollegin. „Alles in Ordnung, Mo? Sie sind ja kreidebleich.“
Mo zeigte auf den Boden. „Schauen Sie mal. Das wurde mit Blut geschrieben, vermutlich mit Janiks Blut.“
Wenn du dich umdrehst, könnte ich hinter dir stehen.
Bojko zuckte mit den Schultern. „Vielleicht. Oder es war irgendein Spinner. Soll sich die Spurensicherung drum kümmern.“
Sie gingen schweigend wieder hinunter ins Erdgeschoss. Im siebten Stock war das tierische Knurren verstummt. In dem Staub, der den Boden im Eingang des Gebäudes bedeckte, waren nun Pfotenspuren über den Abdrücken seiner Stiefel.
Draußen hatte sich der Reiseführer keinen Zentimeter bewegt.
Bojko reichte ihm den Ausweis des Verstorbenen. „Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen?“
Der Fremdenführer betrachtete das Foto eingehend, doch das Gesicht des Mannes sagte ihm nichts.
„Überlegen Sie: Vielleicht haben Sie ihn gestern oder vorgestern bei einem Besuch getroffen. Vielleicht gehörte er zu einer anderen Gruppe.“
„Tut mir leid, ich habe ihn noch nie gesehen“, antwortete dieser energisch.
Sie stiegen wieder in den Lada ein. Während der kurzen Fahrt zum Hauptplatz dachte Bojko, dass es eine gehörige Portion Hass brauchte, um einem Körper das anzutun und danach die Leiche wie die eines Gekreuzigten zur Schau zu stellen. Und er dachte an die Polizistin neben ihm. Auf dem Revier würde er sie fragen, warum das Gekritzel auf dem Fußboden sie irritiert, nein, aus der Fassung gebracht hatte. Auf dem Revier… Nein, sofort.
Als er beim Kleinbus ankam, setzte er den Reiseführer ab. Dann nahm er Mo zur Seite, die sofort im Stehen zu joggen begann, um gegen die feuchte Kälte anzukämpfen.
„Das ist eine 115“, sagte er leise. „Im ukrainischen Strafgesetzbuch befasst sich Artikel 115 mit dem vorsätzlichen Mord. Ich habe es vorgezogen, das Wort Mord zu vermeiden, um die Touristen nicht noch mehr in Panik zu versetzen.“ Er räusperte sich. „Was war vorhin mit Ihnen los, als Sie mir das Gekritzel gezeigt haben?“
Mos Pupillen weiteten sich. „Ich glaube, dass diese Blutnachricht nichts Gutes bedeutet.“
„Das tun diese Nachrichten nie. Diese Leiche war ja schon kein schöner Anblick. Da spürt man förmlich eine Wut, die den Wahn nährt. Eine unberechenbare, mörderische Wut.“
Mo schwieg eine Weile, bevor sie die Strafprozessordnung abspulte. „Wir können den Tatort nicht unbeaufsichtigt lassen… wir müssen… wir müssen einen sicheren Bereich um die Leiche errichten…“
„Immer mit der Ruhe“, erwiderte Bojko. „Wir sind hier mitten im Nirgendwo. Wer würde hier schon am radioaktivsten Tatort der Welt herumlaufen?“
„Ich wüsste da schon jemanden“, kam es wie aus der Pistole geschossen.
„Ach ja. Und wen?“
„Das war nur so dahingesagt… Kommen Sie, Felix, stürzen wir uns auf die Touristen und…“
„Und machen sie ein bisschen kirre?“
Sie lügt, dachte Bojko, aber er wollte es erst einmal auf sich beruhen lassen.
Er holte sein Notizbuch hervor und machte sich an die Arbeit.
Mo las ihm später mit belegter Stimme ihre Aufzeichnungen vor.
„Die Befragten haben alle gestern ihren Ausflug nach Kiew gebucht, nach einem Besuch des nationalen Tschernobyl-Museums. Der Kleinbus holte sie heute Morgen um sieben Uhr vor McDonald's auf dem Maidan-Platz ab. Dann fuhren sie etwas mehr als zwei Stunden, passierten gegen zehn Uhr den Checkpoint Dytyatki und machten die übliche Tour: Zuerst die Stadt Tschernobyl, das Denkmal der Liquidatoren, dann die verlassenen Dörfer, den Reaktor und schließlich kamen sie hier in Pripyat an. Sie blieben zehn Minuten vor Ort, bevor einer von ihnen, ein Japaner, den Leichnam erblickte. Ein Japaner, als hätten die nicht reichlich Atommüll vor der Haustür. Hiroshima, Fukushima. Glauben Sie, dass einer von ihnen den Mann getötet hat?“
Bojko wischte den Gedanken ohne zu zögern beiseite. „Nein. Allein das Aufhängen des Körpers muss Stunden gedauert haben.“
Sein Telefon klingelte. Es war der Kollege aus seiner Dienststelle, dem er die Recherchen zu Janik Kanyukov anvertraut hatte. „Was hast du über das Mordopfer?“
„Über ihn nicht viel, aber ich habe etwas Gruseliges über seine Familie gefunden.“
Die Stimme seines Kollegen schwankte zwischen Aufregung und Nervosität. „Seine Mutter hieß Daya Kanyukov. Sie wurde ganz in der Nähe ermordet. Eine verrückte Sache. Mehrere Messerstiche, Verstümmelungen, der Horror. Ihre Leiche und die einer anderen Frau wurden in einem Haus in Zalissya gefunden.“
Zalissya war nur einen Steinwurf von Tschernobyl entfernt, dennoch hatte Bojko noch nie von diesem Fall gehört. „Das sagt mir nichts. Wann ist diese Geschichte passiert?“
„Das ist das Verrückte daran. Es war im Jahr 1986. Am 26. April.“
Bojko spürte, wie sich ein Kloß in seiner Magengrube bildete. „Bist du dir mit dem Datum sicher. Der 26. April 1986…?“
„Sicher“, antwortete der Polizist.
Bojko legte schaudernd auf.
26. April 1986…
Seine Kollegin sah ihn fragend an.
„Jeder Ukrainer, ob jung oder alt, kennt dieses Datum, Mo. Und das aus gutem Grund: An diesem Tag ist das Kernkraftwerk Tschernobyl explodiert.“
DIE SPRACHE DER NACHTIGALLEN
KAPITEL 3
Moskau
Polizeileutnant Alexej Markow
Metallisches Quietschen, keuchende Atmung.
Alexej erwachte in einem gespenstischen Halbdunkel, das bei jedem Blinzeln von grünen und blauen Flashs durchzogen wurde. Die Luft war schwer, gesättigt mit dem beißenden Gestank von ungewaschenen Körpern, vermischt mit dem Geruch von Antiseptika und hochprozentigem Alkohol.
Wo bin ich?
Seine Augen gewöhnten sich an das schwache Licht im Raum. Er sah eine Reihe von Betten, die gegen die Wand vor ihm standen und von formlosen, stöhnenden Wesen belegt waren, die langsam ihre Glieder bewegten, wie halb zerquetschte, mit ihren Beinen zappelnde Käfer, bevor sie verendeten.
Beweg dich!
Ein Impuls in seinem Hinterkopf schrie: Lauf weg! Er versuchte sich aufzurichten, aber seine Hand- und Fußgelenke verweigerten, sich von der Matratze zu lösen. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass sie mit Gurten an den Bettrahmen gefesselt waren. Er zog mit aller Kraft daran, um die Fesseln zu lösen, aber die Anstrengung löste einen heftigen Schwindel aus, er glaubte, ohnmächtig zu werden. Verwirrt und mit kaltem, fettigem Schweiß auf dem Körper versuchte er sich zu erinnern, wie er hierhergekommen war.
Teigiger Mund, Kopfschmerzen, ein Nachgeschmack von ranzigem Alkohol in der Kehle: Offensichtlich hatte er viel zu viel getrunken. Jedes Mal, wenn sein Herz schneller schlug, hatte er das Gefühl, die Glocken von St. Basilius läuteten unter seinem Schädel. Ein Reißen in den Rippen, ein metallischer Geschmack, der aus seinen aufgesprungenen Lippen sickerte, ein brennendes Gefühl in den Fingerknöcheln: Er hatte demnach nicht nur getrunken, sondern auch gekämpft. Die Bilder der letzten Nacht kamen ihm wieder in den Sinn. Am Abend zuvor hatte Zenit St. Petersburg gegen Spartak Moskau gespielt. In einer Fankneipe hatte er die Petersburger als Ziegenficker oder etwas in der Art bezeichnet. Es sei denn, es war genau umgekehrt: Vielleicht hatte er auch die heilige Mannschaft von Spartak beleidigt, Gott möge ihm verzeihen. Das Ergebnis ließ jedenfalls nicht lange auf sich warten. Als er die Bar verlassen hatte, waren drei Typen auf ihn losgegangen. Ultras, mit kahlgeschorenen Köpfen, auf deren khakifarbenen Bomberjacken ein schwarz-weiß-goldenes Wappen aufgenäht war, die Flagge des kaiserlichen Russlands. Die Art von Typen, die es gewohnt waren, Tschetschenen, Dagestaner und generell alle, die eine dunklere Hautfarbe als sie hatten, im Rudel zu verprügeln.
Mit seiner dunklen Hautfarbe war er eine ideale Beute. Ein "schwarzer Arsch", wie sie ihn nannten. Die Ultras dachten, sie hätten ein leichtes Spiel. Ein fataler Fehler. Das Wild waren sie selbst. Ellenbogenschläge in die Augenbrauenbogen, Fersenschläge in die Rippen, Knie- und Kopfstöße, er hatte seinen Gegnern nichts erspart. In einem Anflug von alkoholisiertem Stolz dachte er, dass es seinen Angreifern im Moment sicher viel schlechter gehen musste als ihm.
Geräusche von Schritten auf dem Flur. Eine knarrende Tür öffnete sich, dann schoss grelles Licht aus den Neonröhren der Deckenlampen, in einem scharfen Klickkonzert. Geblendet schloss er die Augen, während eine männliche Stimme, die Russisch mit sibirischem Akzent sprach, in seinen Ohren knallte wie ein in die Höhe schießender Feuerwerkskörper.
„Wer ist Alexej Markow?“
Die Stimme dringt in sein Bewusstsein, schwingt an der Oberfläche. Das Licht … das Licht der Neonröhren versuchte, sein Gehirn zu verbrennen. Er lehnte sich zur Seite und kniff die Augen zusammen. Durch den schmalen Spalt zwischen seinen Augenlidern betrachtete er den Mann, der gerade hereingekommen war. Jung, Brille, weißer Arztkittel.
„Alexej Markow?“, wiederholte der Mann.
Erneut knallte es in seinem verkaterten Schädel. Er gab ein Knurren von sich und der Arzt trat an ihn heran. „Sind Sie Alexej Markow? Verstehen Sie, was ich Ihnen sage? Sprechen Sie Russisch?“
„Weniger… laut“, brachte er mühsam hervor.
Jedes Wort kostete ihn immense Anstrengung. Seine Zunge war schwer und unbeholfen. Der Klang seiner Stimme ließ das Gehirn unter seinem Schädel vibrieren. Selbst das Denken war schmerzhaft.
„Wo… bin ich?“
„In einem Krankenhaus. Sind Sie Amerikaner? Europäer?“
„Bin Russe, Mudak.“
Ein Ausdruck lebhaften Erstaunens huschte über das Gesicht des jungen Arztes. Alexej fragte sich, ob es der Schock war, dass man ein Mischling sein und Russisch sprechen konnte, oder eher die Überraschung des Arztes, in seiner Muttersprache beleidigt zu werden.
„Warum… bin ich hier?“, artikulierte Alexej mühsam.
Der Arzt setzte schnell wieder ein professionelles Gesicht auf, eine gekonnte Mischung aus Arroganz und müder Resignation.
„Die Polizei hat Sie heute Nacht in der Nähe des Bahnhofs aufgegriffen“, erklärte er ihm in einem gekniffenen Tonfall. „Sie lagen auf der Straße und waren völlig betrunken.“
Alexej hob leicht den Kopf und sah sich um. Die anderen Betten waren mit erbärmlichen Exemplaren hagerer Alkoholiker belegt: arme, zottelige, rotwangige Typen mit violetten Nasen und schmutzigen Fingernägeln. Menschlicher Abschaum. Er hoffte, ohne sich allzu großen Illusionen hinzugeben, dass er weniger erbärmlich aussah.
Vermutlich nicht, immerhin war er der Einzige, dessen Gliedmaße mit Gurten gefesselt waren.
„Warum … bin ich gefesselt?“
„Der Grund dafür war Ihr Verhalten während des Ausziehens. Sie haben versucht, einen der Pfleger zu beißen.“
Er schloss die Augen: neue Erinnerung verfügbar: Er im Flur, geschleift von drei Typen, die versuchen, einen 1,80 m großen und 88 kg schweren Mann zu bändigen, der ungeschickt herumfuchtelt, um ihnen zu entkommen. Schmerzen im Arm, kalter Boden in seinem Gesicht: Er wird mit einem Schlüsselgriff an der Schulter gepackt, um ihn zur Ruhe zu zwingen. Er schreit. „Ich habe keine Zeit zu verlieren, verdammt! Keine Zeit zu verlieren!“ Sie ziehen ihn aus, lassen ihm nur seine Unterhose. Er schreit eine ganze Weile. Dann schläft er ein…
Der Arzt griff nach einem der Lederriemen und begann, die Fesseln zu lösen. „Bevor wir Sie entlassen, werden wir eine kleine Untersuchung durchführen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Sind Sie damit einverstanden, Herr Markow?“
Obwohl es ihm nicht gefiel, dass der Arzt mit ihm wie mit einem zurückgebliebenen Kind sprach, gab er ihm mit einem zögerlichen Kopfnicken seine Zustimmung.
„Setzen Sie sich bitte auf die Bettkante.“
Er gehorchte. Seine Muskeln schmerzten und seine Bewegungen waren unbeholfen. Der Arzt stellte ihm eine ganze Reihe von Fragen, die er einsilbig beantwortete.
„Trinken Sie oft so viel?“
„Nein.“
„Trinken Sie regelmäßig?“
„Nein.“
„Können Sie sich an letzte Nacht erinnern?“
„Nein.“
„An die Nacht davor?“
„Nein.“
„Haben Sie Kopfschmerzen?“
„Ja.“
„Wie hoch würden Sie diese Schmerzen auf einer Skala von eins bis zehn einordnen?“
„Elf.“
„Haben Sie Bauchschmerzen?“
„Ja.“
„Was war das auslösende Ereignis für Ihren übermäßigen Alkoholkonsum?“
Alexej sah den Arzt lange an. „Ich habe jemanden getötet.“
Der Arzt verwandelte sich augenblicklich in eine Salzsäule.
„Jemand? Wie ist das möglich? Wen?“
Er ließ sich Zeit, bevor er mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen antwortete: „Einen Arzt! Er stellte zu viele Fragen!“
Verärgert legte der junge Arzt ihm kurzerhand das Band eines Blutdruckmessgerätes um den Arm.
„Mit so etwas sollten Sie nicht scherzen. Letzten Monat ist ein Typ, dem es ähnlich ging wie Ihnen, auf den Gleisen regelrecht eingeschlafen. Der Fahrer hatte keine Zeit mehr zu bremsen. Der Mann war auf der Stelle tot. Das hätten Sie sein können. Wir haben eine Alkohol-Selbsthilfegruppe, die sich zweimal pro Woche trifft. Am Dienstag und am Donnerstag. Ich empfehle Ihnen, sich dort anzumelden.“
„Bin kein Trinker“, murmelte er.
Der Arzt ignorierte sein Leugnen und hielt ihm den üblichen Vortrag über die Folgen von Alkoholmissbrauch, als würde er einem Ungläubigen die Bibel predigen. Zum Glück verlief der Rest der Untersuchung relativ ruhig. Am Ende teilte der junge Arzt ihm mit, dass er entlassen werden könne. Sobald der Arzt den Raum verlassen hatte, schloss Alexej die Augen und fiel in einen unruhigen Schlaf, bis eine Krankenschwester ihn sanft rüttelte, um ihn zu wecken. Sie hatte seine zerknitterte Kleidung mitgebracht, die er seit drei Tagen getragen hatte. Er versuchte aufzustehen, um sie anzuziehen, aber ihm wurde schwindelig, sodass er sich wieder hinsetzen musste.
„Geht es? Sollen wir Ihnen einen Rollstuhl besorgen?“, fragte die Krankenschwester voller Fürsorge.
Ich bin verdammt nochmal nicht bettlägerig, dachte er in seinem Stolz gekränkt. „Es geht schon.“ Jedes Wort kostete ihm unverhältnismäßig viel Mühe, Aufregung verschlimmerte seine Kopfschmerzen nur.
Unter den amüsierten Augen der anderen Betrunkenen zog er sich mit langsamen, unbeholfenen Schritten so gut es ging seine Hose an, dann seine Socken, seine nassen Schuhe, sein T-Shirt, seinen Pullover, der nach ranzigem Bier roch, und seinen an den Ärmeln zerrissenen Parka. Die Krankenschwester gab ihm Tabletten, die er mit einem Glas Wasser hinunterschluckte, das so kühl war, dass es ihm Zahnschmerzen bereitete. Dann verließ sie den Raum. Er folgte ihr mit schlurfenden Schritten durch die nach Jodtinktur riechenden, gefliesten Gänge. An jede Ecke wartete sie einige Sekunden, bis er sie erreichte. Er hatte das Gefühl, dass sie sich auf den Rand eines Schwimmbeckens zubewegte, während er in einem Taucheranzug auf dem Grund des Beckens lief.
Was für ein Abstieg.
„Sind Sie sicher, dass Sie keinen Rollstuhl wollen?“, fragte sie noch einmal.
Er murmelte ein unhörbares Schimpfwort. Nach weiteren zehn Metern gelangten sie schließlich in die Eingangshalle des Krankenhauses. Die Krankenschwester ließ ihn an einem Schalter stehen, wo ihm eine müde Angestellte seinen Mantel und eine schwarze Plastiktüte mit seinen Sachen überreichte. Er versuchte, den Knoten zu lösen, mit dem die Tasche verschlossen war, aber seine vom Alkohol betäubten Finger waren dazu nicht in der Lage. Schließlich riss er die Tasche mit einer genervten Handbewegung auf und leerte den Inhalt über den Tresen: eine Brieftasche, Autoschlüssel, ein Haufen U-Bahn-Tickets und in der Mitte… Eine MP-443-Pistole.
„Oh.“ Die Angestellte starrte lange Zeit auf die Waffe, machte dasselbe ungläubige Gesicht wie der junge Arzt. Er ahnte, was in ihrem Kopf vor sich ging, welche miesen Assoziationen sich dort bildeten: dunkle Haut, Waffe auf dem Tresen. Gleich würde sie einen Schrei ausstoßen.
„Das ist meine Dienstwaffe“, sagte er.
Er zog seinen Polizeiausweis aus seinen auf dem Tresen ausgebreiteten Sachen hervor und hielt ihn hoch.
„Was sehen Sie? Polizei Moskau. Alles klar?“, knurrte er.
Sie inspizierte den Ausweis mit dem verkniffenen Blick einer Supermarktkassiererin, wenn sie einen Fünftausend-Rubel-Schein begutachtete. In der Zwischenzeit steckte er seine Pistole in das Holster und zog sein T-Shirt darüber. Nachdem die Angestellte sich schließlich entschieden hatte, die Echtheit seines Ausweises nicht anzuzweifeln, reichte sie ihm ein Bündel Dokumente mit einer Rechnung und einem verräterischen Flyer, der für eine Selbsthilfegruppe für Alkoholiker warb. Er steckte alles in die Tasche seines Parkas und bezahlte die Kosten für den Krankenhausaufenthalt.
Dann ging er zur Toilette, um sich das Gesicht mit frischem Wasser zu bespritzen. Im Spiegel über dem Waschbecken hätte er sich fast nicht wiedererkannt. Seine Wangen waren von einem Dreitagebart vernebelt, seine milchkaffeebraune Haut hatte einen erdigen Ton angenommen und seine hellblauen Augen waren blutunterlaufen. Die Worte des Arztes hallten in seinem Kopf nach. Letzten Monat ist ein Typ in Ihrem Zustand auf den Gleisen eingeschlafen. Der Mann war auf der Stelle tot… Das hätten Sie sein können…
Das hätte er sein können… Auf den Gleisen einschlafen, von der ersten S-Bahn am Morgen mitgerissen werden, ohne es zu merken… Vielleicht wäre es für alle besser gewesen, dachte er und schlug den Kragen seiner Jacke hoch.
Er trocknete sein Gesicht mit einem Papierhandtuch und verließ das Krankenhaus. Draußen war die Luft scharf, die Sonne schwach. Ein aspirinfarbenes Taxi wartete in zweiter Reihe. Er wollte gerade einsteigen, seinen Polizeiausweis hochhalten und den Fahrer auffordern, ihn nach Hause zu fahren, als er den Polizisten auf der anderen Straßenseite bemerkte, der an seinem Dienstwagen lehnte: Kurz geschnittenes schwarzes Haar, eine schiefe Nase, die Maße eines übergewichtigen Bodybuilders und in seiner Lederjacke eingezwängt. Auch er hatte dunkle Ringe unter den Augen und seine Wangen waren von einem beginnenden Bartwuchs bläulich verfärbt.
Es war Basil Tschekov, sein Teamkollege.
KAPITEL 4
Moskau
In Basil Tschekovs Lada Priora herrschte eine angenehme Wärme. Alexej schnallte sich an. Sein Kollege fuhr los, um an der ersten Kreuzung in die verstopften Straßen des Moskauer Stadtzentrums einzubiegen. Trotz der frühen Morgenstunde war die Hauptstadt voller Autos, die auf Gehwegen, Parkplätzen, zwei-, vier- und sechsspurigen Straßen fuhren und nur ein langsames, ruckartiges Vorankommen ermöglichte.
„Ich suche dich seit 48 Stunden. Wo warst du?“
Die tiefe Stimme seines Teamkollegen klang wie eine Trommel in seinem Schädel.
„Nicht so laut“, flehte er.
„Wo warst du?“, beharrte Tschekov.
„Ein überall und nirgends… Welcher Tag ist heute?“
„Welcher Tag? Verdammt, es ist Mittwoch!“
Schon Mittwoch? Alexej massierte sich die Schläfen.
„Seit Freitag hat niemand mehr etwas von dir gehört. Was hast du die ganze Zeit gemacht?“
„Zapoi“, antwortete Alexej.
Die russische Sprache hatte ein einfaches Wort dafür entwickelt, sich mehrere Tage hintereinander zu betrinken, bis man sich an nichts mehr erinnern konnte.
„Ein Zapoi? Ernsthaft?“ Tschekov traute seinen Ohren nicht. „Wir suchen dich seit Tagen und du hast dich betrunken? Verdammt, das gibt's doch nicht… Ein Zapoi.“ Er hupte, weil ihm ein Wagen gerade die Vorfahrt genommen hatte. „Ist es dir nicht in den Sinn gekommen, mich zu warnen? Oder am Montag die Dienststelle anzurufen und ihnen zu sagen, dass du krank bist, oder Gott weiß, was für einen Mist sie dir sonst abkaufen würden? Warum hast du niemanden kontaktiert?“
„Ich hatte keine Lust zu reden.“
„Keine Lust auf… aber verdammt, du verarschst mich wirklich!“
„Es geht mir gut, Tolja.“ Er benutzte Tschekovs Spitznamen, um ihn zu besänftigen. „Es ist kein Mensch gestorben.“
„Ach ja, Alexej? Bist du dir da so sicher?“
Als er den Kolben seiner Dienstwaffe streifte, griff Tschekov in die Innentasche seiner Jacke und zog ein spiralgebundenes Notizbuch heraus, das er ihm auf den Schoß warf. Darauf standen Telefonnummern und Adressen, die er wiedererkannte: seine Wohnung, die Wohnung seiner Ex-Frau, einige Bars, sein Fitnessstudio, die Wohnorte seiner engen Freunde. Alle waren mit einem nervösen Strich durchgestrichen. Darunter waren einige Notizen gekritzelt: Trunkenheit in der Öffentlichkeit, Rebellion, Körperverletzung, Beleidigung eines Polizisten, Ruhestörung, Todesdrohungen, Zerstörung von städtischem Eigentum…
„Angesichts der vielen Dummheiten, die du während deines Saufgelages gemacht hast, hätte es mich nicht einmal überrascht, eine Leiche auf der Moskwa treibend zu finden, in deren Stirn dein Name mit einem Messer eingeritzt ist. In einem dieser Avtozaks wärst du gelandet, wenn ich dich nicht zuerst in die Finger bekommen hätte.“
Tschekov deutete auf die unheimlichen Zellentransporter der Polizei, die mit leeren Bäuchen zum Majakowskaja-Platz fuhren, wo eine Antikorruptionsdemonstration stattfand.
„Der Boss ist in Bedrängnis. Pankowski war bereit, einen Haftbefehl gegen dich auszustellen.“
Alexej zuckte gleichgültig mit den Schultern. Er hatte keinen Respekt vor Anatoli Pankowski, seinem Vorgesetzten. Er war ein Bürokrat, der weder durch Mut noch durch Charisma glänzte. Er war der Typ, der seine Männer opfern würde, wenn seine Karriere bedroht war.
„Wenn wir anfangen, die Moskauer Polizisten zu verhaften, die zu viel saufen, müssen wir eine Menge Gefängnisse wieder eröffnen“, sagte er und gähnte.
Tschekov hätte sich vor Wut fast verschluckt. „Genau, mach nur Spaß! Inzwischen ist sogar dein Kumpel Stachin wegen deines Verschwindens ausgeflippt. Dieser verdammte Dealer, mit seinen Neonazis im Schlepptau. Wieso bist du mit so einem Arsch befreundet?“
„Kita?“, fragte er überrascht.
„Ja, Nikita Stachin. Er ist am Sonntagabend bei mir aufgetaucht. Kannst du dir vorstellen, wie froh ich darüber war, dass ein verdammter Drogendealer in meiner Wohnung auftaucht? Er wollte dich um jeden Preis sehen.“
„Warum?“
„Keine Ahnung: Das musst du ihn selbst fragen. Aber es muss etwas Wichtiges sein. Er hat mir einen schönen Batzen Geld gegeben, damit ich dich finde.“
Alexej zwang sich zu einem Lächeln. „Und ich dachte, du hättest mich abgeholt, weil du dir Sorgen um meine Gesundheit gemacht hast.“
„Ich habe dich ein Dutzend Mal angerufen, bevor er mich kontaktiert hat“, protestierte Tschekov.
„Wenn du eines Tages verschwindest, werde ich nicht darauf warten, dass mich jemand dafür bezahlt, nach dir zu suchen.“
Genervt schnalzte Tschekov mit der Zunge gegen seinen Gaumen. „Komm mir nicht mit dieser Nummer, Alexej. Nicht ich habe es vermasselt, sondern du. Was hast du dir dabei gedacht, dich dermaßen zu betrinken? War es wegen Marina?“
Bei der Erwähnung seiner Exfrau presste Alexej die Kiefer fest zusammen und weckte damit den Schmerz, der in seiner Schädeldecke lauerte. Er starrte mit trockenen Augen in das Schweigen des Raumes und versuchte, sich zu erinnern. Ein Erinnerungsfetzen war eine heftige, schmerzhafte, fast greifbare Spannung, die in der Luft hing.
Jetzt fehlten ihm diese Momente, das gemeinsame Leben, die Farben und die Geräusche: der Klang ihrer vertrauten Stimme, ihre Anwesenheit und ihr Lächeln, das Lachen und die Tränen. Das Glück und die Ausgelassenheit, das Bedürfnis nach Liebe, nach Sex mit seiner Frau. Er hatte es versaut.
„Hast du mit ihr gesprochen?“, fragte er.
„Niemand konnte mir sagen, wo du bist, also bin ich zu ihr gegangen. Sie sagte mir, dass sie bald wieder heiraten werde. Hat das alles ausgelöst?“
„Ich will nicht darüber reden.“
Tschekovs Handy klingelte zum richtigen Zeitpunkt, er nahm ab. Ende der ersten Runde, das Verhör würde später fortgesetzt werden. Alexej blickte aus dem Fenster. Die Straßen von Moskau zogen vorbei, bis sich seine Augenlider schlossen und er in den Schlaf glitt. Als er aufwachte, stand der Wagen bereits vor dem Gebäude, in dem sich seine Wohnung befand, einem großbürgerlichen Gebäude aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg.
„Los, beweg dich!“, forderte Tschekov ihn auf und schüttelte ihn leicht.
Alexej streckte sich gähnend und stieg dann aus dem Auto aus. Sie betraten die Eingangshalle des Gebäudes und gingen die Treppen zu seiner Wohnung hinauf. Während er in seinen Taschen nach seinen Schlüsseln suchte, betrachtete Tschekov überrascht die fünf Klingeln an seiner Haustür.
„Du wohnst in einer Kommunalka?“
Alexej nickte. Seit seiner Scheidung hatte er ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft gemietet, eine Art Zeitanomalie aus den schmerzhaften Anfängen der UdSSR, als die Sowjets versucht hatten, die Wohnungsnot zu beheben, indem sie die Wohnungen der Reichen beschlagnahmten und sie in so viele Parzellen aufteilten, wie es Zimmer gab. Fünf Mitbewohner teilten sich seine Kommunalka, und folglich gab es in den Gemeinschaftsräumen alles in fünffacher Ausführung. Fünf Seifen im Badezimmer, fünf Gaskocher in der Küche, fünf Geschirrtücher neben den Spülbecken, fünf Waschmaschinen und natürlich fünf Stromzähler, um den Verbrauch von fünf pleitegegangenen Moskauern zu messen.
„Geh duschen“, sagte Tschekov, „ich rufe Pankowski an. Und während du dich einseifst, versuchst du darüber nachzudenken, was Stachin von dir will“, fügte er hinzu, während er den Flur hinauf ins Badezimmer ging.
Da keiner bereit war, auch nur die geringsten Ausgaben für die Instandhaltung der Gemeinschaftsräume zu tätigen, befanden sich diese in einem erbärmlichen Zustand. Der Wasserhahn am Waschbecken schwitzte rostiges Wasser, der Boden der Badewanne war von schwärzlichen Flecken zerfressen und die gelben und grünen Fliesen an den Wänden waren an einigen Stellen abgefallen und gaben den Blick auf den Beton frei. Um zu verhindern, dass sich andere lösten, hatte man eine Plastikplane an die Wand neben der Badewanne geklebt, die der Feuchtigkeit stark ausgesetzt war.
Er stand lange Zeit regungslos unter den lauwarmen Wasserstrahlen und schrubbte sich dann schlaff mit einem großen Stück Seife, das einem seiner Mitbewohner gehört hatte, einem Tussi-Ding, das nach Vanille und Aprikose roch. Der Boden der Badewanne war glatt und seine Bewegungen unsicher. Er war unfähig, in dieser feindlichen Umgebung das Gleichgewicht zu halten und stützte seinen Kopf gegen die Fliesen, um nicht zu stürzen, während er sich erst den einen und dann den anderen Fuß wusch.
Als er aus der Dusche kam, war sein Kopf etwas klarer, aber er wusste immer noch nicht, warum Stachin ihn sehen wollte. Hatte es etwas mit dem zu tun, was er womöglich am Wochenende getan hatte? Er warf einen Blick auf seine Kleidung. Die Hose, eine dunkelblaue Jeans, war steif von den Flüssigkeiten, die sie aufgenommen hatte – Alkohol, Schweiß und vor allem Blut. Als er sich auf die braunen Flecken konzentrierte, tauchten Erinnerungen auf, wie eine Blase, die an der Oberfläche eines Champagnerglases zerplatzte: Soldaten, die von der Front zurückkehrten, während ihre Kameraden in Leichensäcke steckten. Gefangene, die auf die Ladefläche eines Lastwagens geworfen wurden und denen Blut auf das Hemd gespuckt wurde. An Stühle gefesselte Männer, die mit Gewehrkolben geschlagen wurden. Das Bild eines Panzers, der die Kreuzung einer aschfahlen Stadt bewachte, drängte sich ihm auf. Sie waren weit weg von Moskau, in einem Land, in dem die Menschen zum Beten auf die Knie gingen. Nein, nicht in einem anderen Land, in seinem Land, in den Bergen des Kaukasus, in Tschetschenien, vor vielen Jahren. Ein Land, das betongrau, gittergrün und blutrot war.
Er hielt seinen Kopf mit beiden Händen fest. Es war unmöglich, seine jüngsten Erinnerungen zu verarbeiten, da das ganze Chaos, das auf eine Inventur wartete, seinen Geist verstopfte. Er brauchte andere Gegenstände, auf die er sich konzentrieren konnte. Er zog die Sachen, die man ihm im Krankenhaus zurückgegeben hatte, aus seinen Taschen. Versuche, dich daran zu erinnern, was du in den letzten Tagen getan hast, dachte er.
Alexej Markow, geboren 1978 in der UdSSR, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, ein Land, das 1991 starb. Staatsbürger der Russischen Föderation. Achtzehn Jahre bei der Polizei. Seit fast zwei Jahren von seiner Frau Marina geschieden. Nichtraucher, seit der Geburt seiner Tochter…
Erster Fehler.
Er starrte mit einer Mischung aus Überraschung und Enttäuschung auf die Zigarettenschachtel in seiner Hand. Sofort stieg das Bedürfnis in ihm auf, stark und zwingend. Er zündete sich eine Zigarette an und öffnete das Badezimmerfenster, um den Rauch abzulassen.
Nachdem er eine Zigarette geraucht hatte, setzte er seine Ermittlungen an sich selbst fort. Der Schlüsselbund mit einer Matrjoschka, die an einer Kette hing, brachte ihm wenig Informationen. Es war der Schlüssel zu seinem Auto. Auf dem Sockel der russischen Puppe stand in der Kalligraphie eines fleißigen Kindes ‚Tassia‘ geschrieben. Seine Tochter Anastassia hatte sie ihm vor langer Zeit geschenkt. Die Farbe war an manchen Stellen verblasst, obwohl er darauf achtete, ab und zu mit Klarlack drüber zu pinseln, damit sie länger hielt.
Er betrachtete seine Brieftasche genauer. Sie war vollgestopft mit Geldscheinen, die er vor ein paar Tagen von seinem Bankkonto abgehoben hatte – Geld, das man für schlechte Zeiten aufbewahren sollte. Zwischen zwei Visitenkarten eingeklemmt fand er Quittungen für Wodkatouren . Eine davon war aus der Fankneipe, in der er mit den Skinheads aneinandergeraten war. Insgeheim wusste er, dass er nicht zufällig in diese Bar gegangen war, dass er gehofft hatte, dort solche Typen zu finden, die dumm oder betrunken genug waren, um sich mit ihm zu prügeln, um all die Wut und den Frust in ihm loszuwerden, die sich seit Tagen angestaut hatten. Die Skins waren die perfekten Kandidaten gewesen. Sie hatten eine Tracht Prügel bezogen, aber er erinnerte sich, dass sie noch am Leben waren, als man sich getrennt hatte. Sie lehnten an einer Wand und spuckten Blut zwischen ihren gelockerten Zähnen, aber sie lebten.
Er ging in Gedanken zum nächsten Beweisstück, einem kleinen leeren Fläschchen, das er sofort erkannte. Zu seiner Schande handelte es sich um eine Hundert-Milliliter-Flasche Bojaryschnik, ein Weißdornpräparat, das normalerweise als Badeöl verwendet wurde. Aber in Russland wusste jeder, dass Weißdornöl das Reserverad eines Alkoholikers oder des Betrunkenen war: Selbst wenn die Geschäfte und Bars geschlossen hatten, konnte man es in Automaten auf der Straße kaufen. Das Getränk hatte drei große Vorteile: Es enthielt bis zu 90% Alkohol, war problemlos zu bekommen, weil es nicht den Beschränkungen für Spirituosen unterlag, und kostete nur eine Handvoll Rubel. Als Bonus war es weniger eklig als Eau de Cologne und weniger gefährlich als Frostschutzmittel. Obwohl: Im Jahr zuvor waren in einer schäbigen sibirischen Siedlung Dutzende von Menschen gestorben, nachdem sie Fläschchen mit gepanschtem Bojaryschnik getrunken hatten. Der örtliche Badeöl-Hersteller hatte Ethanol durch Methanol ersetzt, ein tödliches Gift für den Körper.
Wir leben in einer fabelhaften Welt, dachte er voller Ironie und warf das Fläschchen Weißdorn in den Mülleimer neben dem Waschbecken.
Letzter Gegenstand in der Brieftasche: ein kleines Stück Papier, ähnlich einer Kreditkartenquittung, so dünn, dass man fast hindurchsehen konnte. Es war eine Fahrkarte für eine elektrichka, einen Vorortzug. Er hatte sie in Ljubertsy gekauft, der Stadt, in der er und seine Frau vor ihrer Scheidung gelebt hatten. Marina hatte dort immer noch ihre alte Dreizimmerwohnung gemietet, nur dass sie jetzt mit ihrem neuen Freund dort wohnte. Als er sie besuchen wollte, war alles schief gelaufen. Um genug Mut zu finden, hatte er angefangen zu trinken. Zu viel zu trinken. Schließlich war er zu ihrem Haus getorkelt, die Stockwerke hinaufgestiegen und hatte dann, als er an die Tür klopfen wollte, kalte Füße bekommen. Hinter der Haustür hörte er das fröhliche Gelächter von Tassia und Marina. Die Momente ihrer Liebe zogen an ihm vorbei. Marina, Ehefrau, Mutter, Freundin und Geliebte. Ein Leben voller Freude, Schamlosigkeit, Unbekümmertheit, Gerüchen, Stille, berauschenden Augenblicken. Dann hörte er auch die Stimme des Anderen. In diesem Moment war ihm klar geworden, dass es über seine Kräfte ging, mit ihnen zu sprechen. Also war er in die Nacht hinausgegangen und ein paar Tage später in einem Krankenhaus aufgewacht.
Er verließ das Badezimmer mit einem um die Hüfte gewickelten Handtuch. In der Küche duftete es nach frischgebrühtem Kaffee. Tschekov saß dort mit dem Telefon am Ohr und stritt sich mit Pankowski. Alexej ging in sein Zimmer. Es war spärlich möbliert und bestand nur aus einem Bett, einem Schrank, einem Sessel und einem niedrigen Tisch, auf dem einige Dosen Jigoulewskoje-Bier neben einem Fotoalbum standen. Es enthielt Schnappschüsse, die vor etwa zehn Jahren mit einer Kamera aufgenommen worden waren. Erinnerungen an glücklichen Zeiten mit Tassia und Marina.
Er griff im Schrank nach einem Wollpullover mit glänzenden, abgenutzten Ellenbogen und zog ihn über ein T-Shirt, mit dem Porträt von Kurt Cobain und dem falsch geschriebenen Bandnamen Nirvana, an. Der größte Teil seines Kleiderschranks schlummerte noch immer in einem Umzugskarton, irgendwo am Stadtrand von Moskau. Hier hatte er keinen Platz, um alles unterzubringen. Außerdem würde ein kompletter Umzug bedeuten, dass er zugeben müsste, dass zwischen ihm und Marina alles vorbei war.
Seine Kopfschmerzen attackierten ihn wieder. Er griff nach einem Plastikbeutel aus dem Apothekerschränkchen, das bis zum Rand mit Medikamenten gefüllt war. Wahrscheinlich eine alte sowjetische Gewohnheit, aus einer Zeit, in der man sich nie sicher sein konnte, ob die Apotheken Medizin vorrätig hatten.
„Pankowski will, dass du sofort auf dem Kommissariat erscheinst“, verkündete eine rockige Stimme.
Alexej drehte sich um. Tschekov stand im Türrahmen.
„Was hast du ihm geantwortet?“
„Dass du krank bist, damit wir Stachin in Ruhe besuchen können. Er will dich so schnell wie möglich sehen.“
Er griff nach zwei Tabletten und schluckte sie unter den besorgten Augen seines Teamkollegen.
„Alexej, was ist passiert, was dich dermaßen hat abstürzen lassen? Ich kenne dich lange genug, um zu wissen, dass du kein Engel bist, aber vier oder fünf Tage lang Koma-Saufen und nicht zur Arbeit zu kommen, das ist Neuland.“
„Lass es gut sein, Tolja. Bring mich zu Stachin“, wich er aus.
KAPITEL 5
Moskau
Nikita Stachin betrieb in einem südlichen Vorort von Moskau einen Schlachthof mit einer Metzgerei, in der er die besten Würste der Gegend herstellte. Ein Gerücht besagte, dass er damit die Leichen von Menschen verschwinden ließ, die sich ihm widersetzten, aber das war wohl nur ein Geschwätz, das von bösen Zungen verbreitet wurde. Alexej hoffte das, da er von den Treffen oft mit ein oder zwei Kilo frisch gehacktem Fleisch nach Hause ging.