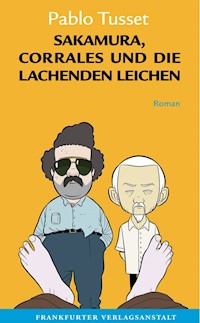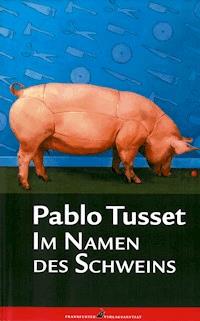Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Frankfurter Verlagsanstalt
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Oxford 7 ist ein spannendes Science-Fiction-Abenteuer, das in gewohnt schräger Manier von einer futuristischen Welt mit all ihren Absurditäten erzählt. Es sind die späten Achtziger, allerdings die des 21. Jahrhunderts. Die Menschen haben ihren Lebensraum auf das Universum ausgedehnt, interplanetare Firmen wie Coca-Cola und Apple bestimmen als Sponsoren den Lehrplan der Universitäten, und Krankenkassen wachen minutiös über den individuellen Kalorien-, Fett- und Alkoholverbrauch. In der Space-Universität Oxford 7 sieht man durch die künstliche Atmosphäre Earth, Moon und Sun, das Vogelgezwitscher wird pünktlich zum Wechsel der Tages- und Nachtseite angestellt, und die Schwerkraft liegt unverändert bei eins Komma eins, etwas schwerer als auf der Erde. Nur eines bringt die eingespielten Abläufe aus dem Takt: die Studentenproteste. Ständige Kontrolle, keine Prä-Computermusik auf dem Zimmer, keine Kerzen, keine Partys: Der Wunsch nach mehr Freiheit und weniger Sicherheit ist bei den Studenten erwacht. Dekanin Emily Deckart, bekannt für ihre Unnachgiebigkeit und ihre spitzen Absätze, klappert den Gang entlang zur Krisenkonferenz, bereit, den Aufstand niederzuschlagen. Zur gleichen Zeit finden sich die Studenten Mam'zelle, BB und Marcuse bei ihrem alten Professor Palaiopoulous ein. Sie haben einen Plan, wie sie Deckart endgültig loswerden können. Mit Hilfe des Draufgängers Rick, der sie in seinem alten Shuttle und dank einiger Tricks durch die Sicherheitsschleusen bringt, fliegen sie zur Erde. Ihr Ziel: Barcelona. Sie wollen einen berüchtigten Systemgegner finden, der in ihrem Plan die Schlüsselrolle spielt. Doch dieser Franz von Assisi ist gefährlicher, als sie dachten ... Pablo Tussets neuer Roman ist ein spannendes und unterhaltsames Science-Fiction-Abenteuer, das uns mit großem Humor eine futuristische Welt mit all ihren absurden Details vor Augen führt: eine wohlmeinende wie totale Überwachungsgesellschaft, die so weit gar nicht mehr entfernt scheint. Und der Autor wirbelt den Leser so durch die Geschichte, dass dieser sich fragen muss: Wer ist denn nun der Bösewicht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 303
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Es sind die späten Achtziger, allerdings die des 21. Jahrhunderts. Die Menschen haben ihren Lebensraum auf das Universum ausgedehnt, interplanetare Firmen wie Coca-Cola und Apple bestimmen als Sponsoren den Lehrplan der Universitäten, und Krankenkassen wachen minutiös über den individuellen Kalorien-, Fett- und Alkoholverbrauch. In der Space-Universität Oxford 7 sieht man durch die künstliche Atmosphäre Earth, Moon und Sun, das Vogelgezwitscher wird pünktlich zum Wechsel der Tages- und Nachtseite angestellt, und die Schwerkraft liegt unverändert bei eins Komma eins, etwas schwerer als auf der Erde. Nur eines bringt die eingespielten Abläufe aus dem Takt: die Studentenproteste. Ständige Kontrolle, keine Prä-Computermusik auf dem Zimmer, keine Kerzen, keine Partys: Der Wunsch nach mehr Freiheit und weniger Sicherheit ist bei den Studenten erwacht. Dekanin Emily Deckart, bekannt für ihre Unnachgiebigkeit und ihre spitzen Absätze, klappert den Gang entlang zur Krisenkonferenz, bereit, den Aufstand niederzuschlagen. Zur gleichen Zeit finden sich die Studenten Mam’zelle, BB und Marcuse bei ihrem alten Professor Palaiopoulous ein. Sie haben einen Plan, wie sie Deckart endgültig loswerden können. Mit Hilfe des Draufgängers Rick, der sie in seinem alten Shuttle und dank einiger Tricks durch die Sicherheitsschleusen bringt, fliegen sie zur Erde. Ihr Ziel: Barcelona. Sie wollen einen berüchtigten Systemgegner finden, der in ihrem Plan die Schlüsselrolle spielt. Doch dieser Franz von Assisi ist gefährlicher, als sie dachten …
Pablo Tussets neuer Roman ist ein spannendes und unterhaltsames Science-Fiction-Abenteuer, das uns mit großem Humor eine futuristische Welt mit all ihren absurden Details vor Augen führt: eine wohlmeinende wie totale Überwachungsgesellschaft, die so weit gar nicht mehr entfernt scheint. Und der Autor wirbelt den Leser so durch die Geschichte, dass dieser sich fragen muss: Wer ist denn nun der Bösewicht?
PABLO TUSSET
OXFORD 7
Roman
Aus dem Spanischen von Ralph Amann
EINS
Es regnet bestialisch.
Die Wohnung ist lang und schmal, sie besitzt ein einziges Fenster zur Tagseite der Space-Station. Professor Sirhan Palaiopoulos schaut hinaus in den Regen, der wie ein Perlenvorhang vom Himmel fällt. Dieses Wetter ist nicht programmiert, die Universitätsleitung hat es ausdrücklich gewünscht, um die Demonstranten umzustimmen.
Ein Taxi hält vor dem Waldorf Astoria. Der Fahrer steigt aus, beeilt sich, um nicht nass zu werden, und öffnet den Kofferraum. Der Hotelportier verstaut das Gepäck eines Paares, beide um die hundert Jahre alt, das unter der Markise Schutz gesucht hat. Offenbar Besucher. Die Mutter eines Studenten mit ihrem Begleiter. Viele Besucher reisen überstürzt ab, zurück on Earth, aus Sorge, der Space-Port könnte wegen der Unruhen seine Abflughalle schließen.
Der Professor beobachtet die Welt draußen nicht länger, sondern schaut auf seine iWatch. Es ist 17:14 Uhr Ortszeit auf Oxford 7. Durch die Bewegung, mit der er auf die Uhr schaut, beginnt der linke Ellbogen zu schmerzen. Ein vertrauter Schmerz. Er strahlt nach kurzer Zeit vom Ellbogen bis in Brust und Schulter aus. Atemnot, kalter Schweiß sind die Folge, panische Angst.
Time to die.
Er hatte immer gedacht, dass der Tod sich als Erschöpfung, als Apathie ankündigen würde, nicht aber als Vorspiel eines Kampfs, den er unbedingt gewinnen muss.
Er schaut wieder hinaus und sieht einige Fahrzeuge der Polizei in Richtung Campus vorbeigleiten. Die Universitätsleitung ließ bekanntgeben, dass zusätzliche eintausendfünfhundert Sicherheitskräfte eines Sondereinsatzkommandos auf der Space-Station eingetroffen sind. Im Southern Cross College berechnete jemand das Verhältnis: Auf Oxford 7 kommt jetzt eine Sicherheitskraft auf fünf Studenten.
Die vielen Gleiter und Fußgänger auf der Hauptbahn tragen nicht gerade zur Beruhigung bei. Er schaut wieder auf seine iWatch. Bereits fünfzehn Minuten Verspätung. Marcuse und Mam’zelle stecken vermutlich im Verkehrschaos auf dem Campus fest. Eigenartig nur, dass BB nicht pünktlich ist.
Einen Augenblick lang scheint Frühlingsduft durch das große Plasmafenster in die Wohnung hineinzuströmen und sich mit dem Geruch nach Eukalyptus und Medikamenten zu vermischen, der in allen Räumen in der Luft liegt. Seit Tagen erhöht der Wetterdienst die Konzentration von Ozon und Allergenen. Wahrscheinlich hat es damit etwas zu tun.
Der Professor atmet tief durch, bevor er vom Fenster wegtritt. Er steckt den Music-Chip in den an der Wand hängenden Bildschirm. Zum Prasseln des Regens ertönt Dizzy Gillespies Trompete. Ein Musiker aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Das Gesundheitsdepartment hatte das Verbot erlassen, ohne Kopfhörer in Wohngemeinschaften Musik zu hören, die nicht von Computern erzeugt ist. Begründet wurde es damit, dass solche Musik die akademische Leistungsfähigkeit der Passivhörer beeinträchtigen könne. Die Studentenvertretung plädierte für eine Ausnahmeregelung, sofern sich alle Mitbewohner mit ihrer Unterschrift einverstanden erklärten. Das Department für statistische Psychiatrie hatte den Antrag jedoch abgelehnt. Dies könne tendenziell zu Nötigungen führen, behaupteten sie. Wer jetzt noch Jazz ohne Kopfhörer hörte, riskierte ein Bußgeld von zweihundert Eurodollar. Immerhin fällt es der Polizei schwer, Verstößen auf die Spur zu kommen, sofern niemand zuvor Anzeige erstattet hat.
Der Professor schaut nachdenklich auf ein Poster aus echtem Papier, das neben dem Bildschirm hängt. Die Schutzfolie, in die es eingeschweißt ist, sieht fast so alt aus wie das vergilbte Poster selbst. Ein Foto aus Casablanca: dem zweidimensionalen Film von Michael Curtiz. Der Professor hatte diesen Film zum ersten Mal als Jugendlicher gesehen. Mehr als ein Jahrhundert ist seitdem vergangen. Der Film spielt zur Zeit des ersten Atomkriegs und erzählt von Liebe und der Treue zu einem Ideal. Kein Wunder, dass die Kids ihn sich zu eigen gemacht haben, denkt der Professor. Das Poster zeigt den Innenraum eines gut besuchten Nachtlokals aus dem zwanzigsten Jahrhundert. Im Vordergrund singt ein Musiker an einem mit Arabesken verzierten Klavier aus der Präcomputerzeit. Neben ihm steht ein ganz in Weiß gekleideter Schauspieler: Humphrey Bogart. An den Tischen sitzen viele früh gealterte Menschen, Frauen und Männer, die sehr uneinheitlich gekleidet sind. Die Frauen tragen Röcke, die Männer Jacketts und Hosen. Fast alle sehen sehr blass aus und wiegen mindestens zwanzig Newton mehr, als ihnen die Krankenversicherungen heute ohne Zusatzgebühren durchgehen lassen würden.
Der Professor geht langsam durch einen langen Flur hinüber zu dem der Nachtseite zugewandten Teil der Wohnung. Alle paar Schritte bleibt er stehen und entfernt Paraffinreste vom Boden. Der Professor gibt ein Vermögen für Paraffinkerzen aus, die er mit echtem Feuer anzündet. Ein blühender Schwarzmarkt mit Kerzen ist entstanden – trotz hoher Bußgelder. Den Kids können siebenhundert Eurodollar direkt von ihrem Familienkonto eingezogen werden, wenn sie Kerzen in ihren Wohnungen anzünden. Die Kerzen stören die Sicherheitssysteme nicht, sind aber verboten, weil sie natürlichen Kohlenwasserstoff enthalten. Die Polizei bemerkte den Verbrauch, als der Bedarf an elektromagnetischer Energie sank.
Der Professor betritt das Bad. Er muss häufig urinieren. Danach wäscht er sich ausgiebig die Hände, um beim Warten etwas scheinbar Sinnvolles zu tun. Das Stück von Dizzy Gillespie ist zu Ende, und jetzt läuft April in Paris in der Version von Ella Fitzgerald, einer in der Epoche von Casablanca berühmten Sängerin. Die Waschbeckenarmatur übertönt die ersten Takte, erst quietscht sie wie ein lebendiges Tier und spuckt dann das Desinfektionsmittel ruckweise aus. Der Professor geht langsam zurück in den Flur. In dem winzigen Eingangsbereich bleibt er vor einem echten IKEA-Möbel stehen. Er bückt sich ein wenig, um es mit den Fingerspitzen zu berühren. Das macht er öfter. Es ist ein dreieckiges Beistelltischchen aus der legendären Lack-Serie. Reiner Kohlenwasserstoff, das Etikett klebt noch immer an der Unterseite. Ein Sammler on Earth würde ein Vermögen dafür hinblättern, aber der Professor hatte es trotzdem mit nach Oxford 7 genommen, selbst auf die Gefahr hin, dass es beim Zoll beschlagnahmt wird.
Fingerknöchel klopfen gegen die Tür und schrecken ihn auf. Tock tocktock, tock tocktock. Den Rhythmus des Klopfens kennt er gut. Er versucht sich zu beeilen, bewegt sich jedoch schwerfällig.
Als er öffnet, steht BB im Türrahmen. Außer Atem. Sehr blonde, sehr kurze Haare, durchnässt vom Regen, blaue Augen, Frau. Ihr laufen dicke, schmierige Regentropfen übers Gesicht. Der Rucksack hängt mit einem Riemen über ihrer Schulter.
Sie spricht mit nordamerikanischem Akzent:
»Diese miesen Arschlöcher«, flucht sie, »sie wollen Zehn-Eurodollar-Geldstrafen auf alles feuern, was sich draußen bewegt.«
»Gegen welchen Verstoß? Sie dürfen keine Strafen verhängen, solang nicht irgendein Vergehen vorliegt«, sagt Professor Palaiopoulos.
Er spricht, besser gesagt lispelt, wegen seines bionischen Gebisses, mit griechischem Akzent.
»Verordnung zum Ausstoß gasförmiger Abfälle: Auf der nicht genehmigten Demonstration wird über die Atemwege mehr Wasserdampf ausgestoßen, als im betreffenden Gebiet zulässig ist. Das haben sie per Megaphon im Corona Australis bekanntgegeben.«
Gut möglich, dass irgendeine Bestimmung in dieser Form tatsächlich existiert. Mittlerweile gibt es so viele Bestimmungen, dass man sie unmöglich alle kennen kann. Vermutlich hätten sie allein schon mit den Geldstrafen fürs Falschparken die Studenten im Zaum gehalten: Sie können bis zu vierhundertfünfzig Eurodollar kosten. Man sagt, dass seit dem letzten Trimester mehr Gleiter zugelassen wurden, als es Parkmöglichkeiten gibt, sodass es jeweils von den aktuellen Richtlinien der Polizei abhängt, ob man eine Strafe bekommt oder nicht. Die Universitätsleitung hat diese neue Strategie von New Berkeley übernommen. Einige Studenten, darunter wichtige Aktivisten, mussten ihre Immatrikulation rückgängig machen, um Widerstand gegen die Sanktionen zu leisten.
»Diese Schlange!«, flucht Professor Palaiopoulos. »Hast du die Instrumente dabei?«
»Ja«, sagt BB und holt ein kleines Lederetui aus ihrem Rucksack. »Wir müssen Wasser abkochen«, sagt sie.
Mam’zelle rutscht unruhig auf dem Sitz des Gleiters hin und her. Rote Haare, asymmetrische Frisur, glatt gekämmt, ringförmige Aluminiumohrringe. Frau.
Am Steuer sitzt Marcuse. Dunkle Haare, braungebrannt, kleine, auffällig schlanke Statur. Mann.
Die Verkehrslage ist nicht nur wegen des unerwarteten Regens viel komplizierter, als sie erwartet hatten. Hunderte von Studenten strömen zu Fuß oder in ihren Gleitern aus allen Richtungen auf den Campus. Es ist nicht mehr nur das übliche Verkehrschaos zu den Hauptverkehrszeiten, sondern Leute aus allen vier Vorlesungsreihen haben sich versammelt, darunter viele jüngere Professoren. Die Nebenbahnen, die zum Hauptgebäude auf den Campus führen, sind nahezu unbefahrbar. Seit einer Weile schon verschießt die Polizei keine Geldstrafen fürs Falschparken mehr. Sie erhielt dagegen die Anweisung, mit kompakten Gruppen die Hauptbahn auf den hydroponischen Grünflächen zu blockieren.
In einem unbewussten Anflug von Widerwillen streckt Mam’zelle sich auf dem Sitz und schaltet den Musikgenerator aus. In klassischem Englisch beginnt sie vor sich hin zu singen:
»I never knew the charm of spring / I never met it face to face …«
Sie hat einen französischen Akzent. Marcuse setzt ein und beendet die Strophe im Stil eines Louis Armstrong – ein anderer berühmter Musiker aus dem zwanzigsten Jahrhundert:
»Till April in Paris / Whom can I run to / What have you done to my heart.«
Marcuse hat einen britischen Akzent, den man beim Mitsingen allerdings nicht heraushört. Die beiden schauen sich an und lachen. Über ihnen zeichnet sich hinter den Himmelspaneelen Sun ab, im Modus der Abenddämmerung. Ein orangefarbener Effekt entsteht. Und wie sie die Studentenströme sehen, die trotz des Regens und trotz der Schwadronen von Sicherheitskräften unbeirrt an ihnen vorbeiziehen, glauben sie, einen magischen Moment zu erleben, den sie womöglich nie wieder vergessen werden.
Ihre Euphorie hält an, bis sie das Wohngebiet im Norden erreichen. Dort werden sie von einer Polizeikontrolle vor einer elektromagnetischen Schranke angehalten. Mam’zelle bleibt ruhig und überlässt es Marcuse, die Fragen zu beantworten. Marcuse ist besser darin, den Polizisten Rede und Antwort zu stehen.
»Wir kommen gerade aus einem Seminar«, sagt er ruhig.
»An welchem Institut seid ihr?«
Der Polizist fragt mit südamerikanischem Akzent. Er weiß genau, an welchen Instituten sie eingeschrieben sind: Fornax und Hounting Dogs. Das steht auf dem Bildschirm seines Geräts, mit dem er die unter ihre Haut gepflanzten Chips scannen kann. Da steht auch, dass sie vor einer halben Stunde die Kontrolle vor dem Institut der Emotionsdiplomwissenschaften und der Sexdiplomwissenschaften passierten, dass sie in einer Wohngemeinschaft in diesem Teil der Stadt leben, dass sie beide Studenten aus dem dritten Studienjahr sind und beide ein Stipendium erhalten, mit dem die Lebenshaltungskosten und die Studiengebühren gedeckt werden.
Was auch immer die Polizei von ihnen wissen wollte, sie könnte nahezu alles mit den Lesegeräten in Erfahrung bringen.
Aber die Polizisten stellen gern Fragen.
»Ich bin vom Hounting Dogs, und sie ist vom Fornax«, sagt Marcuse.
»Sind Sie nervös«, sagt der Polizist.
Weder Marcuse noch Mam’zelle sind sich sicher, ob das als Frage oder als Feststellung gemeint war.
»Nervös? Warum?«
»Ein Puls von dreiundneunzig Schlägen pro Minute«, der Polizist schaut auf den Bildschirm seines Lesegeräts und zeichnet dann mit der Spitze des Strafgebührenverteilers die Zahl 93 nach. Mam’zelles Puls beschleunigt sich ebenfalls. Sie muss darauf vertrauen, dass die Polizei sich nicht die Mühe macht, sich ihre Daten anzusehen.
»Hmm …«, Marcuse zögert, »ich bin mir nicht sicher, ob ich die letzte Kraftfahrzeugsteuer rechtzeitig bezahlt habe.«
Die Polizisten werden umgänglicher. Offenbar beschwichtigt es sie, wenn jemand seine Verstöße freiwillig eingesteht. Viele Studenten sind dazu bereit, weil sich die Bußgelder dann für sie um die Hälfte reduzieren. Das ist eine gute Möglichkeit, alle dazu zu bringen, sich aus Eigeninteresse selbst anzuzeigen.
»Zahlungen, die zu spät bei uns eingehen, kosten pro Tag zwanzig Eurodollar«, knurrt der Polizist.
»Sorry …«, entschuldigt sich Marcuse.
Der Polizist sucht die betreffenden Daten heraus. Es dauert eine Weile, bis er die Datei gefunden hat.
»Sie haben Glück«, sagt er. »Dreiundsiebzig Stunden bleiben Ihnen noch, um den Betrag zu überweisen. Haben Sie den Kalender mit den Fristen für Ihre Steuerzahlungen nicht erhalten?«
»Doch, tut mir leid, heute Morgen hatten wir eine Prüfung und …«
Die Polizisten interessieren sich nicht für Marcuses Prüfungen. Mit einem Mal wirken sie eher gelangweilt.
»Gut, fahren Sie weiter, und achten Sie künftig etwas gewissenhafter auf die Bezahlung Ihrer Steuern.«
Die elektromagnetische Schranke verschwindet, und der Gleiter schaltet die automatische Geschwindigkeitssteuerung des Wohnbezirks ein.
Mam’zelle und Marcuse atmen tief ein und langsam wieder aus.
Beiden zittern die Knie.
Mam’zelle presst die Oberschenkel fest aneinander.
»Puh, ich glaube, mich hat das ein bisschen erregt«, sagt sie.
Rick Blaine landete vor etwa fünf Stunden auf Oxford 7 und erhielt eine der letzten Landegenehmigungen im Zeitfenster am Vormittag. Hektisches Treiben herrscht seitdem in den Abflughallen. Mehrere Hundertjährige drängten ihn, sie mit seinem Shuttle zurück on Earth zu bringen. Sogar die Summe von fünfhundert Eurodollar über dem offiziellen Tarif hatte ihm jemand geboten. Viel weniger als das, was sie ihm bezahlen würden, wenn er noch ein paar Stunden wartete. Aber das ist nicht nur eine Frage des Geldes: Früher oder später muss man sich für einen Gefallen revanchieren, und sei es siebzig Jahre später.
Rick hatte eine Panne vorgetäuscht, um sich während des kurzen Aufenthalts die ganze Anlegeprozedur zu ersparen. Die Kosten für einen Landeplatz kann er so außerdem über die Versicherung abrechnen. Die gefälschte Versicherungsnummer hat ihm jemand von Solar MetLife besorgt, der ihm noch einen Gefallen schuldig gewesen war.
Am frühen Abend verspürt er keine Lust mehr, im Maschinenraum zu hocken und so zu tun, als würde er etwas reparieren. Er schwitzt. Solange sein Space-Shuttle auf der Wartungsrampe steht, kann er sich nicht einmal ein Pfeifchen in der Passagierkabine gönnen. Und wegen der Lautsprecherdurchsagen war an eine Siesta nicht zu denken. Außerdem stört ihn das Bauchkorsett, das er in der Öffentlichkeit immer trägt, um nicht aufzufallen. Die Universitäts-Space-Stations mag er nicht. Dieses Vokabular, das die Studenten von heute mit einem Mal wieder benutzen: Kompromiss, Freiheit, Widerstand gegen das System. Er hatte die Nachrichten von den Unruhen auf New Berkeley gehört. Alle haben die Nachrichten gehört. Die Studenten schreien ihre Parolen und liefern sich auf den Space-Stations des gesamten akademischen Rings Kämpfe mit den Sicherheitskräften. Eine gewisse Sympathie mag man für die protestierenden Studenten hegen, aber in seinem Alter weiß man einfach, dass sich das, was die Studenten das »System« nennen – einmal dahingestellt, was genau sie damit meinen –, bescheißen und benutzen, nicht aber in die Knie zwingen lässt. Schon gar nicht in direkter Konfrontation.
Gelangweilte Dreißigjährige aus reichem Hause.
Kleinkinder.
Er hofft, die Angelegenheit so schnell wie möglich hinter sich bringen zu können.
Vereinbart ist, dass er Punkt acht Uhr an einem bestimmten Ort ist, in der White Hart Tavern, und dort wartet. Bis dahin ist noch Zeit. Mit dem zuständigen Polizisten an der Wartungsrampe, der seine Schicht gerade begonnen hat, hat er gesprochen. Er kann sein Space-Shuttle unbesorgt stehen lassen und sich auf den schmalen Bahnen rund um den Space-Port auf die Suche nach der Bar machen. Vielleicht findet er auf dem Weg noch eine mit Raucherraum. Zu seiner Zeit als Student gab es solche Clubs. Damals hatte er mit Haschisch und Kokain gedealt. Seit die Haschisch- und Marihuana-Sprays in den Apotheken verkauft werden, raucht es niemand mehr. Und seit es Kokainpräparate als Tabletten gegen den Husten gibt, zieht sich niemand mehr das Zeug durch die Nase rein. Sie trinken lieber Speedy Ragweed. Und rauchen lieber Tabak. Rauchen Tabak und zünden sich diese stinkenden Paraffinkerzen an.
Allein bei dem Gedanken an Tabak befeuchten sich seine Nasenschleimhäute voller Vorfreude auf die starke Wirkung der Alkaloide. Auf diesen köstlichen Rausch, den sie ihm sofort verschaffen konnten.
Die Nikotin-Entzugserscheinungen sorgen dafür, dass er sich sofort auf den Weg macht.
Draußen vor dem Space-Port regnet es so stark, dass es seiner Meinung nach nicht ins gewöhnliche meteorologische Programm passt. Er läuft durch die Fußgängerzone rund um den Space-Port. Dreckig, labyrinthisch, ziemlich tot unter der Woche: typische Nachtseite einer Universitäts-Space-Station. Überall billige Buden, in denen man sich in virtuelle Realitäten begeben kann. Dann wieder eine Kneipe neben der anderen. Rick bleibt vor den dunklen Türen eines Etablissements stehen, das ultraviolett beleuchtet ist. »Sweet Dreams« heißt der Schuppen. Ein Plakat kündigt das neue erotische Programm für Jugendliche an. Five o’clock: Lust auf einen Tee mit Freundinnen deiner Mutter? Für das Anal-Special der Woche wirbt ein anderes Plakat: ein Besuch beim Proktologen.
Rick geht weiter. Eher zufällig, als er um die Ecke biegt, entdeckt er ein Schild mit dem weißen Hirsch, nach dem die Bar, die er sucht, benannt ist. Der Hirsch hüpft auf einem umgefallenen Baumstamm immer im Kreis. Darunter leuchtet auf dem Display in Laufschrift ein alter Spruch der Protestbewegung:
»Die Barrikade versperrt die Straße, öffnet aber den Weg.«
Rick kann sich beim Eintreten ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Mam’zelle und Marcuse haben endlich die Wohnung erreicht, es ist 17:34 Uhr, viel später als geplant. BB öffnet die Tür, hinter ihr Professor Palaiopoulos.
»Wir haben es nicht früher geschafft, die Anfahrt vom Campus war …«
Der Professor unterbricht Mam’zelles Entschuldigungen.
»Macht euch keine Sorgen. Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Hast du die Memory-Kapsel mitgebracht?«, fragt er Marcuse.
»Ja«, sagt Marcuse und klopft auf seine Hosentasche.
Sie gehen hinüber in das große Zimmer. Auf dem Tisch liegen auf einer weißen Kompresse bereits die chirurgischen Instrumente bereit, die BB mit kochendem Wasser sterilisiert hat. Ein altes Besteck aus der Glasvitrine, die bei den Mediziningenieuren steht. Das Schloss ließ sich mit einem Laserstift leichter knacken als gedacht. Authentische Instrumente, die früher in der Chirurgie verwendet wurden: Wundhaken, Skalpelle, Retraktoren, Klemmen, gerade und abgerundete Dissektionsscheren, Pinzetten mit und ohne Zähne …
Mam’zelle schaut sie sich mit sichtlichem Unbehagen an.
»Sehen aus wie Küchenbesteck. Hast du mit so etwas schon mal gearbeitet?«
»Im ersten Trimester, als wir Roborowskis seziert haben«, sagt BB. »Die Instrumente waren aus recycelbaren Materialien, sind im Prinzip aber gleich.«
»Tote Roborowskis?«
»In aller Regel haben sie das nicht überlebt … Dir schneide ich aber auch nicht den Bauch von unten bis oben auf. Professor, Sie dürfen jetzt als Einziger Alkohol trinken. Möchten Sie noch ein paar Schnäpse? Das würde die anästhesierende Wirkung der Eiswürfel unterstützen.«
Sirhan Palaiopoulos schüttelt den Kopf. Marcuse und Mam’zelle schauen BB forschend an.
»Bei euch tut es nicht so weh, versprochen. Jetzt macht mich nicht schon nervös, bevor es überhaupt losgeht.«
»Kann ich vorher masturbieren gehen, wäre das okay?«, fragt Mam’zelle. »Um mich etwas zu entspannen.«
Der Professor klatscht zweimal in die Hände, als wolle er wie vor seinen Veranstaltungen zur Präcomputerisierten Kinematographie um Ruhe bitten.
»Los, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir wissen alle, was jetzt zu tun ist!«, ruft er.
BB stellt die Desinfektionslampe auf und öffnet eine Packung mit sterilen Handschuhen. Dann rückt sie zwei Stühle vom Tisch und schaltet die Lampe an. Nachdem Marcuse, Mam’zelle und der Professor im Bad waren und sich gründlich die Hände und vor allem ihren linken Arm gewaschen haben, desinfizieren sie die Hautpartien mit antiseptischem Licht. Marcuse holt aus der Gefriertruhe die Eiswürfel, die bereits in Beuteln portioniert sind. Alle drei legen sich einen Beutel in die Armbeuge und winkeln den Arm an. Sie versuchen sich zu entspannen, während ein Stück mit arhythmischen Percussions und atonalen Kontrabassläufen von Charles Mingus läuft.
BB streift sich die Gummihandschuhe über und streckt die Hände in die Höhe.
»Kann mal jemand andere Musik machen, bitte? Ihr könnt nicht von mir verlangen, bei so einem Lärm mit einem Stahlskalpell herumzuoperieren.«
Marcuse schaut sich die Playlist an und sucht nach einem ruhigeren, langsameren Stück.
Die Stimme von Sarah Vaughan mischt sich unter das Prasseln des Unwetters:
Don’t know why, there’s no sun up in the sky
Stormy weather, since my man and I ain’t together
Keeps raining all the time.
Zuerst ist der Professor dran. BB schneidet die Haut seines Unterarms etwa fünf Millimeter ein. Der Professor schaut an die Decke. Er spürt fast nichts. Die Spannung der Haut sorgt dafür, dass die Wunde aufreißt und Blut herausquillt. BB trocknet die Stelle mit einem osmotischen Tupfer. Sobald die Blutung gestillt ist, wechselt sie die Klinge im Skalpell und dreht sich zu Mam’zelle um. An ihrem Arm vollführt sie den gleichen Schnitt. Als auch diese Wunde trocken ist, legt sie das Skalpell auf die Kompresse zurück und nimmt sich eine der Pinzetten. Mam’zelle möchte sich ihre Wunde nicht ansehen. BB stochert mit der Pinzette darin herum, bis sie den unter der Haut eingepflanzten Chip erwischt hat. Er hat etwa den Umfang einer Linse, an der allerdings winzige Titanfüßchen hängen, die wie eine Zecke in den glatten Beugemuskel gekrallt sind. BB hält den Chip mit der Pinzette fest. Sie strahlt ihn mit antiseptischem Licht ab, bis die silberne Farbe unter dem Blut wieder zum Vorschein kommt. Danach wechselt sie die Pinzette.
»Bereit?«, fragt sie den Professor.
Zustimmendes Gemurmel. Der Professor schaut weiterhin an die Decke.
»Gut, dann wollen wir.«
Mit äußerster Sorgfalt führt BB Mam’zelles Chip in die kleine offene Wunde am Arm des Professors ein. Mit der Pinzette spürt sie den anderen Chip, der dort bereits liegt, und fixiert den neuen direkt daneben. Sie drückt ein wenig, damit die Titaniumfüßchen sich fest ins Muskelgewebe beißen. Sofort fließt wieder Blut, und BB versorgt die Wunde. Danach legt der Professor sich den Eisbeutel wieder auf den rot gewordenen Verband, um die Wunde zu kühlen.
Als Nächstes wird Mam’zelles Wunde genäht. BB kann sich eine gewisse Theatralik nicht verkneifen und wischt sich mit dem Armrücken über die Stirn – so wie sie es in alten Filmen bei vor Konzentration schwitzenden Chirurgen gesehen hat.
»Gut: Diesen Schnitt kann ich mit einem Stich nähen, das würde ich mit einem gefüllten Truthahn auch nicht anders machen. Hey! Was zum Teufel ist in dich gefahren?«
Die Frage richtet sich an Marcuse, der den Fehler begangen hat, ihr über die Schulter zu schauen.
Wie andere akademische Satelliten auch, etwa New Berkeley oder Sorbonne Réseau, verlor Oxford 7 schon vor Jahrzehnten nahezu jegliche Bindung an die Heimatuniversität on Earth. Gleichwohl ist der Sozialrat auf dem Campus im Aldous-Huxley-Tower untergebracht, der noch immer nach dem berühmten Studenten der Heimatuniversität benannt ist. Fast fünfzig Stockwerke ist der Turm hoch, steht mitten auf dem Campus im hydroponischen Park. Von den oberen zehn Stockwerken bietet sich ein Blick über fast die gesamte Tagesseite der Space-Station sowie auf einen schmalen Streifen der Nachtseite. Die Grenze zwischen beiden Seiten wird fein säuberlich von einem breiten Bogen markiert, jenseits des Bogens werden die Straßen und Gebäude mit elektromagnetischen Lampen beleuchtet. Schaut man auf die Nachtseite, sieht man Earth und Moon am Himmel stehen. Earth sieht aus wie eine überdimensional große blaue Traube, Moon ist klein, schimmert gelblich weiß und sieht aus wie eine im Universum schwebende weiße Bohne. Das Licht von Sun wird auf der anderen Seite des Bogens von Himmelspaneelen gefiltert, und sobald es sich im Wasser bricht, das aus den Sprühköpfen herabregnet, entsteht dort ein zarter Regenbogen. Oben vom Turm aus kann man die verschiedenen Colleges des Campus erkennen – sowie einen immer größer werdenden dunklen Pulk: die Studenten, die sich im Park versammeln. Sie schwärmen an den akkurat in Form eines Rechtecks auf dem Rasen postierten Polizeieinheiten vorbei.
Die Rektorin, Emily Deckard, steht mit verschränkten Armen am Fenster und muss bei dem Anblick an die trügerischen Perspektiven von Eschers Kunstwerken denken.
Tausende von Zwergen laufen über einen surrealen Ort.
Sie dreht sich vom Fenster weg und geht ins Bad.
»Optionen«, ruft sie und schaut in den Spiegel. Ihr Akzent ist nahezu unmerklich nordamerikanisch.
Die Stimme eines Computers ertönt.
»Prüfen Sie links im Nacken die Krawattenschleife.«
Ein kleines Bild von ihrem Nacken erscheint auf der spiegelnden Oberfläche. An einer Stelle schaut die blaue Krawatte ein wenig unter dem blütenweißen nanotechnischen Hemdkragen hervor. Die Rektorin bringt den Krawattenknoten in Ordnung. Ein grünes Licht leuchtet auf, und das kleine Bild verschwindet dann mit einem Ping.
»Parfüm«, ruft sie, »individuelle Komposition: Entschlossenheit, Kraft«, sie überlegt kurz, »Gefahr. Dauer: für zwei Stunden. Korrektur: für vier Stunden. Mittlere Konzentration. Keine weiteren Kriterien.«
Das Parfüm des Tages wird zusammengestellt. Drei Sekunden später rieselt der Duft aus einem Zerstäuber an der Decke herab. Die Rektorin streckt mit geschlossenen Augen die Arme aus und schnuppert. Zitrusfrucht, Leder … und ein leicht fauliger Geruch, wohl künstlicher Moschus.
Sie geht wieder hinüber in den großen Raum ihres Arbeitsbereichs.
»Kommunikator!«, ruft sie laut. »Privatsekretär.«
»Jawohl, Rektorin«, antwortet eine weitere körperlose, diesmal eindeutig menschliche, männliche Stimme.
»Sind alle eingetroffen?«
»Bis jetzt noch nicht. Der Gewerkschaftsdelegierte fehlt noch.«
»Aha. Wir haben lange genug gewartet. Dann fangen wir ohne ihn an. Ich bin in zwei Minuten im Konferenzraum.«
Zufrieden lauscht sie ihren Schritten auf dem Korridor: klack, klack, klack, klack. Den alten Teppichboden hatte sie als eine ihrer ersten Amtshandlungen durch einen Natursteinboden ersetzen lassen, der stets frisch poliert wird. Allein schon der Klang dieses wunderbaren Materials schmeichelt ihren Schritten. Einige Mitarbeiter waren verwundert, als eine Superdoktorin und Emotionsingenieurin eine Veränderung vornehmen ließ, die auf den ersten Blick so wenig mit Psychologie zu tun hatte. Sie verbuchten dies eher als sündhaft teuren ästhetischen Spleen.
Ihre Schritte auf diesem Boden sind schnell, nie aber so schnell, dass die Rektorin ihren Gang auf dem Weg in den Konferenzraum vor den sich automatisch öffnenden Stahltüren verlangsamen müsste. Auf diese Weise, klack, klack, klack, klack, betritt sie ihn mit angemessener Natürlichkeit und erinnert an einen Kometen auf seiner Laufbahn. Messerscharf, unerbittlich und heute leicht nach Zitrusfrucht, Leder und Moschus duftend.
»Guten Tag«, begrüßt sie die Anwesenden.
Sie bleibt erst stehen, als sie den Stuhl mit der höchsten Rückenlehne erreicht hat und Platz nimmt. Mit dem Zeigefinger berührt sie den Tisch, um den Bildschirm zu aktivieren. Einige stehen noch herum, plaudern miteinander oder schauen durch die Fensterscheiben hinaus auf die Demonstration. Alle begrüßen sie. In dem Stimmengewirr, allgemeinen Stühlerücken und Umhergelaufe ist kaum ein Wort zu verstehen.
Als alle ihre Plätze eingenommen haben und es ruhig geworden ist, legt die Rektorin ihre Fingerkuppen aneinander, winkelt die Arme an und stützt die Ellbogen auf dem Tisch ab.
»Also gut«, beginnt sie, »dies ist keine gewöhnliche Sitzung, und daher haben wir keine Tagesordnung, aber wie Sie sich gewiss vorstellen können, sind wir wegen der illegalen Studentendemonstrationen auf dem Campus hier zusammengekommen. Falls Sie keine Bemerkungen oder Fragen haben, erläutere ich Ihnen die von uns bisher ergriffenen Maßnahmen. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen?«
Der Studentenvertreter ist ein achtunddreißigjähriger junger Mann. Name: Leroy Torres. Hautfarbe: weiß. Trilby-Hut aus gelbem Gamsleder. Er hebt seine Hand. Sein Akzent ist südamerikanisch, argentinisch.
»Einige Kommilitonen haben mir berichtet, dass an mehreren Colleges über Lautsprecher angedroht wurde, ohne weiteres unbegrenzt Geldstrafen zu verteilen, und das wäre, nur damit das klar ist …«
Die Rektorin bringt ihn mit einer Bewegung der linken Hand zum Schweigen.
»Auf Fragen dieser Art gehe ich dann ein, wenn ich die Beschlüsse erläutert habe. Voraussichtlich dürften sie sich bis dahin von selbst erledigt haben. Wenn Sie erlauben, würde ich Sie daher noch um etwas Geduld bitten. Gibt es weitere Fragen?«
Schweigen. Nur ein leises Schnauben von Leroy Torres ist zu hören und ein Räuspern des Professorenvertreters. Name: Karl Marsalis. Lehrstuhl am Institut für Präcomputer-Heavy-Metal. Er sieht aus wie alle seine Slide-Guitar-Studenten mit den Nietenarmbändern und seiner nanotechnischen Lederjacke.
»Okay«, die Rektorin berührt mit dem Zeigefinger mehrfach den Bildschirm, bevor sie erneut die Fingerkuppen aneinanderpresst. »Um die Sicherheit unserer Studenten zu gewährleisten, mussten wir wegen der Vorfälle eine ganze Reihe von Vorkehrungen treffen. Ich gehe sie jetzt schnell der Reihe nach durch.
Erstens: Wie bereits bekanntgegeben wurde, haben wir unsere Sondereinsatzkommandos mit eintausendfünfhundert privaten Sicherheitskräften verstärkt, solange die Situation dies erforderlich macht. Die anfallenden Kosten werden wir in vollem Umfang auf die Studiengebühren im nächsten Trimester umlegen. Mit Ausnahme von …«
»Was?«, ruft Leroy Torres. »Das sind Sondereinsatzkommandos. Sie fordern eintausendfünfhundert zusätzliche Sicherheitskräfte an und lassen sie sich von uns bezahlen?«
Die Rektorin hält inne und schaut, ohne die Fingerkuppen auseinanderzunehmen, den Delegierten an. Dadurch fühlt der junge Mann sich aufgefordert, weiterzureden:
»Das können Sie nicht … Sie können uns doch solche Kosten nicht eins zu eins aufdrücken. Das ist … Das wäre … Die Verantwortung für die derzeitige Situation trägt die Universitätsleitung, da handelt es sich nicht um laufende Kosten, die Sie legal auf uns umlegen können …«
Gerade als es Torres gelingt, seinen Protest in eine logische Form zu bringen, unterbricht ihn die Rektorin.
»Wenn mich nicht alles täuscht, haben Sie nie ein Jurastudium absolviert. Bevor Sie sich also herausnehmen, uns allen zu erklären, wozu eine Universitätsleitung gesetzlich befugt ist und wozu nicht, darf ich Ihnen versichern, dass ich mich in diesen Fragen kompetent beraten lasse. Unabhängig davon möchte ich Sie daran erinnern, Ausführungen dieser Art zurückzustellen, bis der richtige Zeitpunkt für Fragen und kritische Einwände gekommen ist.«
Die Rektorin lässt den Blick im Raum umherschweifen. Fast alle schauen sich auf die Fingerspitzen oder sonst wohin, niemand aber sieht die Rektorin oder den Studentenvertreter an. Leroy Torres schüttelt den Kopf und lässt die Schultern hängen. Karl Marsalis klopft ihm einmal unauffällig auf den Rücken. Ob er ihn um Geduld bitten will, bis zum Ende ihrer Ausführungen zu warten, oder ihn über die Demütigung hinwegtrösten will, wird nicht ganz klar.
Die Rektorin führt ihre Aufzählung weiter fort:
»Gut, Punkt zwei …«
Am auffälligsten in der White Hart Tavern ist neben den unzähligen Fotos von alten zweidimensionalen Filmen, die mittlerweile überall wieder in Mode gekommen sind, ein riesiges Graffito an der Wand gegenüber der Theke. Eine Sicherheitskraft ist dort in der beeindruckenden Ausrüstung der Sondereinsatzkommandos dargestellt. Helm, Atemschutzmaske, Fiberglaspanzer, Militärstiefel. Bedrohlich bewegt er sich mit leicht angewinkelten Knien vorwärts. Mit dem Geldstrafen-Emissionsgerät zielt er präzise auf den Betrachter.
»In Gold we trust« ist in klassischem Englisch unter die Stiefel gesprayt.
Rick Blaine schmunzelt erneut und macht es sich auf einem hydraulischen Barhocker bequem. Er ist der einzige Gast. Der Barmann steht hinter der Theke und schaut konzentriert auf den Bildschirm seiner Kasse. Präcomputermusik läuft. Irgendein Blues. Rick kann die Stimme des Sängers nicht erkennen. Muddy Waters? Als der Barmann endlich bemerkt, dass er Kundschaft bekommen hat, geht er übertrieben entschlossen auf ihn zu. Er wirkt gereizt, hat ein derbes Aussehen. Um die hundert Jahre dürfte er sein, in einem Alter also, in dem die Eingriffe plastischer Chirurgen an ihre Grenzen stoßen und kräftig mit Schminke nachgeholfen wird.
»Nicht schon wieder, haben Sie verstanden? Man kann mir nicht jede Woche einen Prüfer auf den Hals hetzen. Im Quality-Time-Department habe ich schon angerufen. Meine Steuern sind pünktlich bezahlt, und für die letzte Geldstrafe habe ich Ratenzahlung beantragt …«
Er hat einen britischen, walisischen Akzent. Rick hebt die Arme:
»Immer mit der Ruhe, mein Freund. Ich will nur was trinken …«
Er hat einen spanischen Akzent. Der Barmann scheint ihm nicht zuzuhören:
»… was kann ich denn dafür, dass hier irgendwer Tabak an die Kids vertickt hat, verstanden? Ich habe alle vorgeschriebenen Warnschilder hier und sie alle aufgestellt. Sie können mir gar nichts.«
Er zeigt auf einige Schilder, die mit dem Stempel der Ministerien der Westlichen Union versehen sind: Das Hören nicht genehmigter, handwerklicher Musik kann zu folgenschweren emotionalen Störungen führen.
»Machen wir uns nichts vor, mein Freund«, sagt Rick, »die können uns immer am Arsch kriegen. Zum Beispiel hier: Die Getränkewerbung an der Wand ist nicht in normalisiertem Englisch geschrieben.«
Rick zeigt mit dem Daumen nach hinten auf das Graffito. In Gold we trust.
»Hören Sie, das ist keine Werbung. Ein paar Kids haben das gesprayt … Reine Deko … Freie Kunst … Dafür muss man keine Gebühren zahlen!«
»Ah, ja? Und wie kann man da sicher sein, wenn es nicht in normalisiertem Englisch geschrieben ist?«
Der Barmann stutzt.
»Mann, dass das keine Werbung ist, sieht doch ein Blinder. Anders schreiben würde man ja bloß …«
Rick fällt ihm ins Wort:
»Ganz ruhig, war bloß ein Scherz, okay? Ich bin kein Inspektor. Hätte nur langsam gern was zu trinken, weiter nichts …«
Um letzte Zweifel zu beseitigen, krempelt er sich die Ärmel hoch und zeigt ihm eine kleine Narbe am Unterarm.
Den Barmann scheint das fürs Erste zu beruhigen.
»Sie wären nicht der erste Steuerprüfer in Zivil, der mit so einer Narbe ankommt«, sagt er.
»Junge, Junge … Sehe ich etwa aus wie ein Steuerprüfer?«
Der Barmann schaut ihn zwei Sekunden lang eindringlich an.
»Ehrlich gesagt: ja …! Und bei dem Graffito handelt es sich nicht um irgendwelche Werbung, sondern um freie Kunst, verstanden? Ordnungswidrigkeiten werden Sie nicht finden, auch wenn Sie hier noch so lange herumschnüffeln.«
Rick lächelt. Er weiß natürlich, dass er einschüchternd wie einer von der Verwaltungspolizei wirken kann. Er kultiviert das sogar ein wenig. Das Geheimnis besteht darin, sich so gewöhnlich anzuziehen und zu schminken wie möglich und ein wenig teilnahmslos zu tun. Zum Beispiel mit einem lockeren Krawattenknoten oder dick aufgetragenem Lidschatten … Es muss normal wirken. Das leichte Übergewicht, das man trotz seines Bauchkorsetts an Wangen und Hals erkennen kann, hilft selbstverständlich auch.
»Jetzt aber genug: Gib mir ein kleines Bier. Also wenn ich ein Steuerprüfer wäre, dann könnten Sie mich jetzt übrigens wegen Alkohols im Dienst anzeigen«, sagt er.
Der Barmann ist noch immer nicht ganz beruhigt.
»Haben Sie Ihre Krankenversicherungskarte dabei? Nehmen Sie es nicht persönlich, aber die muss ich mir von allen zeigen lassen.«
»Klar«, sagt Rick.
Aus der Innentasche seiner Jacke holt er die Solar-MetLife-Karte mit der gefälschten Versicherungsnummer hervor.
Der Barmann geht weg und zieht sie durch das Lesegerät. Auf dem Bildschirm an der Kasse erscheinen die Bestimmungen der Versicherungspolice und auch der Alkoholspiegel, der von ihr gedeckt wird. Er kann ein Pfeifen nicht unterdrücken, als er die Zulässigkeit liest: 0,3 Gramm Alkohol pro Liter Blut. Danach schenkt er ihm das winzige Bierglas bis obenhin voll.
»Auf die heißen Holzhasen«, ruft Rick ihm seinen Trinkspruch zu.
Mit zwei Fingern hält er das Gläschen und schlürft ein wenig.
»Nur so aus Neugier«, sagt der Barmann, »wie hoch ist der monatliche Beitrag, um sich so einen Alkoholspiegel leisten zu dürfen?«
»Weiß ich nicht mehr«, sagt Rick. »Schätzungsweise ein Greenpepper.«
»Übergewicht inklusive?«, fragt er.
»Zehn Prozent über den empfohlenen Richtwerten. Ich glaube, ich habe die Gefäß- und Herzrisikofaktoren gleich als Package genommen: Alkoholspiegel von 0,3, Bluthochdruck bis 16-10 und zehn Prozent Übergewicht.«
Der Barmann denkt über die Zahlen nach.
»Wenn ich mir eine Krankenversicherungspolice für tausend Eurodollar im Monat leisten könnte, würde ich nur Übergewicht nehmen. Ich kann diese verfluchten Fitnessstudios nicht mehr sehen. Dreimal in der Woche habe ich eine Stunde Aerobic. Obligatorische Empfehlung …«
»Ja, ja … Sagen Sie, mal unter uns, gibt es hier niemanden, der mir ein halbes Pfeifchen besorgen könnte? Ich saß gerade fünf Stunden im Shuttle auf der Reise von Earth hierher und danach noch mal fünf im Hangar der Abflughalle wegen eines Schadens, der nicht mal wirklich einer war.«
»Bleibt unter uns: Heute werden Sie nirgends irgendetwas bekommen. Die Kids proben die Revolte. Haben Sie die Lokalnachrichten nicht gehört?«
»Ich höre selten Nachrichten. Sie deprimieren mich.«
»Sie haben zu einer großen Demonstration auf dem Campus aufgerufen. Deshalb ist es hier so leer.« Er macht eine Pause. »Beim Financial Department habe ich bereits unregelmäßige Einkünfte angemeldet, wegen höherer Gewalt, verstehen Sie …?«
Vier Chips, BBs mit eingerechnet, den sie sich selbst mit Hilfe von Mam’zelle entfernt hat, muss sie im Arm des Professors unterbringen. Der Schnitt über seinem Beugemuskel muss zwangsläufig länger sein und mit drei Stichen genäht werden. Am schmerzhaftesten ist der zweite Stich.
Der Professor versucht, sich nichts anmerken zu lassen. Als alles vorbei ist, stehen ihm Tränen in den Augen, und er atmet schwer. Ihm ist schwindlig. Den Eisbeutel, den ihm BB gegeben hat, hält er sich an die Stirn.